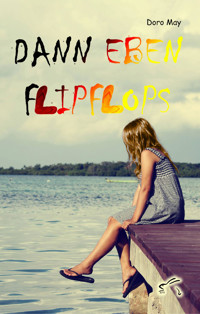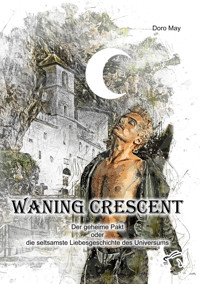Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Neufeld Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
"Es ist Samstag. Ich sitze in einem blauen Kleinbus. Links neben mir brummt Tina, meine besondere Tochter, so laut wie der Motor. Rechts kaut ein junger Mann auf einem verknoteten Unikum herum. Hinter mir unterhalten sich Holger und Jürgen in Gebärdensprache mit Andreas, dem Mann auf dem Beifahrersitz. Den Höhepunkt dieser ungewöhnlichen Fuhre bildet Jan. Jan sieht richtig gut aus. Er ist taubstumm. Jan ist unser Fahrer. Wo bin ich hier hineingeraten? In eine Wohngruppe, die einen Ausflug unternimmt. Es ist Sommer und alle haben gute Laune. Ich bin die einzige, die keine erkennbare Behinderung hat. Und ich fühle mich sauwohl …" Doro May erzählt vom Leben im Wohnheim, von stressigen Arztterminen und überraschenden Glücksmomenten. Sie lässt sich anstecken von der "authentischen Gelassenheit" einer Reittherapeutin und bricht eine Lanze für die Geschwister behinderter Kinder. Natürlich ist es peinlich, wenn Tina im Restaurant mal eben den Tisch abräumt oder sich beim Picknick auszieht. Und ganz sicher ist das Leben mit einem behinderten Kind ein Abenteuer. Schön ist es trotzdem!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 160
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Doro May
Das Leben ist schön, von einfach war nicht die Rede
Meine besondere Tochter ist erwachsen
NEUFELD VERLAG
Zu diesem Buch
Es ist Samstag. Ich sitze in einem blauen Kleinbus. Links neben mir brummt Tina, meine besondere Tochter, so laut wie der Motor.
Rechts kaut ein junger Mann auf einem verknoteten Unikum herum. Hinter mir unterhalten sich Holger und Jürgen in Gebärdensprache mit Andreas, dem Mann auf dem Beifahrersitz. Den Höhepunkt dieser ungewöhnlichen Fuhre bildet Jan. Jan sieht richtig gut aus. Er ist taubstumm. Jan ist unser Fahrer.
Wo bin ich hier hineingeraten? In eine Wohngruppe, die einen Ausflug unternimmt.
Es ist Sommer und alle haben gute Laune. Ich bin die einzige, die keine erkennbare Behinderung hat. Und ich fühle mich sauwohl…
Doro May erzählt vom Leben im Wohnheim, von stressigen Arztterminen und überraschenden Glücksmomenten. Sie lässt sich anstecken von der „authentischen Gelassenheit“ einer Reittherapeutin und bricht eine Lanze für die Geschwister behinderter Kinder.
Natürlich ist es peinlich, wenn Tina im Restaurant mal eben den Tisch abräumt oder sich beim Picknick auszieht. Und ganz sicher ist das Leben mit einem behinderten Kind ein Abenteuer. Schön ist es trotzdem!
Über die Autorin
Doro May lebt als Autorin mit ihrer Familie in Aachen. Tina ist die zweite von drei Töchtern.
Impressum
Veröffentlicht in Kooperation mit der Bundesvereinigung Lebenshilfe e. V., Marburg
Dieses Buch als E-Book: ISBN 978-3-86256-777-5
Dieses Buch in gedruckter Form:
ISBN 978-3-86256-075-2, Bestell-Nummer 590 075
Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der
Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische
Daten sind im Internet über www.d-nb.de abrufbar
Umschlaggestaltung: spoon design, Olaf Johannson
Umschlagbild: philidor/Fotolia
Satz: Neufeld Verlag
© 2016 Neufeld Verlag Schwarzenfeld
Nachdruck und Vervielfältigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Verlages
www.neufeld-verlag.de / www.neufeld-verlag.ch
Bleiben Sie auf dem Laufenden:
www.newsletter.neufeld-verlag.de
www.facebook.com/NeufeldVerlag
www.neufeld-verlag.de/blog
Mehr E-Books aus dem Neufeld Verlag finden Sie bei den gängigen Anbietern oder direkt unter https://neufeld-verlag.e-bookshelf.de/
Inhaltsverzeichnis
Zu diesem Buch
Über die Autorin
Impressum
Prolog
1 Die Fakten
2 Das Leben ist endlich
3 Inklusion oder: Die deutsche Gründlichkeit
4 Meine besondere Tochter entdeckt ihre Sexualität
5 Willy oder: Authentische Gelassenheit
6 Urlaub und Abschied
7 Der Eichhof und die Frage nach der Selbstverständlichkeit oder: Es darf geträumt werden
8 Anarchismus und Zwanghaftigkeit und wie man lernt, damit umzugehen
9 Blumenkohlohren und Zahnärzte
10 Wenn die Kraft nicht reicht oder: Was geschieht mit einem behinderten Kind, wenn die Eltern es nicht wollen? Und was, wenn Eltern selbst behindert sind?
11 Mein Job als Betreuerin
12 Warum gibt es für behinderte Erwachsene nur Kinderkram?
13 Behinderte Menschen pflegen – warum wählt jemand einen solchen Beruf?
14 Spielen, Urlauben und Feiern
15 Striptease am Kanal oder: Warum habe ich nicht gründlicher Gebärdensprache geübt?
16 Etwas Besseres als den Tod findest du überall oder: Das Leben ist schön, von einfach war nicht die Rede
17 Schattenkinder: Die große und die kleine-große Schwester
Delfinennacht
Zum aktuellen Status Quo
Danke möchte ich sagen…
Mehr aus dem Neufeld Verlag
Über den Verlag
Prolog
Es ist Samstag. Ich sitze in einem blauen Ford Transit. Links neben mir brummt Tina, meine besondere Tochter, in etwa so laut wie der Motor des funkelnagelneuen Personentransporters mit Aufschriften von der Lebenshilfe und vom Landschaftsverband Rheinland.
Rechts neben mir sitzt ein schmaler, junger Mann, der auf einem dicken, mehrfach verknoteten Unikum herumkaut, einem vormals weißen Küchentuch, das zu einem lebenswichtigen Feudel geworden ist. Ohne dieses Teil kann er keinen Schritt tun. Überhaupt ist er kaum in der Lage, eigenständig zu laufen. Es hat den Anschein, als halte er sich mit Händen und Zähnen an dem schmuddeligen Teil fest.
Hinter mir haben Holger und Jürgen Platz genommen. Sie unterhalten sich mit einfachen Einzelgebärden mit Andreas, dem Mann auf dem Beifahrersitz – also über meinen Kopf hinweg. Ab und an stoßen sie Laute aus. Nicht unangenehm, aber eben auch nicht leise. Manchmal lachen sie plötzlich los, für mich völlig unvermittelt.
Den Höhepunkt dieser ungewöhnlichen Fuhre bildet Jan, der Anfang 30 ist. Seit mehreren Jahren arbeitet er als Betreuer, ist im Umgang mit diesen besonderen Menschen äußerst geduldig und sieht richtig gut aus. Jan ist taubstumm, würde also jegliche Hupe eines anderen Autos schlichtweg nicht wahrnehmen. Auch keine Feuerwehr oder ein anderes Fahrzeug mit Martinshorn.
Jan ist der Fahrer.
Wo bin ich hier hineingeraten?
In eine Wohngruppe, die einen Ausflug ins Freilichtmuseum Kommern unternimmt. Es ist Sommer und alle haben gute Laune. Ich bin die einzige an dem Ausflug Beteiligte, die nicht anders ist, denn ich kann hören und sprechen und habe in landläufigem Sinne keinerlei Beeinträchtigung der geistigen Art.
Aber das Kurioseste kommt noch: Ich fühle mich sauwohl.
Wenn Sie, liebe Leserinnen und Leser, das jetzt nicht verstehen, dann verstehe ich Sie. Hätte mir vor einigen Jahrzehnten jemand eine solch schräge Ausflugsgesellschaft geschildert, ich wäre nie im Leben auch nur ansatzweise auf die Idee gekommen, dass ich der Fahrgast sein könnte, der, wie der Zufall es will, genau in der Mitte sitzt. Ebenso wenig hätte ich mir träumen lassen, dass ich diesen Ausflug genießen würde.
Auf dem großen Parkplatz kommt der Platzanweiser auf unser Auto zu und fragt durch die heruntergelassene Scheibe, ob wir einen Behindertenparkplatz haben möchten. Eigentlich könnte ich antworten, aber ich bin viel zu neugierig, wie’s jetzt weitergeht. Und tatsächlich: Es geht weiter. Jan zeigt ganz locker seinen Ausweis und deutet »taubstumm«. Das versteht der Platzanweiser zwar nicht, aber er kombiniert völlig richtig, dass wir ein Fall für einen der Sonderparkplätze sind. Er gestikuliert und Jan versteht, wo er langfahren soll. Ehrlich gesagt habe ich den Eindruck, dass Jan nicht zum ersten Mal hier ist, so relaxt, wie er mit der Situation umgeht.
An dem uns zugewiesenen Platz steigen wir aus. Jan unterstützt den Jungen mit dem Feudel und wir bewegen uns in Richtung Kasse, wo einige bereits ihre Behindertenausweise zücken und ihre Geldbörsen geöffnet hinhalten. Da ich als Tinas offizielle Begleitung ohnehin freien Eintritt habe, wir Tinas Behindertenausweis aber vergessen haben, sage ich vorsichtshalber weiterhin nichts. Die Kassiererin palavert über ihre Vermutungen, was die Mitglieder dieses schrägen Ausflugstrüppchens zu zahlen haben. In Anbetracht des sprachlosen Lächelns aller fröhlich Beteiligten gestikuliert sie wild herum, berät sich mit Kassiererin Nummer zwei, wer von dieser Gruppe was zu zahlen hat und wie das eigentlich bisher gelaufen sei, wenn so welche rein wollen. Nummer Zwei zuckt mit den Schultern. Das macht sie ziemlich oft und es wird hinter uns allmählich unruhig, denn andere würden auch noch gerne ins Freilichtmuseum. Vor allem haben die quengelnden Kleinkinder keine Lust auf diese Warterei.
Nummer Eins wirkt inzwischen ein wenig hektisch, Nummer Zwei begibt sich zu einer verschlossenen Türe und kehrt mit einem Mann zurück. Nun palavert der Mann, der es also richten soll, sagt, »da gibt’s doch ganz klare Bestimmungen – äh, das müsste doch hier irgendwo stehen«, schaut sich hilfesuchend um und fragt Jan, ob er nicht wüsste, wer und wieviel und ob nicht vielleicht ein Gruppenpreis, oder wie haben Sie das bisher …?
Die Gruppe lächelt, ich lächle, Jan lächelt und schüttelt immer mal wieder den Kopf zum Zeichen, dass er den Mann leider nicht verstehe (was ich ihm nicht so ganz abnehme, denn er kann durchaus von den Lippen ablesen). Die drei Personen vertrauen sich gegenseitig ihre Ratlosigkeit an und winken uns allesamt durch.
Wie gesagt: Es ist Samstagnachmittag, Kaiserwetter und die Schlange hinter uns mittlerweile gigantisch gewachsen. Die Leute treten von einem Bein aufs andere – das vor uns sind Behinderte, da darf man nicht meckern, steht ihnen auf der Stirn geschrieben. Ihre Gesichtszüge entspannen sich deutlich, als wir endlich den Kassenraum verlassen.
Diese überaus schräge Szene hat was. Die ganze Zeit über bin ich bemüht, nicht zu grinsen. Ich weiß – ist nicht die feine englische Art …
Wir, die sechs Bewohner des Wohnheims, in dem auch meine Tochter lebt, Jan und ich schieben uns also hinein ins Freilichtvergnügen. Nach 50 Metern die ersten gänzlich nicht musealen Fressbuden. Freudig lachend kaufen Holger, Jürgen und Andreas erst mal Currywurst mit Pommes rot-weiß. Damit Tina ihnen nichts von der Pappe klaut, besorge ich ebenfalls Currywurst und dazu eine Limo. Wie praktisch, dass es hier alles in und auf Pappe gibt. Nichts kann kaputt gehen. Tina – der Tag gehört uns! Und damit letztlich alle was haben, stellt sich Jan nun auch an, so dass wir nach 50 Metern Weg und einer Mahlzeit in rot-weiß die nächsten 20 Meter schaffen.
Da gibt’s Eis …
In meinem früheren Leben hätte ich mir verboten, gleich zu Anfang, sozusagen ohne jede Vorleistung, loszufuttern, als gäbe es nach dem Spaziergang nichts mehr. Vor allem habe ich gelernt: Eis gibt’s quasi zur Belohnung erst nach einer Anstrengung – und sei diese noch so klein. Tina und Co. sehen das völlig anders. Da steht die Bretterbude mit Sachen, die zum Essen da sind. Also sind wir hier richtig.
Völlig richtig!
Wozu steht sie sonst da? Wer hat, der hat – und eine Runde drehen kann man ja immer noch.
Genauso wenig hätte ich mir vorstellen können, mit derselben sprachlosen Truppe in einem sehr netten Eiscafé zu sitzen, stumm, weil niemand spricht oder mich hören könnte, wenn ich etwas sagen wollte. Ganz im Ernst: Ich sitze also mit Tinas Wohngruppe – diesmal sieben Personen – und diesem sprach- und gehörlosen, sehr netten und ausgesprochen gut aussehenden jungen Betreuer im Eiscafé und muss nichts sagen; muss nur meinen Kaffee trinken, mir ein gepflegtes Eis aussuchen und das Gefühl genießen, dass ich nicht alleine unterwegs bin, aber auch keiner etwas von mir will. In unserer lauten und vollgequatschten Welt die reinste Idylle. Und das meine ich völlig ernst.
Tinas Mitbewohner ahnen, dass ich in Sachen Gebärden – auch wenn es sich nur um Gebärden des Grundwortschatzes handelt – bei aller Mühe, die ich mir gebe, eine ziemliche Niete bin, sobald es ins Detail geht, stoßen sie mich nur höchst selten an, um mir mittels Gebärden etwas mitzuteilen; zum Beispiel die Frage, für welches Eis ich mich entschieden habe. Recht haben sie. Weil ich in meinem Alltag ohne Tina keine Gebärden benötige, bin ich grottenschlecht in dieser überaus faszinierenden Sprache. Das ist mir gehörig peinlich, zumal ich bereits zwei Kurse in Grundgebärden absolviert habe. Klar, die Gebärde für Eis habe ich drauf. War jahrelang Tinas Lieblingsspeise. Aber die Bezeichnung für Vanilleeis mit Himbeeren und Sahne, die ich gerade in diesem Moment brauchte, habe ich dann natürlich nicht drauf. Mist! Denn eigentlich würde ich gerne mit kommunizieren. Ich finde es besonders – selbst in der einfachen Art. Also ohne bestimmte oder unbestimmte Artikel, weder dekliniert noch konjugiert oder was man mithilfe der deutschen Grammatik noch so alles mit Wörtern anstellen kann. Nur die wesentlichen Worte werden wie Gedankeninseln mittels anschaulicher und naheliegender Handzeichen aneinandergereiht. Da dürfte dann auch jeder Normalo mitbekommen: Seht her, ich kann es auch.
Leider Fehlanzeige. Da kann ich noch so oft das große teure, blaue Buch aufschlagen: Grundgebärden. Wenn man nicht tagtäglich auf diese Weise miteinander umgeht, prägen sich nur die 08/15-Wörter ein. Wie ich Tinas Betreuerinnen und Betreuer bewundere, wenn sie meiner Tochter etwas mitteilen, das über essen, trinken, an- und ausziehen hinausgeht. Wie überaus konzentriert meine Tochter auf ihre Hände schaut …
Wie ich es seit ihrem Auszug von Zuhause bis hierher geschafft habe?
Eine Geschichte, die sich zu erzählen lohnt. Ende offen …
1
Die Fakten
Meine besondere Tochter heißt Tina, sieht aus wie 14, ist aber mittlerweile 27 Jahre alt. Sie lebt in einem Wohnheim für gehör- und wahrnehmungsgestörte Menschen. Im Klartext heißt das, die Bewohner – es sind acht – haben eine geistige Behinderung. Zum Beispiel haben sie ausgeprägte autistische Züge, sind manisch-depressiv oder von irgendeiner anderen Behinderung betroffen, die mit Nicht-hören-können einhergeht beziehungsweise mit dem Phänomen, dass das Gehörte nicht ins Bewusstsein dringt. Das nennt man in Fachkreisen Wahrnehmungsstörung.
Okay, darunter leidet so mancher Normalo auch, höre ich Sie sagen.
Stimmt!
Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zu uns, die wir ebenfalls gelegentlich nicht durchschalten, wenn uns jemand etwas mitteilt. Den Menschen, um die es hier geht, ist gemeinsam, dass sie mit gesprochener Sprache nichts verbinden. Sie begreifen kaum oder auch gar nicht, was wir ihnen durch Worte mitteilen möchten – selbst dann nicht, wenn sie die Worte hören können. Ihre Wahrnehmung von Sprache funktioniert ganz einfach nicht. Deshalb sagt man, dass sie keine Sprache haben – Sprache im landläufigen Sinn, denn auch sie können sich unterhalten: Mit einfachen, meist sehr eingängigen Gebärden für zentrale Hauptwörter wie Auto, Haus, Flugzeug usw., Verben wie essen, trinken, an- und ausziehen und Adjektive wie super (Daumen hoch!), lecker (Bauch reiben) und dergleichen drücken sich meine Mitfahrer (siehe oben) problemlos aus.
Es sind keine besonders komplexen Schilderungen – die Menschen, um die es hier geht, sind in ihrer Denkfähigkeit anders und haben weder das Vermögen noch den Drang, komplizierte Dinge zu diskutieren. Sie erleben vielleicht gar nicht so kompliziert wie der normale Stadtneurotiker – jedenfalls, wenn es nach Woody Allen ginge. Doch sind die meisten dazu in der Lage, sich über alltägliche Erlebnisse und Vorhaben zu unterhalten, ihre Wünsche, ihren Willen beziehungsweise Unwillen kundzutun, zu schimpfen oder ihre Launen an jemandem auszulassen. Tina ist Meisterin im Ausdrücken, dass sie etwas nicht will. Nämlich absolut gar nicht! Da gibt es keinerlei Missverständnisse.
Die Gebärden sind höchst anschaulich und auch als Laie kann man sich das Standardrepertoire rasch aneignen. Nur bei den Feinheiten hapert es schnell: Eis – kein Problem. Man hält ein imaginäres Eishörnchen vor den Mund und schleckt an der Eiskugel. Aber bei der Bestellung von Vanilleeis mit heißen Himbeeren und Sahne stößt man schnell an seine Grenzen und zeigt lieber gleich auf die entsprechende Stelle in der Eiskarte, um den anderen zu bedeuten, was man sich nun bestellen wird.
Meine Tochter hat das Down-Syndrom, das in etwa fünf Prozent der Fälle einen Autismus, mal mehr, mal weniger ausgeprägt, als Zugabe parat hat. Das wissen nur wenige; mir war es zum Beispiel völlig unbekannt, obwohl ich gleich nach der Diagnose jede Menge Fachbücher gewälzt habe. Es ist eine harte Diagnose, die verkraftet werden will. Schlimm genug, wenn man anerkennen muss, dass das eigene Kind geistig behindert ist. Dass man wie bei sechs Richtigen im Lotto dann auch noch die Zusatzzahl gezogen hat, ist mehr als heftig. Denn diese im Grunde genommen mehrfach behinderten Menschen können sich im Extremfall kaum mitteilen, und das tut den Eltern weh, wenn sie erleben, wie das Gesicht ihres Kindes immer leerer, immer ausdrucksloser wird, weil sich das Leben kaum in ihm abbilden kann. Auch sind sie auf sehr fest gezurrte Abläufe im Alltag angewiesen, damit sie die Orientierung behalten. Das geht soweit, dass man unter Umständen einen gewohnten Weg nicht verlassen kann.
Ganz wörtlich: Ist man auf dem Hinweg eine bestimmte Straße entlanggegangen, tut man gut daran, dieselbe Straße auch für den Rückweg einzukalkulieren. Am besten sogar dieselbe Seite des Bürgersteigs. Sonst kann es nämlich passieren, dass Leute wie Tina plötzlich eigenständig losrennen, um den für sie bekannten Weg zu verfolgen, also rasch und unvermittelt über die Fahrbahn zu rennen. Oder sie setzen sich schlichtweg an Ort und Stelle hin – und sei es mitten auf die Straße oder in eine Pfütze …
Wie gesagt: Aktiver Protest war noch nie Tinas Problem.
Tina hat zwar nicht das Vollbild eines Autisten, aber ausgeprägte autistische Züge. Menschen wie Tina sind dazu verdammt, vieles, manche auch alles mit sich alleine auszumachen: in einem Winkel in ihrem Innersten, der so fest verschlossen ist, dass denjenigen, die alles für sie tun und sein wollen, allzu oft nur die Rolle des ohnmächtigen Zuschauers zukommt.
Es bleibt keine andere Chance für die betroffenen Eltern, als sich aus dem tiefen Loch, das einem der Kummer gegraben hat, herauszubaggern, Hilfen anzunehmen und dem Schicksal eins auszuwischen, indem man das Leben in seiner Schräglage akzeptieren lernt. Es hat eben nicht anders sollen sein, und damit basta!
Ein langer Weg bis dahin, den ich in dem Band Meine besondere Tochter – Liebe zu einem Kind mit Behinderung (Sankt Ulrich Verlag, Augsburg 2010) versucht habe zu beschreiben. Die Arbeit an jenem Buch liegt mehr als zehn Jahre zurück. Als ich begonnen hatte, war alles noch so neu: Vier Jahre lang habe ich an dem Manuskript gesessen, habe damals noch per Hand geschrieben, durchgestrichen, verworfen, neu begonnen. Und das alles aus eigenwilliger Perspektive – in der seltenen Du-Form, als würde ich einen Brief an mich selbst schreiben. Einfach paradox! Ich wollte über meine Tochter und mich berichten, aber selbst eigentlich nicht so richtig vorkommen.
Zum Glück geriet das Manuskript durch Zufall an eine Journalistin, die es einem Literaturagenten zeigte … Zufall ist manchmal etwas, das einem zufällt. Und so traf Tinas und meine Geschichte auf einen Lektor, der rigoros auf der einzig vernünftigen Erzählperspektive bestand: auf der Ich-Perspektive! So einfach wie logisch. Aber das musste ich erst einmal kapieren, denn eigentlich war das Buch ja ursprünglich für mich.
Ich habe mir mein Leben mit Tina von der Seele geschrieben. Nein. Ich habe es mir in die Seele geschrieben, denn durch das Hinschreiben wurde mir bewusst, wie gut mir Tina gefällt und wie sehr sie ein Teil von mir ist. Was ging es andere Menschen an, wie ich mich fühlte und was für ein Kind ich hatte? Damals nannte ich meine Tochter im Manuskript tatsächlich Mein Anderes Kind. Aus heutiger Sicht ganz und gar unpassend, denn in erster Linie ist sie Tina – ein höchst individuelles Menschenkind, das es nicht nötig hat, sich ausschließlich über ihr Anderssein definieren zu lassen.
By the way: Wegen Tina bin ich Schriftstellerin geworden. Da man unsere Tochter besser niemals alleine in einem Zimmer lässt, man aber nicht ununterbrochen Lust hat auf Action, bis der Arzt kommt, beschäftigt man sich zwangsläufig irgendwann selbst. Dies hat sich bei mir zur Initialzündung gemausert, bedenkt man, dass ich bereits als Kind Bücher fabuliert habe.
Mein Kopf war immer schon voller Geschichten. Nun hat mich Tina dahin geschubst, wo ich hingehöre-und in meinem Innersten immer schon hinwollte – nämlich zur schreibenden Zunft. Allen Ernstes: Im Januar habe ich meinen Job als Oberstudienrätin an einem altehrwürdigen Gymnasium gekündigt, weil ich mich beruflich nur noch damit befassen möchte, was ganz offenbar meine Bestimmung ist.
Danke, Tina!
Nun ist Tina eine erwachsene Frau – jedenfalls an Jahren und natürlich auch vor dem Gesetz. Ich bin nicht nur ihre leibliche Mutter, sondern in juristischem Sinn ihre Betreuerin und in vielfältiger Hinsicht nah dran am Leben meiner besonderen Tochter. Eine große Verantwortung – ohne Frage. Aber zugleich eine Aufgabe, die ich nicht missen möchte, zumal ich gelernt habe, Verantwortung abzugeben, denn es gibt hervorragend ausgebildete Betreuerinnen und Betreuer. Es ist gar nicht hoch genug einzuschätzen, was Eltern in den sechziger Jahren, also deutlich vor meiner Zeit als Tinas Mutter, mit der Lebenshilfe ins Leben gerufen haben. Sie betrifft bei weitem nicht nur die besonderen Mitmenschen, sondern uns – die Eltern. Wenn man es recht bedenkt, sind nämlich wir Eltern diejenigen, denen geholfen werden muss – vor allem, wenn wir noch am Anfang unserer Karriere derjenigen stehen, die ein behindertes Kind bekommen haben.