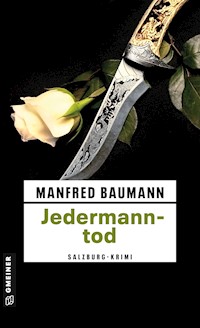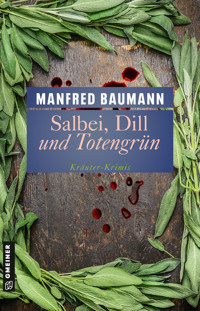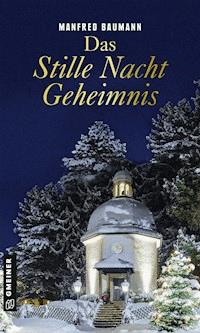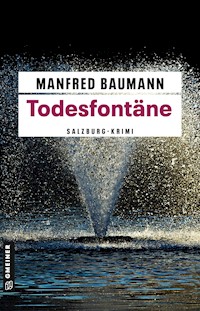Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gmeiner-Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Martin Merana
- Sprache: Deutsch
Im Sebastiansfriedhof in Salzburg wird der Franziskanernovize Elias tot aufgefunden. Kommissar Merana fragt sich: War der Tote nur zur falschen Zeit am falschen Ort als wertvolles Kirchengut gestohlen wurde? Oder steckt mehr hinter dem Mord? Elias hatte Kontakt zur rechtspopulistischen HPÖ - eine gefährliche Verbindung? Während Merana ermittelt, stößt er auf ein Netz aus Manipulation, Hass und Spaltung. Was hatte Elias entdeckt? Merana muss die Wahrheit finden, bevor der Zorn die Stadt erfasst.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Baumann
Salzburgwut
Meranas zwölfter Fall
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Bei Fragen zur Produktsicherheit gemäß der Verordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) wenden Sie sich bitte an den Verlag.
Die automatisierte Analyse des Werkes, um daraus Informationen insbesondere über Muster, Trends und Korrelationen gemäß § 44b UrhG (»Text und Data Mining«) zu gewinnen, ist untersagt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2025 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Satz/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © J Chavez Photography / stock.adobe.com
ISBN 978-3-7349-3470-4
Prolog
Er hatte noch exakt elf Minuten und 18 Sekunden zu leben. Aber das wusste er nicht. Der Strahl seiner 1.100-Lumen-LED-Taschenlampe tastete sich langsam die eingravierten Lettern entlang. Die Lampe strich über die achte Zeile der mit geschickter Handwerkskunst in den Marmor gekerbten Inschrift. Der helle Schein verharrte kurz bei BONA. Dann schwenkte er nach unten, strich nahezu zärtlich über PAUPERES und hielt schließlich an bei COLLOCANDA. Jetzt blieben ihm noch zehn Minuten und 46 Sekunden in diesem Leben. Seine Lippen begannen sich zu bewegen. Er kannte die alte Inschrift längst auswendig. Wort für Wort. Buchstabe für Buchstabe. »Ac bona sua in pauperes distribuenda collocanda«, flüsterte er ehrfürchtig. Paracelsus hatte dafür gesorgt, dass sein Hab und Gut unter den Armen verteilt werden sollte. Darauf bezogen sich diese Worte. Welchen Wert nach heutigen Maßstäben die Hinterlassenschaft des Alchemisten und Arztes gehabt hatte, darüber hatte er bisher nirgendwo auch nur eine Andeutung gefunden. Vielleicht gab es auch keinen Hinweis. Gut möglich, dass es ausgerechnet ihm beschieden war, hier Licht ins Dunkel der historischen Überlieferung zu bringen. Er würde jedenfalls intensiv weiterforschen. Langsam wanderte der Lichtstrahl weiter. Bis ans Ende der Tafel. REQUIES AETERNA SEPULTIS. Ewige Ruhe den Toten.
Er schaltete die Lampe aus, kniete nieder. Seine Lippen flüsterten ein kurzes Gebet. Ein kläglicher Laut erreichte sein Ohr. Es hörte sich an wie erbärmliches Miauen. Schnell ließ er das Licht der Taschenlampe wieder aufflammen. Er sah eine Katze. Sie hockte auf der Stufe neben ihm. Ihr Fell war struppig. Rotfarben. Leicht getigert. An der Stirn der Katze war das Fell heller. Weiße Strähnen waren zu einem zackigen Gebilde geformt. Es erinnerte ihn an ein Pentagramm. »Drudenfuß«, flüsterte er. An manchen Fensterrosetten gotischer Kirchen waren heute noch Pentagramme auszumachen. Ursprünglich war das Pentagramm ein heidnisches Symbol. In der christlichen Auslegung verwiesen die fünf Eckpunkte auf die fünf Wunden, die Christus bei der Kreuzigung zugefügt wurden. Das wusste er. Die Katze kam näher. Wieder miaute sie. Sie schmiegte kurz ihr Kinn an seinen linken Unterschenkel. Dann blickte sie auf. Leuchtende Augen. Grünstichig. Darüber auf der Stirn das helle, leicht schiefe fünfzackige Gebilde. Sie senkte den Kopf, machte kehrt, trippelte davon. Er leuchtete dem davoneilenden Tier hinterher. Bald wurde die Katze von der Dunkelheit verschluckt. Langsam erhob er sich aus der Hocke. Er wollte noch ins Innere der Kirche. Die stille und würdevolle Aura des Kirchenraumes würde ihm auch heute guttun. Seine Linke strich vertraulich über das steinerne Wappen von Paracelsus auf dem Monument. Den Schrägbalken mit den drei Kugeln zu berühren war ihm vertrautes Ritual geworden. Dass es nun ein Abschiednehmen für immer bedeutete, konnte er nicht wissen. Dann begab er sich ins Innere. Hier fühlte er sich Sebastian am innigsten verbunden. Er hockte sich auf den Steinboden, richtete den Blick zur Decke. Das große Deckenfresko von Paul Troger gab es nicht mehr, zerstört beim großen Brand 1818. Das war ihm bekannt. Aber er spürte hier überall die Präsenz von Sebastian. Ganz stark. Nach einer Weile vernahm er ein Geräusch hinter sich. Er erhob sich, drehte sich um. Was er zu sehen bekam, erstaunte ihn. Und bald darauf stieg Angst in ihm auf. Viel Zeit war ihm nicht mehr in diesem Leben gegönnt. Es blieben ihm zwei Minuten und zwölf Sekunden. Dann würde er tot sein.
DONNERSTAG
1
Ein Schrei. Grell. Verzweifelt. Die helle Fratze zersprang, explodierte in tausend Teile. Wie eine Supernova. Sein Oberkörper schnellte hoch. Merana riss die Augen auf. Sein Kopf schnellte nach allen Seiten. Was seine Augen erfassten, kam ihm vertraut vor. Er atmete tief durch. Er war zu Hause. Gott sei Dank. Er befand sich in seinem Bett. Er presste die Hände gegen die Stirn. Die Haut fühlte sich kalt an. Schweißnass. Er schüttelte langsam den Kopf, begann ruhig und tief zu atmen, massierte seine Schläfen. Er hatte schon lange nicht mehr dermaßen schlecht geträumt. Er konnte sich gar nicht mehr erinnern, wann zuletzt grässliche Höllenfratzen durch seine Träume gespukt waren. Das musste Jahre her sein. Früher war ihm das öfter widerfahren. Als Kind hatte er immer wieder solche Träume durchlitten. Die Fratzen hatten ihm Angst bereitet. Die glühenden Augen, die aufgerissenen Mäuler, die Hörner auf den schrecklichen Köpfen. Krampuslarven, Masken von Schiachperchten, Teufelsgesichter, davor hatte er sich als Kind fast zu Tode gefürchtet. Sie verfolgten ihn auch in seinen Träumen. Mit den Jahren war es besser geworden. Vor allem durch die beruhigende, kluge Art der Großmutter. Sie hatte manchmal einen der wilden Krampusläufer angehalten. Dann hatte sie ihn gebeten, die Maske abzunehmen. Ihr Enkelsohn sollte sehen, wer oder was hinter der Maske zum Vorschein kam. Der kleine Martin hatte oft gestaunt, wen er da sah. Die größeren Buben aus der Nachbarschaft waren dabei. Der Briefträger. Der ältere Bruder des Dorfmetzgers. Sogar die Posaunenbläser der Trachtenmusikkapelle waren einmal zum Vorschein gekommen. Allmählich hatte Merana sich immer weniger gefürchtet, wenn er auf unheimliche Typen mit Krampuslarven stieß. Sie mussten auch nicht mehr die Masken abnehmen. Im Gegenteil. Er fand Spaß daran, zu erraten, wer hinter der Maske steckte. »Es ist nicht von vorneherein schlecht, Angst zu haben, Martin«, hatte die Großmutter oft gesagt. »Im Gegenteil. Gerade Furcht bringt uns dazu, vorsichtig zu sein. Wenn du Angst hast, hinunterzufallen, dich an den Steinen zu verletzen, wirst du den schmalen Steg am Bach mit Vorsicht überqueren. Das ist klug. Du wirst aufmerksam Schritt für Schritt setzen. Das ist weitaus besser, als gedankenlos jauchzend über den Steg zu rennen, zu meinen: Mir kann eh nichts passieren! Wer so handelt, ist schon öfter ausgerutscht und in den steinigen Bach gestürzt. Furcht ist hilfreich. Aber nicht hilfreich ist es, sich von Furcht lähmen zu lassen, dass man hilflos wird.« Genau so hatte es ihm die Großmutter in seiner Kindheit immer wieder dargelegt. »Deshalb ist es wichtig«, hatte die Großmutter hinzugefügt, »dass man erkennt, worin die Gründe für die Angst liegen. Es hilft, genau hinzuschauen. Es ist nicht immer leicht. Bisweilen ist es sogar mühsam, herauszufinden, was hinter den Dingen steckt.« Ja, es war nicht einfach. Er musste sich manchmal gehörig anstrengen. Aber es machte ihm immer mehr Spaß, herauszufinden, wer sich tatsächlich hinter der einen oder anderen Krampuslarve verbarg. Er lernte, genau hinzuschauen. Auf viele kleine Details zu achten. Wie bewegt sich das Gegenüber? Wie schüttelt der Herumtobende die großen Glocken an den Hüften? Welche Laute gibt er von sich? Wie hört sich die Stimme, die jetzt höllisch brüllte, wohl im normalen Tonfall an? An wen erinnern die Bewegungen der Arme, mit denen der Krampusdarsteller die Rute schwingt? An den ältesten Sohn vom Leitenbauer? An den Malermeister aus dem Nachbarort? Er war oft über sich selbst erstaunt, wie leicht es bisweilen war, herauszufinden, wer hinter der Maske steckte. Manchmal ging es schwerer. Aber Merana schaffte es mit zunehmendem Alter immer besser. Vielleicht war er deshalb später Kriminalpolizist geworden, weil ihm so viel daran lag, herauszufinden, was hinter den Dingen steckte. Was hatte tatsächlich dazu geführt, dass sich etwas auf diese Art und Weise darstellte? Merana traute nie dem ersten Eindruck. Es galt, genauer hinzuschauen. Das versuchte er als Kommissar seinem Team nahezubringen. Man muss auf alle Details achten. Auch auf vordergründig unscheinbare. Es galt, alles einzubeziehen. Fragen zu stellen. An andere und vor allem an sich selbst. Ständig weiterforschen. Wer oder was verbirgt sich hinter bestimmten Erscheinungen? Das zu begreifen, hatte er als Kind immer besser verstanden. Mit großer Mühe bisweilen, aber zunehmend begleitet von Erfolgen. Dennoch waren hin und wieder durch seine Träume dunkle Larven gefetzt, deren Geheimnis er nicht entschlüsseln konnte. Das bereitete oft Angst. Die Fratze aus dem heutigen Traum war heller gewesen. Nahezu gelblich. Dann war sie in blitzende Stücke zerstoben. Merana schaute auf die Uhr. Zwölf Minuten nach sechs. Eigentlich hatte er sich den Wecker auf halb neun gestellt. Er wollte erst um zehn Uhr im Büro erscheinen. So war es ausgemacht. Schließlich war er erst um zwei Uhr früh nach Salzburg zurückgekommen. Eingeschlummert war er wohl gegen drei. Es galt also, einiges an Schlaf aufzuholen. Doch daraus würde wohl nichts mehr werden. Er schwang die Beine aus dem Bett. Mit einem Ruck erhob er sich. Das Schwindelgefühl packte ihn schnell. Langsam, Merana, besänftigte er sich. Durchatmen, Boden unter den Füßen spüren. Behutsam einen Schritt nach dem anderen setzen. Auf diese Weise gelangte er einigermaßen schwindelfrei ins Badezimmer. Falls noch eine Spur von Müdigkeit durch seinen Körper kroch, der gebündelte Strahl des eiskalten Wassers in der Dusche verscheuchte sie. Eine Viertelstunde später saß er am Küchentisch, vor sich eine Tasse mit Espresso. Auch mit der Großmutter hatte er kurz vor Mitternacht Kaffee getrunken. Starken Kaffee. »Das passt gut, Martin. Dir hilft er, auf der Fahrt nach Salzburg munter zu bleiben. Und mir macht er nichts aus. Ich kann auch bei starkem Kaffee gut schlafen. Das weißt du.« Ja, das war ihm vertraut. Viele Menschen konnten kein Auge zu tun, wenn sie abends Kaffee tranken. Nicht so seine Großmutter. Sie schlief auch bei starkem Espresso tief und fest. Wie ein Murmeltier. Das war nur eines der Phänomene, das seine Großmutter von vielen anderen Menschen unterschied. Da gab es noch mehrere. Er liebte die alte Frau. Tief in seinem Herzen. Von allen Menschen in seinem Leben war ihm stets die Großmutter am nächsten gewesen. Er war bei ihr aufgewachsen. Er hatte als Neunjähriger miterleben müssen, dass seine Mutter von einer Bergtour nicht mehr heimkam. Sie war abgestürzt. Die Großmutter hatte ihn bei sich aufgenommen. Sie hatte ihn in seiner Verzweiflung getröstet. Sie hatte ihn einfühlsam und zuvorkommend durch Kindheit und Jugend geleitet. Sie hatte ihn in jedem Augenblick das Wichtigste spüren lassen, das sie zu geben hatte. Mit dem sie ihn umhüllte. An dem er sich jederzeit anhalten konnte. Ihre tiefe, alles stärkende Liebe. Er trank den Kaffee aus. Er stand auf, trat an den Herd. Er hob die Edelstahlkanne von der Platte hoch. Da würden sich noch gut zwei weitere Tassen Espresso ausgehen. Ich werde mir jetzt ein großes Stück vom Apfelstrudel nehmen, den die Großmutter mitgegeben hat, entschied er. Ich werde mich wieder hinsetzen, den Apfelstrudel und den Kaffee genießen. Dann werde ich mir in Erinnerung rufen, wie es gestern bei der Großmutter war. Das ist gewiss besser, als Fetzen von zerstobenen Fratzen zu verscheuchen, die vielleicht in mir herumschwirren. Genau so machte er es. Er holte den Strudel, nahm die Kaffeetasse, setzte sich hin. Er war eine Woche im Friaul gewesen. In Cividale, Duino, Triest, Pordenone. Zuletzt in Latisana und Spilimbergo. Auf dem Rückweg hatte er im Oberpinzgau Halt gemacht, um die Großmutter zu besuchen, ihr Eindrücke von seiner Reise zu vermitteln. So saß er nun am Küchentisch, ließ die Begegnung wie in einem Film ablaufen. Es ist früher Abend. So beginnt der Film in ihm. Die Großmutter empfängt ihn im Garten. Sie umarmt ihn, drückt ihn an sich. Ihr Kopf reicht ihm bis zum Halsansatz. Ihre weißen Haare schimmern. Das Licht aus der Umgebung ist noch hell, auch wenn die Sonne vor einer halben Stunde unterging. Wieder spürt er, wie sehr er diese alte Frau liebt. Dann führt sie ihn hinein. Er kennt das Haus gut. Hier ist er aufgewachsen. Hier hat er gelebt, bis er nach bestandener Matura in die Landeshauptstadt übersiedelte, um an der Uni Jus zu studieren. »Magst du einen Teller Gemüsesuppe, Martin?« Er mag. Er hat seit Mittag nichts mehr zu sich genommen. Die Suppe schmeckt ausgezeichnet. Wie immer. Verfeinert mit duftenden Kräutern aus ihrem Zauberkräutergarten. Er lässt sich nachschöpfen, genießt dazu zwei Scheiben vom Bauernbrot. Dann holt er das Notebook aus der Tasche, zeigt der Großmutter, wo er überall war. Sie ist beeindruckt. Von vielem, was sie sieht, begeistert. Besonders gefallen ihr die prachtvollen Fresken auf der Fassade des großen Castello in Spilimbergo. Aber er zeigt der Großmutter auch anderes. Spuren von Verwüstungen. Eingestürzte Brücken. Verunglückte Zugwaggons. Von Fluten mitgerissene Fahrzeuge. Folgen der schrecklichen Unwetterkatastrophen. Und er zeigt ihr noch mehr. Auch das ist hässlich. Furchteinflößend. Schmierereien an den Wänden. Parolen gegen Ausländer. Gegen Juden. Fett aufgetragene Sprüche von Nazis. Die Großmutter erkennt, was sie da liest. Sie versteht die Sprache. Sie ist halbe Italienerin. Ihr Vater war Straßenbaumeister aus Treviso, die Mutter Krankenschwester aus Südtirol. Die alte Frau schüttelt den Kopf, schließt die Augen, als horche sie in sich hinein. »Es ist schwer nachzuvollziehen, warum Menschen das machen«, sagt sie dann, die Augen wieder geöffnet. Ihre Stimme ist ruhig. »Es hat gewiss viel mit Unsicherheit zu tun, die ganz tief drinnen sitzt. Da ist Wut, da ist Unmenschlichkeit, da ist Lust nach Grausamkeit und Zerstörung. Aber da ist auch Angst. Angst, zurückzubleiben, keinen Platz zu haben, nicht beachtet zu werden. Angst, die sich in schwer kontrollierbarer Wut entlädt.« Sie blickt auf den Bildschirm. »Gescheite Erklärungen dafür in klugen Gesprächen zu finden ist schwer. Auch mir fällt es nicht leicht, zu erspüren, warum so viele Menschen in meinem geliebten schönen Italien den Faschisten zujubeln. Den Nachkommen von Menschenverachtern und Mördern.« Sie löst den Blick vom Notebook. »Und wie wir sehen, Martin, passiert eben in vielen Ländern Ähnliches. Selbst in unserer Heimat geschieht derzeit vieles, das mir Angst macht. Große Angst.« Sie schaut ihm lange in die Augen. Dann richtet sie sich auf.
»Aber es bringt nichts, sich von Furcht lähmen zu lassen. Man muss etwas tun.
Es ist gut, genau hinzuschauen.« Ihr alter Körper strafft sich. Während Merana, zu Hause am Küchentisch sitzend, sich in Erinnerung rief, wie die Augen der Großmutter bei dieser Bemerkung aufgeblitzt waren, läutete das Handy. Es lag auf dem Wohnzimmertisch. Er holte es. ›Otmar‹, zeigte das Display.
»Guten Morgen, Martin. Bist du gut aus Italien zurückgekommen?«
Sein Mitarbeiter saß offenbar im Auto.
»Ja. Das bin ich. Was gibt es?«
»Unerfreuliches. Wir haben eine Leiche.«
Der Urlaub war endgültig vorbei. Das klang nach Arbeit.
»Wo?«
»Sebastiansfriedhof.«
Der Sebastiansfriedhof in der Linzergasse war ihm gut vertraut.
»Ich mache mich sofort auf den Weg.«
»Va bene. Wir sind schon fast dort. Wir erwarten Sie, Signor Commissario.«
2
Es war kurz vor halb acht, als Merana am Bruderhof eintraf. Der freie Platz und der Gebäudekomplex an der Passage zwischen Linzergasse und Paris-Lodron-Straße war ihm bekannt. Er hatte schon öfter im Freien vor einem der Lokale Platz genommen. Hier ließ sich gut sitzen, die Umgebung genießen, eine Kleinigkeit essen. Merana hatte den Weg durch die Linzergasse gewählt. Beide Zugänge zum Hof waren von der Polizei mittels Gitter und Bändern abgesperrt. Kleine Trauben von Schaulustigen hatten sich gebildet. Uniformierte Beamte bemühten sich um Ordnung, ersuchten die Passanten weiterzugehen. Die Kollegen und Kolleginnen agierten höflich, aber mit Nachdruck.
»Guten Morgen, Herr Kommissar.«
»Guten Morgen, Kollegen.«
Die Beamten ließen ihn durch. Merana eilte zur Mitte des Hofes, hielt sich nach dem in Hellgrau gehaltenen Institutsgebäude rechts. Von hier gelangte man in den Sebastiansfriedhof. Merana war der Zugang bekannt. Er hatte ihn schon gelegentlich gewählt. Kurz stoppte er. Das kreisförmige Objekt über dem Eingang war ihm bisher nie sonderlich aufgefallen. Was war das? Er vermeinte, eine weiße Taube mit ausgebreiteten Flügeln und angezogenen Beinen zu erkennen, umgeben von einem goldenen Strahlenkranz. Warum hatte er dem Gebilde bisher keine Beachtung geschenkt? Wieder einmal entdeckte er mitten in der Stadt, die er so gut kannte, etwas, das ihm bisher entgangen war. Ja, so war eben Salzburg. Immer wieder gut für Überraschungen. Die Darstellung über dem Eingang zum Friedhof sollte wohl den Heiligen Geist verkörpern. Merana glaubte an keinen Gott. Weder an einen dreifaltigen noch an sonst einen. Aber bei dem, was ihm gleich bevorstand, würde er himmlisch geistvolle Unterstützung gerne annehmen, wenn er sie bekam. Direkt neben dem Eingang begrüßte ihn eine uniformierte Beamtin. »Gleich links, Herr Kommissar.« Im Arkadengang, der geradeaus in der Verlängerung des Eingangs sichtbar war, arbeiteten drei Kollegen von der Tatortgruppe. Sie untersuchten penibel den Boden. Merana durchquerte den Eingang und wandte sich, wie geheißen, nach links. Er hielt inne, blieb stehen. Es war nicht das erste Mal, dass er so reagierte. Wie immer scheute er davor, sofort den Fuß in den unsichtbaren Kreis zu setzen, den der Tod hinterlassen hatte. Dieses Mal lag der Tatort in einer ganz besonderen Umgebung. Sie waren mitten in einem Friedhof. Eine Anhäufung von Toten ringsum. Nicht wenige lagen hier seit Jahrhunderten. Doch deren Präsenz berührte Merana nicht. Ihm ging es um den einen Toten. So wie immer. Wegen der einen toten Person war er hier. Dieser eine Mensch war erst vor kurzem aus dem Leben geschieden. Merana konnte den Kreis wahrnehmen, den der Tod hinterlassen hatte. So erging es ihm immer, wenn er an einem Tatort eintraf. Er schaffte es nicht, gleich ganz heranzukommen. Seine Mitarbeiter wussten das. Niemand stieß sich daran. Er musste kurz innehalten. Erst dann fiel es ihm leichter, die unsichtbare, aber für ihn spürbare Schwelle zu überschreiten. Er atmete tief durch, dann setzte er langsam seinen Weg fort. Der Platz mit der Leiche war gleich am Beginn des nach links ausgerichteten Arkadenganges. Neben dem Toten erkannte Merana die Gerichtsmedizinerin. Zwei weitere Kollegen der Tatortgruppe machten im Hintergrund Fotos. Der Tote lag auf dem Rücken. Ein junger Mann. Das hatte ihm Otmar Braunberger beim Telefonat während der Herfahrt mitgeteilt. Und noch etwas hatte der Abteilungsinspektor angeführt. Der Tote trug eine Art Kutte. Mehr hatte Meranas Mitarbeiter nicht in Erfahrung gebracht. »Ich hätte doch gestern Abend noch wegfahren sollen. Dann hätte ich mir im Ausseerland ein hübsches Zimmer genommen und das Handy abgeschaltet. Keiner hätte gewusst, wo ich bin. Dann wäre mir das hier erspart geblieben.« Die Gerichtsmedizinerin befand sich in der Hocke. Ihre Stimme klang genervt. Für Merana war das nichts Neues. Frau Doktor Eleonore Plankowitz war eine Koryphäe auf ihrem Fachgebiet. Sie wurde oft als Referentin zu namhaften Forensik-Seminaren eingeladen. Man schätzte ihren Rat. Auch Merana tat das. Und er hatte sich inzwischen längst mit der brummigen Art abgefunden, mit der Frau Doktor Plankowitz sich meist ihrer Umwelt mitzuteilen beliebte. Das war offenbar ihre Art von Schutz, um mit dem leichter zurandezukommen, dem eine Gerichtsmedizinern bei ihrer Arbeit mit toten, oft brutal hingemetzelten Menschen ausgesetzt war. Heute präsentierte sich Frau Doktor Plankowitz grimmiger als sonst. »Aber nein, ich Idiotin hatte ja beschlossen, erst heute gegen Mittag abzufahren«, setzte sie drauf. »Also war ich in der Früh da. Und rumms, schon hat es wieder mich erwischt. Und niemand anderen.« Sie wandte sich ächzend um, hob abwehrend die Hand. »Bleib auf Abstand, Merana. Versau mir keine Spuren. Ich bin noch lange nicht fertig mit dem armen Kerl.« Der Kommissar stoppte ab. Er ließ sich mit etwas Abstand ebenfalls in die Hocke nieder. Die Leiche hatte starke Verletzungen im Bereich des Kopfes. Das war für Merana von seinem Platz aus zu bemerken. Ein hässlicher Anblick. Dunkle Flecken waren zu sehen, offenbar eingetrocknetes Blut. »Ich weiß, Eleonore, Genaues erfahre ich erst, wenn du den Toten bei dir in der Gerichtsmedizin gründlich untersucht hast.« Merana hob Verständnis bezeugend die Hände. »Ich frage dennoch. Was kannst du mir jetzt schon sagen?« Die Ärztin brummte etwas Unverständliches. Dann drehte sie langsam ihr Gesicht in Richtung des Kommissars. »Junger Mann«, sagte sie. »Anfang bis Mitte 20, schätze ich.« Sie wies auf einen aufgerichteten Quader. Das steinerne Objekt trug am oberen Ende einen Abschluss aus dunklem Metall. »So wie ich es derzeit vermute, landete unser Opfer zuerst mit dem Kopf an diesem Gebilde. Ob der junge Mann stolperte oder gegen den steinernen Klotz gestoßen wurde, lässt sich noch nicht sagen. Ich gehe aber stark davon aus, dass er durch diesen Aufprall nicht starb.« Sie wies auf eine imposante viereckige Säule gleich dahinter. »Sein Kopf krachte auch dagegen.« Die Säule bildete eine der vielen wuchtigen Stützen, die das gesamte Dach des Arkadenrundganges trugen. An der Säule war eine große Steintafel mit altertümlicher Schrift angebracht. Deutlich waren Spuren von Blut daran auszumachen. »Der Tote hatte Verletzungen am Kopf und an den Schultern. Die wurden ihm hier an mehreren Stellen zugefügt.« Sie wies auf eine steinerne Figur. Die Skulptur war auf einem Sockel angebracht. Sie befand sich auf der anderen Seite des Ganges. Doktor Plankowitz wies auf eine weitere Gestalt aus Stein. »Auch dagegen ließ man ihn krachen.« Diese Figur stand ebenfalls auf einem Sockel. ›Grabstätte der Franziska Beck‹, las Merana auf der geschwungenen Tafel, die der kleinkindähnliche Putto in Händen hielt. Tafeln, Inschriften, Figurengruppen, aufwändig gestaltete Grabmonumente gab es hier unzählige, wie Merana wusste. Die Grabstätte, vor der der Tote auf dem steinernen Boden lag, war die erste im linken Arkadengang. Auch hier war eine Aufschrift zu erkennen. Schöpf’sche Gruft. »Wenn ich deine Ausführungen richtig verstanden habe, Eleonore, dann wurde der junge Mann mehrmals herumgestoßen. Er verletzte sich also nicht nur an einer bestimmten Stelle dieser Gräberanlage.« Die Ärztin nickte. »Davon gehe ich vorerst aus. Den genauen Tathergang kann ich dir erst nach umfassendem Abschluss meiner Untersuchung sagen. Vielleicht wurde ihm zusätzlich mit einem Gegenstand auf den Kopf geschlagen. Das weiß ich noch nicht. Eine der Wunden ließe es der Form nach zumindest vermuten. Thomas und seine Männer wissen jedenfalls Bescheid. Sie forschen nach einer möglichen zusätzlichen Tatwaffe.« Merana schaute sich um. Im Augenblick war Thomas Brunner, der Leiter der Tatortgruppe, nirgends auszumachen. Er würde sich später mit ihm austauschen.
»Anfang bis Mitte 20, sagst du, Eleonore?« Doch die Medizinerin war beschäftigt, schenkte ihm keine Beachtung mehr.
»22 ganz genau«, hörte er hinter sich. Er wandte sich um. Der Abteilungsinspektor kam heran, begleitet von einem Mann. Der Begleiter trug dunkle Kleidung. Der Herbeigekommene reichte Merana kaum bis zur Brust. Das Haar des Mannes war schütter. Erste Anzeichen von grauen Strähnen waren deutlich zu erkennen. Die Wangen schienen eingefallen. Doch die gesamte Statur des Mannes wirkte füllig. »Martin, das ist Pater Paul Keffner, der Rektoratsleiter der Priesterbruderschaft St. Johannes«, stellte Otmar vor. Die Priesterbruderschaft hatte ein eigenes Büro im Gebäude am Eingang zum Friedhof. Der Bruderschaft war die Kirche St. Sebastian anvertraut. Pater Keffner war es, der die Leiche heute Morgen entdeckt hatte, erklärte der Abteilungsinspektor. Es war dem Kirchenmann deutlich anzusehen, dass ihm der schreckliche Fund zusetzte.
»Kennen Sie den Toten?«, fragte Merana. Das Nicken kam schnell. »Ja, das ist … das war … also ich will sagen, ich kenne ihn. Das ist Elias.«
Merana blickte auf den in eine Kutte gekleideten Toten.
»Stammt Elias aus Ihrer Bruderschaft?«
»Nein.« Pater Keffner hob abwehrend die Hände. »Elias gehört zum Orden der Franziskaner.«
»Franziskaner? Von hier, aus der Stadt?«
Erneutes Nicken. »Ja, von der Gemeinschaft der Franziskaner drüben in der Altstadt.« Merana blickte schnell zu Otmar. Der hob die Hand. »Darum werde ich mich gleich kümmern, Martin. Ich verständige umgehend die Ordensleitung.«
»Danke, Otmar.« Merana wies wieder zur Leiche. »Wann fanden Sie den Toten? Also den Elias.«
»Kurz nach sechs Uhr. Ich war eben im Begriff, meine Morgenrunde anzugehen. Ich war verwundert, dass das Eingangstor nicht abgeschlossen war.«
»Der Friedhof ist während der Nacht nicht zugänglich?«
»Nein, er ist abgesperrt. Geschlossen wird um 18 Uhr. Geöffnet wird der Friedhof um 9 Uhr. Hat Elias wieder einmal vergessen abzuschließen, dachte ich. Aber dann …« Er blickte zum Toten. Er bekreuzigte sich. Seine Lippen bewegten sich. Er sprach ein kurzes Gebet.
»Elias gehört also nicht zu Ihrer Bruderschaft, der St. Sebastian anvertraut ist, sondern zu den Franziskanern.«
»Ja, aber er durfte hier sein, bisweilen sogar in der Nacht. Er hatte einen Schlüssel.
Er ging seiner Forschungsarbeit nach.«
»Was forschte er?«
»Er interessierte sich sehr für Paracelsus.« Pater Keffner wies zum Aufgang zur Kirche. Rechts nahe dem Eingang befand sich das Grabmal von Theophrastus Paracelsus. Das war Merana bekannt.
»Vor etwa drei Wochen suchte mich Pater Leonhard auf«, fuhr Pater Keffner fort.
»Pater Leonhard ist der Guardian der Franziskaner. Wir kennen uns gut. Er kam in Begleitung eines jungen Mannes. Er wurde mir als Elias vorgestellt, seit einem halben Jahr Novize. Mir wurde erklärt, dass Elias dabei war, einige besondere Forschungen anzustellen. Ich glaube, er wollte eine Arbeit über Paracelsus schreiben oder ein bestimmtes Projekt über den Gelehrten initiieren.« Er blickte Merana direkt an. »Wenn es für Ihre Untersuchung eine Rolle spielt, können Sie dazu gewiss mehr von Pater Leonhard und den Franziskanern erfahren. Es war Elias ein tiefes Anliegen, gelegentlich nachts das Innere der Kirche aufzusuchen. Auch das ermöglichten wir ihm. Er interessierte sich sehr für den Heiligen Sebastian.«
»Seit etwa drei Wochen kam Elias regelmäßig hierher, sagten Sie?«
»Ja, wir erlaubten es, da Guardian Leonhard mich eindringlich darum gebeten hatte.
Er setzte sich sehr für das Anliegen von Elias ein. Allerdings war ich vor einer Woche fast dabei, die Zusage einzuschränken, die Erlaubnis nur mehr für den Zugang während des Tages auszusprechen.«
»War etwas vorgefallen?«
»Alles in allem machte Elias einen sehr gewissenhaften Eindruck. Aber offensichtlich traf das das nur zu, was seine Arbeit anbelangte. Von seinen Untersuchungen zu Paracelsus hatte er mir mit leuchtenden Augen berichtet. Da wirkte er vorbildlich. Ich muss zugeben, er konnte einem mit seiner überschwänglichen Art gelegentlich auf die Nerven gehen. Bei allem, was nicht direkt seine Forschungsarbeit betraf, schien er zudem eher nachlässig. Vorige Woche hatte er vergessen, das Tor abzuschließen, als er gegen Mitternacht den Friedhof verließ.«
»Heute war das Tor ebenfalls nicht abgeschlossen, sagten Sie. Kam das öfter vor, wenn Elias seiner Tätigkeit nachging?«
»Entdeckt haben wir es nur das eine Mal in der Vorwoche.«
»Aber Sie sprachen das Verbot dann doch nicht aus. Elias war wieder hier. So auch in der vergangenen Nacht.«
»Ja, der Guardian hatte mich darum gebeten, keine endgültigen Konsequenzen zu ziehen. Wir redeten beide Elias streng ins Gewissen. Der junge Mann versprach, künftig besonders achtsam zu sein, immer abzusperren.«
Er zuckte mit den Schultern. Tränen schlichen ihm in die Augen. »Es wäre wohl besser gewesen, ich hätte es ihm nicht mehr erlaubt. Dann wäre er vergangene Nacht nicht hier gewesen. Dann wäre er vielleicht noch am Leben …«
»Bruder Paul!« Ein Mann, gekleidet wie Pater Keffner, hetzte auf der rechten Seite die Stufen herab. Der Mann wirkte aufgeregt.
»Bruder Paul, komm mit in die Kirche. Es ist unvorstellbar. Du musst es mit eigenen Augen sehen.« Er machte auf der Stelle kehrt. »Bruder Reginald, warte.« Doch der Mitbruder rannte zurück. Pater Keffner und Merana folgten dem Davoneilenden. Jetzt erblickte Merana Thomas Brunner. Der Chef der Tatortgruppe war aufmerksam geworden, näherte sich rasch mit zweien seiner Leute aus dem rechten Arkadengang. Merana und Keffner erreichten das Innere der Kirche. Das Tor am Emporengitter war offen. Bruder Reginald stand auf der rechten Seite vor dem ersten Seitenaltar. Er hielt aufgeregt die Hand zum Boden gestreckt. »Bruder Paul, sieh nur. Der Heilige Sebastian ist weg.« Seine Hand schnellte nach oben. »Und zwei der Kerzenständer fehlen auch.«
»Das ist der Florian-Altar«, bemerkte Keffner, leicht außer Atem. »Hier steht immer die Statue des Heiligen Sebastian.« Vor dem Altar befand sich ein mit weißem Spitzentuch umhüllter Sockel. Der Platz war leer.
»Wann haben Sie die Statue zuletzt gesehen?«, wandte Merana sich an beide Patres. Inzwischen waren die Tatortleute herbeigeeilt. »Gestern Abend«, versicherte der aufgeregte Reginald. »Ich mache immer einen Kontrollgang, ehe ich den Kircheneingang abschließe.«
»Hatten Sie in letzter Zeit mit Kirchendiebstahl zu tun, Pater Paul?«, fragte Merana.
Der Rektoratsleiter der St. Johannes-Bruderschaft schüttelte den Kopf. »Schon lange nicht mehr. Vor vier Jahren verschwand eine große Kerze, sie tauchte nie mehr auf. Aber seit damals passierte nichts mehr.«
Merana machte einen Schritt zurück, ließ seinen Blick über den Altar schweifen. Dann schaute er durch die geöffnete Kirchentür hinaus auf den Friedhof. Warst du vergangene Nacht unglücklicherweise jemandem im Weg, Novize Elias? Haben die Kirchenguträuber deine Anwesenheit entdeckt? Merana trat zur Seite. Auch die beiden Patres gaben den Weg zum Altar frei, damit Thomas Brunner und die Tatortspezialisten mit der Arbeit beginnen konnten. Merana blickte hinaus zum Friedhof. Wie war das, Novize Elias, Bewunderer von Theophrastus Paracelsus? Entdeckten die Kirchenguträuber, dass du hier warst? Brachten sie dich daraufhin brutal zum Schweigen? Damit du sie nicht verraten kannst. Merana musterte den kleinen Seitenaltar. Zwei Kerzenständer und eine Heiligenstatue fehlten, wie er mitbekommen hatte. Kirchenraub. Er atmete durch. Jetzt hatten sie zumindest so etwas wie einen Spurenansatz, dem sie folgen konnten.
3
»Raub von Kirchenwertgegenständen?«, war das Erste, das dem Abteilungsinspektor entfuhr, als Merana ihn anrief. »Und in Zusammenhang damit eine übel zugerichtete Leiche? Hatten wir das schon einmal, Martin? Ich kann mich beim besten Willen nicht daran erinnern. Und ich bin lange genug dabei.«
Ja, das war er tatsächlich, der Abteilungsinspektor Otmar Braunberger. Merana überlegte. Es waren weit mehr als 15 Jahre, dass Otmar zum Team gestoßen war. Eine treue Seele, wie sich von Anfang an herausstellte. Typ ›zuverlässiger Kinderonkel‹. Einer, auf den du immer bauen kannst. Dass Otmar Braunberger damals Alkoholprobleme hatte, war kaum zu bemerken. Merana hatte ihn nicht vor die Tür gesetzt, als es schließlich doch aufkam. Im Gegenteil. Er und seine Stellvertreterin Carola Salman hatten alles darangesetzt, dem sympathischen Kollegen beizustehen. Ihm zu zeigen, dass er ihnen viel wert war. Und tatsächlich. Der Abteilungsinspektor, damals im Rang eines Gruppeninspektors, hatte es bald geschafft, seine Misere in den Griff zu bekommen. Heute sah Braunberger überhaupt kein Problem mehr darin, ab und zu ein Glas Bier zu trinken.
Aus Kollegen waren Freunde geworden. Es war ein festes Band, das Merana, Carola und Otmar zusammenhielt. Bis heute.
»Kannst du dich an eine ähnliche Begebenheit erinnern, Martin?«
Nein, konnte er nicht.
»Wir sollten Kollegin Sukac hinzuziehen«, schlug Otmar vor. »Sie ist, was Diebstahl von Kunstgegenständen anbelangt, regelrecht zur Expertin geworden. Willst du das als Chef angehen oder soll ich es in die Wege leiten?«
»Übernimm bitte du das. Vielleicht kann Bezirksinspektorin Sukac heute bei unserem Meeting am späten Nachmittag dabei sein.« Sie beendeten das Gespräch. Otmar hatte ihm kurz geschildert, wie die Reaktion der Ordensbrüder war, als er den Franziskanern die Nachricht vom gewaltsamen Tod ihres jungen Mitbruders überbracht hatte. Die Welt der Franziskaner war Merana wenig bekannt. Nun hatte er einen Toten, dem diese Welt Heimstatt gewesen war. Wie immer wollte Merana über alles grundlegend Bescheid wissen, was das Opfer betraf. Es wurde höchste Zeit, sich mit der Welt, aus der Elias kam, besser vertraut zu machen. Damit wollte er gleich beginnen.
Merana parkte den Dienstwagen auf dem Max-Reinhardt-Platz direkt neben dem Wilden-Mann-Brunnen. Er eilte in Richtung Franziskanergasse. Wie oft hatte er das Gebäudeensemble vor sich schon gesehen? Einige hundert Mal würde wohl hinkommen. Er kannte gut, was er sah. Und dennoch war er jedes Mal aufs Neue vom imposanten Anblick fasziniert. Als würde er es zum ersten Mal wahrnehmen. Rechts hinten war auf Anhöhe das prachtvolle Profil der Festung Hohensalzburg auszumachen. Sie thronte über den Häusern der Stadt. Davor zu sehen war der markante Kirchturm von St. Peter. Und direkt vor Merana ragte der Turm der Franziskanerkirche als schlanke Erscheinung mit gotisch anmutender Spitze in den Himmel.
»Gegen 12.30 Uhr habe ich Zeit für Ihren Besuch«, hatte der Sprecher des Ordens ihn am Telefon wissen lassen. »Vorher geht es nicht. Da wollen wir in der Hauskapelle für unseren Elias beten.« Merana schaute auf die Uhr. Ihm blieb noch Zeit. Dann könnte er gut die Franziskanerkirche aufsuchen. Er versuchte sich zu erinnern, wann er das letzte Mal dort gewesen war. Es musste sehr lange her sein. Es hätte nur weniger weiterer Schritte bedurft, dann stünde er vor dem Dom. Dessen äußere Erscheinung fand Merana eindrucksvoll. Die Fassade aus hellem Marmor mit den zwei Türmen präsentierte sich bestens geeignet als theatralisch beachtenswerte Kulisse für das berühmte Spiel, in dem Jedermann Bekanntschaft mit dem Tod macht. Dazu passten die vier großen Statuen in der Fassade. Sie zeigten die Apostel Paulus und Petrus sowie die beiden Landespatrone. Den heiligen Virgil mit der Skulptur des Vorgängerdoms und den Heiligen Rupert mit dem Salzfass. Dieses Äußere war gewiss prächtig. Doch das Innere des Doms interessierte Merana weniger. Er konnte dem einen oder anderen Prunkstück der barocken Überladenheit im Inneren gelegentlich etwas abgewinnen. Allerdings eher aus kunsthistorischem Interesse. Die Aura des Dominneren berührte ihn kaum. Ganz anders war das bei der Franziskanerkirche. Wenn er hier eintrat, fühlte er sich in eine völlig andere Welt versetzt. Er tauchte in eine andere Sphäre ein. In eine Umgebung, die nichts mit dem geschäftig-hektischen Treiben von draußen zu tun hatte. Merana tat sich ungemein schwer, an so etwas wie einen Gott zu glauben. Er konnte sich unmöglich vorstellen, dass irgendwo ein höheres Wesen existierte, das die Welt und die Menschen darin erschaffen hatte. Mit aller Schönheit, aber genauso mit all der unleugbaren Hässlichkeit und Brutalität. Nein, dass es einen Gott dieser Art gab, mochte Merana nicht glauben. Und dennoch konnte er sich gelegentlich der Faszination nicht entziehen, die von manchen der sogenannten Gotteshäuser ausging. Die Franziskanerkirche gehörte zweifellos auf beeindruckende Weise dazu. Er war allein in der Kirche. Zumindest sah er von seinem Platz aus niemanden. Er stand an der hinter ihm wieder geschlossenen Eingangstür. Es war eine Bahn. Eine hinreißend ausgerichtete Bahn. Wie bei einem sanften Fluss. Anders konnte er es nicht bezeichnen. Er stand am Beginn des hohen, schmalen Mittelschiffes. Hier war es eher dunkel. Die langen Bankreihen links und rechts vor ihm bildeten so etwas wie eine Uferbegrenzung. Auf der Bahn zwischen den Bankreihen fiel der Blick direkt auf das Ziel. Das war wie eine Anlegestelle. Der im Licht hell strahlende Hochaltar. Langsam setzte Merana sich in Bewegung, leitete die Füße über den Marmorboden. Mit jedem Schritt wurde es rings um ihn eine Nuance lichter. Es war, als schreite er auf einem Weg aus dem Dunkel ins Helle. Der Weg führte vom Eingangsbereich, in dem die ursprünglich romanische Bauweise merkbar war, hin zur lichterfüllten Helle des gotischen Hallenchores. Am Ende des Weges erreichte man die Anlagestelle, den wunderbar gestalteten Hochaltar. Ihn in seiner heutigen Form hatte der berühmte Bildhauer und Architekt Johann Bernhard Fischer von Erlach geschaffen, der in Salzburg unter anderem die Dreifaltigkeitskirche entworfen hatte. Merana war in der Reihe der vielen berühmten Bauwerke Fischer von Erlachs