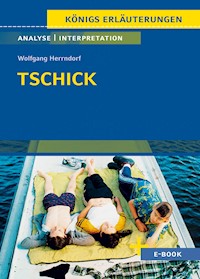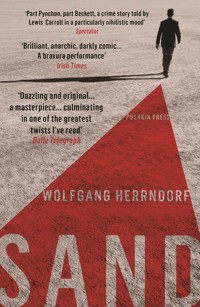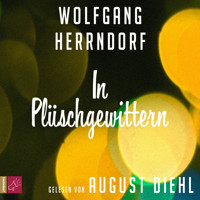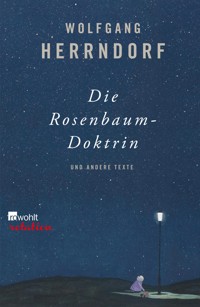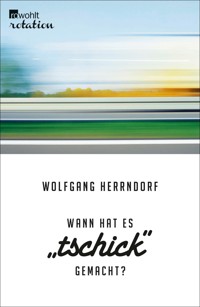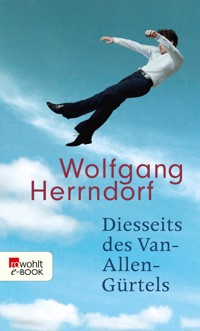9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
«Er aß und trank, bürstete seine Kleider ab, leerte den Sand aus seinen Taschen und überprüfte noch einmal die Innentasche des Blazers. Er wusch sich unter dem Tisch die Hände mit ein wenig Trinkwasser, goss den Rest über seine geplagten Füße und schaute die Straße entlang. Sandfarbene Kinder spielten mit einem sandfarbenen Fußball zwischen sandfarbenen Hütten. Dreck und zerlumpte Gestalten, und ihm fiel ein, wie gefährlich es im Grunde war, eine weiße, blonde, ortsunkundige Frau in einem Auto hierherzubestellen.» Während in München Palästinenser des «Schwarzen September» das olympische Dorf überfallen, geschehen in der Sahara mysteriöse Dinge. In einer Hippie-Kommune werden vier Menschen ermordet, ein Geldkoffer verschwindet, und ein unterbelichteter Kommissar versucht sich an der Aufklärung des Falles. Ein verwirrter Atomspion, eine platinblonde Amerikanerin, ein Mann ohne Gedächtnis – Nordafrika 1972.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Wolfgang Herrndorf
Sand
Roman
Über dieses Buch
«Er aß und trank, bürstete seine Kleider ab, leerte den Sand aus seinen Taschen und überprüfte noch einmal die Innentasche des Blazers. Er wusch sich unter dem Tisch die Hände mit ein wenig Trinkwasser, goss den Rest über seine geplagten Füße und schaute die Straße entlang. Sandfarbene Kinder spielten mit einem sandfarbenen Fußball zwischen sandfarbenen Hütten. Dreck und zerlumpte Gestalten, und ihm fiel ein, wie gefährlich es im Grunde war, eine weiße, blonde, ortsunkundige Frau in einem Auto hierherzubestellen.»
Während in München Palästinenser des «Schwarzen September» das olympische Dorf überfallen, geschehen in der Sahara mysteriöse Dinge. In einer Hippie-Kommune werden vier Menschen ermordet, ein Geldkoffer verschwindet, und ein unterbelichteter Kommissar versucht sich an der Aufklärung des Falles. Ein verwirrter Atomspion, eine platinblonde Amerikanerin, ein Mann ohne Gedächtnis – Nordafrika 1972.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Reinbek bei Hamburg, Dezember 2011
Copyright © 2011 by Rowohlt · Berlin Verlag GmbH, Berlin
Umschlaggestaltung Anzinger | Wüschner | Rasp, München
(Abbildung: plainpicture/Glasshouse)
ISBN 978-3-644-11081-6
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Inhaltsübersicht
Erstes Buch: Das Meer
1. Targat am Meer
2. Das Zentralkommissariat
3. Kaffee und Migräne
4. MS Kungsholm
5. Die Tat eines Verrückten
6. Shakespeare
7. Lundgren
8. Auf der Gangway
9. Spasski und Moleskine
10. Die Zentrifuge
11. Revision
12. Chamsin
13. Bei der Arbeit
14. Schwarzweiß
Zweites Buch: Die Wüste
15. Tabula Rasa
16. Möglichkeiten des Erwachens
17. Möglichkeiten des Abstiegs
18. Unter Dünen
19. Der Viertelbuchstabe
20. Im Land des Ouz
21. Maispflanzen
22. Eine Tankstelle in der Wüste
23. Mercurochrom
24. Schwalben
25. Schwimmen
Drittes Buch: Die Berge
26. Der Teufel
27. Das Läuferportal
28. Im Atlas
29. Tourist Information
30. Hakim von den Bergen
31. Der Tyrann von Akragas
32. Dissoziation
33. Die Bibliothek
34. Die Banane
35. Risa, genannt Khach-Khach
Viertes Buch: Die Oase
36. Beim General
37. Die Hohepriesterin
38. Kampf der Häuptlinge
39. Ohne Leiche kein Mord
40. Die unsichtbare Königsbrigade
41. Ein gelber Mercedes mit schwarzen Sitzen
42. Nichts von Bedeutung
43. Sirenen
44. La chasse à l’ouz
45. Mond und Sterne
46. Die Elektrifizierung des Salzviertels
47. Chéri
48. Ockhams Rasiermesser
49. Trübe Gedanken
50. Contrazoom
51. Marshal Mellow
52. Tuareg
53. Die fünf Säulen
Fünftes Buch: Die Nacht
54. Der Baststuhl
55. Das schwarze Kästchen
56. Strom
57. Die Stasi
58. Das Vanderbilt-System
59. Operation Artischocke
60. Die Legenden der Standhaften
61. Ein wenig Stochastik
62. Im tiefsten Grund
63. Räumliche Vorstellungen
64. Aéroport de la liberté
65. Das weitere Geschehen
66. Schöne Erinnerungen
67. Der König von Afrika
68. Die Madrasa des Salzviertels
Dank
Erstes Buch: Das Meer
1.Targat am Meer
Wir schicken jedes Jahr – und scheuen dabei weder Leben noch Geld – ein Schiff nach Afrika, um Antwort auf die Fragen zu finden: Wer seid ihr? Wie lauten eure Gesetze? Welche Sprache sprecht ihr? Sie aber schicken nie ein Schiff zu uns.
Herodot
Auf der Lehmziegelmauer stand ein Mann mit nacktem Oberkörper und seitlich ausgestreckten Armen, wie gekreuzigt. Er hatte einen verrosteten Schraubenschlüssel in der einen Hand und einen blauen Plastikkanister in der anderen. Sein Blick fiel über Zelte und Baracken, Müllberge und Plastikplanen und die endlose Wüste hinweg auf einen Punkt am Horizont, über dem in Kürze die Sonne aufgehen musste.
Als es so weit war, schlug er Schraubenschlüssel und Plastikkanister gegeneinander und rief: «Meine Kinder! Meine Kinder!»
Die östlichen Wände der Baracken flammten hellorange auf. Der hohle, schleppende Rhythmus sank in die bleigrauen Gassen hinab. In Kuhlen und Gräben wie Mumien liegende verschleierte Gestalten erwachten, rissige Lippen formten Worte zu Lob und Preis des alleinigen Gottes. Drei Hunde tauchten ihre Zungen in eine schlammige Pfütze. Die ganze Nacht über war die Temperatur nicht unter dreißig Grad gesunken.
Unbeeindruckt hob sich die Sonne über den Horizont und schien über Lebende und Tote, Gläubige und Ungläubige, Elende und Reiche. Sie schien über Wellblech, Sperrholz und Pappe, über Tamarisken und Dreck und eine dreißig Meter hohe Barriere aus Müll, die Salzviertel und Leeres Viertel von den übrigen Bezirken der Stadt trennte. Ungeheure Mengen von Plastikflaschen und entkernten Autos erstrahlten in ihrem Licht, Pylonen aus aufgeklopften Batteriegehäusen, zerschroteten Ziegeln, Schamott, Gebirge aus Fäkalschlamm und Tierkadavern. Über die Barriere hinweg hob sich die Sonne und beschien die ersten Häuser der Ville Nouvelle, vereinzelte zweistöckige Gebäude im spanischen Stil und die bröckeligen Minarette der Vorstadt. Lautlos glitt sie über die Rollbahn des Militärflughafens, die Tragflächen einer verlassenen Mirage 5, den Suq und die angrenzenden Verwaltungsgebäude von Targat. Ihr Licht glänzte auf herabgelassenen Metallrouleaus kleiner Handwerksgeschäfte und drang durch die Fensterläden des zu dieser Stunde noch unbesetzten Zentralkommissariats, wanderte die von Halfagras gesäumte Hafenstraße hinauf, rieselte am zwanzigstöckigen Sheraton-Hotel hinunter und erreichte kurz nach sechs Uhr das vom Küstengebirge sanft abgeschirmte Meer. Es war der Morgen des 23. August 1972.
Kein Wind wehte, keine Welle ging. Wie eine Panzerplatte dehnte sich das Meer bis zum Horizont. Ein großes Kreuzfahrtschiff mit gelben Schornsteinen und erloschenen Lichterketten lag schlafend vor Anker, leere Champagnergläser standen auf der Reling.
Der Reichtum, wie unser Freund mit dem blauen Plastikkanister zu sagen pflegte, der Reichtum gehört allen. Holt ihn euch.
2. Das Zentralkommissariat
You know what happened to the Greeks? Homosexuality destroyed them. Sure, Aristotle was a homo, we all know that, so was Socrates. Do you know what happened to the Romans? The last six Roman emperors were fags.
Nixon
Polidorio hatte einen IQ von 102, errechnet nach einem Fragebogen für französische Schulkinder im Alter von zwölf bis dreizehn Jahren. Den Fragebogen hatten sie im Kommissariat als Packpapier für in Marseille gedruckte Formulare gefunden und nacheinander mit Bleistift ausgefüllt, in der vorgeschriebenen Zeit. Polidorio war schwer betrunken gewesen. Canisades auch. Es war die lange Nacht der Akten.
Zweimal im Jahr wurden auf den Fluren Berge aus Papier aufgetürmt, flüchtig durchgesehen und im Hof verbrannt, eine lästige Pflicht, die oft bis zum Morgengrauen dauerte und traditionell an den Dienstjüngsten hängenblieb. Warum manche Akten weggeworfen und andere aufbewahrt wurden, konnte niemand erklären. Man hatte die Verwaltung von den Franzosen übernommen, wie man eine Höflichkeitsformel übernimmt, und der bürokratische Aufwand stand in keinem Verhältnis zum Nutzen. Die wenigsten Angeklagten konnten lesen und schreiben, Gerichtsverfahren waren kurz.
Mitten in der Nacht hatte es im Kommissariat einen Stromausfall gegeben, Polidorio und Canisades waren stundenlang damit beschäftigt gewesen, jemanden aufzutreiben, der einen Vierkantschlüssel für den Sicherungskasten besaß. Eine Weile hatten sie bei Kerzenschein weitergearbeitet, und unter dem Einfluss von Kif und Alkohol war ihre Ermüdung in Euphorie umgeschlagen. Sie veranstalteten im Hof Schneeballschlachten mit zerknülltem Papier und auf den Gängen eine Verfolgungsjagd mit rollenden Aktenschränken. Canisades erklärte sich zu Emerson Fittipaldi, Polidorio setzte mit einer Zigarette einen Abfallhaufen in Brand, dann fiel aus einer umgestürzten Hängeregistratur ein Packen Spezialausweise aus der Kolonialzeit. Sie spannten die Ausweise in die Schreibmaschine, trugen Phantasienamen ein und stolperten damit im Licht des hereinbrechenden Tages gemeinsam ins Bordell («Sonderermittler des Tugendkomitees, Bédeux mein Name»).
Und davor eben der verhängnisvolle IQ-Test. An die meisten Erlebnisse dieser fatalen Nacht konnte Polidorio sich hinterher nur noch undeutlich erinnern. Aber das Testergebnis blieb hängen. Einhundertzwei.
«Alkohol, Stress, Stromausfall!», rief Canisades, eine kleinbusige Schwarze auf jedem Knie. «Ist das eine Entschuldigung? Runden wir einfach auf hundert ab.»
Canisades’ Ergebnis hatte deutlich höher gelegen. Um wie viel höher, selbst daran konnte Polidorio sich nicht erinnern. Aber die eigene Zahl stand von nun an festbetoniert in seinem Gedächtnis. Obwohl er sicher war, dass er im nüchternen Zustand mehr Punkte erzielt hätte – nicht mehr als Canisades, aber mehr auf jeden Fall –, fiel ihm das jetzt jedes Mal wieder ein, wenn er etwas nicht verstand. Wenn er etwas mühsamer begriff als andere, wenn er Sekundenbruchteile später über einen Witz lachte als seine Kollegen.
Polidorio hatte sich immer für einen verständigen und begabten Menschen gehalten. Wenn er nun zurückblickte, wusste er nicht, worauf sich diese Überzeugung gegründet hatte. Er war ohne große Schwierigkeiten durch die Schule, die Ausbildung, die Prüfungen gekommen, aber mehr auch nicht. Immer Mittelfeld, immer Durchschnitt. Und nichts anderes besagte die Zahl ja auch: Durchschnitt.
Die Erkenntnis, nichts Besonderes zu sein, überfällt die meisten Menschen einmal in ihrem Leben, nicht selten gegen Ende der Schulzeit oder zu Beginn der Berufsausbildung, und die intelligenteren eher als die unintelligenten. Aber nicht alle leiden gleich stark darunter. Wer mit den Idealen des persönlichen Verdienstes, der Leistung, des Herausragens als Kind nicht ausreichend vertraut gemacht worden ist, wird das Bewusstsein blasser Durchschnittlichkeit vielleicht hinnehmen wie eine zu große Nase oder zu dünnes Haar. Andere wieder reagieren darauf mit den bekannten Fluchtbewegungen, die von exzentrischer Kleidung über exzentrisches Leben bis hin zur ehrgeizigen Suche nach einem Selbst reichen können, das im eigenen Innern vermutet wird wie ein prächtiger verborgener Schatz, welchen die gnädige Psychoanalyse auch dem letzten Trottel zugesteht. Und die Sensiblen reagieren mit einer Depression.
Schon ein paar Tage nachdem Canisades die herrlichen Erlebnisse der Nacht dem gesamten Kollegen- und Bekanntenkreis weitererzählt hatte, stand Polidorio vor seinem Fach mit der Nummer 703 und sah, dass irgendein Witzbold mit Kugelschreiber aus der 7 eine 1 und aus der 3 eine 2 gemacht hatte.
Achtundzwanzig Jahre lang hatte er keinen Gedanken an die Höhe und Messbarkeit seiner Intelligenz verschwendet – jetzt dachte er manchmal an nichts anderes mehr.
3. Kaffee und Migräne
Ein Verrückter natürlich, so einer, der die Hosen voll hat und lauter erlesene Gefühle in sich spürt, der ist immer fein raus.
Joseph Conrad
«Und interessiert mich das? Das kannst du irgendwem erzählen, deinen Briketts kannst du das erzählen, aber nicht mir.» Polidorio hatte sich Kaffee eingeschenkt und rührte ihn mit dem Kugelschreiber um. Die blauen Fensterläden waren geschlossen bis auf einen schmalen Spalt weißer Mittagshitze. «Und du kannst hier auch nicht einfach reinkommen und irgendwen anschleppen. Hollerith-Maschinen! Du weißt nicht mal, was das ist. Und das interessiert mich nicht. Das Einzige, was mich interessiert, ist: Wo ist das passiert? Das ist in Tindirma passiert. Wer ist da zuständig? Also. Pack das da ein und verschwinde. Nein, rede nicht. Hör auf rumzureden. Seit einer Stunde redest du. Hör mir zu.»
Aber der Dicke hörte nicht zu. In einer verschmuddelten Uniform stand er vor Polidorios Schreibtisch, und er machte es wie alle hier. Wenn sie nicht kooperieren wollten, redeten sie irgendeinen Unsinn. Wenn man sie dazu befragte, redeten sie einen anderen Unsinn.
Polidorio hatte ihm weder Kaffee noch einen Stuhl angeboten, und er duzte ihn, obwohl der Mann dreißig Jahre älter war und vom Rang gleichgestellt. Für gewöhnlich waren das zuverlässige Mittel, diese Leute zu kränken. Aber der Dicke schien dagegen immun. Ungerührt redete er über nahe Rente, Fahrten mit dem Dienstfahrzeug, Gartenbau und Vitaminmangel. Zum vierten und fünften und sechsten Mal erläuterte er den Inhalt seiner Tankfüllung und sein Konzept des Gefangenentransports, sprach von Gerechtigkeit, Zufall und höherem Willen. Er zeigte auf die einander gegenüberliegenden Fenster (Wüste, Meer), auf die Tür (der lange Weg durchs Salzviertel), den defekten Deckenventilator (Allah) und trat mit dem Fuß gegen das am Boden liegende Bündel (die Ursache allen Übels).
Die Ursache allen Übels war ein an Händen und Füßen zusammengeschnürter Junge namens Amadou, den der Dicke in der Wüste zwischen Targat und Tindirma aufgegriffen hatte, ein Faktum, das in seinem endlosen Redeschwall nur sehr am Rande auftauchte.
Ob er schon einmal von Kompetenzen gehört habe, wollte Polidorio wissen, und bekam zur Antwort, dass erfolgreiche Polizeiarbeit eine Frage der Technik sei. Er fragte, was Technik mit dem Tatort zu tun habe, und bekam zur Antwort, wie schwierig es sei, in der Nähe der Oase Landwirtschaft zu betreiben. Polidorio fragte, was Landwirtschaft damit zu tun habe, und der Dicke redete von Versorgungsengpässen, von Flugsand, Wassermangel und Missgunst der Nachbarn auf der einen Seite, Wohlstand, Elektronengehirnen und hoher Polizeiorganisation auf der anderen. Er warf erneut einen Blick auf die defekte Hollerith-Maschine, sah sich mit gespieltem Entzücken im Zimmer um und setzte sich, da kein Stuhl in Reichweite war, auf den Gefangenen, ohne eine Sekunde seinen Redeschwall zu unterbrechen.
«Jetzt Ruhe», sagte Polidorio. «Ruhe. Hör mir zu.» Er ließ seine Handflächen einen Moment flach über der Schreibtischplatte schweben, bevor er sie rechts und links der Kaffeetasse entschieden auf zehn Finger stellte. Der Dicke wiederholte seinen letzten Satz. An seiner Hose fehlten zwei Knöpfe. An seinen fleischigen Ohrläppchen hingen Schweißtropfen und schwangen im Takt. Mit einem Mal hatte Polidorio vergessen, was er sagen wollte. Er spürte ein leises Pochen in den Schläfen.
Sein Blick fiel auf Hunderte kleiner Bläschen, die durch das Umrühren in der Tasse entstanden waren und sich nun zu einem kreiselnden Teppich zusammenschlossen. Als die Rotation schwächer wurde, wanderten die Bläschen zum Tassenrand, wo sie sich zu einem ringförmigen Wall auftürmten. Im Innern jedes Bläschens war ein kleiner Kopf eingeschlossen, der ihn mit zusammengekniffenen Augen anstarrte, in den kleinen Bläschen ein kleiner Kopf, in den mittleren ein mittlerer und in den großen ein großer. Das Auditorium bewegte sich militärisch synchron und verfiel für einige Sekunden in eine Art Totenstarre. Dann wurden alle Köpfe plötzlich größer, und als Polidorio ausatmete, starb ein Viertel seines Publikums.
Benzingutscheine, Wüstensand, Maul- und Klauenseuche. Kinderreichtum, Rebellen, Präsidentenpalast. Polidorio wusste, worum es dem Dicken nicht ging. Aber er wusste nicht, worum es ihm ging. Die Überstellung eines Verdächtigen nach Targat ergab keinen Sinn. Vielleicht, dachte er, war der Dicke mit seiner Sitzgelegenheit vage bekannt und wollte persönlichen Verwicklungen aus dem Weg gehen. Vielleicht war der Betriebsausflug an die Küste aber auch reiner Selbstzweck. Oder er hatte hier Geschäfte zu erledigen. Vielleicht wollte er das Hafenviertel sehen. Und mit Sicherheit ging es auch ums Geld. Allen ging es bei allem immer ums Geld. Wahrscheinlich wollte er ein paar Sachen verkaufen. Er wäre nicht der erste Dorfsheriff, der als Kompensation für ausbleibende Lohnzahlungen Schreibmaschine, Blankopapiere oder Dienstwaffe zum Suq trug. Und wenn es nicht ums Geld ging, ging es um Verwandte. Vielleicht hatte er einen Sohn hier, den er besuchen wollte. Oder eine dicke Tochter im heiratsfähigen Alter. Vielleicht wollte er in ein Bordell. Vielleicht arbeitete auch seine dicke Tochter in einem Bordell, und er wollte ihr seine Dienstwaffe verkaufen. Das war alles möglich.
Ein dumpfes Weckerrasseln unterbrach seine Überlegungen. Polidorio holte ein großes Stoffknäuel aus der untersten Schublade seines Schreibtischs und schlug mit der flachen Hand auf eine bestimmte, nur ihm erkennbare Stelle. Das Rasseln verstummte. Er zog eine Packung Aspirin aus derselben Schublade und sagte gereizt: «Jetzt genug. Jetzt hau ab. Hau einfach ab in deine Oase und nimm das da mit.»
Er drückte zwei Tabletten aus dem Blister. Kopfschmerzen hatte er keine, aber wenn er jetzt keine Medikamente nahm, setzten die Schmerzen in genau einer halben Stunde ein. Jeden Tag um vier. Was die Ursache dieser periodischen Anfälle war, hatte sich bisher nicht klären lassen. Der letzte Arzt hatte die Röntgenbilder gegen das Licht gehalten, von Normvarianten gesprochen und Polidorio zu einem Psychologen geraten. Der Psychologe empfahl Medikamente, und der Apotheker, der von diesen Medikamenten noch nie gehört hatte, vermittelte ihn an einen weisen Mann. Der weise Mann wog vierzig Kilo, lag zusammengekrümmt auf der Straße und verkaufte Polidorio einen Zettel mit Beschwörungsformeln, der abends unters Bett gelegt werden musste. Seine Frau brachte schließlich eine Anstaltspackung Aspirin aus Frankreich mit.
Es war nichts Seelisches. Polidorio weigerte sich zu glauben, dass es etwas Seelisches war. Was sollte das für eine Seele sein, die jeden Tag um genau dieselbe Uhrzeit brüllende Schmerzen auslöste? Um vier Uhr nachmittags war nichts Besonderes. An der Arbeit konnte es nicht liegen, die Schmerzen kamen auch an freien Tagen. Sie kamen um vier und blieben bis zum Schlafengehen. Polidorio war jung, er war von athletischer Konstitution und ernährte sich nicht anders, als er sich in Europa ernährt hatte. In unmittelbarer Nähe des Sheraton gab es einen Laden mit Importwaren, einheimisches Wasser benutzte er nicht mal zum Zähneputzen. Das Klima? Warum hatte er dann nicht vierundzwanzig Stunden am Tag Kopfschmerzen?
In den einsamen Stunden der Nacht, wenn der Pesthauch der Hitze durch das Moskitonetz zu ihm drang, wenn das unbekannte Meer an die unbekannten Felsen schlug und die Insekten unter seinem Bett tobten, glaubte er zu wissen, dass es weder etwas Körperliches noch etwas Seelisches war. Es war das Land selber. In Frankreich hatte er niemals Kopfschmerzen gehabt. Nach zwei Tagen in Afrika setzten sie ein.
Er nahm die Tabletten in den Mund, spülte sie mit zwei Schluck Kaffee hinunter und spürte dem sanften Druck in seiner Speiseröhre nach. Es war sein tägliches Ritual, und es verletzte ihn, von dem hemmungslos vor sich hin redenden Dicken dabei beobachtet zu werden. Während er die Packung wieder in der Schublade verstaute, sagte er: «Oder sehen wir hier aus wie die Annahmestelle für Scheißprovinzprobleme? Hau ab in deine Oase. Du Kaffer.»
Stille. Kaffer. Er wartete auf die Reaktion, und die Reaktion kam mit nur einsekündiger Verzögerung: Der Dicke riss lustig seine Äuglein auf, formte mit dem Mund ein kleines O und wedelte schlaff eine Hand in Schulterhöhe. Dann redete er weiter. Oase, Straßenzustand, Hollerith-Maschine.
Zwei Monate war es her, dass Polidorio seine Arbeit hier angetreten hatte. Und seit zwei Monaten wollte er nichts anderes als nach Europa zurück. Schon am Tag seiner Ankunft hatte er festgestellt (und diese Feststellung mit einem Fotoapparat bezahlt), dass vor den fremden Gesichtern seine Menschenkenntnis versagte. Sein Großvater war selbst Araber gewesen, aber früh nach Marseille ausgewandert. Polidorio hatte einen französischen Pass und wuchs nach der Trennung seiner Eltern bei der Mutter in der Schweiz auf. In Biel ging er zur Schule, später studierte er in Paris. Seine Freizeit verbrachte er in Cafés, in Kinos und auf dem Tennisplatz. Die Leute mochten ihn, aber wenn es Streit gab, nannten sie ihn Pied-noir. Wäre sein Aufschlag besser gewesen, hätte er vielleicht Profi werden können. So wurde er Polizist.
Wie so vieles in seinem Leben war es Zufall. Ein Freund hatte ihn mit zur Aufnahmeprüfung genommen. Der Freund wurde abgelehnt, Polidorio nicht. Während der Jahre seiner Ausbildung veränderte sich die Gesellschaft, ohne dass er viel davon mitbekam. Er war kein politisch denkender Mensch. Er las keine Zeitungen. Der Pariser Mai und die Irren von Nanterre interessierten ihn so wenig wie die nach Luft schnappende Gegenseite. Gerechtigkeit und Gesetze waren für ihn ungefähr identisch. Die Langhaarigen mochte er nicht, aber hauptsächlich aus ästhetischen Gründen. Von Sartre hatte er zehn Seiten gelesen. Es sei einfacher, schrieb seine erste Freundin, als sie sich von ihm trennte, ihn durch das zu beschreiben, was er nicht sei, als durch das, was er sei.
Seine zweite Freundin heiratete er. Das war im Mai 1969, und er liebte sie nicht. Sie wurde sofort schwanger. Das erste Jahr war die Hölle. Als man ihm wegen seiner Arabischkenntnisse eine Stelle in den ehemaligen Kolonien anbot, nahm er sofort an. Hochglanz-Bildbände von malerischen Wüsten, primitive Holzskulpturen in Wohnzimmerschränken, das Gerede von den Wurzeln. Er hatte keine Ahnung von Afrika.
Was sich ihm stärker als alles andere einprägte, war der fremde Geruch auf dem Flughafen. Dann die Einsamkeit der ersten Wochen, bevor die Familie nachkam. Ein Bild in der Tageszeitung: Thévenet am Mont Ventoux. Postkarte eines Freundes: schneebedeckte Alpen. Der Gestank, die entsetzlichen Kopfschmerzen. Polidorio fing an, auf der Straße stehen zu bleiben, wenn jemand ein reines Französisch ohne asthmatisches Gurgeln sprach. Der Anblick von Touristen, ihre Ungezwungenheit, die heiter-blonden Frauen. Er stellte einen Antrag auf Rückversetzung, der französische Staat lachte ihn aus. Mit jeder Woche wurde er sentimentaler. Französische Touristen, französische Zeitungen, französische Produkte. Selbst die stets in Rudeln auftretenden Gammler und Langhaarigen, die im Gänsemarsch und mit fünfhundert Gramm Kif in den Taschen aus den Bergen zu Tal strömten, um sich anschließend von ihm die Handschellen anlegen zu lassen, erfüllten ihn mit einer Art von Rührung. Sie waren Idioten. Aber sie waren europäische Idioten.
Der Dicke redete noch immer. Polidorio schob die Kaffeetasse auf dem Schreibtisch beiseite. Er wusste, dass er einen Fehler machte. Er griff mit beiden Händen über die Schreibtischkante, zog seinen Oberkörper nach vorn und spähte in den Abgrund.
«Zwanzig Dollar, ja?»
Der gefesselte Junge schien unter dem Gewicht des Dicken eingeschlafen zu sein.
«Der Herr Oberkommissar redet mit dir!», rief der Dicke und klatschte dem Gefangenen die flache Hand aufs Ohr.
«Zwanzig Dollar und ein Korb Gemüse?», wiederholte Polidorio.
«Was?»
«Ja, du!»
«Ja, was, Chef?»
«Ein paar Dollar und ein Korb Gemüse. Und dafür hast du vier Leute in Tindirma umgenietet?»
«Was?» Das Bündel begann, sich zu beleben. «Vier Leute wo?»
«Vier Leute in Tindirma. Vier Weiße.»
«Ich bin nie im Leben in Tindirma gewesen, Chef. Ich schwör!»
4. MS Kungsholm
Eroberungen auf sexuellem Gebiet lösten in Ellsberg die gleiche kindliche Begeisterung und den gleichen Mitteilungsdrang aus wie vertrauliche Informationen über Nukleartechnik. Den Leuten der RAND Corporation beschrieb er seine neueste Liebschaft einmal mit den Worten: «Sie hat eine Lücke zwischen jedem Zahn.»
Andrew Hunt
Es gibt nur wenige Menschen, die man in einem einzigen Satz beschreiben kann. In der Regel braucht man mehrere, und für gewöhnliche Menschen reicht oft ein ganzer Roman nicht aus. Helen Gliese, die mit weißen Shorts, weißer Bluse, weißem Sonnenhut und riesiger Sonnenbrille an der Reling der MS Kungsholm lehnte, mit halboffenem Mund Kaugummi kaute und auf das Gewimmel der Menschen am sich nähernden Ufer schaute, konnte man in zwei Worten beschreiben: schön und dumm. Mit dieser Beschreibung konnte man einen Fremden zum Hafen schicken und sicher sein, dass er unter Hunderten Reisenden die Richtige abholen würde.
Das Erstaunliche daran war allerdings nicht die Kürze der Beschreibung. Das Erstaunliche war, dass diese Beschreibung nicht im mindesten zutraf. Helen war nicht schön. Sie war eine Versammlung ästhetischer Gemeinplätze, ein Zuviel an Körperpflege und modischer Bemühung, aber schön im eigentlichen Sinne war sie nicht. Sie war jemand, den man am besten aus der Entfernung betrachtete. Manche Fotos von ihr hätte man auf die Cover von Modezeitschriften setzen können – ein Eindruck von Glattheit, Kälte und großen Linien. Doch sobald das Bild sich zu beleben anfing, wurde man merkwürdig verwirrt. Helens Mimik war mit sich selbst schlecht synchronisiert. Der schleppende, leiernde Singsang ihrer Stimme erzeugte den Eindruck einer Vorabendserienschauspielerin, der jemand die Regieanweisung reich und blasiert ins Drehbuch geschrieben hat, ihre Arm- und Handbewegungen wirkten wie die Parodie eines Homosexuellen, und dies alles zusammen mit dem Übermaß an Schminke und ausgefallener Kleidung konnte einen, wenn man Helen zum ersten Mal begegnete, mehrere Minuten – oder Stunden oder Tage – lang von der Erkenntnis ablenken, dass alles, was sie sagte, logisch und durchdacht war. Ihre Gedanken waren vollkommen klar, und sie formulierte sie mühelos. Noch überraschender war es, Briefe von ihr zu lesen.
Mit anderen Worten, Helen war das genaue Gegenteil von dumm, und wenn nicht das Gegenteil von schön, so doch von einer klassischen Vorstellung von Schönheit sehr weit entfernt; was nichts an der Tatsache änderte, dass diese Vom-Hafen-abholen-Geschichte funktionierte. Oder funktioniert hätte. Es war Helens erster Besuch in Afrika, und niemand holte sie ab.
5. Die Tat eines Verrückten
Er riet uns, sogleich aufzubrechen, und erbot sich, uns zu begleiten und vor Verrat zu schützen. Diese freundliche Geste eines verschlagenen alten Barbaren gegenüber zwei völlig hilflosen Fremden rührte mich zutiefst.
Rider Haggard
Der Beschuldigte hieß Amadou Amadou. Jedes einzelne Indiz sprach gegen ihn, die Summe der Indizien war ein Todesurteil. Amadou war einundzwanzig oder zweiundzwanzig, ein schlaksiger junger Mann, der mit seinen Eltern und Großeltern und einem Dutzend Brüdern und Schwestern zwei Straßen vom Tatort, einer agrarischen Kommune in der Oase Tindirma, entfernt wohnte oder gewohnt hatte.
Die Kommune bestand überwiegend aus Amerikanern, einigen Franzosen, Spaniern und Deutschen, einer Polin und einem Libanesen, insgesamt doppelt so vielen Frauen wie Männern. Die meisten von ihnen hatten sich Mitte der sechziger Jahre in der Küstenregion um Targat kennengelernt und waren zufällig auf das Anwesen in der zwanzig Kilometer entfernten Oase aufmerksam geworden, ein billig zu mietendes, zweistöckiges Haus mit einem kleinen Stück Land. Der Traum vom natürlichen, selbstbestimmten Leben, eine Idee sozialer Selbstorganisation und so weiter. Keiner der Kommunarden hatte Erfahrung mit dieser Sorte praktizierter Utopie. Anfangs lebten sie von einem mühsam bewässerten Acker und einfachem Trödel, den sie den Einheimischen abkauften und in die Erste Welt exportierten, später kam gelegentlich Handel mit verbotenen Substanzen hinzu.
Den zunächst misstrauisch beäugten, langhaarigen, redseligen und orientierungslos herumtappenden Kommunarden gelang es durch ihre Offenheit und Hilfsbereitschaft relativ rasch, das Wohlwollen ihrer neuen Nachbarn zu gewinnen. Freundlich und großzügig streckten sie die Hände zur Gegenseite hin aus, und die Gegenseite griff zunächst zögerlich und dann überraschend fest und herzlich zu. Fremder Schmuck wurde bestaunt, Haare wurden betastet, Lebensmittel getauscht. Es war die Zeit des großen Redens, der langen Diskussionen und der angedeuteten Verbrüderungen. Es kam zu einigen kleineren Festen und erster Unruhe. Im Laufe des Sommers wurde die Zahl der ungebetenen Gäste, die versuchten, finanziellen Vorteil aus der Kommune zu ziehen, unüberschaubar. Auch medizinische, handwerkliche und sexuelle Dienstleistungen wurden verlangt und teilweise gewährt. Eine Kette mühseliger Auseinandersetzungen, kommunenintern Missverständnisse genannt, war die Folge, woraufhin man sich zunächst diffus und dann programmatisch von den Einheimischen nach und nach wieder zurückzog, sich auf ein reines Geschäftsverhältnis besann und schließlich sogar die einen Meter sechzig hohe Mauer um das Anwesen herum um einen weiteren Meter aufstockte. Einer nur knappen Mehrheit von zwei Stimmen war es zu verdanken, dass in den frischen Lehm der Mauerkrone keine Glasscherben gedrückt wurden. Dies alles geschah im Laufe weniger Monate.
Die beiden auffälligsten Figuren der Kommune waren der schottische Industriellenspross Edgar Fowler III und der französische Ex-Soldat und Herumtreiber Jean Bekurtz. In einem ihrer nüchternen Momente hatten sie die Idee zu der Kommune gehabt, mit ihrem ansteckenden Enthusiasmus Mitglieder – darunter eine beachtliche Zahl sehr gut aussehender Frauen – rekrutiert und einen groben Umriss dessen entworfen, was sie ihre Philosophie nannten.
Doch die Wüste änderte die Anschauungen rasch. War man anfangs im Graubereich eines diskutierfreudigen Marxismus angesiedelt, mehrten sich schon nach kurzer Zeit die Räucherstäbchen im Haushalt. Zwischen Kerouac und Castaneda verschimmelte ein halber Meter Trotzki, und die Idee eines körperlich dauerhaft ineinander verflochtenen Humankapitals («Das ist nur eine Metapher») scheiterte am Widerstand uneinsichtiger Frauenzimmer. Zum Zeitpunkt unserer Erzählung war die Kommune auf das Niveau einer mickrigen ökonomischen Zweckgemeinschaft herabgesunken – um deren Prosperität es nur geringfügig besser bestellt schien als zur Gründungszeit.
Um den Tathergang und alles Weitere verständlich zu machen, muss an dieser Stelle eine kurze Erläuterung gegeben werden, wovon wir sprechen, wenn wir von der Oase sprechen.
Archäologische Untersuchungen ergeben keine Anzeichen für eine Besiedlung des Ortes in früher Zeit. Noch um 1850 ist Tindirma eine Ansammlung dreier Lehmhütten um ein kärgliches Wasserreservoir an den Hängen einer vereinzelt in der Wüste aufragenden Felsnadel. Geologen sprechen von einem Kegelberg vulkanischen Ursprungs. Die höchste Erhebung liegt etwa 250 Meter über dem Meer und gestattet einen Blick, der auch an guten Tagen ringsum nichts als Sand erkennen lässt, den ein stetig von der Küste herwehender Wind in die Form eines endlosen Sicheldünenfeldes gepflügt hat. Nur den westlichen Horizont säumt eine Ahnung von Dunst und Grün und Blau.
Gelegen am Kreuzungspunkt zweier unbedeutender Karawanenstraßen, lassen erst die blutigen Kämpfe um das Massina-Reich die Oase wachsen. Versprengte Fulbe, die ohne Hab und Gut und vor allem ohne Vieh von Süden her eintreffen, halb nackt und halb verhungert, bewältigen den Übergang vom Nomadendasein zur Landwirtschaft. Aus drei Lehmhütten werden fünfzig, die zwischen struppigen Akazien und Doumpalmen die flacheren Felshänge hinaufrutschen.
Das Leben ist hart, und wie viele unfreiwillige Emigranten nennen die Fulbe den kargen Flecken Erde, den sie bewirtschaften, nach dem Ort, aus dem sie geflohen sind: Nouveau Tindirma. Innerhalb einer Generation verzehnfacht sich die Zahl der Unglücklichen.
Eine Geschichtsschreibung aus dieser Zeit existiert weder in schriftlicher noch in zuverlässiger mündlicher Form. Das erste Bilddokument ist eine Schwarzweißfotografie narbengesichtiger Männer aus den 1920er Jahren. Mit erloschenen Blicken und zu einem schwarzen Rechteck gepresst stehen sie auf der Ladefläche eines Thornycroft BX, der auf der frisch planierten Hauptstraße in das vor der Umgebung kaum sich abzeichnende Tindirma einfährt, im Hintergrund ein erstes zweistöckiges Gebäude.
Ende der dreißiger Jahre verwandeln zwei Ereignisse Tindirma von Grund auf. Das erste ist die Ankunft des verirrten Schweizer Ingenieurs Lukas Imhof, der eine Autopanne erleidet und von Einheimischen an der Reparatur seines Fahrzeugs gehindert wird. Praktisch ohne Hilfsmittel und nur mit der Unterstützung einiger Haratin bohrt Imhof in den folgenden Monaten einen vierzig Meter tiefen Brunnen neben den Kaafaahi-Felsen, der die Oase fortan überreichlich mit Wasser versorgt. Anschließend werden Imhof in einem feierlichen Akt zwei gereinigte Zündkerzen übergeben (Familienalbum, quadratisches Foto).
Das zweite ist der sich auswachsende Bürgerkrieg im Süden, der Tindirma in die strategisch günstigste Lage für den Schmuggel mit Waffen und Hilfsgütern bringt. Nur zwei oder drei Familien bestellen weiterhin ihre Hirsefelder, der Rest verabschiedet sich in die Nachtarbeit und überschwemmt die Gemeinde mit ungekanntem Wohlstand und die südlichen Pisten mit leblosen Körpern.
Etwa zeitgleich siedeln die ersten arabischen Händlerfamilien aus Targat über. Europäer mit dunklen Sonnenbrillen und akkurat ausrasierten Nacken fahren in olivgrünen Autos durch Tindirma, und 1938 installiert die Zentralverwaltung einen ersten Polizeiposten. Das Erscheinen der Staatsmacht ändert am Alltag zunächst wenig. Wer das ruhige Leben schätzt und es sich leisten kann, hält sich eine Privatarmee; die Polizei kämpft hauptsächlich um ihre eigene Sicherheit.
Der Übergang vom gesetzlosen zum halbzivilisierten Gebilde vollzieht sich erst mit der Verlagerung des Bürgerkrieges im Süden und Westen. Die mit Waffen gesättigte Region wird aufnahmefähig für andere Güter. Ehemalige Schmugglerkönige investieren in die Infrastruktur, einige Bars und ein erstes Hotel entstehen. Mitte der fünfziger Jahre gibt es für kurze Zeit ein kleines Lichtspielhaus. Eine asphaltierte Straße schiebt sich einige hundert Meter durch das Zentrum der Oase, fährt als schwacher Florettstoß zur Küste hin und versickert im Sand. Zwei kleinere Moscheen strecken ihre Minarettfinger in den gelben Himmel. Die Religion übt einen mäßigenden Einfluss auf das Leben der Gemeinschaft aus, stärkt die Schwachen und Rechtgläubigen und befestigt Sitten und Zivilisation durch die Klarheit des Gottesgedankens, durch Bildung und Scharia.
Parallel zum Eindringen staatlicher und religiöser Organe werden immer wieder Anläufe unternommen, dem Ort einen anderen Namen zu geben, die dunkle Vergangenheit vergessen zu machen, aber weder unter den Einheimischen, noch unter den Arabern oder den zwei oder drei Kartographen, die von der Siedlung bis zum Jahr 1972 Kenntnis nehmen, kann sich eine andere Bezeichnung als Tindirma durchsetzen.
Am Mittwoch, dem 23. August 1972, war laut Augenzeugenberichten Folgendes passiert: Amadou Amadou war angetrunken mit einem Auto, einem hellblauen, verrosteten Toyota, der ihm nicht gehörte, in den Hof der in der Nähe des Suqs gelegenen Kommune eingefahren. Dort hatte er, wie fünf Mitglieder der Kommune übereinstimmend berichteten, zunächst nicht näher bezeichnete Dienstleistungen feilgeboten, anschließend bei einem servierten Tee ebenso freizügige wie anatomisch unkorrekte Reden über Sexualität gehalten (vier Augenzeugen) bzw. philosophische Gespräche über das Geschlechterverhältnis begonnen (eine Zeugin), hatte sich anschließend offenbar unbeobachtet in der Küche selbständig weiter mit Alkohol versorgt und war zuletzt mit einer plötzlich aufgetauchten Schusswaffe in der Hand durch das Anwesen gestürmt, auf der Suche nach Wertgegenständen. Eine Dual-Hi-Fi-Stereo-Kompaktanlage im Gemeinschaftsraum habe als Erstes sein Interesse erregt, doch habe er sie allein nicht transportieren können. Ein weibliches Kommunemitglied, aufgefordert, ihm die Boxen zum Auto hinterherzutragen, habe sich geweigert, da die Anlage noch nicht vollständig bezahlt gewesen sei, woraufhin Amadou ihr ins Gesicht geschossen habe. Er habe dann zwei weitere Kommunarden erschossen, die hinzugekommen seien, um ihn (mit Worten oder wie?) zu entwaffnen. Bei der weiteren Durchsuchung des Anwesens (jetzt die Waffe wie einen an der Leine zerrenden Hund vor sich her tragend) sei ihm ein Bastkoffer in die Hände gefallen, der randvoll mit Geld gewesen sei (Papiergeld unbekannter Währung). Amadou habe nun alles andere vergessen und mit dem Bastkoffer fluchtartig das Haus zu verlassen versucht. Dabei habe er eine Sandale verloren, die in einen Treppenschacht gefallen sei, habe einen weiteren Kommunarden in einem Schrank erschossen und sich beim Verlassen des Hauses noch eines auf der Küchenanrichte stehenden gutgefüllten Obstkorbes bemächtigt. Etwa dreißig bis vierzig Augenzeugen, von den Schüssen in den Hof der Kommune gelockt, hatten Amadou gesehen, als er, um die Menge zu zerstreuen, in die Luft schießend in den Toyota gesprungen und in Richtung Küstenstraße davongefahren war. Auf halber Strecke war ihm mitten in der Wüste das Benzin ausgegangen, und er war vom kleinen, dicken Dorfsheriff verhaftet worden, der mit dem Verdächtigen wenig später in Polidorios Büro vorstellig wurde. Amadou hatte bei seiner Verhaftung nur noch eine Sandale getragen. Der Bastkoffer mit dem Geld war unauffindbar gewesen, der Obstkorb jedoch stand auf dem Beifahrersitz des hellblauen Toyota in der Wüste. Die noch warme Mauser lag im Handschuhfach. Ein zur Waffe passendes leeres Magazin wurde später im Hof der Kommune sichergestellt. Im Treppenschacht wurde eine Sandale gefunden, die der Sandale, welche Amadou am Fuß trug, spiegelbildlich glich.
Amadou beschäftigte sich in seiner Aussage mit keinem einzelnen der gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Er stritt die Tat pauschal ab. Das war nichts Ungewöhnliches. In einem Land, in dem das Wort eines Mannes noch etwas galt, gab es praktisch keine Geständnisse. Die Standardaussage aller Beschuldigten in allen Ermittlungen lautete, sämtliche gegen sie erhobenen Vorwürfe seien frei erfunden und sie fühlten sich tief in ihrer Ehre verletzt. Wenn Beschuldigte oder Angeklagte sich die Mühe machten, eine eigene Version des Tathergangs zu erfinden, nahmen sie in der Regel keine Rücksicht auf Details. Amadou machte hier keine Ausnahme. Die vorhandenen Fakten in das eigene Phantasiegebilde logisch zu integrieren, kam ihm nicht in den Sinn. Wie gelangte die Sandale in den Treppenschacht der Kommune? Wie kam das leere Magazin in den Hof? Wieso vermochten vierzig Augenzeugen Amadou eindeutig wiederzuerkennen? Amadou zuckte die Schultern. Das könne er beim besten Willen nicht sagen, und er verstehe nicht, warum man diese Fragen ausgerechnet an ihn richte. Sei es nicht vielmehr Aufgabe der Polizei, sie zu beantworten? Er zeigte auf irgendein elektrisches Gerät (Fernschreiber, Kaffeemaschine) und bat, man möge ihn an den Lügendetektor anschließen. Er schwor beim wahren und einzigen Gott, er erklärte, er könne nur angeben, was sich in Wirklichkeit zugetragen habe, und das sei er jederzeit zu tun bereit. Er, Amadou Amadou, habe einen Spaziergang in der Wüste unternommen. Das Wetter sei sehr lieblich gewesen, und der Spaziergang habe mehrere Stunden gedauert. (Das war nicht so unwahrscheinlich, wie es im ersten Moment klang. Viele Oasenbewohner waren im Zweitberuf noch immer Schmuggler.) Dabei habe er in einem Dornengestrüpp eine Sandale verloren. Dann habe er nahe der Piste einen verlassenen, hellblauen Toyota entdeckt und habe sich in das unverschlossene Auto gesetzt, weil auf dem Beifahrersitz ein köstlicher Obstkorb gestanden habe, und er, Amadou, habe mit dem Gedanken gespielt, etwas von diesem Obst zu essen, denn er sei sehr hungrig gewesen. Dies sei tatsächlich etwas, was man ihm vorwerfen könne, denn das Obst habe ihm nicht gehört. Er sei bereit, dies zu beschwören. In diesem Moment jedoch sei er von einem wie aus dem Nichts auftauchenden Polizisten verhaftet und nach Targat verbracht worden. Von einer Pistole im Handschuhfach sei ihm nichts bekannt.
Diese Aussage wiederholte er an vier aufeinanderfolgenden Tagen, ohne ein Wort zu verändern. Nur einmal, am Abend des vierten Tages und im Zustand starker Ermüdung, äußerte Amadou, er habe den Bastkoffer während der Flucht aus dem Fenster geworfen; er widerrief diesen Satz jedoch schon nach wenigen Minuten und wollte sich später nicht mehr dazu einlassen. Wollte überhaupt nichts mehr sagen, wenn man ihn nicht endlich schlafen lasse.
Und dann machte die Tatsache, dass die Opfer Ausländer waren, alles unendlich kompliziert. Polidorio hatte das Verhör nur am ersten Tag geleitet, am zweiten und dritten unternahm Canisades halbherzige Versuche, den Fall nach Tindirma zurückzuschieben; doch dann schaltete sich überraschend das Innenministerium ein, und die Angelegenheit wurde dem Dienstältesten Karimi übertragen.
Ein Mitglied der Regierung befand sich seit einigen Tagen in den USA und verhandelte über Waffenbrüderschaft und Entwicklungshilfe, als das Massaker ungewöhnlich ausführlich in der amerikanischen Presse auftauchte. Auch in Europa beschäftigte man sich damit, obgleich kein Europäer unter den Opfern war. In der Hauptstadt kam es zu unangenehmen Anfragen (der französische Botschafter, der amerikanische Botschafter, ein deutsches Nachrichtenmagazin), und die Konsequenz aus allem war, dass Karimi und ein Staatsanwalt sich in einem Hotel in Tindirma einquartieren mussten. Offiziell, um nochmals gründlich zu ermitteln, in Wahrheit, um die vor Ort aufgelaufenen Journalisten mit indiskreten Informationen über den Stand der Dinge und die Unzurechnungsfähigkeit des Täters grell illustrierenden Beispielen zu versorgen. Denn mochten die Opfer auch allesamt zugedrogte Hippies gewesen sein, die einen antiimperialistischen Kiffer-Betrieb in der Wüste leiteten – sobald es ernst wurde, zählte für die Erste Welt nur noch die Staatsbürgerschaft.
Amadou bekam von diesen Ehren wenig mit. Er zeigte weiterhin auf die Lügendetektor-Kaffeemaschine, schwor beim Leben seines Vaters und Vatersvaters, schwor beim wahren und einzigen Gott, rief den König und seine Familie um Beistand an und sagte, man könne ihn foltern und Schrauben in seine Fußsohlen drehen, er werde doch keinen Millimeter von der Wahrheit abweichen.
«Schrauben in die Fußsohlen», sagte Karimi. «Das sind Methoden, die hier selbstverständlich nicht zur Anwendung kommen. Im Ernst, wenn uns dein Geständnis interessieren würde, hätten wir das längst. Das ist dir hoffentlich klar. Dafür brauchen wir deine Füße nicht. Dafür brauchen wir überhaupt nichts. Nur, wen interessiert das? Hast du mal überlegt, wen deine Aussage interessieren soll? Hast du dir die Indizien mal angesehen?»
Amadou rutschte auf dem Stuhl hin und her und grinste. Karimi wandte sich an den Anwalt: «Haben Sie wenigstens mal versucht, ihm das zu erklären? Ein Zehntel davon bringt einen Mann unters Fallbeil.» Er drehte sich wieder zu Amadou. «Ob du redest oder nicht, ist scheißegal. Nicht mal das korrupteste Bohnengericht der Welt kann dich noch freisprechen. Du kannst die Klappe halten, oder du kannst reden. Der einzige Unterschied ist, wenn du redest, kriegt deine Familie eine ordentliche Leiche. Denk mal an deine Mutter. Nein, korrigiere – das ist natürlich nicht der einzige Unterschied. Der andere ist, wenn du redest, kannst du mal zum Pinkeln raus.»
Der Anwalt, der fast die ganze Zeit schweigend und nägelkauend dabeigesessen hatte, protestierte schwach. Dann verlangte er, sich mit seinem Mandanten unter vier Augen besprechen zu dürfen. Karimi zeigte auf ein in der Ecke stehendes Sofa, auf dem die Kommissare gewöhnlich saßen, wenn sie kifften.
Der Anwalt hätte mit Amadou in einen Nebenraum gehen können. Oder er hätte Karimi, Canisades und Polidorio bitten können, vor die Tür zu treten. Stattdessen führte er Amadou zu dem sieben oder acht Meter entfernt stehenden Möbel und erklärte ihm in gedämpftem Tonfall – wenngleich für die Polizisten deutlich vernehmbar –, dass die Indizienlage erdrückend und der Tag sehr heiß sei. Er fügte mit erhobenem Zeigefinger hinzu, vor den Augen Allahs sei ohnehin alles entschieden. Vor einem irdischen Gericht hingegen könne man in diesem Fall mit einem Geständnis weder etwas verbessern noch etwas verschlimmern, allein die sinnlose und entehrende Prozedur werde abgekürzt. Und ein Mann von Ehre, wie Amadou es sei usw. Der Mann war nicht gerade ein Staranwalt. Er hatte ein Bauerngesicht und trug einen schlechtsitzenden schwarzen Anzug, in dessen Brusttasche wie ein verzweifelter Hilfeschrei ein senffarbenes Taschentuch steckte. Auf dem Kommissariat war nicht ganz klar, wo Amadous Familie den Mann überhaupt aufgetrieben hatte. Die Vermutung, er werde in Naturalien entlohnt, lag nahe. Amadou hatte sechs oder sieben Schwestern.
«Oh, Mann», sagte Canisades mit Blick auf den Schreibtisch. Er freute sich wie ein kleines Kind. «Oh, Mann. Oh, Mann.»
Polidorio sah auf seine Uhr, zog zwei Aspirin aus der Tasche und schluckte sie trocken. Mit hochgerecktem Kinn schaute er eine Weile zum Deckenventilator. Der Beschuldigte beharrte noch immer pantomimisch auf seiner Version: Spaziergang in der Wüste, Sandale, Obstkorb, Verhaftung. Er wand sich auf dem Sofa hin und her, und während der Anwalt seine Argumente zum dritten oder vierten Mal wie ein Grundschullehrer wiederholte, fing Polidorio plötzlich einen Blick des Angeklagten auf, den er so noch nicht gesehen hatte. Was war das für ein Blick? Es war der verzweifelte Blick eines nicht allzu intelligenten Menschen, dem in diesem Moment, während des monoton dahinplätschernden Redeflusses seines Anwalts, zu Bewusstsein kommt, dass sein Leben zu Ende ist, der Blick eines Mannes, der trotz erdrückender Beweislast bis vor wenigen Minuten davon ausgegangen sein musste, es gebe eine Chance, der Guillotine zu entgehen, ein Blick, der nicht allein verzweifelt, sondern auch überrascht schien, der Blick eines Mannes, dachte Polidorio, der – vielleicht unschuldig war.
Er blätterte in den Akten.
«Wo sind eigentlich die Fingerabdrücke?»
«Was für Fingerabdrücke?»
«Auf der Waffe.»
Karimi wickelte kopfschüttelnd eine Schokopraline aus dem Stanniolpapier.
«Wir haben vierzig Augenzeugen», sagte Canisades. «Und Asiz ist im Urlaub.»
«Das kann doch jeder andere auch?»
«Was kann jeder andere auch? Kannst du das?» Karimi, der unbedingt noch bei Helligkeit zurück nach Tindirma wollte, wo er eine Verabredung mit einem LIFE-Reporter hatte, schnaubte. «Nicht mal Asiz kann das. In der Palastwache hat er eine Woche lang das Gelände zugeklebt. Dann hatte er vierhundert Abdrücke, und die einzigen beiden, die erkennbar waren, waren vom achtjährigen Sohn des Hausmeisters.»
Polidorio seufzte und sah zum Anwalt hinüber, der aufgehört hatte zu reden.
Amadous Kopf war auf halbmast gesunken.
6. Shakespeare
Ich bekam mal einen wundervollen Brief von der Ärzteschaft der medizinischen Fakultät in Boston, Massachusetts. Sie hatten mich zu der Person gewählt, die sie am liebsten operieren würden.
Dyanne Thorne
Helen war sich der Wirkung ihrer Person nie bewusst gewesen. Sie kannte sich nur von Fotos oder aus dem Spiegel. Ihrer eigenen Einschätzung nach sah sie gut, auf manchen Bildern sogar atemberaubend aus. Sie hatte ihr Leben im Griff, ohne besonders glücklich oder unglücklich zu sein, und sie hatte keine Probleme mit Männern. Jedenfalls nicht mehr als ihre Freundinnen. Eher weniger. Vom Beginn der Highschool an gerechnet, hatte Helen sieben oder acht Beziehungen gehabt, allesamt mit Jungen, die etwa in ihrem Alter, sehr nett, sehr wohlerzogen und sehr sportlich waren, Jungen, denen Intelligenz an ihren Freundinnen nicht sonderlich wichtig erschien und die sie auch an Helen selten bemerkten.
Helen machte sich keine Gedanken deswegen. Wenn Männer sich für geistig überlegen halten wollten, war sie nicht verstört. Meist hielten diese Beziehungen nicht lange, und ebenso schnell, wie sie zerbrachen, fanden sich neue. Ein Gang über den Campus in bauchfreiem T-Shirt, und Helen hatte drei Einladungen zum Abendessen. Die einzige Frage, die sie sich von Zeit zu Zeit stellte, war, warum die wirklich interessanten Männer sie nie ansprachen. Sie konnte sich das nicht erklären. Depressionen hatte sie wie alle anderen, nicht öfter. Aus Romanen wusste sie, dass die schönsten Frauen auch immer die unglücklichsten waren. Sie las viel.
Einen ersten Riss erhielt ihr Selbstbewusstsein, als sie zur Vorbereitung auf ein Referat ihre Stimme mit einem Tonbandgerät aufzeichnete. Helen hörte sich diese Aufzeichnung genau vier Sekunden lang an und hatte anschließend nicht den Mut, die Play-Taste ein zweites Mal zu drücken. Ein Außerirdischer, eine Tex-Avery-Figur, ein sprechendes Kaugummi. Ihr war bewusst, dass die eigene Stimme etwas Fremdes sein kann, aber die Laute auf dem Tonband waren mehr als fremd. Im ersten Moment hielt sie sogar einen technischen Defekt für möglich.
Der picklige Chemieprofessor, der ihr das Tonband geliehen hatte, erklärte, im Kopf mitschwingende Knochen und Resonanzräume seien die Ursache, dass der Mensch die eigene Stimme voller und wohltönender wahrnehme, als sie in Wirklichkeit sei, und Überraschung sei eine angemessene Reaktion. Er selbst hatte die Fistelstimme eines Kastraten und konnte seinen Blick beim Sprechen nicht von Helens Ausschnitt lösen. Sie veranstaltete keine weiteren Experimente in dieser Richtung und vergaß die Sache. Das war in ihrem ersten Jahr in Princeton.
Helen hatte die Zulassung mühelos geschafft und ein begehrtes Stipendium erhalten. Aber wie viele Studienanfänger reagierte sie auf das Verpflanztwerden in eine Welt voller fremder und abgezirkelter Rituale mit starker Verunsicherung. In ihrem Studentenwohnheim fühlte sie sich so einsam wie nie zuvor im Leben. Sie stürzte sich in Studien, ging auch dem langweiligsten Smalltalk nicht aus dem Weg und mühte sich, feste Termine für die meisten Abende der Woche zu finden.
Durch die Vermittlung eines Bekannten, der englische Literatur studierte, kam Helen in Kontakt mit einer Laienschauspielgruppe, die vier- oder fünfmal im Jahr ein klassisches Stück, selten etwas Modernes, aufführte. Die meisten Teilnehmer der Gruppe studierten, aber auch zwei Hausfrauen, ein ehemaliger Professor, der sich gern nackt auszog, und ein junger Gleisarbeiter waren mit von der Partie. Der Gleisarbeiter galt als der heimliche Star der Gruppe. Er war 24 Jahre alt, hatte das Gesicht eines Filmschauspielers, einen Körper wie eine griechische Plastik und konnte sich – einziger Mangel – keinen Text merken. Nicht zuletzt um seinetwillen beschäftigte Helen sich fast drei Jahre lang mit den Dramen der elisabethanischen Zeit.
Zuerst bekam sie nur kleine Rollen, später spielte sie die Bianca in Der Widerspenstigen Zähmung und die Dorothea Angermann. Sie war nicht untalentiert, und sie hätte auch nichts dagegen gehabt, einmal die strahlende Heldin zu sein; aber die besten Rollen wurden, wie ihr schien, weniger nach Talent als nach Erfahrung besetzt. Wer am längsten dabei war, war Desdemona.
Und dann spielten sie Die Katze auf dem heißen Blechdach. Man führte weniger das Stück auf, als dass man den Film nachspielte. Der Gleisarbeiter brillierte als Paul Newman, sah dem großen Vorbild irritierend ähnlich und humpelte derart lässig an Krücken über die Bühne, dass seine Unterhaltungen mit dem Souffleur wirkten wie ein raffinierter Teil des Stückes. Eine umwerfend schwarzhaarige Biologiestudentin aus dem vierten Studienjahr stellte Liz Taylor dar. Helen war Mae. Die bigotte Mae mit ihrer bigotten Familie. Man polsterte ihre Taille auf das Fünffache auf, puderte ihr die Haare grau, malte Apfelbäckchen unter die hohen Wangenknochen, steckte sie in ein kartoffeliges Kleid, und als halslose Kinder wurden ihr die Enkel des ehemaligen Professors zur Seite gegeben, denen man, da sie in Wirklichkeit Hälse besaßen, Zervikalstützen umgebunden hatte. Ihre Münder wurden mit Schaumgummi ausgestopft, und statt zu sprechen, gaben die Kinder ein vom Publikum begeistert begrüßtes, konsonantenloses Gequengel von sich.
Der Dozent, der die Gruppe leitete, nahm die Premiere mit der Doppel-8-Kamera auf. Es war das erste Mal seit ihrer Einschulung, dass Helen gefilmt wurde, und bei der Vorführung des Films musste sie den Raum verlassen. Sie ging auf die Toilette, warf einen kurzen Blick in den Spiegel und übergab sich. In sehr aufrechter Haltung kehrte sie anschließend in den Vorführraum zurück, blickte anderthalb Stunden knapp an der Leinwand vorbei und lauschte dem monotonen Rattern des Projektors. Als nächstes Stück stand Schnitzlers Reigen auf dem Spielplan, aber noch bevor die spannende Frage beantwortet werden konnte, welche Rolle man ihr diesmal zuteilen würde, trat sie aus der Theatergruppe wieder aus.
Ihr Dozent bedauerte diesen Schritt. Außer ihm schien niemand groß Notiz davon zu nehmen. So wie niemand Notiz davon genommen hatte, was für eine durch und durch lächerliche und geistlose Vorstellung Helen auf der Bühne gegeben hatte. Zwar in gewisser Übereinstimmung mit der Rolle – um ehrlich zu sein, in genauer Übereinstimmung mit der Rolle –, aber die Figur doch auf eine Weise gelungen darstellend, die man nur schlecht als geschauspielert empfinden konnte. Diese Mimik, diese Intonation! Und niemand fand es bemerkenswert. Beim Schlussapplaus warf Helen noch einmal einen Blick auf die Leinwand. Lärmpegel und Pfiffe verdoppelten sich, als Mae im grotesken Baumwollhänger einen Schritt nach vorne tat, geziert die Arme um zwei halslose Ungeheuer legte und den Mund zu einem entsetzlich dümmlichen Lächeln verzog. Das letzte Bild auf einer knatternd sich drehenden Filmspule.
Auf der anschließenden kleinen Feier trank Helen zu viel Wein, und ihre letzte Handlung, bevor sie sich dauerhaft von der Gruppe verabschiedete, war, dem Gleisarbeiter ins Ohr zu flüstern, sie werde ihn flachlegen diese Nacht. Sie nannte Adresse und Uhrzeit und ging, ohne seine Reaktion abzuwarten. Dass sie ihre Worte bewusst drastisch gewählt hatte, um einen Misserfolg von vornherein zu rechtfertigen, machte es nicht besser.
Aber es war kein Misserfolg. Um ein Uhr nachts kratzten im Studentenwohnheim Fingernägel auf Holz. Paul Newman hatte einen Blumenstrauß in der Hand, der aussah wie auf dem Friedhof zusammengeklaubt, und wirkte erleichtert, als Helen die Blumen achtlos ins Waschbecken warf und eine weitere Flasche Wein entkorkte. Bei Sonnenaufgang gestand er schluchzend, eine Verlobte zu haben, erntete als Reaktion ein Schulterzucken, und sie sahen einander nicht wieder.
Im weißen Frotteebademantel schlich Helen über die Gänge des Studentenwohnheims, stieg mit hängendem Kopf zwei Treppen hoch und klopfte bei ihrer besten Freundin Michelle Vanderbilt. Oder vielleicht nicht ihrer besten, aber ihrer ältesten Freundin. Michelle und Helen kannten sich seit der Grundschule, und vom ersten Tag ihrer Freundschaft an bestand ein starkes und unveränderliches Machtgefälle zwischen den beiden Mädchen.
Eine der frühesten, entsetzlichsten und exemplarischsten Erinnerungen: die Sache mit dem Kanarienvogel. Vielleicht in der dritten Klasse, vielleicht sogar noch früher. Da saßen sie zwischen lauter Spielsachen auf dem Boden, als sie aus dem Nebenraum einen furchtbaren Schrei hörten. Michelles jüngerer Bruder. Sekunden später kam ein kleiner, gelber Federball über die Türschwelle zum Kinderzimmer gehüpft. Das Köpfchen hing schlaff pendelnd zur Seite. Michelle sprang panisch auf, der Federball schwirrte wie vom Windstoß getroffen zur Seite, kullerte in den Flur hinaus und näherte sich gefährlich der Treppe. Helen vertrat ihm den Weg. Der kleine Bruder rannte hysterisch hin und her. Mrs. Vanderbilt sank wie ohnmächtig auf einen Stuhl, streckte abwehrend beide Hände aus, und Michelle schrie Helen an: «Jetzt hilf ihm doch! Jetzt hilf ihm doch!»
Die achtjährige Helen, die keine Haustiere besaß und auch diesen Vogel noch nicht außerhalb des Käfigs gesehen hatte, hob ihn vorsichtig auf und hielt das Köpfchen mit einem Finger hoch. Es fiel hinunter. Sie schlug vor, das Tier ins Bett zu bringen oder seine Wirbelsäule mit Streichhölzern zu schienen. Niemand reagierte. Schließlich ging sie in das Vanderbilt’sche Wohnzimmer und schlug im Lexikon nach. Sie hangelte sich von Kanarienvogel über Notfall, Genickbruch und Fraktur bis zur Querschnittslähmung. Sie schlug Michelle vor, einen Arzt anzurufen oder eine Freundin, die ebenfalls einen Vogel hatte.
Am Ende schaffte Mrs. Vanderbilt es, einen Veterinär ans Telefon zu bekommen, der riet, das Tier von seinen Leiden zu erlösen. Die Dame des Hauses hielt den Telefonhörer weit von sich weg in die Luft, wiederholte laut die Worte des Arztes und sah sich hilfesuchend um. Doch kein Mitglied der Familie Vanderbilt war imstande, das Notwendige zu unternehmen, und so erbarmte sich schließlich Helen des Elends. Sie fegte den Vogel sacht in eine Plastiktüte, setzte beide Knie auf die Öffnung und schlug so lange mit einem Band der Encyclopædia Britannica auf das Dreidimensionale der Tüte, bis es zweidimensional war. Anschließend begruben sie das flache Ergebnis im Garten. Mrs. Vanderbilt stand weinend hinter der Gardine.
Es war mit Furcht gemischte Bewunderung, die Michelle an diesem Tag für ihre neue Freundin empfand, und dies blieb auch in den folgenden Jahren ihr beherrschendes Gefühl Helen gegenüber. Gelegentlich (und besonders während der Pubertät) kamen zu dieser Ehrfurcht noch eine Reihe anderer, sich abwechselnder Gefühle hinzu, Verständnislosigkeit, Schwärmerei, Wut, Eifersucht, vorsätzliche Kühle, fast Mitleid … und dann wieder noch größere Ehrfurcht und aufrichtige Liebe – sämtlich in ihrer Intensität gesteigert dadurch, dass das Objekt dieser widersprüchlichen Gefühle niemals auch nur den geringsten Unterschied zu bemerken schien.
Und so war der Tag nach der Filmvorführung ein ganz besonderer Tag für Michelle. Es war der erste und einzige Tag, an dem sie ihre Freundin schwach sah. Ein Häuflein Elend kam da im weißen Bademantel in ihr Zimmer geschlurft und verlangte nach Kräutertee und Zuwendung. Überwältigt von der Gelegenheit stieß Michelle das Messer in die Wunde und drehte es um: Das ginge doch jedem so, rief sie, jeder sei zunächst erschüttert, auch sie, Michelle, sei erschüttert gewesen, als sie neulich einmal zufällig ihre eigene Stimme auf Tonband gehört habe. Freilich kämen bei Helen noch die Bewegungen hinzu, und in Verbindung mit der Mimik sei das etwas, das man tatsächlich, wenn sie ehrlich sei … doch wenn man all die Jahre diesen Anblick … und es sei ja auch der Sinn von Freundschaft … letztlich gewöhne man sich. Und sie persönlich jetzt: wirklich kein Problem.
Michelle war in den Seminarräumen keine große Rhetorikerin, aber unter vier Augen und im herzlichen Gespräch konnte sie Textblöcke von beachtlichem Umfang in den Raum stellen. Auch wenn es in ihren Augen nur eine Lappalie war (Liebeskummer, Misserfolg oder eine Erkrankung der Hauskatze hätten sie mehr angestachelt), redete sie fast zwei Stunden ununterbrochen über das, was sie später die «Tonband-Sache» nannte.
Helen überhörte den gesamten Inhalt der Botschaft und nahm als Einziges deren Länge wahr. Man kann nicht zwei Stunden lang über etwas reden, sagte sie sich, das kein gravierendes Problem darstellt.
Einige Monate lang übte sie mit einem Diktaphon schnellere, klarere Aussprache, ohne Erfolg. Gleichzeitig suchte sie, um ihren Bewegungen das Gezierte und Schleppende auszutreiben, nach einer Sportart, die, wie sie annahm, allem zuwiderlief, was ihr Spaß machen oder ihrem Körper angemessen sein könnte, und kam auf Karate. Als eine von zwei Frauen schrieb sie sich für einen Kurs an der Uni ein und begriff nach vier Wochen, dass man vieles im Leben ändern kann, aber nicht gewisse physiologische Gegebenheiten. Helen wurde kräftiger und geschickter, doch an der Art ihrer Bewegungen änderte das nichts. Sie war Mae im Keiko-Gi, Mae beim Yoko-geri, Mae auf der Matte. Es war eine deprimierende Zeit.
Trotz der Vergeblichkeit ihrer Bemühungen gab sie das Karate nicht auf. Als der Kurs an der Uni eingestellt wurde, wechselte sie in eine professionelle Sportschule. Dort war sie die einzige Frau, und ihr fiel die unverminderte Aufmerksamkeit aller anderen Kursteilnehmer zu, fast ausnahmslos Polizisten aus einer nahen Akademie.
Als sie ihr Studium beendete, hatte sie zwei Abtreibungen hinter sich, besaß den Schwarzen Gürtel in zwei Kampfsportarten, hatte drei oder vier Polizisten zum Freund und keine Ahnung, was sie mit ihrem Leben anfangen sollte. Hervortretende Wangenknochen und erste Fältchen um Mund und Augen verliehen ihrem Gesicht eine gewisse Härte, die nicht das war, was sie sich einst als Kur gegen ihr Selbst verordnet hatte, aber auch nichts völlig Unpassendes. Sie schminkte sich.
«Hör auf deine innere Stimme», riet Michelle, aber im Gegensatz zu ihrer Freundin konnte Helen eine solche Stimme in ihrem Innern nirgends entdecken. Der bürgerlichen Existenz stand sie fremd gegenüber, und hätte sie die Art und Stärke ihrer Empfindungen mit denen anderer Menschen vergleichen können, wie es für die meisten Fünfundzwanzigjährigen kaum oder nur sehr eingeschränkt möglich ist, so hätte sie sich eingestehen müssen, dass sie gefühlskalt war. Situationen, in denen andere schwelgten, bedeuteten ihr so wenig wie impressionistische Postkarten, ein Wurf junger Katzen oder Grace Kellys Verlobung, und ein unaufmerksamer Beobachter hätte sie für insgesamt leidenschaftslos halten können. Aber ihre Tagträume waren erfüllt von sonderbaren Bildern. Der Feuerwehrmann, der zwei röchelnde Kinder aus dem brennenden Haus schleppt, das hinter ihm zusammenbricht … der Flieger, der, seinen Cowboyhut schwenkend, breitbeinig auf der Atombombe zu Tal reitet … der gekreuzigte Spartakus, von Jean Simmons beweint … please die, my love, die now … sie bevorzugte das heroische Sujet.
7. Lundgren
No Chinaman must figure in the story.
Ronald Knox, Ten Commandment List for Detective Novelists
Und jetzt hatte Lundgren ein Problem. Lundgren war tot. Als man ihn an rahmengenähten Schuhen aus einer Kloake im Osten Tindirmas zog, war nur am Schnitt seiner Kleidung noch zu erkennen, dass er Europäer gewesen war. Spielende Kinder hatten den Körper entdeckt, vier Männer ihn geborgen. Niemand wusste, wer der Tote war, niemand wusste, wie er in die Oase gekommen war oder was er dort gewollt hatte, niemand vermisste ihn.
Die erneute Gräueltat an einem Weißen, nur drei Wochen nach dem Massaker in der Kommune, versetzte die Wüstenbewohner in eine angenehme Aufregung. Mit spitzen Fingern und Holzstöcken durchstocherten sie die Taschen seines Anzugs, fanden nichts von Wert – fanden überhaupt nichts … und besiegelten das Schicksal seiner Identität, indem sie den Leichnam zurück in die Kloake beförderten.
Ein alter Tuareg, der an Flussblindheit litt und sich von Kindern an Besenstielen herumführen ließ, stellte sich einige Tage lang am Ort des Verbrechens auf und erzählte gegen ein geringes Bakschisch, eine Hand voll Pistazien oder ein Glas Schnaps die grauenvolle Geschichte. Er hatte topasblaue Augen, in denen keine Pupille mehr war, blinzelte über die Köpfe seiner Zuhörer hinweg und schwor, einen Tag vor Entdeckung der Leiche in der Wüste gewesen und durch ein unheimliches Geräusch am Himmel aufgeschreckt worden zu sein. Seine minderjährigen Begleiter hätten vor Angst mit den Zähnen geklappert und mit den Knien geschlottert, er jedoch, alter Kämpfer unter Moussa ag Amastan, habe mühelos den Überschallknall einer F-5 erkannt. Und richtig, sogleich hätten die Kinder ihm einen nadelfeinen Kondensstreifen im Blau beschrieben, aus dessen Mitte sich ein goldener Fallschirm geöffnet habe. Dieser Fallschirm und sein Schatten seien über der Flanke des Kaafaahi-Felsens wie sich paarende Adler aufeinander zu gekreist, wenig später sei ein Mann in teurem Anzug und auf allen vieren vom Berg hinunter in das Dickicht der Lehmhäuser gekrochen und verschwunden, den Fallschirm wie einen goldenen Pflug hinter sich her ziehend.
Besonders der Fallschirm erregte allgemeines Wohlgefallen unter den Zuhörern. Später erfand der Erzähler noch einen Sportwagen, einen Geheimdienst und vier Männer mit Eisenstangen hinzu, aber nach ein paar Tagen hatte jeder die Geschichten gehört, und es ließ sich kein Geld mehr damit verdienen. Man zerstreute sich wieder.
Die Wahrheit war: Es gab keinen Fallschirm. Es gab keine Eisenstangen. Die Wahrheit war: Niemand hatte etwas gesehen. In der ganzen Oase gab es nur eine einzige Person, die etwas wusste, und diese Person sagte nichts. Es war die Zimmerwirtin, bei der Lundgren am Tag seiner Ankunft Quartier genommen hatte, und sie sagte deshalb nichts, weil in dem winzigen Zimmer, das sie vermietete, nun ein herrenloses Gepäckstück voller wunderbarer Dinge stand.
Lundgrens Ankunft in der Oase war unspektakulär. Er war mit der Bahn nach Targat gekommen. Dort hatte er eine Dschellabah übergeworfen, sich einen lächerlichen Bart angeklebt und war mit dem Sammeltaxi und ohne ein Wort mit seinen Mitreisenden zu wechseln, in die Wüste gefahren. Einige Kilometer vor Tindirma hatte das Sammeltaxi eine Panne erlitten, und Lundgren, der glaubte, es eilig zu haben, war auf einen Eselskarren umgestiegen. Er gab dem Fahrer ein Bakschisch, damit der ihn durch eine bestimmte Gasse fuhr. Dann ließ er sich lange im Kreis herumkutschieren und stieg schließlich zwei Straßen von der besagten Gasse entfernt vor einer schäbigen Bar ab. Über der Bar gab es ein schäbiges Zimmerchen, das für gewöhnlich an schäbige Händler vermietet wurde. Jetzt stand es frei, wie ein Schild auf Arabisch und Französisch verkündete. Lundgren hatte eine Reservierung für das örtliche Zwei-Sterne-Hotel, aber er war kein Amateur. Er ließ sich das Zimmerchen zeigen.
Die etwa hundertjährige Wirtin führte ihn in den ersten Stock. Sie hatte ein Gesicht, das nur aus Falten bestand, mit zwei Löchern als Augen. Ihre Kiefer mahlten ununterbrochen, und aus dem jeweils tieferen Mundwinkel floss ein schwarzer Sud. Sie schloss eine niedrige Tür auf, dahinter eine Waschschüssel, eine Matratze, kein Strom. Kakerlaken flohen im Gänsemarsch an den Scheuerleisten entlang. Lundgren lächelte verbindlich – freundlich – und zahlte zwei Wochen im Voraus. Das Ungeziefer störte ihn nicht. Alte Sache: Wo es Araber gab, gab es auch Ungeziefer. Er wickelte eine Plastikfolie aus, die er mit Hilfe der Greisin über das Bett breitete, und bestrich die herabhängenden Ränder der Folie mit einer ockerbraunen, zähen Paste. Dann nebelte er das Zimmer mit einer Flitspritze ein und schloss die Tür. Was noch lebte, starb.