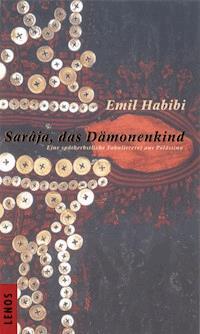
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lenos
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Arabische Welten
- Sprache: Deutsch
»Sarâja, das Dämonenkind« ist - nach »Der Peptimist« und »Das Tal der Dschinnen« - der dritte und letzte längere Prosatext des 1996 verstorbenen grossen palästinensischen Autors Emil Habibi. Der Titel geht zurück auf eine alte palästinensische Legende von einem Mädchen, das von einem Dämon entführt und auf ein Schloss hoch oben in den Bergen gebracht wird. Ihr Cousin und Geliebter kann Sarâja, die inzwischen zu einer jungen Frau herangereift ist, schliesslich retten, indem er an ihrem langen Zopf hochklettert und dem Dämon ein Schlafmittel in seinen Trunk mischt. Auf der Suche nach seiner verlorenen Jugendliebe Sarâja beschwört der Ich-Erzähler, dessen Beruf das Angeln und dessen liebstes Hobby die Literatur ist, seine Kindheit in Palästina herauf und geht den Leidensweg zurück an die Stätten seiner Jugend in Haifa, die grösstenteils von den Israelis zerstört wurden. Erst im Herbst seines Lebens, als er bereits ein alter Mann geworden ist, findet er Sarâja wieder. In seiner stark autobiographisch gefärbten Geschichte erweist sich der »Meister der Ironie und des Spotts« (Tahar Ben Jelloun) auch als Meister der Poesie.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 254
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Der Autor
Emil Habibi (1922–1996) hat sich sein Leben lang für die Verständigung zwischen Palästinensern und Israelis eingesetzt. Der ausgebildete Ingenieur trat 1940 der KP bei, deren Organ al-Ittihad er 1944 mitbegründete. Nach 1948 arbeitete er als Journalist, von 1951 bis 1959 und von 1961 bis 1972 war er Mitglied der Knesset.
Für sein literarisches Werk (Romane, Kurzgeschichten, ein Theaterstück) wurde Emil Habibi 1990 mit dem Al-Quds-Preis der PLO und 1992 – als erster Araber – mit dem Israel-Preis für Literatur ausgezeichnet.
Die Übersetzerinnen und der Übersetzer
Nuha Forst, geboren 1947 in Gasa (Palästina). Studium der Architektur in Kairo. Seit 1975 in Deutschland (Münster), Dozentin in der Erwachsenenbildung zu kulturellen und politischen Themen der arabischen Welt.
Angelika Rahmer, geboren 1962 in Altenhundem (Nordrhein-Westfalen). Studium der Islamwissenschaft, der Allgemeinen Sprachwissenschaft und der Politikwissenschaft in Münster. Seit 1995 beim Deutschen Industrie- und Handelstag Bonn in der Abteilung Auslandshandelskammern tätig.
Hartmut Fähndrich, geboren 1944 in Tübingen. Studierte Vergleichende Literaturwissenschaft und Islamwissenschaft in Deutschland und in den Vereinigten Staaten. Seit 1978 Lehrbeauftragter für Arabisch und Islamwissenschaft an der ETH Zürich. Für Presse und Rundfunk tätig.
Titel der arabischen Originalausgabe:
Sarâjâ bint al-ghûl
Copyright © 1991 by Emil Habibi
E-Book-Ausgabe 2015
Copyright © der deutschen Übersetzung
1998 by Lenos Verlag, Basel
Alle Rechte vorbehalten
Cover: Anne Hoffmann Graphic Design, Zürich
www.lenos.ch
ISBN 978 3 85787 937 1
Sarâja, du Dämonenkind,
lass mir dein Haar herab, geschwind!
Legende aus Palästina
Vorrede des Verfassers
„Ein Birnbaum wird gepflanzt, um uns mit Birnen zu nähren.“
Den Namen „Sarâja, das Dämonenkind“ habe ich einer alten, im ganzen arabischen Raum verbreiteten palästinensischen Legende entnommen. Sie handelt von einem kleinen Mädchen, das bei einem seiner täglichen, neugierbeflügelten Ausflüge vom Dämon entführt wird. Dieser nimmt es zu sich und lässt es in seinem Schloss hoch oben über den Gipfeln der Berge wohnen. Währenddessen zieht der Cousin des Mädchens aus, um in der Wildnis nach seiner Cousine zu suchen. Da sie für ihre langen Zöpfe bekannt ist, die nie mit einer Schere in Berührung gekommen waren, ruft er bei seiner Suche immer wieder: „Sarâja, du Dämonenkind, lass mir dein Haar herab, geschwind!“ Als sie ihn hört, lässt sie einen Zopf herab, den er ergreift und daran hochklettert. Daraufhin mischt sie heimlich ein Schlafmittel in den Trunk des Dämons, und während dieser in tiefen Schlaf versunken daliegt, schleicht sie mit ihrem Cousin davon und kehrt in ihr Dorf zurück.
Mein Held nun ist den ganzen Roman hindurch damit beschäftigt, nach einem Mädchen zu suchen, das er in seiner Jugend einmal geliebt hat, von dem ihn jedoch die Sorgen des Alltags abgelenkt haben. Erst als er ein alter Mann geworden war, erschien sie ihm wieder.
Doch wer ist diese Sarâja und wer dieser Dämon?
Wie bei meinen früheren Romanen erstellte ich auch diesmal, bevor ich mit dem Schreiben begann, keinen Plan für den Gang der Erzählung, sondern überliess mich einer von innen kommenden Weitschweifigkeit, die manchmal zu einem richtigen Schlendrian führte. Erst auf den letzten Seiten gelangte ich zur wahren Bedeutung dieser Sarâja. Da war ich dann verblüfft über die Wahrheit, die sich vor meinen Augen enthüllte, und genauso erging es einem bekannten Dichter, dem ich mein Manuskript zur Lektüre unterbreitete. Doch gestattete ich mir nicht, diese Wahrheit zu verbergen, obwohl sie im Widerspruch steht zu meiner selbstgewählten Lebensmaxime, der Überzeugung nämlich, es sei möglich, ja nützlich, zwei Wassermelonen mit einer Hand zu tragen, das heisst, sich gleichzeitig mit Politik und mit Literatur zu beschäftigen.
Weil ich ein „Gläubiger“ bin und sich ein solcher – wie man bei uns sagt – nicht zum zweiten Mal der gleichen Schlangenhöhle nähert, habe ich gar nicht erst erwogen, die Geschichte von „Sarâja, dem Dämonenkind“ der Gattung Roman zuzuordnen. Was aber ist sie dann? Ich nenne sie eine Churafîja und meine damit eine Art spätherbstliche Fabuliererei.
Wir Palästinenser – Spezialisten oder andere – verwenden das Wort Churafîja, um etwas Seltsames, Wunderliches zu benennen. Sollte dieses bereits erklärt sein, dient die Bezeichnung der Vermeidung zeitraubender Wiederholung; sollte es noch nicht erklärt sein, dient sie dem einleitungs-, sprich erklärungslosen Übergang zu freien Gedankenassoziationen.
Die dreifaltige Konsonantenwurzel des Wortes Churafîja, also ch–r–f, ist fest verwurzelt in der arabischen Sprache. Viele Bedeutungen lassen sich davon ableiten. So heisst charafa: Er erntete – zum Beispiel eine Frucht. Machrafa ist ein Garten, ein Ort, wo es Geerntetes gibt, und Machraf ist ein Gefäss, in das man Geerntetes legt. Mit Charûf wird ein männliches Lamm oder auch ein Fohlen bis zum Alter von einem Jahr bezeichnet. Ein Chârif wiederum ist jemand, der Palmen anbaut. Und Charîf ist die dreimonatige Periode zwischen Sommer und Winter, also der Herbst, weil die Früchte zu dieser Zeit geerntet werden. Charîf ist auch der erste Regen zu Beginn dieser Periode, und charafana heisst: Wir wurden von diesem Regen überrascht. Churâfa nun – ein arabischer Münchhausen – war ein Mann vom Stamme der Banu Udhra, den die Dschinnen verzaubert hatten. Als er davon erzählte, erklärte man ihn zum Lügner und sagte: Ach, das ist so ein Märchen von Churâfa, eine witzige und nette, aber erlogene Geschichte. Charifa hingegen heisst: Er ist senil geworden, hat aber auch die Bedeutung: Er isst leidenschaftlich gern Churfa, also Früchte. Achrafa heisst dann: Er lässt die Früchte verderben, aber auch: Es ist Zeit, die Palmen zu ernten. Das Mutterschaf gebiert im Charîf, also im Herbst. Und der Soundso akhrafa will heissen: Er geht auf den Herbst zu. Charrafa mit doppeltem r heisst: Er faselt Charaf, das ist schwachsinniges Zeug. Meiner Meinung nach steckt in all diesen unterschiedlichen Ableitungen ein einziger Sinn, nämlich der vom Ernten von Früchten. Das geschieht aber erst dann, wenn genügend Zeit zum Reifen war. Erntet man allerdings nicht rechtzeitig, „verherbstet der Baum“. Es ist schwierig, diese kritische Phase zu treffen, die zwischen Reife und „Verherbstung“ liegt. Vielleicht ist meine Churafîja, meine spätherbstliche Fabuliererei, ja in dieser kritischen Phase entstanden.
Unsere Sprache ist eine lebendige Sprache, trotz der vielen „Jahrhunderte des Verstummens“, die ihr und uns von oben aufgezwungen wurden, besonders durch fremde Arabisten, die uns glauben machen wollten, unsere einzige Stärke liege im Erzählen. In Wirklichkeit versuchten sie, uns das blosse Sprechen zu verbieten. Das wusste schon vor langer Zeit unser Dichter Abul-Tajjib al-Mutanabbi, als er feststellte:
Hast du weder Pferd noch Geld,
nichts Gutes sonst auf dieser Welt,
lass halt die Worte fliessen,
wenn kein Glück du kannst geniessen.
Doch die gesellschaftliche Wirklichkeit ist viel abgründiger. Können die Worte nicht fliessen, kann man auch kein Glück geniessen. Hätten nicht andere Völker die Meinungsfreiheit errungen – ganz obenan die Freiheit, eine Überzeugung in Frage stellen zu können –, dann hätte die Wissenschaft in unserem Zeitalter den „Komplex des Turmbaus zu Babel“ nie überwunden und sich nie bis an den Himmel gewagt. Sich an den „Wurzeln festzuklammern“ ist wahrhaftig keine angeborene Eigenschaft unserer Völker und unserer Sprache, sondern eine Eigenschaft, die uns und ihr von aussen aufgezwungen wurde, und zwar gerade von jenen, die daran interessiert sind, dass wir uns nicht nur in unseren Heimatländern, sondern vor allem auch in der „neuen Welt“ fremd fühlen.
Gerne möchte ich unsere Herzen beruhigen und die Herzen derjenigen beunruhigen, die uns, beruhigt für alle Zeiten, unfähig sehen, unsere Überzeugung zu bekunden, dass wir in Kultur und Sprache durchaus fähig sind, uns den Anforderungen der Zeit mit ihren neuen und bahnbrechenden Errungenschaften zu stellen. Ich bin weder Wissenschaftler noch Kritiker, aber von dem Moment an, da ich feststellen musste, dass man unmöglich zwei Wassermelonen mit einer Hand tragen kann, sah ich mich befähigt – obwohl schon im Herbst meines Lebens stehend –, alle Errungenschaften der „Wissenschaftsphilosophie“ nachzuholen, die mir, noch in den Illusionen der „Philosophiewissenschaft“ verhaftet, entgangen waren. Und ich bin nur „einer von ihnen“. Was ich kann, konnte und kann jeder Sohn und jede Tochter unserer Sprache. Und trotz meines begrenzten, sehr begrenzten Wissens über die moderne arabische – und das heisst auch die moderne palästinensische – Literatur sehe ich im Zusammenbruch des diesweltlichen Fundamentalismus etwas, das alle unserer Gesellschaft im Wege stehenden Fundamentalismen hinwegraffen und uns zu unserem einzigen Fundament zurückführen wird: Die Last der Verantwortung ist Sache jedes einzelnen, niemand darf sie aufs Ausland oder auf den Himmel abschieben.
Schon in alter Zeit gelangte unser Dichter und Denker Abul-Alâ al-Maarri zu folgender Erkenntnis:
Der beste Vorbeter, wie wohl bekannt,
ist klar der eigene Verstand;
von morgens früh bis abends spät
hast du ihn stets in deiner Hand.
Nicht zufällig werden Verstand und Gehirn in unserer Sprache auch Herz und Gefühl genannt. Darin drückt sich bereits die Aufgabe der „Herren der Sprache“ aus – der Literaten und Dichter, die ich in meiner spätherbstlichen Fabuliererei mit einem Birnbaum verglichen habe, von dem wir es doch auch nicht akzeptierten, wenn er statt Birnen Auberginen trüge und das damit rechtfertigte, er wolle die Armen mit dem „Fleisch der Armen“ speisen. Der Birnbaum wird schliesslich gepflanzt, um uns mit Birnen zu nähren!
Erster Teil
Papa!
Das da von Anfang war, das wir gehört haben, das wir gesehen haben mit unsern Augen, das wir beschaut haben und unsre Hände betastet haben, vom Wort des Lebens.
Der erste Brief des Johannes, 1,1
1
Es war im Sommer 1983. Das Echo des sechsten Krieges1 hallte noch ebenso in ihren Ohren wie die Seufzer in ihrer Brust – Seufzer der Sehnsucht nach einem Felsen an der Küste, vom Meer verschlungen, nach einer Quelle im Karmelgebirge, zum Versiegen gezwungen.
Von Krieg zu Krieg wurden ihr Gehör schärfer, ihre Ohren empfindlicher, bis sie schliesslich mit grosser Präzision die Kriege am Gefechtslärm zu unterscheiden vermochten. Lass sie Geschrei hören, Brummen, Dröhnen, Heulen, patriotische Gesänge oder Marschmusik – sie werden dir den dazugehörigen Krieg und das entsprechende Jahr nennen.
Manchmal ist der Gefechtslärm wie ein Raunen im Ohr, das die Zunge lähmt und sie hindert, es nachzuahmen, und das dem Verstand den Atem raubt, weil schon der Gedanke daran entsetzlich ist. Manchmal ist der Gefechtslärm wie das Rauschen eines einsamen Waldes in mondloser Nacht, wie das Geflüster von Gespenstern, die aufgescheucht darin umherhasten. Mitunter hört man den Gefechtslärm nur mit den Augen, nicht mit den Ohren.
Jetzt, erst jetzt stellte er fest, dass alle seine Romane seit 1948 Versuche waren, die rätselhaften Zauberformeln des Gefechtslärms zu entschlüsseln, von Krieg zu Krieg.
Ein Sprecher des Senders „Die Stimme Israels“ habe ihn als erster den Faden aufnehmen lassen, sagte er, und zwar, als dieser eines Tages ins Mikrofon donnerte, das Donnern der israelischen Kanonen und das Wimmern der arabischen Verwundeten klinge in seinen Ohren wie eine wundervolle Symphonie.2 Man erzählt, dass die Frequenzen der Delphin-Stimme so kurzwellig sind, dass nur die Ohren sprachloser Tiere sie empfangen können. Jene Wale, so er, deren vorwärts mahlende Kiefer über mehrere Sätze Zähne verfügen, schnappen und schlucken und machen dann Platz für den nächsten Satz bei einem „wundervollen Festschmaus mit Orchesterbegleitung“.
Jetzt, erst jetzt stelle ich fest, fuhr er fort, dass ich jedes seltsame Ereignis, das geschah, jede verdächtige Erscheinung, die ich sah – dort an der Küste des Dorfes Saib, dessen Wohnhäuser mitsamt seinen Bewohnern in die Luft gejagt wurden –, auf den Gefechtslärm des Libanonkriegs zurückführte, der sich dadurch auszeichnet, dass er gleichzeitig mit Augen und Ohren gehört und mit Ohren und Augen gesehen werden kann.
Saib ist ein palästinensisches Dorf an der Küste zwischen Akka und Kap Nakûra, etwa vierzehn Kilometer nördlich von Akka. Am Nordrand von Saib liegt die Mündung des Horntals, am Südrand die des Vagabundentals. Bär, Wolf und Kaninchen verkehrten in dieser Gegend und vermehrten sich reichlich. Der selige palästinensische Historiker Mustafa Murâd al-Dabbâgh, von dem wir diese Information haben, hat uns nicht über den Ursprung des Namens „Vagabundental“ aufgeklärt. Weil nun diese bergige Gegend mit ihren vielen Tälern und Niederungen immer wieder Schauplatz für jene Angriffswellen gewesen ist, die im Verlauf der bekannten Geschichte unser Land überfluteten und sich an diesen Niederungen und Tälern und deren Bewohnern brachen, denen die Angreifer nur das nackte Leben liessen, fände ich es durchaus einleuchtend, wenn die Einheimischen hier in den Augen der Herren Angreifer als „Vagabunden“ galten. Beleg dafür mögen die vielfältigen Bezeichnungen sein, die Ussâma Ibn Munkidh3, der Kreuzzug-Dichter und Ritter, für die Araber in dieser Gegend verwendete. Mal waren es „vermaledeite Teufel, die jeden töten, der ihnen allein in die Fänge geht“. Mal verfluchte er sie als „Verbrecher und Diebe“, als „Ismailiten“ und „Batiniten“, als „Bauern“, „Baumwollentkörner“ oder „Karmaten“. Hätte ich noch tiefer in seinen Büchern und Schriften geforscht, wäre ich sicher auf Stellen gestossen, wo er sie als „Vagabunden“ bezeichnete oder als „Leute, die immer der Nase nachgehen“.
Hätte er es nicht selbst getan, dann sicherlich seine Mutter, die zu allem fähig war und die nichts Tubares ungetan liess. Als er zum Beispiel nach einem Kampf mit Beduinen, die seine Burg Schaisar angegriffen hatten, zu seiner Familie zurückkehrte und seine Schwester „im vollen Ornat“ auf dem Rauschan sitzen sah, dem Balkon, der auf das Wadi hinausgeht, fragte er seine Mutter, was seine Schwester dort treibe. Mein Sohn, antwortete sie, ich setzte sie auf den Rauschan und mich daneben. Sobald ich die Batiniten kommen sehe, stosse ich sie hinunter ins Tal, denn lieber sehe ich sie tot als von Bauern und Baumwollentkörnern gefangen!
Die Menschen dort waren früher einmal berühmt für den Anbau von Oliven und Orangen – vor allem der Sorte Jûssuf Effendi –, während sich die Leute von Saib ihres Fischfangs rühmten. Noch früher als früher waren sie gar berühmt für die Herstellung von Purpur, den sie aus jenen Schnecken gewannen, die es überall an der Küste zwischen Sidon und dem Karmelgebirge gab. Die beste Sorte aber stammte aus dem Meer vor Saib, dessen Bewohner sie aus etwa fünfundzwanzig Klafter Tiefe nach oben holten.
Da die Gewinnung nur weniger Tropfen Purpur äusserst schwierig, das Reinigen und Filtrieren harte und mühsame Arbeit war, wurden exorbitante Preise dafür verlangt. Im ersten Jahrhundert nach Christus soll ein purpurgefärbtes Gewand umgerechnet zweitausend Dollar gekostet haben.
Es ist doch naheliegend, warf ich ein, dass dort früher einmal beduinische Landstreicher regelmässig die Meeresküste infiltrierten und tief ins Meer hinabtauchten, um Purpurschnecken vor allem an der Mündung dieses Wadis herauszuholen und sie unter der Hand zu verkaufen. Demnach könnten sie die „Vagabunden“ sein, nach denen das Wadi benannt ist.
Saib ist ein uraltes Dorf, das laut einer Überlieferung von den kanaanäischen Arabern errichtet wurde. Im Mittelalter diente es Reisenden, die von Akka nach Sûr (Tyros) unterwegs waren, als Zwischenstation. Auch Ibn Dschubair4, der andalusische Reisende, machte dort Halt.
Saib fiel den Israeliten in die Hände. Das war nur einen Monat, nachdem ihnen bereits am 18. Mai 1948 die Stadt Akka in die Hände gefallen war. Sie zerstörten das Dorf über seinen Bewohnern. Nur diejenigen, die zu jener Zeit gerade auf dem Feld waren und somit nicht unter den Trümmern begraben wurden, retteten sich nach Syrien.
Kein Haus war stehengeblieben ausser dem des Bürgermeisters – auf einem Hügel errichtet und mit Blick aufs Meer. Später führte es – warum, weiss nur Er, der das Unsichtbare kennt – einen „vagabundierten“ Vetter von uns, einen Mann persischer Abstammung, zu jenem Haus. Wer weiss, vielleicht war er ja von Stamme und Geblüt „judaisierter Ismailit“; jedenfalls wandelte er das Haus des Bürgermeisters in ein Museum um, für das er die Reste des arabischen Saib zusammenlas, vom Mühlstein bis zum Schädel. Als sie es in Beschlag nehmen und dem neugeschaffenen öffentlichen Park eingliedern wollten, umzäunte er das Gelände und erklärte es zum „Unabhängigen Freistaat Saib“. Besuchern stellte er fiktive, gebührenpflichtige Reisepässe aus, die er mit seiner Unterschrift versah. Er machte diesen „Staat“ zu einer Schlafstätte für vagabundierende, mittellose, mit Zelten beladene Jungen und Mädchen aus Europa, die auf dem Gelände campierten und als Gegenleistung gewisse Arbeiten zur Pflege des „Staatsgebietes“ sowie der darauf wachsenden ertragreichen Bäume verrichteten, zumal jener arabischen Feigenbäume, die sich geweigert hatten wegzugehen. Sie trugen honigsüsse Früchte der Sorten Ghasâli und Chartamâni, die gepflückt und, ganz gleich ob Würmer drin waren oder nicht, direkt in den Mund gesteckt wurden.
Stimmt, warf ich ein, die Würmer dieser mehr als honigsüssen Ghasâli- und Chartamâni-Feigen liefern uns ja auch die Redensart „Feigen mit Maden tun nicht schaden“. Weiss Gott!
Da nun jeder Vagabund des anderen Bruder und Stütze ist, da ausserdem die Hobbyangler sich damals wie Vagabunden kleideten und benahmen, verbrüderten sie sich mit diesem ihrem Vetter, der sie seinerseits an Bruders Statt annahm. An die Küste seines Königreiches setzten sie sich in mondlosen Nächten, von den Berufsanglern abgesondert. Häufig verbrachten sie die Nacht im Schutz seines Staates, und manchmal assen sie frischen Fisch zum Abendbrot und frischen Fisch zum Frühstück. Stets aber kehrten sie gesund und munter und mit Beute beladen zu den Ihren zurück, manchmal auch nur gesund und munter. In beiden Fällen jedoch verabschiedete der „Herr Präsident“ sie genauso, wie er sie empfangen hatte: mit der gleichen Freundlichkeit und Zuwendung, die er all seinen Museumsstücken entgegenbrachte; vom Mühlstein bis zum Schädel. Gleichen sie sich doch wie ein Ei dem anderen.
Bis dann jene schreckliche mondlose Spätsommernacht des Jahres 1983 kam, sagte er.
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!
Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!





























