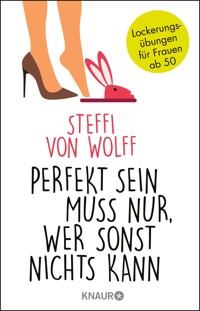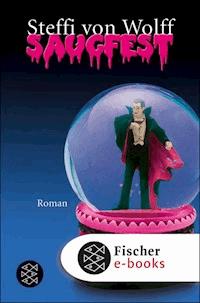
8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Jetzt hat sie auch noch Blut geleckt: der neue Roman der Comedy-Spezialistin Steffi von Wolff. Helene, 29, die schlechtestgelaunte Taxifahrerin von Hamburg, soll spät nachts an einem abgelegenen Ort Fahrgäste abholen. In einem düsteren Kellergeschoss torkeln leichenblasse Gestalten herum, und ein geheimnisvoller Mann mit einer Stimme wie Zedernholz erwartet sie. Helene ist fasziniert von ihm – aber wer sind diese Leute, die nie das Tageslicht sehen und sich einseitig ernähren? Systemadministratoren?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Steffi von Wolff
Saugfest
Roman
Roman
Fischer e-books
Für Fridtjof.
Nicht untot.
Zum Glück.
1
»Dreizehn Euro achtzig.«
»Kannich … kannich … äh, hicks … mit Karte zahlen?«
»Nein, können Sie nicht. Das hatte ich Ihnen aber vor Fahrtantritt bereits gesagt.« Meine Finger trommeln auf dem Lenkrad herum. Das dauert mir schon wieder viel zu lange.
Der ziemlich angetrunkene Gast brabbelt so etwas wie »Blöde Kuh« vor sich hin und lallt dann: »HamSienich.«
Doch. Habe ich. Ich sage es immer. Weil nämlich das Kartenlesegerät schon seit ungefähr einem Jahr nicht mehr funktioniert und ich auch überhaupt nicht einsehe, es reparieren zu lassen. Weil nämlich die Garantie schon abgelaufen ist und ich das selbst bezahlen müsste; und dazu habe ich keine Lust, keine Lust, keine Lust. Diese Herumstreiterei mit dem Kartenlesegeräthersteller würde mich zermürben, und ich bin zermürbt genug. Man würde mir des Weiteren vorwerfen, ich hätte doch sehen müssen, dass ich keine EC-Karte, sondern einen Mitgliedsausweis der Barmer Ersatzkasse durch den Schlitz gezogen und damit die komplette Elektrik zum Brachliegen gebracht hatte. Mich nerven solche Diskussionen, weil sie zu nichts führen, und zu nichts habe ich keine Zeit.
»Ich habe es vorher gesagt. Dreizehn Euro achtzig. Es wird nicht weniger, wenn Sie rummeckern.«
Der Fahrgast schnaubt und kramt umständlich in seinem Portemonnaie. Dann drückt er mir zwanzig Euro in die Hand, sagt »Mir ist schlecht« und kotzt mir im nächsten Augenblick in den Nacken. Er hat Sauerbraten gegessen. Und Knödel. Pfanni halb und halb. Das rieche ich sofort. Wenn man Taxi fährt, lernt man so was. Meine Laune ist jetzt noch beschissener als vorher. Auch, weil ich den Wagen jetzt erst mal grundreinigen kann und mir wegen des Ausfalls Geld durch die Lappen gehen wird.
Der Fahrgast öffnet die Tür und fällt aus dem Auto.
Ich lasse ihn liegen, verzichte darauf, ihm das Wechselgeld hinterherzuwerfen, und trete aufs Gaspedal. Was für ein idyllischer Dienstagabend! Es ist zwar warm, fast zu warm für den Juni, aber es regnet. Ein Scheißabend. Rosenkohl hat er auch noch gegessen. Wie eklig ist das denn? Rosenkohl bleibt ewig haften. Außerdem ist Rosenkohl meines Erachtens ein Wintergemüse, er muss es tiefgefroren gekauft haben.
Zwei Stunden später stinke ich immer noch nach dem halbverdauten Braten, obwohl ich Ewigkeiten unter der Dusche gestanden habe. Der Wannenboden sieht aus, als hätte ich Blätter verloren. Wegen des Rosenkohls. Das Telefon klingelt. Weil ich hoffe, dass es die Reinigungsfirma ist, gehe ich dran; ich gehe sonst nie ans Telefon. Weil ich Telefonieren hasse.
»Hallo.«
»Spreche ich mit Helene Messmer?«
»Hm.« Hm ist immer gut.
»Hier ist Nicole Wiedekopf, ich rufe von der Marktforschungsagentur Bauer und Sohn an. Frau Messmer, wie geht es Ihnen?« Ich sage nichts.
»Das ist aber schön. Frau Messmer, ich stelle Ihnen jetzt ein paar Fragen, die Sie bitte mit Zahlen beantworten. Das geht so: Sagen Sie eins, trifft die Frage sehr auf Sie zu, und das geht dann so weiter bis zur Zahl zehn, da trifft dann die Frage gar nicht auf Sie zu.
Haben Sie das verstanden?«
Meine Laune ist keine Laune mehr, sondern ein untragbarer Zustand.
»Haben Sie eine Waschmaschine?«, will Frau Wiedekopf fröhlich von mir wissen.
Wie soll ich diese Frage denn anders beantworten als entweder mit eins oder mit zehn? Sage ich zwei, trifft es dann ein bisschen auf mich zu, dass ich eine habe? Sage ich fünf, bin ich dann mit mir am Ringen, ob ich eine habe?
»Was soll der Quatsch?«, frage ich Frau Wiedekopf zurück, die daraufhin glockenhell auflacht und nun ihre absolvierten Rhetorikschulungen herausholt: »Das war lustig, was? Ich wollte Sie nur ein wenig auflockern. Sie scheinen mir eine sehr sympathische Frau zu sein.« Bestimmt möchte sie, dass ich jetzt sage: »Hahahahaha, Sie aber auch, Sie aber auch! Sie sind mir vielleicht eine, mich so aufs Glatteis zu führen.« Und dann könnten wir zusammen lachen, und ich könnte noch lockerer werden, ihr sogar die Marke meines Weichspülers verraten und mich mit ihr darüber austauschen, dass das mit dem Wäschewaschen früher ja viel komplizierter war als heute. Und Frau Wiedekopf würde sagen: »Ja, ja, wir können uns glücklich schätzen, dass wir in einer Zeit leben, in der wir die Laken nicht mehr auf der Bleiche trocknen müssen.« Vielleicht würde Frau Wiedekopf sogar noch ein Witzchen erzählen, und ich wiederum wäre irgendwann so locker, dass ich einfach so auseinanderfalle und in meinen Einzelteilen auf dem Boden liege.
Aber ich denke gar nicht daran. »Woher haben Sie überhaupt meine Nummer?«, frage ich böse. Das will Frau Wiedekopf mir allerdings nicht verraten, also muss ich davon ausgehen, dass es sich bei Bauer und Sohn um eine Firma handelt, die heimtückisch Adressen kauft, um dann ahnungslosen Mitbürgern mit Hilfe der Rufnummernunterdrückung den Abend zu verderben. Während Frau Wiedekopf mich weiter mit Fragen löchert, die ich ihr nicht beantworte, laufe ich in die Küche und nehme aus dem rechten Schrank einen Teller, den ich auf den Boden fallen lasse. Ich brauche jetzt einfach Scherben, über die ich mich ärgern kann. Und ich motze Frau Wiedekopf an, die irgendwann nur noch vor sich hinstammelt. Irgendwann sagt sie traurig: »Warum sind Sie denn so unfreundlich zu mir? Ich bin noch nicht so lange hier, wissen Sie, ich studiere nämlich, und meine Eltern können mich nicht unterstützen. Ich mache doch nur meinen Job.«
»Ach Gottchen.« Jetzt drückt sie auch noch auf die Tränendrüse. Hut ab. Hier haben schon mehrere Marktforschungsunternehmen angerufen, aber so geflennt hat noch keiner. Frau Wiedekopf klingt auch ehrlich gesagt gar nicht wie eine Frau, die dort arbeitet, sie klingt eher wie eine Nichtschwimmerin, die mitten im Atlantischen Ozean merkt, dass ein Schnorchel kein Schwimmflügel ist. Panisch und ein wenig orientierungslos. Will mich da vielleicht irgendjemand verarschen?
»Bestimmt hatten Sie auch eine total schwere Kindheit, sind in der Schule gehänselt worden, stimmt’s?« Ich warte die Antwort gar nicht ab, weil mich Frau Wiedekopf so dermaßen nervt. »Und beim Abschlussball wollte keiner mit Ihnen tanzen, weil sie so ein Mauerblümchen waren, richtig? Dabei wollten Sie doch nur glücklich sein und … «
Ich höre Frau Wiedekopf leise schluchzen, werde aber einen Teufel tun, mich jetzt weichklopfen zu lassen und wie ein Rind eine Skala von eins bis zehn runterzubeten, nur damit sie auf ihre Quote kommt. Ist es mein Problem, dass sie nebenbei jobben muss? Eher nicht. Außerdem glaube ich nach wie vor, dass die Alte gar nicht bei einem Marktforschungsunternehmen arbeitet, sondern mir da sonst wer einen witzigen Telefonstreich spielt.
»Warum sind Sie so gemein?«, fragt Frau Wiedekopf.
»Gegenfrage: Warum rede ich überhaupt noch mit Ihnen?«
»Glauben Sie nicht, es würde Ihnen vielleicht besser gehen, wenn Sie ein bisschen freundlicher wären? Jeder sollte doch seine Mitmenschen so behandeln, wie er selbst behandelt werden möchte.«
»Mir ist es scheißegal, wie ich behandelt werde, das dürfen Sie mir jetzt einfach mal glauben. Und wie es Ihnen geht, ist mir ebenfalls scheißegal. Auch ob Sie Ihr blödes Studium schaffen oder nicht. Ich hab auch nicht studiert.«
»Aber das ist doch nicht meine Schuld.«
»Das habe ich auch nicht behauptet. Und jetzt lege ich auf.«
»Nein!«, ruft Frau Wiedekopf verzweifelt, so als ob ich ihre allerletzte Rettung wäre. »Bitte nicht. Dann habe ich bestimmt gar kein Glück mehr.«
Das ist das erste Mal, dass mir jemand, wenn auch durch die Blume, sagt, dass ich so was wie Glück für ihn bedeute.
»Belästigen Sie andere Idioten mit Ihrem Scheiß«, sage ich abschließend, aber sie gibt noch nicht auf und stellt mir blöde Fragen zu meinem Frischwurstkonsum. Ob ich Hirnwurst eklig fände. Aber wirklich auszukennen in der Lebensmittelbranche scheint sie sich auch nicht. Sonst wüsste sie, dass Hirnwurst schon lange nicht mehr aus Hirn, sondern aus relativ magerem Schweine- und Kalbfleischbrät besteht. Und sie heißt auch nicht mehr Hirnwurst, sondern Gelbwurst. Selbst früher bestand sie nicht komplett aus Hirn, sondern nur zu 25 Prozent. So. Wen interessiert’s? Ich weiß so was, weil ich nachts oft nicht schlafen kann. Und da laufen im Fernsehen diese ganzen Dokumentationen. Es ist also nicht so, dass ich mich für Gelbwurst interessiere. Gelbwurst ist mir total egal. Ich interessiere mich für eigentlich gar nichts. Die Scherben werde ich auch nicht wegfegen. Immerhin könnte es sein, dass ich heute Nacht Durst bekomme, barfuß in die Küche gehe und mir schlaftrunken einen oder beide Füße an den Scherben aufschneide, was wiederum zur Folge haben könnte, dass ich verblute. Aber bei meinem Glück werde ich natürlich genau in die scherbenlosen Zwischenräume treten.
»Bitte … «, fleht Frau Wiedekopf und sagt dann noch irgendwas, das ich aber nicht mehr höre, weil ich einfach und ohne mich zu verabschieden auflege. Danach geht es mir besser.
Ja, gut erkannt: Ich bin ein schlechtgelaunter, missmutiger Mensch von 29 Jahren. Wenn ich es auf den Punkt bringen soll: Ich finde das Leben beschissen. Am liebsten wäre ich tot. Nicht, dass ich von Todessehnsucht geplagt bin, aber ich kann dem Leben als solches einfach nichts abgewinnen. Früher, ganz früher, war das, glaube ich, mal anders. Als ich mit meiner Freundin Annkathrin im Sandkasten gespielt habe. Wobei ich da auch immer schon nie gelacht habe. Lieber habe ich den anderen die Plastikschaufeln über den Kopf gehauen oder ihnen Sand in die Augen gedrückt. Wenn sie mich zu sehr genervt haben. Lediglich mit Annkathrin habe ich mich gut verstanden und nie gezofft. Vielleicht lag es daran, weil sie so ganz anders war als ich, und das Wichtigste: Sie hat mich so akzeptiert, wie ich eben nun mal bin. Das mit meiner schlechten Laune wurde mit den Jahren immer schlimmer. Ich habe einfach an nichts Freude. An Männern übrigens auch nicht, und das soll jetzt nicht heißen, dass ich auf Frauen stehe. Sieben Beziehungen habe ich hinter mich gebracht, die kurzen mitgerechnet. Und sieben Mal bin ich so was von aufs Maul gefallen, dass es gar nicht in Worte zu fassen ist. Details möchte ich nicht nennen, nur so viel: Männer sind für mich keine Männer mehr, sondern Abschaum. Widerlicher Mist. Von Mann zu Mann wurde meine miese Laune noch schlechter. Mittlerweile kann sie gar nicht mehr schlechter werden.
Leider sieht Annkathrin das mit den Männern anders. Sie wird nämlich heiraten. Und zwar übermorgen. Seit zwei Jahren ist sie jetzt mit Bernd zusammen, den sie Bernie nennt, was ich fast schon anmaßend finde. Der Mann ist sechsunddreißig, war mal Kampfschwimmer bei der Bundeswehr und hat Schultern, die so breit sind wie das Brandenburger Tor. Bernie. Bernie heißt für mich ein schmächtiger, ungelenker Hornbrillenträger mit Sprachproblemen, der im Archiv der Stadtverwaltung verstaubte Akten von Spinnweben befreit, oder ein schwuler Imker. Aber doch kein Kampfschwimmer. Gut, er ist ja nicht mehr Kampfschwimmer, sondern jetzt Mitinhaber einer Baufirma, aber dazu passt Bernie ja auch nicht (»Bernie, pass auf, der Rohbau kracht gleich zusammen!« »Bernie, hast du Zement nachbestellt? Wir müssen das Fundament gießen, bevor der erste Frost kommt.«). Wie Bernie das mit der Teilhaberschaft in der Firma gemacht hat, wird immer ein Rätsel für mich bleiben, denn Bernie ist dumm wie ein Übertopf. Ich kann mir schlecht vorstellen, dass Bernie die Buchhaltung versteht und weiß, was Soll und Haben bedeutet. Aber er hat ja Angestellte, die das für ihn richten, das hat Annkathrin mir mal erzählt. Bernie kann nur mit seinen Händen arbeiten, aber nicht mit seinem Kopf. Außerdem macht Bernie mich total aggressiv. Er kommt nämlich aus Saarbrücken und hat nie auch nur einen einzigen Versuch unternommen, sich diesen grauenhaften Dialekt abzugewöhnen. Es ist einfach fürchterlich: »Isch hann heid noch e Termin, un’s kinnd schbäder genn.« Oder: »Jetzt hammer lang genuch geschwätzt, jetzt gehts ans Esse, sunscht wird de Salad kalt.« Und Annkathrin macht, egal was Bernie für einen Stuss von sich gibt, grundsätzlich ganz verliebt: »Hihihi.« O GOTT!
Aber das Allerschlimmste: Ich bin auch noch Annkathrins Trauzeugin. Die beiden heiraten ganz pompös auf einer Burg im Hessischen, und das auch noch drei Tage lang. Daran, dass ich dann drei Tage lang keine Einnahmen habe, hat natürlich keiner gedacht.
»Ich finde das total romantisch, auf einer Burg zu heiraten«, hat Annkathrin nun schon ungefähr fünfhundertmal gesagt, ohne dass ich sie jemals darum gebeten hätte. »Außerdem müssen wir das tun, wegen Bernies Opa.« Bernies Opa mütterlicherseits kam 1952 aus der Gefangenschaft in Russland und hat Hessen seitdem nicht ein Mal mehr verlassen. Er hat seit nunmehr 58 Jahren Angst davor, dass der Russe wieder unangemeldet einmarschieren könnte. Und wenn das passiert, wird er, Walter, das nicht mehr einfach so hinnehmen, sondern etwas tun. Was er tun wird, das verrät er allerdings nicht. Es soll wohl eine Überraschung werden. Also kann ich übermorgen nach Hofgeismar gurken und dort die Sababurg suchen, wo angeblich schon Dornröschen gewohnt und sich überarbeitet mit der Nadel in den Finger gestochen hat, um dann ziemlich lange zu schlafen, bis irgendein dämlicher Prinz sie nach hundert Jahren geküsst hat und sie aufgewacht ist, wobei natürlich nicht ansatzweise Alterserscheinungen zu erkennen waren. So ein Schwachsinn. Ich hab mir auch schon mehrfach mit einer Nadel in den Finger gestochen, und zwar beim Knöpfeannähen, da kam aber kein Prinz, sondern lediglich einmal, wenigstens einmal, eine recht gefährliche Blutvergiftung, die ich leider ohne gesundheitliche Schäden überstanden habe, was an einem übereifrigen Arzt lag, der mir, ohne mich zu fragen, eine Spritze in den Arm jagte. Dabei achte ich ganz genau darauf, mich bloß nicht impfen zu lassen, aber irgendwie schaffen es diese Quacksalber doch immer, mir was Gutes zu tun.
Na ja, man sollte die Dinge positiv sehen: Möglicherweise kommt mir auf der Fahrt ein Geisterfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit entgegen, dem ich nicht mehr ausweichen kann. Oder ich nehme einen Anhalter mit, der gefährlich aussieht und so, als würde er vor nichts haltmachen, weil er Geld für den nächsten Schuss braucht oder einfach so gern Messer benutzt. Ich nehme grundsätzlich Anhalter mit, weil ich hoffe, dass sie Mörder sind oder zumindest welche werden könnten. Aber ich hatte noch nie Glück. Die Anhalter waren einfach nur froh, dass ich sie mitgenommen habe. Zu einem meinte ich sogar mal, dass ich im Kofferraum eine große Summe Bargeld hätte, die ich aber nur über meine Leiche hergeben würde. Daraufhin hat er mich leider nicht erschossen, sondern lediglich gesagt: »Bei meiner Bank würden Sie bei diesem hohen Betrag gute Zinsen bekommen. Ich bin da nämlich gerade in der Ausbildung. Soll ich Ihnen mal ein unverbindliches Angebot zukommen lassen?«
So ist das eben bei mir. Ich habe einfach kein Glück mit dem Tod. Irgendwie scheint er mich nicht zu mögen. Wenn ich bloß wüsste, wie ich das ändern könnte.
Seit wann ich meine schlechte Laune bewusst einsetze, weiß ich ganz genau: Da war ich acht Jahre alt und auf Klassenfahrt in Waldmichelbach im Odenwald. In der Jugendherberge dort gab es keine Einzelzimmer, was ich persönlich besser gefunden hätte, sondern Schlafsäle, in denen zehn Mädchen zusammengepfercht wie Vieh übernachten mussten. Und ach, was fanden sie das alle witzig. Und ach, war das alles aufregend, und die Jungs, und die Jungs, und die Nachtwanderung und huuuh und Gruseln, und was weiß ich. Das wäre ja alles nicht so schlimm gewesen, schlimm war das ständige Gekicher und Herumgegackere dieser Mädchen. Alles, wirklich alles war lustig: die Tür zum Klo abzuschließen und den Schlüssel zu verstecken, meine Hand in eine Schüssel mit lauwarmem Wasser zu halten, während ich schlief, was zur Folge hatte, dass ich ins Bett pinkelte, Zahnpasta unter die Türklinke zu schmieren oder mein Schlafanzugsoberteil hochzuziehen und mir mit Eddingstift eine Berglandschaft auf den Rücken zu malen.
Mädchen in diesem Alter sind die Hölle auf Erden. Sie sollten meiner Meinung nach vernichtet werden. Das Geschrei ist nicht zu ertragen. Deswegen weigere ich mich auch, diese Spezies in meinem Taxi zu transportieren. Weder alleine noch mit Familie. Schon manch ein Vater hat sich deswegen mit mir angelegt, aber da lasse ich mich auf absolut keine Diskussionen ein. Die Vorpubertät wird nicht in meinem Taxi stattfinden. Niemals. Jedenfalls habe ich damals in Waldmichelbach im Odenwald zum ersten Mal mit meiner schlechten Laune Ernst gemacht. Eines Abends habe ich mich mit bösem Gesicht vor meine Klassenkameradinnen gestellt und sie angebrüllt. Mit einer verzerrten Fratze. Ich habe ihnen gedroht, dass sie ihres Lebens nicht mehr froh würden, wenn sie nicht endlich damit aufhörten, diesen Scheiß zu machen. Ich schilderte ihnen anschaulich, wie ich sie in ungelöschten Kalk legen oder sie aus dem dreizehnten Stock eines Hochhauses stoßen würde, ich redete von glühenden Wattestäbchen, die ich ihnen in die Ohren pressen und von Bienenschwärmen, die ich auf sie loslassen würde, nachdem ich sie an einen Baum gebunden und mit Honig eingeschmiert hätte. Es hat funktioniert. Zwar war ich von diesem Augenblick an eine Außenseiterin, aber ich wurde in Ruhe gelassen. Das allerdings war schon relativ am Ende dieser unsäglichen Klassenfahrt. Davor hatte ich einiges zu erdulden. Unter anderem von dem widerlichen Herbergssohn, der mit meinen Haaren furchtbaren Schindluder getrieben hat, aber daran möchte ich jetzt lieber nicht denken.
Eines habe ich festgestellt im Laufe der Jahre: Wer schlechte Laune hat, wird ernster genommen als diejenigen, die immer mit einem Strahlen im Gesicht durchs Leben gehen, die, denen es nichts ausmacht, von Jugendlichen in der U-Bahn ausgeraubt zu werden, die, die es als Schicksal hinnehmen, wenn sich Leute an der Kasse vordrängeln. Schlägt man solche Drängler oder schnauzt sie zumindest kräftig an, zucken sie zusammen oder krümmen sich vor Schmerz, und man hat seine Ruhe. Ich mache das immer so. Gut, manchmal erwischt es 88-jährige Frauen, die halbblind sind und einfach nicht wissen, ob ich vor ihnen dran bin oder nicht, und die fahren dann ganz schön zusammen, wenn ich »Schon mal das Wort Warteschlange gehört?« brülle, aber das kann ich leider auch nicht ändern. Alte Leute erleben sowieso nicht mehr allzu viel, sie sollten dankbar sein, wenn sie mal von jemandem angesprochen werden.
Mit schlechter Laune bekomme ich immer einen Parkplatz, weil andere Suchende denken, ich könnte ihr Auto zu Schrott fahren, wenn sie mit mir diskutieren, ich muss beim Arzt nie länger als zwei Minuten warten, weil ich mit meiner Aura die Atmosphäre im Wartezimmer vergifte, verheulte Kinder schenken mir zitternd die Süßigkeiten, die sie sich eben noch am Quengelwarenständer von ihren entnervten Müttern ertrotzt haben, und Obdachlose drücken mir die zu verkaufende Zeitung in die Hand, ohne auch nur ansatzweise zu jammern oder einen Euro zu fordern. Man kommt gut durchs Leben mit einer missgelaunten Grundhaltung und dem entsprechenden Gesichtsausdruck.
Ich bin seit jeher der Meinung, dass bei anderen Leuten weder die inneren Werte zählen noch das Aussehen. Ich halte das für halbseidenen Mumpitz. Mein Aussehen ist mir auch total egal. Ich bin eins zweiundsiebzig groß, meine Haare sind dunkelbraun oder braun, was weiß ich, eine Frisur interessiert mich nicht, deswegen hängen sie einfach so runter. Von teurer Kosmetik halte ich genauso wenig wie von schicken Klamotten. Ich trage grundsätzlich Jeans und Pullover und irgendwelche Schuhe, die gerade so herumstehen. Manche Leute finden mich interessant, weil ich hellblaue Augen habe, aber auch das ist mir egal, weil ich sowieso immer denke, dass die das nur sagen, weil sie irgendeine Gefälligkeit von mir erwarten, aber diese Hoffnung werde ich niemandem erfüllen.
Mir ist nicht wirklich viel wichtig. Aber was mir wichtig ist: Man soll etwas sagen, wenn man etwas zu sagen hat, und ansonsten die Klappe halten. Lange Gespräche finde ich genauso überflüssig wie kurze Gespräche. Ich unterhalte mich manchmal in Grunzlauten, weil das alles und nichts bedeuten kann. Ich gebe zu, dass ich nicht viele Freunde habe. Eigentlich habe ich gar keine Freunde, sondern nur eine Freundin, nämlich Annkathrin. Sie weiß mich einfach zu nehmen, und sie war damals auf der Klassenfahrt die Einzige, die noch zu mir gehalten hat. Annkathrin hat nur einen Fehler, sie redet wie ein Wasserfall und meint immer: »Ich muss ja für uns beide sprechen.« Aber sonst ist sie okay, ehrlich, auch wenn ich es nie verstehen werde, warum sie Bernie heiraten wird.
Genug davon. Ich muss packen.
Während ich in meinem Schlafzimmer stehe und alle, wirklich alle Klamotten aus dem Schrank ziehe, die ich besitze, werde ich schon wieder sauer. Diese Hochzeit geht mir auf die Nerven. Ich könnte den Organisten und den Pfarrer mit seinem gütigen Blick jetzt schon um die Ecke bringen. Wenn der Pfaffe mich anfasst, kriegt er was auf die Zwölf, auch wenn er mir nur gütig den Arm streichelt oder mir eine Oblate geben will.
Schon wieder Telefon.
Annkathrin. »Helene, es ist was ganz Schreckliches passiert!«
»Mmpff.« Bestimmt ist ihr ein Fingernagel abgebrochen, oder sie hat festgestellt, dass das Hochzeitskleid, in dem sie aussieht wie ein Baiser, doch Scheiße ist, womit sie recht hat. Annkathrin trägt natürlich reine Seide mit Schleppe und Schleier, und selbstverständlich wird sie auch noch Blumen in ihre Locken flechten, was mit Sicherheit einen Niesreiz bei mir auslösen wird, weil ich nämlich den Geruch von Blumen genauso wenig ertragen kann wie den Geruch von Parfüm.
»Ich habe plötzlich solche Angst!«, schreit Annkathrin. »Vielleicht ist das alles zu schnell gegangen, und ich sollte noch warten. Ich überlege, die Hochzeit zu verschieben! Jetzt sag doch auch mal was!«
Nicht der Pfarrer, sondern Annkathrin kriegt was auf die Zwölf. Seit Monaten geht es nur um diese verdammte Hochzeit, ich hab nachts schon Albträume davon gehabt, und jetzt will sie alles verschieben, und in ein paar Wochen geht der ganze Quatsch von vorne los. Nicht mit mir.
»Was soll das heißen?« Allein die Tatsache, dass ich diesen Satz ausspreche, zeugt von meinem wirklichen Interesse.
»Das heißt, dass es bestimmt besser ist, alles abzublasen!« Nun fängt sie auch noch an zu weinen, eine Unart, die ich ausdrücklich missbillige. Nur Memmen weinen. Und Annkathrin, die nun hysterisch wird: »Mutti findet das natürlich unmöglich. Wegen der Leute! Mutti ist außer sich. Bestimmt sind alle anderen auch außer sich, aber das ist mir auch egal. Ach, ich weiß nicht, was ich tun soll!« Und dann sagt sie: »Kannst du herkommen? Bitte!«
»Jetzt?«
»Natürlich jetzt!«, heult Annkathrin und schnäuzt sich lautstark.
»Mutti ist auch da. Ich brauche dich jetzt wirklich, Helene!«
Das ist ja super, dass Mutti auch da ist. Mutti mag ich ungefähr so gern wie eine herausgefallene Plombe oder eine Zwangsehe mit einem Iraker, um es mal dezent auszudrücken. Mutti heißt Isolde und war schon immer eine absolute Nervensäge. Sie hat Annkathrin immer gezwungen, auch im Sommer Strumpfhosen zu tragen und dicke Pullover, was zur Folge hatte, dass Annkathrin ständig krank war. Und Isolde machte sich immer Sorgen um »den Umgang, den meine Tochter hat«. Niemand war gut genug für sie, auch ich natürlich nicht. Unter anderem hat sie behauptet, ich sei eine Diebin und hätte ihren Schmuck, so komische, hässliche Ringe und Colliers und Broschen, die sie von ihrer Tante geerbt hat, kaltblütig aus ihrer Nachttischschublade geklaut, was ja auch stimmt, aber ich habe damit der Menschheit eine Freude gemacht, weil es eine Zumutung fürs Auge war, diesen Schmuck anzuschauen. Bernstein, noch Fragen? Um es kurz zu machen: Isolde mag mich nicht, und ich mag Isolde nicht. Um es noch kürzer zu machen: Wir finden uns gegenseitig zum Kotzen. Ihren Mann hat sie auch nicht mehr. Der hat sich mit einem Arbeitskollegen aus dem Staub gemacht, um fortan monogam zu leben, und das im Himalayagebirge. Ich glaube nicht, dass er seine Entscheidung bereut hat. Isolde hat die Trennung ganz gut verkraftet, jetzt konnte sie noch mehr um Annkathrin herumglucken.
Also gut, ich werde jetzt zu Annkathrin fahren, weil ich es nicht ertragen kann, wenn es ihr nicht gutgeht. Sie ist der einzige Mensch auf dieser Welt, den ich mag. Außerdem bin ich neugierig. Schlecht gelaunt und neugierig. Das passt gut zusammen, wie ich finde. Und wie andere das finden, geht mir am Hintern vorbei. Und was Mutti findet, erst recht. Manchmal wünsche ich ihr einen Unfall. Keinen wirklich schlimmen natürlich, na ja, um ehrlich zu sein, doch. Ich wünsche fast allen Leuten schlimme Unfälle.
Nachdem ich mein Rad aus dem Keller geholt habe und losgeradelt bin, fängt es an zu regnen, was meine Laune noch schlechter werden lässt. Wann hatten wir eigentlich den letzten richtig harten Winter, bei dem die Straßen zufroren und man mit dem Fahrrad ausrutschen, hinfliegen und sich tödlich verletzen konnte? Das wäre doch mal was. Für mich, meine ich jetzt natürlich, nicht für Mutti.
2
»Ich werde meinen Verlobungsring jetzt essen«, schluchzt Annkathrin, »und hoffentlich beim Runterschlucken daran ersticken. Ich habe es verdient.«
Wir sitzen zu dritt zusammen, also sie, Mutti Isolde und ich.
»Wisst ihr eigentlich, was die Torte gekostet hat?«, ist das Einzige, was die hysterische Isolde immer wieder sagt. »Die Torte hat ein Vermögen gekostet.«
»Bestell sie doch ab«, schlage ich vor. »Von dem Geld kannst du dir vielleicht eine günstige Grabstätte kaufen.«
Isolde war noch nie die Hellste, deswegen wundert es mich kein bisschen, dass sie als Antwort nur ein »Weißt du, was Grabstätten kosten?« in die Runde wirft.
»Bernie ist Bauunternehmer«, greint Annkathrin weiter, »ich hätte wissen müssen, dass ich Zweifel bekomme.«
»Das hätte dir genauso gut mit einem Arzt passieren können«, sage ich und würge einen der trockenen Kekse hinunter, die wahrscheinlich noch aus den letzten Kriegstagen stammen und die Isolde immer und überall auf den Tisch stellt, egal, wo sie hinkommt.
»Ein Arzt würde mich niemals zu solchen Gedanken verleiten«, lautet die Antwort. »Aber ein Mensch vom Bau ist roh und ungehobelt, weil er den ganzen Tag mit Beton und Stahlträgern und anderen toten Elementen zu tun hat«, bekomme ich weiter erklärt. »Nur ein Bauarbeiter ist fähig, mich so zu verunsichern.« Sie beginnt zu schielen, wie immer, wenn sie sich aufregt. Das ist der einzige Makel an ihr. Ansonsten ist sie eine wunderhübsche Frau; Menschen mit dem Hang zu gewählten Worten würden sie als »elfenhaft und zartgliedrig« bezeichnen. Ich natürlich nicht, obwohl diese beiden Attribute passen. Annkathrin weckt in jedem Mann Beschützerinstinkte; sogar der unverschämte Kioskbesitzer, bei dem wir immer unsere Zeitungen kaufen, ist nett zu ihr und sorgt sich um ihr Wohlergehen, während er mir immer nur alles hinpfeffert, ohne ein Wort zu sagen. Aber zu Annkathrin wird natürlich so was wie »Na, so spät noch unterwegs, junge Frau? Dass Ihnen in der Dunkelheit bloß nichts passiert! Das würde ich nicht überleben! Soll ich Sie nach Hause bringen?« gesagt.
»Wäre Bernie doch nur Torwart oder Kanzler geworden, dann würde ich jetzt hier nicht sitzen und weinen, sondern mich auf die Hochzeit freuen. Oder ein Arzt eben, der würde mich jetzt in den Arm nehmen und mir ein Barbiturat verabreichen, damit die schlimmen Gedanken verschwinden.«
»Ich hab’s doch immer gesagt, den Doktor Weick, den hättest du heiraten sollen. Da hättest du ausgesorgt gehabt. Wie nett der immer zu unserer ganzen Familie war. Weißt du noch, als du Keuchhusten und Masern hattest? Oder die Windpocken? Und ich meine Gürtelrose im Schritt? Wie das immer genässt hat … « »Mutti!«
»Ist doch wahr. Keine zwei Meter konnte ich gehen, ohne vor Schmerzen zu schreien. Der Doktor Weick hat damals gesagt, das sei wie ein Biotop, eine Gürtelrose in dem Bereich. Weil da kaum Luft drankommt zwischen den Beinen. Am besten sollte ich nackt gehen, hat er gesagt. So ein Filou!«
»Mutti, hör auf!«
»Wenn er’s doch gesagt hat. Ein charmanter Mann. Weltoffen, mit Klasse.«
»Ist das nicht der Arzt, der wegen Exhibitionismus vorbestraft ist?« Ich muss diese Frage einfach stellen.
Die Antwort darauf unterstreicht Isoldes Dummheit aufs Neue: »Das hat er doch nur gemacht, weil die Frauen das wollten. Sonst würde der Herr Doktor Weick sich doch niemals vor einer Frau ausziehen.«
»In Hagenbecks Tierpark vor der Elefantenanlage?«
»Die Frauen wollten das.«
»Die Frauen kannten ihn gar nicht. Sie hatten Angst vor ihm.«
»Nein, die wollten das. Die waren nur so sprachlos, dass sie nichts gesagt, sondern nur geguckt haben.«
»Sie haben geschrien. Das hat sogar in der Zeitung gestanden.«
Ich spucke den Keks aus. Die feuchten Krümel fallen auf den Tisch. Das finde ich gut.
»In der Zeitung steht viel, wenn der Tag lang ist. Die brauchen doch immer Schlagzeilen und bauschen alles auf, bloß damit auch viele Leute diese Schundblätter kaufen. Wenn es nach mir ginge, sollten Zeitungen verboten werden. Außerdem wirst du dich nie ändern, Helene. Nie. Alles hinterfragst du, alles machst du schlecht. So bist du schon immer gewesen. Der Doktor Weick ist ein solider Mann.«
Isolde steht auf und holt von irgendwoher ein Stück Haushaltstuch. Während sie den Tisch säubert, beuge ich mich extra ein Stück nach vorn, damit sie es nicht zu einfach hat. Isolde hat nämlich Probleme mit der Bandscheibe, und vielleicht habe ich ja Glück, sie erwischt einen ungünstigen Bückwinkel, und ein Wirbel springt raus. Dann haben wir für eine Weile Ruhe vor ihr.
»Wie geht es denn dem Doktor Weick?«, frage ich in unschuldigem Ton.
Annkathrin pfeffert ihr Taschentuch aufs Sofa. »Er ist schon seit ungefähr zehn Jahren tot.«
»Das weißt du auch ganz genau«, keift Isolde mich an. »Du fragst das immer, wenn du mich siehst, weil du meine Seele verletzen willst.«
»Stimmt«, sage ich.
»Er ist an seinem gebrochenen Herzen gestorben«, erklärt Isolde zum tausendsten Mal. »Seine Frau hat ihn verlassen, einfach so.« Ja, einfach so. Doktor Weick hatte drei eigene und neun uneheliche Kinder, siebenundvierzig Geliebte, er war spielsüchtig, ein Säufer und, wie schon erwähnt, ein Exhibitionist. Außerdem ist er nicht an gebrochenem Herzen gestorben, sondern weil er in die Kanalisation fiel. Ein Teil der Hamburger Rothenbaumchaussee war aufgerissen und das Ganze natürlich mit Rotweißband abgesichert worden, aber mit ungefähr fünf Promille kann man das nicht mehr so richtig einschätzen. Und so verstarb Doktor Weick zwei Meter unter dem Asphalt in einer Sickergrube. Seiner Frau ging es danach wenigstens wieder gut. Wie es den Geliebten ging, weiß ich nicht. Ich nehme an, auch nicht so schlecht, denn sie hatten ja alle miteinander unterhaltspflichtige Kinder, und bestimmt wurde das Erbe entsprechend verteilt an die ganze Sippschaft. Ich konnte Doktor Weick nie leiden. Er war ein Schmierlappen und hat sich auch jenseits der sechzig noch das Resthaar eingegelt, was total lächerlich aussah.
»Wo ist Bernie eigentlich?«, will ich wissen.
»In einer Schwulenbar«, werde ich aufgeklärt.
»Wieso das denn?«
Annkathrin hebt ratlos beide Hände. »Er meinte, er könne momentan keine Frauen mehr sehen. Er sagte, wir würden ihm mental zu sehr zusetzen. Dabei wollten wir doch nur mit ihm die
Sachlage diskutieren.«
»Welche Sachlage denn?«
»Na, meine Zweifel. Bernie meinte, das würde ja kein normaler Mensch aushalten, wenn es seit dem frühen Morgen nur um das eine Thema geht. Außerdem ist Bernie sauer auf mich.«
»Ach was.« Ich schüttele den Kopf.
»Seine Verwandtschaft kommt doch extra aus Saarbrücken und Worms.«
»So weit ist das ja auch nicht in die Kasseler Gegend.« Herrje, Probleme hat die Menschheit. Eigentlich wäre ich ganz froh, wenn die Hochzeit ausfällt. Am Wochenende sind die Einnahmen höher.
»Aber die meisten fahren doch mit dem Fahrrad. Ich hab dir doch erzählt, wie gesundheitsbewusst sie sind. Sie ernähren sich alle makrobiotisch und werden zu wilden Tieren, wenn sie sich nicht ausreichend bewegen können.«
Ja, Annkathrin, du hast es mir erzählt. Mehrfach. Ich weiß auch, dass Bernies Mutter Menschen verachtet, die Alkohol nur anschauen, und ja, Annkathrin, du hast mir auch erzählt, dass sie kein Leitungswasser trinkt, weil die Rohre aus Blei sein könnten. Ich wusste allerdings nicht, dass die Verwandtschaft von Saarbrücken und Worms aus mit dem Rad nach Hofgeismar anreisen wollte. Das muss sie ja jetzt auch gar nicht mehr, weil Bernie hoffentlich für immer in dieser Schwulenbar bleibt und diese Hochzeit eh ins Wasser fällt.
»Also, wenn ihr mich fragt … «, fängt Isolde an, »wenn ihr mich fragt, sollten wir die Hochzeit auf jeden Fall durchziehen. Trennen kann man sich danach immer noch. Immerhin sprechen wir über einen Gesamtbetrag von ungefähr zwanzigtausend Euro.
Wirklich, allein die Torte, was die gekostet hat! Und ich bin mir sicher, die Hotelzimmer auf der Burg, die kann man auch nicht mehr kostenfrei stornieren. Alles andere auch nicht. Das Menü, das Menü, wie lange haben wir uns darüber den Kopf zerbrochen.
Du wolltest ja keinen Fisch, Kind, dabei gibt es da die leckere Reinhardswaldforelle. Jetzt gibt es Wild, nur Wild aus heimischen Wäldern, und Klöße, und eine rustikale Sahne-Kartoffel-Suppe, und dann gibt es ja auch noch … «
»Ist das makrobiotisch?«, frage ich scheinheilig und würde jetzt lächeln, wenn ich wüsste, wie das geht. »Habt ihr daran gedacht, für die Saarbrücker Verwandtschaft ein bisschen zerquetschtes Getreide aus biologischem Anbau zu bestellen? Und ein paar Äpfel von glücklichen Bäumen?«
Isolde und Annkathrin starren mich an. Ich bin mir sicher, dass daran nicht gedacht wurde. Jetzt haben sie noch ein Thema, über das sie sich stundenlang unterhalten können.
Ich für meinen Teil werde jetzt gehen und Bernie holen. Ich kenne Annkathrin nämlich schon sehr lange und sehr gut. Ich weiß, wie sie manchmal ist. Und ich weiß, dass sie ihn heiraten wird. Außerdem ist mir das jetzt alles zu viel Zirkus. Da verzichte ich lieber auf die Wochenendeinnahmen und ziehe diese beknackte Hochzeit durch.
Bernie hockt in einer rosafarbenen Kneipe auf einem rosafarbenen Drehstuhl an einem rosafarbenen Tresen und trinkt einen rosafarbenen Cocktail. Die Beleuchtung ist so eingestellt, dass selbst der Barkeeper rosa ist. Bernie auch und ich mit Sicherheit ebenfalls. Bernie passt so wenig hierher wie ein Geburtshelfer in die Gerichtsmedizin. Es ist fast schon lächerlich, wie er dasitzt und fast heult mit seinen wässrigen Augen und seinem tumben Blick. Mich würde mal interessieren, welchen IQ Bernie hat. Wahrscheinlich den einer Steckrübe.
»Isch liewe se doch«, sagt Bernie. »Isch hann ihr doch jeder Wunsch vunn de Aue abgeläs, unn isch werre’s aach weiderhin mache. Jo, awwer do kummt’s ums Eck unn saat, es wisst net, ob das alles sei Rischtischkät hat. Seit heit morje hann isch mit ihr unn ihrer Mudder do gehuckt unn rumgeschwafelt. Do wird mer doch wahnsinnisch.« Er sieht mich ratlos an. »Was solle mer jetz mache? Kannscht du mer das saan?«
Stell diesen Dialekt ab, Bernie. Das ist das Erste, was du machen solltest.
»Un isch wollt’s doch aach üwwerrasche mit emme rischtisch große Geschänk. Isch hann nämlisch schunn aangefang, e Fundament fier unser eischenes Haus ze gieße, das wollt isch mit meine eischene Hänn baue. In Saarbrigge.« Bekräftigend zeigt er mir seine großen, rissigen Hände mit den schmutzigen Fingernägeln.
Oh, Bernie, da wird sich Annkathrin aber freuen. Ein Haus in Saarbrücken!
Ich fasse es nicht. Dieser Mensch hat so viel Ahnung von meiner Freundin wie eine Kerze von der Elektrizität. Aber da Annkathrin der einzige Mensch auf dieser Welt ist, der mir etwas bedeutet, verzichte ich darauf, ihr diesen Mann madig zu machen. Ich sage auch nichts zu dem Haus. Ich bezahle sogar Bernies Rechnung und ziehe ihn dann aus der rosafarbenen Bar.
»Nitt ähner änzischer Mann hat misch aangeschproch«, beschwert sich Bernie. »Die hann bestimmt gemerkt, dass ich ganz durschenanner bin.«
Oder sie haben instinktiv gespürt, dass du nicht der Hellste bist, Bernie, und ein wenig Reststolz hatten sie auch noch, was einen One-Night-Stand mit dir betrifft.
»Ich bring dich jetzt nach Hause«, sage ich also nur und verfrachte Bernie in Isoldes Auto, das ich selbstverständlich ungefragt genommen habe. Ich fahre extra nur im ersten Gang, weil das den Motor vielleicht schneller verrecken lässt. Isolde hätte es verdient.
Die Hochzeit findet dann natürlich doch statt, so wie ich es prophezeit habe. Ich werde nie verstehen, warum Menschen um zwei Leute, die lediglich jeweils »Ja« sagen müssen, so ein Gewese machen. Am Donnerstag setze ich mich in mein mittlerweile gereinigtes Taxi und fahre Richtung Nordhessen. Dabei höre ich laut Musik von Van Halen, weil ich mich nicht von den Außengeräuschen hupender Autos oder nahender Notarztwagen ablenken lassen möchte. Ich gerate in einen Stau und benutze selbstverständlich als Einzige den Standstreifen, weil es da lustig zugehen kann, wenn man Rettungsfahrzeuge blockiert oder Autos streift, die korrekt auf der Fahrbahn geblieben sind. Meistens stehen die Wagen so eng hintereinander, dass niemand auf den Standstreifen ausscheren und mich verfolgen könnte. Ich stelle mir immer vor, wie die Leute fluchen und sich gegenseitig die Schuld geben, weil ich ja nicht mehr zur Rechenschaft gezogen werden kann. Das verursacht in mir eine Art Glücksgefühl, aber meistens nur sehr, sehr kurz, weil ich auch dagegen ankämpfe. Ich höre übrigens auch mit großer Freude Verkehrsnachrichten, und es kam in der Vergangenheit nicht nur einmal vor, dass ich kurzfristig von einer staufreien auf eine staugequälte Autobahn abgebogen bin, nur weil der Moderator sagte: »Auf der A noch was gibt es momentan fünfzehn Kilometer Stau. Achtung, das Stau-Ende befindet sich hinter einer Kurve.« Immerhin könnte ich diejenige sein, die in das Stau-Ende hineinrast. Man muss die Dinge doch nehmen, wie sie kommen. Aber ich habe immer Glück. Auch heute. Auf dem Standstreifen will kein Rettungsfahrzeug an mir vorbei, und es steht auch kein LKW quer, was zur Folge hat, dass ich am Spätnachmittag pünktlich auf der Sababurg eintreffe.
Schon die Zufahrt ist mit roten und weißen Blumen geschmückt, und Annkathrins Onkel, der Hans-Günther heißt, aber von allen nur Hansemann genannt wird, wie sie mir erzählt hat, steht in der Einfahrt mit einer Kelle in der Hand und weist die Autos ein, die eintreffen. Er trägt eine orangefarbene Jacke mit Leuchtstreifen drauf und sieht aus wie ein engagierter Hilfspolizist. Es stehen auch schon ein paar Fahrräder da, also nehme ich an, dass ein Teil der Verwandtschaft aus dem Saarland bereits eingetroffen ist. Wahrscheinlich sind die Ersten an Neujahr losgefahren, um einigermaßen pünktlich anzukommen. Ich steige aus und schaue mich um. Verdammte Scheiße, ist das schön hier. Das ist ja beinahe zu schön, um wahr zu sein. Diese Burg sieht in der Tat aus wie aus einem Märchen gehopst, alles blüht und wirkt total gepflegt. Ich passe hier nicht hin, stelle ich fest, während ich meine Koffer zur Rezeption schleppe. Ich fühle mich noch mehr fehl am Platz, nachdem die Empfangsdame mich freundlich angelächelt, mir meinen Zimmerschlüssel überreicht und mir einen angenehmen und schönen Aufenthalt gewünscht hat. Sie ist ein wenig irritiert, weil ich nicht »Danke« gesagt habe, aber ich kann nicht danke sagen. Danke klingt, als wolle man sich bedanken für etwas, und ich will mich für gar nichts bedanken. Ich hab ja auch nichts gefordert, ich bin ja zu dieser Hochzeit eingeladen und bin Trauzeugin, worum ich nicht gebeten habe, da sag ich doch nicht danke. Stattdessen gebe ich ein knurrendes Geräusch von mir und reiße dem Pagen, der mein Gepäck aufs Zimmer bringen will, die Koffer aus der Hand, weil ich mich sonst ja wieder bedanken beziehungsweise ihm ein Trinkgeld geben müsste, was für mich unter absolut gar keinen Umständen in Frage kommt. Geld bekommen die wenigsten Menschen von mir. Manchmal mein Vermieter, manchmal der Stromanbieter, aber schon mal gar nicht Leute, die sowieso schon bezahlt werden. Wieso sollte ich einem Pagen zwei Euro geben? Er hat doch sein Gehalt. Wie beabsichtigt reagiert er irritiert auf mein »Garrrrr!« und flüchtet, während ich alleine mit den beiden Koffern mein Zimmer suche.
Annkathrin hat darauf bestanden, dass ich eins der schönen Turmzimmer bekomme, obwohl ich darauf überhaupt keinen Wert lege. Ich kann auch auf dem Dachboden oder im Keller schlafen. Im Keller gibt es bestimmt Schimmelpilze, und das ist nicht gut für die Gesundheit. Ich hatte das vorgeschlagen, und kurzzeitig hat sich Hoffnung in mir breitgemacht, die aber von Annkathrin im Keim erstickt wurde. Das hab ich jetzt davon. Das Turmzimmer hat sogar ein Himmelbett. Leider gibt es keine Balken, an denen ich mich erhängen könnte. Romantisch, das Zimmer. Also genau das Richtige für mich.
Ich schmeiße meine Koffer in eine Ecke und lasse mich über die Rezeption mit Annkathrin verbinden. Sie wollte zum tausendsten Mal den Ablauf mit mir durchgehen. Aber Annkathrin ist natürlich bei der Maniküre. Weil ich sonst nichts zu tun habe, latsche ich ein bisschen in der Burg herum, dann gehe ich nach draußen und latsche da herum. Das Wetter ist schön, drei Tage Hochzeit stehen mir bevor, meine beste Freundin heiratet, und jeder normale Mensch würde sich auf ein tolles Wochenende freuen. Aber meine Laune wird immer mieser. Sonne, Hochzeit, zum Kübeln. Ich verlasse das Burggelände und laufe ein wenig vor der Burg herum.
Und dann bekomme ich zum ersten Mal in meinem Leben einen Riesenschreck. Vor mir, wie aus dem Nichts, taucht plötzlich ein Tier auf. Ein Hirsch oder so etwas ist es nicht, denn das Tier hat kein Geweih. Keine zwei Meter liegen zwischen uns. Das Tier steht einfach nur da und schaut mich mit schräggestelltem Kopf aus seinen gelben Augen an. Ich halte die Luft an. Es kommt näher, und irgendwie habe ich mit einem Mal ein sehr merkwürdiges Gefühl.
Weil das nämlich ein Wolf ist.
3
Da ich Sport wie jedes andere Fach in der Schule auch gehasst habe, befürchte ich, nicht schnell genug rennen zu können. Und wenn ich nicht schnell genug renne, dann könnte der Wolf mich einholen und mit seinen scharfen Zähnen zerfleischen. Halt, Moment! Ich hab ja gar nichts dagegen zu sterben. Aber so? Vor der Hochzeit meiner besten Freundin, und dann frisst mich ein Wolf? Soll ich als Skelett vor dem Traualtar stehen und mit klappernden Knochen die Ringe suchen? Nein, diese Hochzeit muss ich noch hinter mich bringen, dann werde ich die Gesamtsituation neu überdenken. Der Wolf fletscht die Zähne. Er sieht so aus, als würde er sich damit auf eine Verfolgungsjagd vorbereiten, aber vielleicht habe ich Glück und bin schneller. Er ist nämlich nicht so durchtrainiert, wie ich das von Wölfen eigentlich dachte, sondern eher moppelig. Trotzdem kann ich mich darauf nicht verlassen. Ich drehe mich um und rase los. Zurückzuschauen traue ich mich nicht, weil ich Angst davor habe, dass der Wolf mich verfolgt. Aber dann drehe ich mich natürlich doch um. Und bleibe stehen. Der Wolf ist weg. Von ihm ist nichts mehr zu sehen. Alles ist leer und still. Hab ich mir das nur eingebildet? Herrje, ich bilde mir nie etwas ein. Der Wolf war da! Warum ist er jetzt weg? Wölfe sind doch Raubtiere, ich wäre doch im wahrsten Sinne des Wortes ein gefundenes Fressen für ihn gewesen. Das komische Gefühl, das ich hatte, ist auch verschwunden. Ich bin wieder ganz die Alte und gehe zur Burg zurück. Nur meine Hände sind noch schweißnass. Na ja, nur ein bisschen. Ich beschließe, niemandem von dieser merkwürdigen Begegnung zu erzählen.
Abends sitzen wir auf der Restaurantterrasse und schieben uns Essen in den Mund; Mutti nennt es natürlich »dinieren«. Dass die Leute, die aus den einfachsten Verhältnissen stammen, immer so tun müssen, als seien sie was Besseres. Mutti hat ihr Leben lang an einer Drogeriekasse gehockt und ein weiteres Leben lang für die aufwändige Hochzeit ihrer Tochter gespart, was ja in Ordnung ist, aber dann soll sie sich trotzdem bitte nicht so aufführen, als sei sie eine Gräfin, bloß weil sie einmal