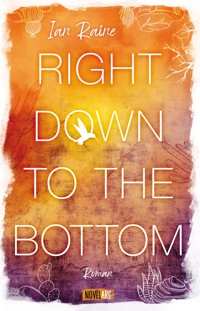5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Novel Arc Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ian Raine entführt die Lesenden in »Save my Drowning Dreams« in ein kleines, romantisches Dorf an der französischen Küste und verzaubert mit einer prickelnden und gleichzeitig tiefschichtigen Love Story. Der Workaholic Adair soll sich nach einer Nahtoderfahrung in der Normandie erholen, während die träumerische Amélie Paris nach ihrem Film-Studium verlässt, um ihren Vater zu beerdigen. Zwei gegensätzliche Charaktere, die sich in einem kleinen französischen Küstenort unvermutet begegnen. Und ausgerechnet die Rettung eines hoffnungslos veralteten Kinos treibt sie aufeinander zu. Denn Amélie ist fest entschlossen, das kleine Kino am Leben zu erhalten. Adair will dagegen sein Trauma so schnell wie möglich verarbeiten, als wäre es nur ein weiterer Tagesordnungspunkt zum abhaken. Doch das Schicksal hat für beide einen anderen Plan. Mit explosiven Folgen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Ian Raine
Save My Drowning Dreams
Ian Raine
Save My Drowning Dreams
Instagram: @ian.raine_autor
Tiktok: @ian.raine_autor
Content Notes:
Todesfall, Trauer, Ertrinken, schwere Krankheit (Krebs, erwähnt), Nahtod erfahrung, Burnout, einvernehmliche sexuelle Handlungen (ausgeschrieben), queerfeindliche Gewalt (erwähnt), Feuer.
1. Auflage 2025
Copyright © Novel Arc Verlag, Fridolfing 2025
Novel Arc Verlag, Kirchenstraße 10, 83413 Fridolfing
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk darf im Ganzen, wie auch in Teilen, nur mit Genehmigung des Verlags wiedergegeben, vervielfältigt, übersetzt, öffentlich zugänglich gemacht oder auf andere Weise in gedruckter oder elektronischer Form verbreitet werden.
www.novelarc.de
www.novelarcshop.de
Umschlaggestaltung: Guter Punkt GmbH & Co. KG
Envato Elements Bildnachweis: kit8
Lektorat: Ellen Rennen | Texpertin
Korrektorat: Tino Falke
Klappenbroschur: 978-3-910238-63-3
E-Book Ausgabe: 978-3-910238-69-5
Playlist
BLUE – Billie Eilish
Voilà – Barbara Pravi
La Vie En Rose – Lady Gaga
Time Warp – Richard O’Brien
La Foule – Édith Piaf
bad idea right? – Olivia Rodrigo
How Bad Do U Want Me – Lady Gaga
Red Wine Supernova – Chappell Roan
L’AMOUR DE MA VIE – Billie Eilish
You’re Losing Me (From The Vault) – Taylor Swift
Sailor Song – Gigi Perez
My Boy Only Breaks His Favorite Toys – Taylor Swift
My Heart Will Go On – Céline Dion
I Love You, I’m Sorry – Gracie Abrams
Break My Heart Again – FINNEAS
False God – Taylor Swift
Outrunning Karma – Alec Benjamin
Homesick – Noah Kahan
DAUGHTER – Beyoncé
How Did It End? – Taylor Swift
Weil Rennen nicht immer schneller zum Ziel führt,
Fallen nicht immer das Ende bedeutet und nach vorne
der einzige Weg in die Zukunft ist.
Und weil du wichtig bist.
Vergiss das nicht.
Vorwort
Liebe Lesende,
um allen das bestmögliche Leseerlebnis bieten zu können, informiere ich euch in diesem Vorwort über Inhalte des Buches, die möglicherweise triggern. Es ergeben sich Spoiler für die Handlung.
Folgende Themen werden in diesem Roman behandelt: Todesfall, Trauer, Ertrinken, schwere Krankheit (Krebs, erwähnt), Nahtoderfahrung, Burn-out, einvernehmliche sexuelle Handlungen (ausgeschrieben), queerfeindliche Gewalt (erwähnt), Feuer.
Bitte gebt beim Lesen auf euch acht und meldet euch bei Novel Arc unter [email protected], wenn ihr Inhalte im Text entdeckt, die in der Auflistung fehlen.
Viel Spaß mit »Save My Drowning Dreams« wünscht
Ian Raine
Vorher – Adair
Ich falle. Jetzt ist alles vorbei.
Tiefer und tiefer, während die Welt zu nachtblau-bunten Schlieren verwischt und sich in meinem Kopf alles doppelt so schnell überschlägt wie ich mich selbst. Ich weiß nicht, wo unten oder oben ist – es gibt nur flüchtige Farben und Formen, die mir entgleiten und entgleiten und entgleiten, je öfter ich versuche, nach ihnen zu greifen.
Ich höre eine laute Stimme, Schreie. Erst nach unendlichen Sekunden realisiere ich, dass es sich um meine eigene handelt. Ich schreie. Als würde mein Leben viel zu früh enden. Was es vermutlich auch tut.
Adair Dumont wird in wenigen Sekunden sterben. Kein Zweifel.
Mein Magen zieht sich zusammen, meine Brust pocht eine Handbreit oder zwei über meinem Herzen, da, wo ich auf die Steinbrüstung geprallt bin. Mir bleibt nur noch, auf den Aufprall zu warten. Darauf, dass es vorbei ist.
Doch der Aufprall bleibt aus, stattdessen dehnt sich der Sturz ins Unendliche.
Es ist pure Tortur, dem Tod sehenden Auges entgegenstürzen zu müssen.
Zu wissen, was ich alles nun nie tun werde … Ich denke an die Firma, an all unsere großen Pläne und daran, dass ich noch mehr hätte tun müssen, mehr schaffen. Wir hätten so viel erreichen können, ich hätte so viel erreichen können. Ich wünschte, ich könnte Maman und Papa einen letzten Kuss geben, ein letztes Mal sagen, wie sehr ich sie liebe, dafür, dass sie mir mein Leben ermöglicht haben, und meine Träume.
Der volle Mond leuchtet mich silbern an. Ihm ist mein Schicksal egal.
Dann zieht mich die Seine in ihre betonharte Umarmung, eiskalt, und setzt meinen Körper und meine Lunge in Flammen. Der Mond verschwindet hinter schlammigen Wellen, Wasser, das sich in meine Lippen drängt, meine Nase, meine Lunge, und meine Gedanken entgleiten mir und entgleiten mir und entgleiten mir.
Ich entgleite mir.
Es ist vorbei.
Kapitel 1 – Adair
»Adair? Hörst du überhaupt zu?« Elliot schnippt mehrmals vor meinem Gesicht und ich schrecke auf. Die kleinen, bunten Fische auf seinen türkis lackierten Fingernägeln lachen mich an. Oder aus. Genau kann ich das nicht sagen.
Meine Wangen sind kribblig warm von der Scham, die mir tief aus meiner Magengrube bis ins Gesicht steigt. Ich brauche einen Moment, um zu realisieren, wo ich bin.
Frühsommerliches Sonnenlicht fällt in den schlichten Büroraum und V Change Reality hält wie jeden Mittwochvormittag seinen großen Jour fixe, an dem wir die vergangene Woche besprechen und uns detaillierter über unsere Fortschritte austauschen, als wir es bei unseren täglichen Meetings tun.
»Ja, natürlich«, beeile ich mich zu sagen. Meine Stimme fühlt sich rau an, unbenutzt. Oder über-benutzt. Vielleicht eher das. In der Mitte unseres Besprechungstisches steht die geschwungene Glaskaraffe mit dem gesprungenen Rand. Ich schenke mir ein Glas Wasser ein und versuche, das Zittern meiner Hand so gut es geht zu verbergen. Dennoch schwappt eine der Zitronenscheiben aus der Kanne in das Glas und feine Tropfen verteilen sich kühl auf meinem Handrücken und auf der hölzernen Tischoberfläche. Ich wische das Wasser behelfsmäßig mit meinem Ärmel weg und bin mir der Blicke von Elliot und Xenia genau bewusst. Erst als der Tisch trocken ist, sehe ich mit möglichst beiläufiger Miene auf. Bloß nicht anmerken lassen, dass etwas anders wäre. Alles ganz normal. Genauso normal wie die letzten Wochen und Monate – ich habe alles unter Kontrolle.
»Sicher?«, fragt Xenia trocken und pustet sich eine Strähne ihres pinken Haares aus dem Gesicht.
»Du hast eben geschnarcht«, fügt Elliot hinzu. »Ich habe es genau gehört!«
Sie beäugen mich beide so konzentriert, dass ich ihre Examination physisch spüren kann – wie ein feines Prickeln auf meiner Haut.
Sogar Blaze, Xenias Labradoodle, inoffizieller Breakdown-Präventions-Beauftragter und offizielles Maskottchen unseres Start-ups – auf Drei-Leckerli-pro-Stunde-Basis – trottet zu mir und stupst mit seiner kalten Schnauze an meinen Oberschenkel. Dabei sieht er mich unter seinem weißen, lockigen Fell, das dringend einen Hundefriseurbesuch nötig hat, eindringlich an. Als würde sogar Blaze mit seinen schwarzen Knopfaugen fragen, ob alles in Ordnung ist. Ich kraule ihm das Fell hinter den Ohren und kratze ihn dann an seiner Lieblingsstelle am Nacken, wo das purpurfarbene Geschirr anliegt.
»Habe ich wirklich geschlafen, Monsieur Snuff?«, murmle ich. Den Spitznamen habe ich ihm gegeben, als er noch ein kleiner Puppy war und Xenia das erste Mal in den Hörsaal begleitet hat. Damals, während der Analysis-I-Vorlesung, in der wir uns kennengelernt haben. Um ehrlich zu sein, war Blaze der Hauptgrund, wieso ich mich zu ihr gesetzt habe – natürlich würde ich ihr niemals verraten, dass ich mit ihrem Hund zuerst befreundet sein wollte.
Ich kitzle Blaze unter dem Kinn und seine Schwanzwedelfrequenz nimmt deutlich zu. Die Sorge scheint einer so puren Freude zu weichen, wie nur Hunde sie verspüren können.
Mit einem Räuspern wende ich mich wieder meinen Freund*innen zu und versuche mich an einem ungezwungenen Lächeln.
»Pardon – lange Nacht«, erkläre ich.
Das ist eine maßlose Untertreibung – genau genommen kann ich mich an keine Nacht in den letzten Wochen erinnern, in der ich mehr als vier oder fünf Stunden geschlafen habe. Nie jedoch am Stück, immer durchbrochen von kalten Träumen von endlosen Stürzen, von Gedanken, die mir entgleiten und entgleiten – von meinem Leben, das mir entgleitet. Manchmal schlafe ich auch gar keine Stunde. In der wachen Zeit arbeite ich – genug Arbeit gibt es immer.
»Von denen scheint es in letzter Zeit ja so einige zu geben«, merkt Elliot an. Er ist unser Chief Technical Officer sowie Mitgründer von V Change Reality - und mein bester Freund. Dabei spielt er mit einer seiner dicht geflochtenen Braids, die mit bunten Perlen durchsetzt sind und wunderbar zu seinem farbenfrohen Auftreten passen.
»Elliot hat recht.« Xenia tauscht mit ihm einen verstohlenen Seitenblick. »Seit Monaten werden deine Augenringe immer dunkler, du bist müde, gestresst und ständig schlecht …«
»Können wir bitte weitermachen?« Genervt schneide ich ihr das Wort ab. Mein Tonfall ist unbeabsichtigt scharf und fast möchte ich eine Entschuldigung hinterherwerfen, doch mein Stolz lässt das nicht zu.
Xenias Schultern sacken nach unten, als sie seufzt. »… und ständig schlecht gelaunt. Das wollte ich sagen.«
»Wie läuft es mit der Rekrutierung der Testkandidat*innen?«, frage ich und bemühe mich um einen versöhnlicheren Tonfall.
»Darüber hatten wir eben gesprochen, während deines spontanen … Schönheitsschlafs«, erklärt Elliot.
»Könnt ihr es noch einmal wiederholen?« Ich nehme einen großen Schluck Wasser, setze mich aufrechter hin und versuche, die lähmende Müdigkeit fortzuschieben. »Bitte?«, füge ich hinzu.
Elliot und Xenia tauschen einen letzten, besorgten Blick, dann setzen sie mit einem Seufzen das Meeting fort und ich klammere mich an jedes ihrer Worte, wie an einen rettenden Anker.
Nach dem Jour fixe verläuft der Arbeitstag wie jeder andere auch. Ich programmiere, teste, verbessere. Schreibe E-Mails, führe Telefonate mit Geschäftspartner*innen, potenziellen Investor*innen und Kund*innen. Wälze die Zahlen, um wie immer zu dem gleichen frustrierenden Ergebnis zu kommen: Unsere bisherigen Finanzierungen, Stipendien und Eigeninvestments reichen nur noch drei Monate. Soll V Change Reality überleben, brauchen wir weitere Förderungen. Und wollen wir nicht nur überleben, sondern wachsen, dann müssen wir es in die Station Future schaffen – den größten Start-up-Hub der Welt, der sich nur wenige Kilometer von hier, auf der anderen Seite der Seine im 13. Arrondissement befindet.
Unsere aktuellen Büroflächen in Le Sentier, die wir uns mit zwei weiteren Start-ups teilen, reichen räumlich zwar vollkommen aus, allerdings sind sie auch Teil eines Förderprogrammes, das Ende des Jahres auslaufen wird.
Und davon, uns Mietraum in Paris ohne Förderungen leisten zu können, sind wir noch weit entfernt.
Die Station Future ist nicht nur wegen der Arbeitsspaces der größte Traum eines jeden Start-ups: Die größten Big-Tech-Unternehmen der Welt finanzieren Zukunftsprogramme, wie sie dort genannt werden. Nicht nur das: Dort treffen sich auch die Besten der Branche, um vom Wissensaustausch zwischen Aufsteigenden und lang Etablierten zu lernen und zu profitieren.
Elliot, Xenia und ich haben die Station Future bereits mehrmals besucht. Die innovative Energie steckt in jeder Pore dieses Ortes. Noch nie haben wir so viele intelligente Menschen an einem Fleck getroffen, die allesamt neue, kreative Wege in eine bessere Zukunft suchen, wie dort in den lichtdurchfluteten Räumen des riesigen Hubs. Noch nie wollten wir drei so sehr Teil von etwas sein.
Ich lege den Bleistift zur Seite, auf dem ich abwesend rumgekaut habe, und betrachte das große Plakat, das unsere riesige Magnetwand dominiert, gut sichtbar von allen Arbeitsplätzen aus.
»Unser Weg zu Station Future« steht darauf in großen Lettern geschrieben. Xenia hat dafür extra ihre Handlettering-Skills ausgepackt, die sie sich in einer ihrer unzähligen, ADHS-induzierten Hobby-Phasen beigebracht hatte. Darunter ist unser Plan, wie wir V Change Reality optimieren wollen, um die notwendigen Gremien bei Station Future zu überzeugen. Dafür haben wir unseren Status quo analysiert, die Optimierungspotenziale ausgelotet und unsere VR-Lösungen in der Anti-Diskriminierungsarbeit auf technischer und inhaltlicher Ebene genauestens untersucht.
Unsere Arbeit ist hochwertig. Nicht perfekt, aber vielversprechend – und welches Start-up liefert schon Perfektion?
Trotzdem wird mir jedes Mal unwohl, wenn ich das Plakat mit dem Logo der Station Future in der Mitte betrachte. Mein Herz schlägt dann schneller, mein Magen dreht sich zu einem Knoten und mein Kopf … mein Kopf quillt über vor lauter Ängsten. Dass wir versagen werden. Dass uns die Fördergelder ausgehen und die Träume, die Elliot und ich in einem schäbigen Wohnheimzimmer im Schein einer nackten Glühbirne gesponnen haben, endgültig in Schall und Rauch zerfallen würden, auch wenn wir bereits viel erreicht haben. Träume, für die Xenia eine sichere Karriere bei einem absoluten VR-Giganten ausgeschlagen hat. Denn was ist, wenn wir am Ende des Tages einfach nicht gut genug sind? Zu wenig geleistet haben? Zu wenig gekämpft haben? Was, wenn es da draußen jemanden gibt, der besser ist, verbissener, ehrgeiziger, obwohl bereits jede Sekunde meines Alltags, jede Faser meiner Existenz auf den Erfolg des Start-ups ausgerichtet ist?
»Adair?« Elliots honigwarmes Timbre gibt mir einen willkommenen Ausstieg aus dem Strudel meiner Ängste, der sich seit Monaten in meinem Kopf dreht. »Xenia und ich sind fertig für heute. Wann machst du Feierabend?«
Ich habe gar nicht gemerkt, wie Elliot seinen Arbeitsplatz mir gegenüber verlassen hat – und das, obwohl er dank seiner Größe und des neongrünen Blazers, den er heute trägt, wirklich nicht zu übersehen ist. Nun steht er im Türrahmen, die Augenbraue skeptisch hochgezogen. Mein Blick zuckt in die untere Ecke meines Bildschirms – bereits achtzehn Uhr. Die Zeit ist mal wieder gerannt. Elliot und Xenia gehen meistens um halb sechs, für sie ist es heute also sogar spät. Ich nicht. Ich … bleibe, meistens. Arbeite weiter, einfach immer weiter. Um nicht denken zu müssen, nicht zu fallen. Um mir vorzumachen, dass es mir gut geht. Beschäftigt zu bleiben.
»Äh …«, beginne ich. Ich weiß genau, was er hören will. Er will, dass ich überrascht den PC herunterfahre, ebenfalls den Tag für beendet erkläre und Feierabend mache. Natürlich habe ich Xenias und Elliots Kommentare und Sticheleien oft genug gehört, ihre sorgenvollen Blicke gespürt. Sie denken, ich würde mich überarbeiten, zu viel tun. Aber wieso verstehen sie nicht, dass die Arbeit mir alles bedeutet? Dass ich mich an ihr festhalte, um nicht einfach davonzutreiben? »Ich mache gleich Schluss für heute«, murmle ich.
»Wirklich?« Elliot schiebt seine violette Brille ein wenig höher auf der breiten Nase. »Du warst heute schon wieder vor uns allen im Büro, mittags hast du dein Essen hinuntergeschlungen und währenddessen Tabellen durchgeguckt. Dir ist bewusst, dass du dir Pausen nehmen musst? Niemand kann vierundzwanzig Stunden am Tag an die Arbeit denken.«
»Ich weiß, ich weiß …«, lenke ich ab. »Es ist bloß …«
»… viel zu tun, ich weiß. Wir sind ein unterbesetztes, unterfinanziertes Tech-Start-up – es ist immer viel zu tun. Aber deswegen müssen wir nicht jede Selbstachtung hinter uns lassen und wie Ameisen auf Drogen unser Leben nur noch mit Arbeit füllen. Besonders deswegen brauchen wir noch Luft zum Atmen, Zeit, den Kopf freizubekommen. Nur dann kommen die besten Ideen. Es heißt work hard, play hard. Nicht work hard, work harder.«
Ich antworte nicht. Öffne nur die nächste E-Mail, überfliege sie, setze zur Antwort an. Elliots Seufzen wird fast vom Klappern meiner Finger auf der Tastatur übertönt – nur fast.
»Xenia besorgt uns gerade einen Tisch im La Bonne Note. Wenn du Lust auf einen Drink hast, komm gerne vorbei … wann immer du hier fertig bist.« Ich höre Schritte auf dem Parkett, dann spüre ich den warmen Druck einer beringten Hand auf meiner Schulter. »Du weißt, dass wir dir immer einen Platz frei halten.«
Wieder antworte ich nicht, auch wenn meine tippenden Finger einen Moment ins Stocken geraten. Ein Teil von mir möchte aufstehen, möchte mit Elliot gehen, mal wieder einen schönen Abend mit Freunden verbringen. Das La Bonne Note ist eine charmante Jazzbar, nur einige Straßen entfernt. Aber ich kann nicht – nicht, wenn es Arbeit zu erledigen gibt, nicht, wenn so viel in der Schwebe ist. Und ich benötige Sicherheit. Gewissheit.
Elliot wartet, ich rieche sein florales Parfüm. Wartet auf eine Antwort, auf ein Zeichen. Doch ich schreibe einfach weiter. Was genau genommen auch einer Antwort entspricht. Schließlich entfernen sich seine Schritte und stoppen nur für eine kurz angebundene Verabschiedung, dann schließt sich die Tür hinter ihm mit einem lauten Klacken. Eigentlich ist es ein Tag wie jeder andere und trotzdem habe ich das Gefühl, dass ich etwas verloren habe. Dass etwas fehlt, auch wenn ich nicht benennen kann, was genau.
Ich dränge diesen Schatten einer Vorahnung zur Seite, schenke mir Kaffee nach und arbeite weiter.
Ich weiß nicht genau, wieso ich doch um neun Uhr abends vor dem La Bonne Note stehe. Die Julisonne schickt ihre letzten Strahlen durch die enge Seitengasse und verfängt sich in dem wilden Wein, der die Fassade des Gebäudes überwuchert. Lautes Gelächter klingt durch die offen stehende, antik wirkende Holztür, hinter der im Schatten abgenutzte Stufen ins Souterrain führen. Darunter mischen sich die Klänge des alten Flügels, des Herzstücks des La Bonne Note.
Hier hatten Elliot und ich das erste richtige Date unserer sehr kurzen romantischen Beziehung. Kennengelernt haben wir uns in einer gemeinsamen Informatikvorlesung auf Grindr. Dem folgten ein Hook-up auf der Unitoilette, nervös, hormongesteuert und kurz, sowie längere in Elliots damaligem Wohnheimzimmer. Da wir uns sofort gut verstanden haben, und das nicht nur auf körperlicher Ebene, hat mich Elliot eines Tages auf ein Glas Wein im La Bonne Note eingeladen. Unsere Beziehung war zwar schneller Geschichte, als man »Zweites Date« sagen kann, unsere Freundschaft hat sich jedoch als etwas noch viel Wertvolleres, Wichtigeres erwiesen. Immerhin hat sie uns V Change Reality gebracht, und viele schöne Erinnerungen.
Und vielleicht stehe ich jetzt deshalb vor dem La Bonne Note, den Lenker meines Fahrrads fest umklammert, während mein Magen Salti schlägt. Weil ich weiß, dass ich sie vernachlässige, sie beide. Nicht mehr so für sie da bin wie früher. Und auch wenn Xenia und Elliot vermutlich schon längst gegangen sind, habe ich trotzdem das Bedürfnis nachzusehen. Wenigstens zu versuchen, ihr Angebot anzunehmen. Wieder mehr für sie da zu sein, obwohl alles in mir mich zurück an den Schreibtisch zwingen möchte.
Ich schließe das Rad an einem Laternenpfosten ab und betrete die Steinstufen, lasse die Sommerabendsonne für den Abstieg ins Zwielicht zurück.
Der Geruch von Schweiß und Wein empfängt mich, gepaart mit dem von altem Zirbenholz, der dem La Bonne Note innewohnt. Mit den Düften wachen die Schatten meiner Erinnerungen auf und tanzen durch meinen Geist – unzählige, ungezwungene Abende, mit Freunden, Fremden und Fremden, die zu Freunden wurden. Alle auf diesen alten Holzdielen, eingehüllt von den Klängen des wunderbaren Flügels und der Musik, die in jeder Ecke des La Bonne Note lebt.
Auf den ersten Blick scheint jeder Platz an den dicht aneinander gerückten Tischen besetzt zu sein. Die niedrig hängenden Lampen sind abgedunkelt, nur die unzähligen Kerzen und Teelichter spenden ihr flackerndes, weiches Licht. Auf der kleinen, runden Bühne in der Mitte des Raums steht der altvertraute Flügel, dessen Außenseiten mit handgeschriebenen Gedichten, Songtexten und Gedanken übersät sind. Ein Mann, etwa Anfang zwanzig, mit im Scheinwerferlicht beinahe leuchtend weißer Haut und rabenschwarzem Haar spielt an dem Flügel, begleitet von einem ähnlich jungen Mann an der Trompete. Sie improvisieren, mal gleichzeitig, dann im Wechsel. Sie werfen sich Melodien und Harmonien zu wie Bälle, die der jeweils andere fängt und weiterspielt. Ich bewundere, wie vertieft sie in ihre Instrumente und ihre Musik sind. Es hat etwas eigenartig Intimes, dieser Performance zuzusehen. Obwohl sie offensichtlich für das Publikum spielen, fühlt es sich an, als würden sie eine ganz private Konversation führen, deren Inhalte nicht für fremde Ohren bestimmt sind. Und irgendwie macht genau das die Musik einfach noch besser.
Als die beiden nach einem kompliziert klingenden Run auf dem Klavier enden, nutze ich die Unterbrechung für den Applaus, um mich zur Bar vorzukämpfen, die sich hinter der Bühne befindet. Im Vorbeigehen scanne ich die Tische nach meinen Freund*innen. Kurz glaube ich, Xenias pinkes Haar in einer Ecke aufblitzen zu sehen, doch bemerke schnell meinen Irrtum, als die Frau mir das Gesicht zuwendet.
»Was darf’s sein?«, fragt der Barkeeper, als ich endlich an der Reihe bin. Ich überlege, ob ich einen Gin Tonic trinken soll, doch schwenke dann auf ein Wasser um. Ich habe nicht vor, lange zu bleiben. Vor allem, da Xenia und Elliot nicht mehr hier zu sein scheinen. Da ich später noch mal an den Laptop will, muss mein Kopf klar bleiben. Fokussiert und unverschleiert.
Ich nippe an dem kalten Wasser, genieße das Prickeln der Kohlensäure, während ich, mit dem Rücken an die Bar gelehnt, den Blick durch den Raum schweifen lasse. So viele Menschen verbringen unbeschwert und glücklich ihren Abend miteinander und ich kann mich an eine Zeit erinnern, als ich einer von ihnen war. Als ich arrogant genug gewesen war, zu glauben, dass ausgerechnet mir alle Zeit der Welt bleiben würde und ich keine ständig tickende Uhr in meinem Herzen spüre. Als jede Krankheit, jeder mögliche Unfall sich in etwa so fern und unrealistisch angefühlt hat wie eine zweite Präsidentschaft von Donald Trump. Aber ich bin gestorben, für eine volle Minute und dreizehn Sekunden. Und Trump ist wieder Präsident.
Beschissene Zeiten eben.
Seitdem betrachte ich manchmal die Menschen um mich und frage mich, was die geheime Uhr in ihrem Herzen sagt. Wie lange sie noch tickt, bevor sie eines Tages einfach stehen bleibt. Am liebsten würde ich jeden von ihnen schütteln, oder auf die Bühne springen und mir das Mikro schnappen. Wisst ihr nicht, dass euer Leben jederzeit vorbei sein kann? Wacht auf, würde ich gerne schreien. Trödelt nicht.
Doch natürlich mache ich das nicht. Man würde mich für einen Verschwörungstheoretiker halten und vor die Tür setzen.
Gleichzeitig vermisse ich diese Unbeschwertheit, die mir die Seine mit ihrer kalten Umarmung aus dem Körper gepresst hat. Ich vermisse die Leichtigkeit, das Im-Moment-Sein. Andererseits arbeite ich nun so fokussiert wie nie zuvor für meine Ziele, vielleicht hat das also etwas Gutes.
Ich trinke mein Wasser aus, mache ein Foto von der Bühne und sende es in unseren WhatsApp-Chat, dann kämpfe ich mich an der Bühne vorbei nach draußen. Immerhin habe ich es versucht, wenn auch zu spät.
Es ist Zeit, wieder an die Arbeit zu gehen. Doch die laute Umgebung hat meine Kopfschmerzen verstärkt und nicht mal ich kann die Müdigkeit leugnen, die in meinen Gliedern liegt. Vielleicht sollte ich doch versuchen, tatsächlich mal zu schlafen und wenigstens in dieser Hinsicht eine gute Nacht zu haben. Und vielleicht ist Elliot dann endlich mal zufrieden.
Es ist keine gute Nacht geworden. Und das, obwohl ich alles versucht habe, damit es klappt. Ich habe Melatonin genommen und mir einen Salbeitee gemacht. Ich habe einen beruhigenden Podcast, der beim Einschlafen helfen soll, gehört, jeden Winkel meiner Wohnung abgedunkelt und jeden Rest Straßenlicht ausgesperrt. Und alles, was dabei herumgekommen ist, waren wenige Stunden Herumgewälze, während mein Kopf Kreise drehte und mein Körper fiel, wieder und wieder. Als würde das Liegen mir das Gefühl geben, wieder zu fallen, wieder zu entgleiten. Schließlich wollte ich mich wenigstens mit etwas anderem ablenken als Arbeit, also habe ich es erst mit einem Buch probiert, dann mit einer Serie. Doch nichts hat geholfen. Als mein Kopf besonders weit abwandert und mir eine Filmvorstellung meiner tiefsten Ängste präsentiert, denke ich an die Visitenkarte von dem Psychologen, den mir das Krankenhaus empfohlen hat. Sie ruht immer noch vergraben in endlosen Papierstapeln auf dem Küchentisch. Therapien sind langwierig, und Plätze rar. Und es wird immer jemanden geben, der dringender professionelle Hilfe benötigt. Im Großen und Ganzen geht es mir gut und ein paar akute Bewältigungstricks für Panikattacken habe ich bereits in der Klinik gelernt. Beim Einschlafen helfen die mir jedoch auch nicht.
Also habe ich den Kampf aufgegeben, habe meine Schlaflosigkeit akzeptiert und das Einzige getan, was mir übrig geblieben ist.
Um halb drei Uhr morgens krame ich in meinem Rucksack nach meinem Fahrradschloss, um mein Rad an einer geschwungenen, gusseisernen Straßenlaterne anzuketten. Das Licht der Laterne ist von den unzähligen Spinnweben an der kugelförmigen Leuchte so trüb, dass es mir bei meiner Suche kaum eine Hilfe ist. Dass sich mein Schädel anfühlt, als würde ein Einbrecher sich mit einer Eisenstange einen Fluchtweg durch meine Stirndecke brechen, macht das Ganze nicht besser.
»Merde«, murmle ich. »Merde, merde, merde.« Habe ich das Schloss in der Wohnung liegen lassen?
Ich starte eine letzte verzweifelte Suche: Taschentücher, Geldbeutel, Haustürschlüssel – immerhin – und in einer zerknautschten Tüte die Reste eines Croissants. Aber kein Schloss.
Soll ich das Rad einfach hier stehen lassen und beten, dass niemand auf der Suche nach einer kurzfristigen Fahrgelegenheit vorbeikommt? Mit dem abblätternden, rostroten Lack und den löchrigen Gummigriffen am Lenker ist es bei Weitem kein Hauptgewinn. Trotzdem: Das ist Paris. Was nicht festgenagelt ist, bekommt Beine. Ich versuche, eine Entscheidung zu treffen, doch mit dem Hämmern in meinem Schädel ist das fast unmöglich.
Ich werfe einen Blick über die kopfsteingepflasterte Straße, auf die andere Seite des Platzes. Dort kauern sich schmutzige Zelte, von leeren Kartons und Unrat umgeben, an die Steinmauern der Notre-Dame-de-Bonne-Nouvelle. Sie ist eine klassizistische, vergleichsweise schlichte Kirche, zumindest im Gegensatz zu dem gotischen Prunk der weltbekannten Notre-Dame de Paris auf der Île de la Cité. Von den Zelten gab es in Paris unsäglich viele, ein Armutszeugnis für unsere Stadt. Mir hat es das Herz gebrochen zu sehen, wie die obdachlose Bevölkerung für die Olympischen Spiele von Polizisten und dem Militär in die Randbezirke getrieben wurde, obwohl sie in einer mehr oder weniger friedlichen Symbiose mit Paris lebten. Alles, um die Stadt sauberer und schöner wirken zu lassen, für die vielen internationalen Gäste. Kaum waren die Spiele vorbei, kamen die Zelte wieder überall in die inneren Arrondissements zurück – auch hier im Zweiten, in dem sich Le Sentier befindet.
Auch wenn von den Obdachlosen meist keine Gefahr ausgeht, würde ich Paris nicht als sicher bezeichnen. Ich vertraue der Stadt nicht weiter, als ich gucken kann. Ein unabgeschlossenes Fahrrad gleicht einer goldenen Einladung und Paris wäre nicht Paris, wenn es nicht jemanden geben würde, der dieser Einladung mit Freuden nachkommt.
Damit bleibt nur eine Option: Mitnehmen.
Ich trage das Rad ächzend die Stufen zu der Eingangstür empor. Während ich mit meiner freien Hand in dem dämmrigen Licht versuche, das Schlüsselloch zu treffen, bleibe ich an dem Schild neben der Tür hängen: V Change Reality.
Noch immer erfüllt es mein Herz mit warm prickelndem Stolz, egal wie oft ich das Rechteck aus Messing mit unserem Logo sehe. Dieses Gefühl ist jede Mühe und Entbehrung wert.
Endlich passt der Schlüssel und das Treppenhaus breitet sich vor mir aus. Wie zu erwarten, dunkel – in dem Gebäude befinden sich ausschließlich Unternehmen mit ihren Büroräumen. Ich warte, bis die Tür hinter mir ins Schloss fällt, dann erst schalte ich das Licht an und offenbare das steril wirkende Treppenhaus, das so gar nicht zu dem charmanten, eleganten Paris voller Stuckfassaden und Schnörkeln passen mag. Mit der Aussicht, das Fahrrad nun sechs Stockwerke nach oben schleppen zu müssen, wünsche ich mich kurz in mein Bett zurück, das ich vor einer Dreiviertelstunde verlassen habe. Wobei … nein, lieber nicht. Ich würde alles tun, um mich nicht noch länger schlaf- und rastlos hin und her wälzen zu müssen.
Also mache ich mich an den Aufstieg und erreiche wenige Minuten später verschwitzt und außer Puste unseren geteilten Bürokomplex. Mit den nigelnagelneuen Büros der Station Future können unsere einfachen Räumlichkeiten allerdings bei Weitem nicht mithalten.
In der kleinen Küche, die zentral zwischen den verschiedenen Büros liegt, schalte ich die Kaffeemaschine ein. Während das Mahlwerk rattert, aktiviere ich meinen PC. Mit einer frischen Tasse schwarzen Kaffees setze ich mich vor den Bildschirm. Drei Uhr ist es bereits. Vier Stunden also noch, bis Elliot und Xenia erscheinen werden.
Vier Stunden, die ich bis auf die letzte Sekunde ausnutzen werde. Ich weiß, wie begrenzt unsere Zeit ist, wie schnell alles einfach vorbei sein kann. Beinahe hätte ich gehen müssen, ohne meine Ziele zu erreichen. Doch ich habe eine zweite Chance bekommen.
Und ich plane, diese zweite Chance zu nutzen und V Change Reality so weit voranzubringen wie nur irgendwie möglich. Unsere Mission ist jedes bisschen Anstrengung wert – und wenn wir am Ende die Welt mit unserem Sensitivity-VR nur ein wenig besser machen, hat sich die viele Arbeit gelohnt.
Ich unterdrücke ein Gähnen, nehme einen großen Schluck Kaffee und lege los. Es dauert nicht lange, bis ich in diesen besonderen Fokus gerate, in dem es nur mich und die Aufgabe vor mir gibt und ich endlich nicht mehr fallen muss, sondern festen Boden unter meinen Füßen spüre. Sogar meine Kopfschmerzen treten in den Hintergrund.
Erst als die Sonne ihre frühen, ersten Strahlen durch die halb hochgezogenen Plissees schickt, erlaube ich mir eine Pause für einen kurzen Blick aus dem Fenster. Vor mir breiten sich die Dächer von Paris aus – eine unebene Landschaft aus Metall, Schornsteinen und Stein, und alles leuchtet honiggelb, als hätte die Welt einen Instagram-Filter aktiviert. In der Ferne erkenne ich sogar die Spitze des Eiffelturms. Für einen Moment sieht Paris beinahe so zauberhaft aus, wie es in der verklärten medialen Perspektive wirkt. Voller Liebe und Möglichkeiten. Ein Schwarm Tauben fliegt auf dem Dach gegenüber auf und von der Straße ertönt Autohupen – das war’s mit der schönen Illusion.
Keine zwei Stunden nach dem Sonnenaufgang lenkt mich das Geräusch eines Schlüssels in der Tür von meinem Workflow ab, dann Schritte und wenig später …
»Fuck, Adair. Was machst du schon hier?«
Natürlich ist es Elliot. Das war klar. Ich drehe mich um und lächle ihm zu.
»Dir auch einen guten Morgen!«
Wie immer sieht Elliot wie aus dem Ei gepellt aus – die Locs heute zu einem lässigen Dutt gebunden, die Kanten des Dreitagebarts klar rasiert. Die Augenbrauen hinter seiner Brille sind vorwurfsvoll hochgezogen.
»Wie lange bist du schon hier? Mann, Adair, wieso schläfst du nicht mal aus? Und was wolltest du uns mit diesem Foto aus der Bar eigentlich beweisen?«
Dass ich es mit den Pausen versuche und ihr mir nicht egal seid, denke ich. Doch meine Stimmbänder versagen, so überrumpelt bin ich von seiner Wut und der Sorge, die in ihr mitschwingt.
Kapitel 2 – Amélie
Der Zug spuckt mich förmlich am Bahnsteig aus und setzt sich dann mit einem lauten Pfeifen und schnaufenden Motor wieder in Bewegung – zurück nach Paris. Die wie aus einer anderen Zeit wirkende Laternen, die über den beiden Bahnsteigen und entlang des Bahnhofsgebäudes aufgestellt sind, werden von der Abendsonne so angestrahlt, dass es wirkt, als würden sie bereits leuchten.
Um mich herum eilen die wenigen Passagiere, die mit mir ausgestiegen sind, über den Gleisübergang zur Straße, Kofferrollen klackern, Rufe ertönen. Zwei Männer fallen sich lachend in die Arme und drücken sich Küsschen auf die Wangen. Meine Füße jedoch scheinen wie festgewachsen, ich umklammere den Griff meines Koffers so fest, dass es wehtut. Zitternd ziehe ich Luft in meine Lunge, dann atme ich in einem festen Stoß wieder aus. Ein und aus. Immer und immer wieder, während ich gedanklich zu einem der letzten Male reise, als ich an diesem Bahnsteig gestanden habe. Es war ein goldener Herbsttag. Die Welt bereitete sich auf den Winter vor, meine Semesterferien waren gerade zu Ende und ich war dabei, mein Abschlussfilmprojekt vorzubereiten, und Papa … Papa hat noch gelebt.
Die Ärzte hatten gesagt, es würde ihm besser gehen. Ich habe gesehen, wie er mit dem Sommer wieder näher an die Welt der Lebenden gerückt ist als an das Land der Toten. Zumindest, so sehr wie es einem Todkranken besser gehen kann. Er hat wieder gelacht, hat immer gelacht, damit es mir besser geht, aber auch um sich selbst Kraft zu spenden. Farbe ist in seine Wangen zurückgekehrt und er aß wieder mehr, wenn auch immer noch zu wenig.
Dann bin ich zurück nach Paris, habe Port Azur hinter mir gelassen, ohne zu wissen, dass ich nie wieder meine Arme um seinen schwindenden Körper legen, nie wieder einen Kuss auf seine Stirn drücken oder sein wunderschönes Lachen hören würde. Ohne zu wissen, dass der Winter ihn mir nehmen würde.
Für die Beerdigung hat Maman mich mit dem Auto hier, in Le Tréport abgeholt. Wir haben geschwiegen, die Fahrt über, mit tränennassen Augen.
Seitdem hat Maman mich zwar in Paris besucht, ich bin aber nie zurückgekehrt.
Jetzt bin ich wieder hier, an dem Bahnsteig, von dem ich so oft abgeholt wurde, und muss mit dem Fakt klarkommen, dass er nicht daheim auf mich warten wird.
Nur noch wir zwei, denke ich und die Welt in meinem Kopf fühlt sich auf einmal so unfassbar klein und eng und dunkel an. Sie scheint mich von innen zu erdrücken. Ich möchte schreien, weinen, kämpfen, um wieder Luft zum Atmen zu bekommen, dieser Enge zu entfliehen, aber es funktioniert nicht.
»Amélie! Hier bin ich!«, ruft Maman und rettet mich mit ihrer warmen Stimme aus dem luftleeren Raum in mir, zurück in die echte Welt, die noch immer groß ist. Die jetzt bloß ein bisschen weniger Liebe und Licht enthält ohne ihn.
Der Bahnsteig ist mittlerweile leer, der Zug längst abgefahren. Auf der anderen Seite des Gleises steht Maman, deutlich zu erkennen an ihren langen, silbernen Locken, die dicht gedreht über ihre Schulter fallen, in ihrer kerzengeraden Körperhaltung. Die Ringe an ihren Fingern glänzen im Licht, als sie mir zuwinkt – als könnte irgendjemand sie übersehen. Vor allem nicht in dem aquamarinfarbenen Sommerkleid, das einem Wasserfall gleich elegant um ihre langen Beine fließt.
Stark sein, Amélie, erinnere ich mich und lächle. Ich hebe ächzend den Koffer an, der mein halbes Leben enthält, schultere meine Reisetasche und überwinde den Weg über das Gleis. Meine Oberschenkel beschweren sich, als ich die Stufen zum anderen Bahnsteig erklimme. Ich kann kaum meine Taschen abstellen, da schließt Maman bereits ihre langen Arme um mich. Fest und trotzdem vorsichtig. Als hätte sie Angst, mich zu zerbrechen. Ihr blumiges Parfüm hüllt mich ein, die Spitzen ihrer Locken kitzeln mich an meiner Stirn. Sie überragt mich fast um eineinhalb Köpfe, ist hübscher als ich, schlanker als ich – was mich nie gestört hat. Ich bin nun mal eher auf Papas Seite des Genpools gelandet.
Oder wie Papa sagen würde: kleiner Mensch, große Träume.
Nur die Locken habe ich von Maman.
Ich vergrabe mein Gesicht tief in dem seidenen Stoff ihres Kleides und erlaube mir für einen Wimpernschlag, nicht die starke Amélie zu sein. Sondern einfach nur Amélie, die ein wenig zerbrochen ist, ziemlich viel Trauer in sich trägt und kaum nach vorne gucken kann. Mamans warme Lippen drücken sich fest auf meine Stirn. Dann nimmt sie mein Gesicht in ihre Hände und hält es ein wenig von sich. Sie mustert mich ganz genau, als müsste sie sich davon überzeugen, dass ich noch unversehrt bin. Ich hole meine Stärke wieder, biege meine Lippen zu einem halben Lächeln und ignoriere das Brennen hinter meinen Augen.
»Es ist so schön, dich wiederzusehen, mon cœur! Wie war die Reise?«
Bevor ich antworten kann, drückt sie mir einen weiteren Kuss auf die Stirn.
»Wie immer«, sage ich, reibe mir abwesend die schmerzenden Hände und versuche zu verdrängen, dass es eben nicht wie immer ist. »Immerhin keine Verspätungen. Um ehrlich zu sein, bin ich aber trotzdem reif fürs Bett.« Wie um meine Aussage zu unterstreichen, muss ich laut gähnen.
»Das glaube ich dir.« Sie betrachtet mich nachdenklich. Ihre Augen glänzen verdächtig – auch sie kämpft. Aber dann schluckt sie, wischt sich abwesend über die Augen und lässt sich ihre Trauer so wenig wie möglich anmerken. Seufzend richtet sie sich auf und streicht mir eine Strähne aus der Stirn. »Meine wunderschöne, erwachsene Tochter – wohin rennt nur die Zeit?«, murmelt sie.
»Maman!«, protestiere ich. Dafür, dass ich erwachsen bin, verhätschelt sie mich wie ein kleines Mädchen.
»Pardon. Ich habe dich bloß so sehr vermisst, du kannst es dir gar nicht vorstellen. Komm, lass uns nach Hause fahren.« Schon nimmt sie mein Gepäck und geht in großen Schritten voraus in Richtung Auto. Ich folge ihr, den Gurt meiner Reisetasche fest umgriffen.
Der blaue Chevrolet steht einsam auf dem Parkplatz. Er ist so alt, dass der Lack abblättert und man den Schlüssel noch in den Türgriff stecken muss, um das Auto aufzusperren. Ich helfe Maman, mein Gepäck im Kofferraum und auf der Rückbank zu verstauen – für Koffer und Reisetasche ist der Kofferraum zu klein. Dann öffne ich die Beifahrertür und lasse mich auf dem abgenutzten, cremefarbenen Bezug nieder. Das Auto empfängt mich wie ein alter Freund. Der Zederngeruch, der von der Dufttanne am Rückspiegel ausgeht. Die kleine Wackelkopffigur von Roxie Hart aus Chicago auf dem Armaturenbrett blickt mich aus starren schwarzen Augen an. Und das Bild von mir, das in den Lüftungsschlitzen in der Mittelkonsole steckt. Ich war sieben Jahre alt, als es aufgenommen wurde. Seitdem habe mich sehr verändert, doch die Locken und mein Lächeln hatte ich damals schon, genauso wie die vielen Sommersprossen in meinem Gesicht, als hätte jemand mich mit Farbe besprenkelt. Das Bild ist verknittert und verblichen. Papa hat es vor jeder Fahrt in die Hand genommen und einmal mit dem Daumen über mein Gesicht gestrichen, wenn er ohne mich unterwegs war. Ich wäre sein Schutzengel, meinte er immer. Vielleicht hat das gestimmt, zumindest in seinem Kopf. Aber wieso konnte ich ihn dann nicht vor dieser grausamen Krankheit beschützen?
Der stotternd startende Motor holt mich in die Gegenwart zurück. Wie immer klingt das Auto, als hätte es einen schweren Fall von Keuchhusten, und ob es tatsächlich anspringt, gleicht stets einem Glücksspiel. Meistens gewinnen wir, aber leider verlieren wir auch häufiger, als uns lieb ist. Dennoch ist das Auto Teil unserer Familie – mit all seinen Fehlern.
Heute haben wir Glück und das Auto setzt sich ohne Rebellionen in Bewegung. Es ist bereits zehn Uhr abends und ich bin seit früh morgens auf den Beinen, also schließe ich die Augen und versuche, mich zu entspannen. Maman macht das Radio an, es läuft Elvis Presley. Übelkeit sitzt lauernd in meinem Magen. Ich kann nicht sagen, ob sie der kurvigen Route und Mamans Fahrstil entstammt oder den fremden Umständen. Notgedrungen öffne ich die Augen wieder und kurble das Fenster einen Spalt runter. Gerade so weit, dass ein steter Strom Frischluft in das Auto fließt und die Übelkeit ein wenig zurückdrängt.
Wir fahren durch nachtblaue Felder über sanft rollende Hügel auf schmalen Landstraßen ohne Markierungen. Wir sind allein. Hinter Le Tréport gibt es nur eine Handvoll kleiner Dörfer und die größeren Städte etwas weiter die Küste entlang schlucken die meisten Touristen, weswegen es bei uns ruhiger bleibt. Wir steuern auf eine Anhöhe zu, höher, höher, und dann – dann sehe ich es.
Einem endlosen Teppich gleich breitet sich das Meer vor uns aus. Die sanft gekräuselte Oberfläche glitzert im Schein des aufsteigenden Vollmondes, der der Sonne mittlerweile den Himmel gestohlen hat. Lichter und dunkle Schemen lassen Schiffe erahnen, die in der Ferne am Horizont gleiten und scheinbar auf der Kante der Welt segeln. Frachtschiffe oder Kreuzfahrer.
Nichts verbinde ich so sehr mit Heimat wie das Meer. Ich liebe Paris und die endlosen Dächer der Stadt, ich liebe den Trubel und das Filmstudium, die eleganten Bauten und die Seine. Aber noch mehr liebe ich den Ozean, das Salz in Wasser und Luft, die Wellen, mal ruhig und sanft, dann hoch und stürmisch, doch immer beständig. Ich liebe den Wind, der über das Meer an Land getragen wird, die Schreie der Möwen und das Gefühl, bis ans Ende der Welt sehen zu können. Und erst jetzt, wo ich diese nachtblau-weiß schimmernde Weite wieder vor mir sehe, merke ich, wie unfassbar ich es vermisst habe.
Alle Zweifel an der Entscheidung, Paris den Rücken zu kehren und nach Port Azur zurückzuziehen, um Papas Erbe auferstehen zu lassen, sind plötzlich unfassbar fern und unbedeutend, angesichts des Kribbelns und der Wärme, die das Meer in mir auslöst.
Ich muss doch noch eingeschlafen sein, denn ich wache erst auf, als Maman abbremst und in die kopfsteingepflasterte Einfahrt unseres Hauses abbiegt.
»Da sind wir«, sagt Maman und zieht den Schlüssel. Ich reibe mir über die verklebten Augen.
Die vertrauten Schemen unseres Steinhauses ragen vor uns auf, dunkel vor dem sternenübersäten Nachthimmel. Spitze, reetgedeckter Giebel, eingerahmt von zwei Schornsteinen, einer an jedem Ende des Giebels. Dazwischen mit Blumenkästen geschmückte Fenster, links und rechts flankiert von weißen Fensterläden, die im Mondlicht sanft strahlen. Wilder Wein rankt über die mit Naturstein durchzogene Fassade. Links führen ein überwucherter Torbogen und ein Gartentor in einen kleinen, aber liebevoll gepflegten Garten.
Maman sperrt auf und lässt mir den Vortritt. Die alten Holzdielen atmen ächzend unter meinen Schritten. Ich betätige den Lichtschalter. Warmer Schimmer erfüllt den engen Flur und haucht ihm Farbe ein. Es ist still im Haus. Still und leer.
Maman schließt hinter mir die Tür und legt behutsam einen Arm um mich. Zieht mich kurz an sich, als würde sie wissen, was ich gerade denke, wie es mir geht. An wen ich gerade denke.
Verdammt, vermutlich weiß sie es selbst gut genug. Immerhin muss sie ständig in dieses Haus zurückkehren und wird jedes Mal von absoluter Stille empfangen. Umso besser, dass ich nun da bin. Dann können wir uns gegenseitig etwas Lärm schenken und gegen die Leere in uns kämpfen. Ich lege meinen Arm ebenfalls um sie, während ich die zahlreichen Familienfotos an den Wänden betrachte.
Kein Bilderrahmen gleicht dem anderen, keines hängt auf gleicher Höhe. Papas chaotisch-liebevoller Einfluss. Natürlich erblicke ich sofort das Bild von ihm, wie er lächelnd vor dem neu eröffneten Palais steht. Maman hatte an diesem Tag das Gefühl, dass seine Liebe zu ihr nie so groß wie seine Liebe für sein Kino, für seinen persönlichen Palast der Träume, sein würde. Das sagt sie zumindest, immer mit einem Augenzwinkern.
Meine Trauer hat sich gewandelt, seit er vor neun Monaten gestorben ist, natürlich hat sie das. Das Atmen fällt mir wieder leichter, ich schlafe besser und ich weine nur noch selten. Doch deswegen ist die Trauer nicht fort. Es ist, als wäre sie in meine Knochen geritzt, stets in mir, unwiderruflich – genauso wie meine Erinnerungen an ihn.
»Ist es okay, wenn ich direkt zu Bett gehe?«, frage ich Maman. Sicher hat sie sich auf einen gemeinsamen Abend mit mir gefreut. Seit Papas Tod habe ich mich in Paris noch ein wenig mehr von ihr abgekapselt, auch wenn ich das eigentlich gar nicht wollte. Es ist einfach passiert. Weil ich mit mir beschäftigt war, mit meinen Sorgen und meinen Schmerzen und meinem Leben in der großen Stadt. Aber jetzt bin ich ja wieder hier. Zu Hause.
Maman nickt.
»Natürlich, chérie. Wir haben alle Zeit der Welt. Komm, ich helfe dir mit den Taschen.«
Gemeinsam steigen wir die engen Stufen ins Obergeschoss, zu meinem Zimmer, von dem aus man das Meer sehen kann. Den Ausblick habe ich geliebt, noch etwas, das ich von meinem Papa habe.
Maman stellt die Tasche neben den Koffer, dann dreht sie sich um. Im Türrahmen stoppt sie. »Möchtest du noch einen Rooibos-Vanille-Tee?«
»Gerne«, antworte ich. Sie lächelt mich warm an und macht sich auf den Weg in die Küche. Wenige Momente später höre ich den Wasserhahn laufen.
Wie zu erwarten, hat sich in meinem Zimmer nichts verändert – das sehe ich sogar im Dunkeln. Alles wie immer, aber alles anders.
Ich trete an das Fenster. Von hier kann ich fast die ganze Bucht Port Azurs überblicken. Den Leuchtturm des alten Jacques, die im Hafen vertäuten Boote und den Kirchturm, bis zu den Klippen, die mir alles bedeuten. Auf denen, unsichtbar im Schatten der Nacht, der Palais des Rêves thront.
Der Ort, an dem ich fast mehr aufgewachsen bin als in meinem eigenen Zuhause. Seit Papas Krebs zu schlimm wurde, schläft er – sein Lebenswerk. Doch nicht mehr lange. Denn ich bin gekommen, um ihm wieder Leben einzuhauchen.
Kapitel 3 – Adair
Als Xenia und Elliot am nächsten Tag ins Büro kommen, merke ich sofort, dass etwas anders ist. Die beiden kommen nie gleichzeitig.
Blaze begrüßt mich wie gewohnt, wedelt kräftig mit dem Schwanz und leckt meine Hand freudig bellend ab. Elliot und Xenia sind deutlich verhaltener.
Mit der Sprache rausrücken tun sie allerdings erst, als ich mit einem neuen Kaffee von der Büroküche zurückkomme. Es ist mein dritter an diesem Tag … und das, obwohl es erst neun Uhr morgens ist.
»Adair, wir müssen reden«, beginnt Xenia vorsichtig. Sie kann mir kaum in die Augen sehen.
»Okay«, sage ich und stelle meinen Kaffee ab. »Worum geht es?«
Elliot nickt in Richtung Konferenzraum. Stumm folge ich ihm … und fühle mich dabei wie ein Kind, das darauf wartet, von seinen Eltern ausgeschimpft zu werden.
»Also … rückt raus. Was drückt euch aufs Gemüt?« Ich gebe mich betont salopp, auch wenn ein leiser Teil von mir bereits weiß, worauf sie hinauswollen. Immerhin diskutieren wir seit Wochen über mein Arbeitspensum.
»Du hast dich verändert«, sagt Elliot. »Wir sehen dich nur noch im Büro und du scheinst nie nicht zu arbeiten – und ja, neulich warst du in der Bar. Allerdings Stunden nachdem wir Feierabend gemacht haben. Und wir fragen uns … wir fragen uns, was passiert ist. Und ob es dir gut geht.«
»Nichts ist passiert.« Ich male Gänsefüßchen in die Luft. »Ich habe einfach nur meine Ziele im Blick. Unsere Ziele.« Die zweite Frage ignoriere ich, denn die Antwort darauf kenne ich selbst nicht. Was ist schon gut? Ich lebe, das ist gut genug.
Elliot seufzt, Xenia lehnt sich zurück und reibt sich die Stirn.
»Du kannst mit uns reden«, sagt Xenia schließlich. »Immer. Wir sind deine Freunde.«
»Ich weiß«, antworte ich und lächle mein falsches Lächeln. »Aber wirklich, es ist nichts. Alles ist gut.«
»Nichts ist gut«, fährt Elliot auf und schlägt auf den Tisch. Ich zucke zusammen. So gereizt habe ich ihn noch nie erlebt. Sonst ist Elliot immer so unfassbar ausgeglichen. »Du bist nur noch ein Schatten deiner selbst, arbeitest viel zu viel und achtest nicht auf uns. Wobei das nicht mal das Schlimmste ist: Du hast aufgehört, auf dich zu achten. Ich mein, der alte Adair wäre niemals mit zerknitterten Klamotten oder unrasiert aufgeschlagen. Und wir müssen zusehen, wie sich unser bester Freund zu Grunde arbeitet.«
»Ja …«, murmle ich. »Ich arbeite viel und wir sehen uns selten. Aber ihr müsst mir glauben, alles ist gut.«
»Wenn alles gut ist, wieso machst du dann nicht einfach mal Pause und erholst dich?«, fragt Elliot und verschränkt die Arme vor der Brust.
»Ich kann jetzt keine Pause machen«, protestiere ich über die Panik hinweg, die einer Stichflamme gleich in mir aufglimmt. »Es steht so viel auf dem Spiel.«
»Das tut es«, sagt Elliot. »Aber es steht noch mehr auf dem Spiel, wenn du dich kaputt arbeitest.«
Xenia nickt bestimmt. Nicht mal ihr buntes Haar lässt ihre Miene fröhlich wirken – so ernst sieht sie mich an.
»Wir möchten, dass du Pause machst«, sagt sie.
»Und es ist keine Bitte.«
»Das ist doch unnö…«
»Wenn du nicht Pause machst, gehen wir. Denn wir stellen dieses Unternehmen nicht über deine Gesundheit.«
Elliots Worte fühlen sich an wie ein Schlag in den Magen. Nicht nur das: wie ein Schlag in den Magen mit einer Faust aus Metall.
»Ich …«
»Wir haben dir Urlaub gebucht – zwei Wochen. In einem wunderschönen kleinen Ort in der Normandie, direkt am Meer. Montag geht es los.«
Sie haben was?!
»Das könnt ihr doch nicht machen …«, beginne ich, doch Elliot schneidet mir das Wort ab.
»Das können wir.«
»Was ist mit meinen Meetings?«
»Übernimmt einer von uns, oder verschieben wir.«
»Die Deadline für unsere Station-Future-Bewerbung?«
»Noch weit genug entfernt. Und du hast sowieso auf allen Ebenen vorausgeschossen.« Elliot bleibt hartnäckig und mir gehen die Argumente aus. Die Panik jedoch gleicht mittlerweile einem Waldbrand und hat jede Faser meines Seins in ihrem heißen Griff. Die Arbeit ist alles, was ich habe – sie strukturiert mich, gibt mir Halt und ohne sie … ohne sie falle ich nur wieder.
»Wir wollen dir nur helfen«, erklärt Xenia. Ihre Stimme hat einen flehenden Unterton angenommen. »Das musst du uns glauben.«
Ich schweige. Sitze aufrecht und still da und verarbeite die Botschaft. Ich möchte schreien, möchte streiten, doch ein Teil von mir kann nicht mehr. Ich bin müde, deswegen zu streiten. Ich bin müde, unsere Freundschaft zerfallen zu sehen. Vielleicht hätte ich ihnen einfach von meinem Sturz erzählen sollen. Aber ich kann nicht, weil es sich zu groß anfühlt und der richtige Moment vorbei ist – und weil ich immer versuche, diese Wahrheit, dieses Erlebnis, so klein und unwichtig wie möglich zu machen. Weil es dann leichter ist.
Zurück in meinem Appartement bekomme ich eine Benachrichtigung für eine E-Mail von Elliot auf meine Smartwatch.
Ich lasse meine Schlüssel auf die Holzplatte fallen und öffne die Mail. Sie enthält Details über den Zwangsurlaub, den Elliot und Xenia für mich gebucht haben. Meine Zugverbindung, eine Zimmerbuchung in einer rustikalen, aber durchaus charmant wirkenden Pension sowie ein paar Bilder von dem Ort. Nach wenigen Sekunden schließe ich die Mail und schleppe mich ins Schlafzimmer, vorbei an der chaotischen Küche voller schmutziger Töpfe und Teller, neben diversen Müllresten vom Lieferdienst.
Manchmal würde ich am liebsten mein ganzes Leben mit Benzin überschütten und ein Streichholz hineinwerfen, damit alles zu Boden brennt. Doch das kann ich nicht – ich möchte niemanden enttäuschen. Vor allem nicht mich selbst.
Das Licht im Schlafzimmer leuchtet wie warmes Gold.
Regalbretter füllen jede freie Lücke an der langen Wand, so vollgestellt mit Büchern, dass sie sich unter dem Gewicht der vielen Worte biegen. Wegen der Arbeit komme ich kaum zum Lesen, zumindest rede ich mir ein, dass das der Grund ist.
Die reine Anwesenheit der Bücher reicht jedoch, um meine Stimmung ein wenig zu heben – so viele Leben, in die ich abtauchen könnte, die nicht mein eigenes sind. Das Bett ist aus einem Vintage-Shop, in sanftem Beige gehalten und übersät mit weichen Kissen. Auf den beiden Nachttischen stapeln sich weitere Bücher, manche schon vor Monaten oder Jahren begonnen, andere nie geöffnet. Vielleicht sollte ich welche mit in die Normandie nehmen?
Erst am Sonntag, einen Tag vor der Abreise, hole ich meinen Koffer aus dem Kleiderschrank und beginne zu packen – was bleibt mir denn sonst? Zu diesem Schluss bin ich zumindest gekommen, nachdem ich das ganze Wochenende vor mich hin gegrübelt habe.
Bereits die Menschen im Krankenhaus hatten mir nach dem Sturz zu einer kleinen Auszeit geraten – ein paar Tage Ruhe, um mit einem Ereignis wie diesem klarzukommen. Ich habe ihnen keine Beachtung geschenkt, immerhin ging es mir körperlich gut und die Arbeit wurde täglich mehr. Vielleicht hatten sie gar nicht so unrecht. Denn obwohl mein Kopf etwas anderes sagt, fühlt sich die Vorstellung, hier auszubrechen, Abstand zu gewinnen, wenn auch nur auf Zeit, auf einmal verwirrend gut an. Zumindest wenn ich den eigentlichen Zweck meines Urlaubs vergesse.
Mit den Knien auf dem Deckel zerre ich schließlich an dem Reißverschluss. Dabei denke ich an die Bilder von der Bucht, an die tosenden Wellen und den kleinen Leuchtturm, erlaube mir für einen Augenblick, den Geschmack von Salz auf meinen Lippen zu spüren.
Kapitel 4 – Amélie
»Und, bist du bereit, die Dorfgemeinschaft in deinen Plan einzuweihen?«, fragt Cecile und grinst mich an.
Wie sehr ich sie in Paris vermisst habe! Wir sind von Kindesbeinen an unzertrennlich. Lange konnte ich mir niemals vorstellen, auch nur einen Tag ohne sie zu verbringen. Doch dann bin ich in die große, weite Welt aufgebrochen, mit Träumen und Ängsten im Gepäck, auf nach Paris. Vom kleinen Dorf an der Kante des Kontinents in die vibrierende Stadt. Und Cecile ist geblieben. Auch wenn wir uns so oft wie möglich gesehen haben, auch wenn wir wöchentlich telefonierten – es ist einfach nie dasselbe gewesen.
Aber nun bin ich wieder hier. Wir sitzen auf unserem üblichen Platz auf der Hafenmauer und essen dort im Schneidersitz eine Kleinigkeit, wie wir es viele Jahre lang und jeden Tag in der vergangenen Woche gemacht haben. Dabei tanzt die Sonne fröhlich auf unseren Gesichtern, während die Meeresbrise Salz und Erfrischung zu uns bringt.
Bin ich bereit?
»Ist man das jemals für irgendetwas?«, schnaube ich, und beiße in mein Tartlett. Erdbeeren mit dieser perfekten, sauren Note zwischen den süßen Symphonien, die meinen Mund erfüllen, und buttrige Vanillecreme. Dank Cecile bekommen wir die bei Maurice immer umsonst. Definitiv ein Vorteil unserer Freundschaft, auch wenn ich manchmal gegenüber Maurice ein schlechtes Gewissen verspüre, immerhin handelt es sich dabei um ein sehr einseitiges Geschäft.
»Kopf hoch!« Auch sie gönnt sich einen großen Bissen und seufzt hörbar vor Glück. »Ich bin mir sicher, alle werden sich mit dir freuen, die Eröffnung wird wunderbar und du hast dir mal wieder viel zu viele Sorgen gemacht!«
Ich nicke nur, wenig überzeugt von ihrem Optimismus. Seit ich in Port Azur angekommen bin, wälze ich mich schlaflos in meinem Bett. Heute habe ich weit nach Mitternacht noch einen Spaziergang zum Meer gemacht, für eine halbe Stunde auf die Wellen geschaut und gehofft, die tobenden Ängste in meinem Kopf würden von den Fluten mitgerissen werden. Einfach auf und davon, bis sie sich in Meeresschaum zersetzen.
Table of Contents
Playlist
Vorwort
Vorher – Adair
Kapitel 1 – Adair
Kapitel 2 – Amélie
Kapitel 3 – Adair
Kapitel 4 – Amélie
Kapitel 5 – Adair
Kapitel 6 – Amélie
Kapitel 7 – Adair
Kapitel 8 – Amélie
Kapitel 9 – Adair
Kapitel 10 – Amélie
Kapitel 11 – Amélie
Kapitel 12 – Amélie
Kapitel 13 – Adair
Kapitel 14 – Amélie
Kapitel 15 – Adair
Kapitel 16 – Amélie
Kapitel 17 – Adair
Kapitel 18 – Amélie
Kapitel 19 – Adair
Kapitel 20 – Amélie
Kapitel 21 – Adair
Kapitel 22 – Amélie
Kapitel 23 – Adair
Kapitel 24 – Amélie
Kapitel 25 – Adair
Kapitel 26 – Amélie
Kapitel 27 – Adair
Kapitel 28 – Amélie
Kapitel 29 – Amélie
Kapitel 30 – Amélie
Kapitel 31 – Adair
Kapitel 32 – Amélie
Kapitel 33 – Adair
Kapitel 34 – Amélie
Danach – Amélie
Danksagung
Guide
Cover