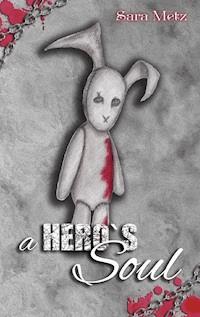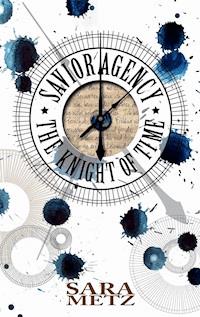
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Savior Agency
- Sprache: Deutsch
The Saviors - So nennen sich die Agenten der beliebten Savior Agency, die das Leiden der einfachen Leute lindern sollen. Durch Zeitreisen verhindern sie Tragödien wie Unfälle, Anschläge und gezielte Morde, die das Leben eines geliebten Menschen frühzeitig beendet hätten. Joshua Dagger ist einer von ihnen und er bekommt einen Auftrag, der sich für ihn nach nichts Besonderem anhört: Er soll den Selbstmord des erfolglosen Künstlers Hektor Frattini verhindern. Doch schon bald stellt er fest: Das ist leichter gesagt als getan. Es beginnt ein Wettlauf, nicht gegen die Zeit - die hat Joshua in seiner Hand -, aber gegen die Geduld und die Dämonen, die den Menschen innewohnen. Und irgendwann droht sein Ehrgeiz, Hektor zu retten, Raum und Zeit komplett zu zerstören.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 694
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Diese Geschichte ist für all die gefolterten Seelen dieser Welt. Ich hoffe, ihr findet euren Frieden.
Inhaltsverzeichnis
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Kapitel 35
Kapitel 36
Kapitel 37
Kapitel 38
Kapitel 39-1 Jahr später
Kapitel 1
Es waren fünf. Keiner mehr und keiner weniger. Ganz genau fünf. Das hätte mich nicht stören sollen, ganz im Gegenteil. Ein kleines bisschen störte es mich aber.
Mir war aufgetragen worden: Geh los und rette das Mädchen! Niemand hatte etwas davon gesagt, dass da noch mehr Menschen sein würden. Aber sie waren zu fünft. Und ich sollte vier von ihnen ignorieren. Vier Menschen, die innerhalb von zweiunddreißig Minuten tot sein würden.
Na gut, ich muss zugeben, dass meine Konzentration in der letzten Zeit einen ordentlichen Knacks hatte. Der Zug ratterte und quietschte, er ächzte und schrie. Nun zu meiner Wenigkeit: Ich hatte keine Ahnung, was hier vor sich ging. Tut mir leid, ich kann euch das auch nicht erklären. Ich bitte euch um etwas Geduld.
Dazu lässt sich noch sagen: Entschuldigt mich, ich habe ein kleines Problem mit der Chronologie. Das liegt vielleicht an meinem Beruf. An meiner Berufung, wenn ihr so wollt. Aber dazu später mehr, mein verwirrter Kopf hält das sonst nicht aus.
Der Zug war jetzt schon weiter vorne, näher an der Stadt, näher an der Brücke, unter der das Mädchen in nur wenigen Minuten eintreffen würde. Ich hatte mir einen genauen Zeitplan zurechtgelegt. Bei dem Wort Zeitplan konnte ich nicht anders als innerlich lachen, immer wenn ich darauf traf.
Ihr fragt euch jetzt sicherlich, wer dieser Kerl ist und was er euch damit sagen will. Nun, in einer halben Stunde würde dieser Zug, von dem ich hier spreche, mit voller Wucht auf das kleine Mädchen zurollen, das sich auf die Gleise verirrt hatte. Weggelaufen ist sie, da sie gerade erst das Gehen gelernt hat. Und die Situation hat sie nicht einschätzen können, so klein war sie noch. Der Zugführer würde Panik bekommen und in dieser Panik versuchen, den Zug zu stoppen. Das war natürlich unmöglich, auf wenige Meter konnte niemand einen ganzen Zug anhalten. Und dieser Bremsvorgang hätte die Menschen purzelnd hin und her geworfen, die Funken an den Schienen wären gestoben und das Chaos wäre ausgebrochen. Nicht nur das kleine Mädchen wäre gestorben – die anderen vier Menschen, die im Zug saßen, wären auch ums Leben gekommen, denn was passiert nicht alles, wenn ein kleines Kind auf die Schienen läuft.
Ich war dort, um es zu verhindern.
Da kommt die Frage auf: Warum wusste ich, dass es so passieren würde? Wie konnte ich am Ort des Geschehens sein, um es zu verhindern? Das ist meine Aufgabe. Meine Arbeit.
Meine Savior-Watch zeigte, dass mir noch knapp fünfundzwanzig Minuten blieben, um das kleine Kind auf den Schienen zu finden und es zu retten. Mir wurde gesagt, es sei egal, was mit dem Zugführer und den Passagieren geschah. Bloß das Mädchen, das hatte Lewis von mir verlangt. Nur das Mädchen, ihre Eltern waren zu uns gekommen und hatten uns um Hilfe gebeten. Ich tat mich schwer damit, die anderen vier zu ignorieren, aber ich hatte das schon oft gemacht. Ich war schließlich nicht irgendein Agent, ich war mit Geist und Verstand bei der Sache und konzentrierte mich nur auf meine Aufgabe: Rette das Mädchen.
Leichter gesagt, als getan. Da war kein Mädchen, jedenfalls konnte ich keines sehen. Ich war schon mindestens zehnmal über die Brücke gerannt, wieder zurück, hatte mich vornüber gebeugt, über das Geländer, ein Blick auf die bräunlichen Schienen.
Ich bekam keine Panik, ganz im Gegenteil. Einundzwanzig Minuten, das war ein Klacks! Ich hatte einmal bloß dreieinhalb Minuten gehabt, um eine Bombe zu entschärfen. Ich habe bis heute keine Ahnung, wie man eine Bombe entschärft. Da ist dieses Getue mit dem blauen und dem roten Draht, welchen schneidet man jetzt durch? Um genauer zu sein, ich habe es nicht einmal geschafft, die Bombe zu entschärfen. Wie gesagt, ich wusste nie, wie das funktioniert. Ich habe das Ding kurzerhand genommen und in den Pool geschmissen, dann hatte sich die Sache erledigt.
Aber heute konnte ich das Kind nicht einfach in den Pool werfen, oder etwa den Zug, ich musste es gezielt finden und retten.
Finden und retten. Das waren die zwei Dinge, die man als Savior tun musste. Man lebte im Gestern, buchstäblich, und dort fand man und rettete.
Mithilfe meiner Savior-Watch sah ich den Zug, wie er näher kam. Er war noch außerhalb der Stadt. Ich konnte noch locker bleiben. Noch.
Aber von Minute zu Minute stellte sich das als zunehmend kompliziert heraus. Da war nämlich kein Mädchen. Mir war berichtet worden, sie sei vor der Brücke auf die Schienen gelaufen. Und blöd war ich nicht, ich hatte schon auf beiden Seiten nachgeschaut.
Dass man so alte, klapprige Züge überhaupt fahren ließ! Es war mir ein Rätsel. Selbst ich, der nie ein Experte für Züge gewesen war, konnte ganz genau sehen, dass das eigentlich verboten sein müsste. Dass solche Züge heutzutage noch fuhren, war einfach nur beunruhigend. Man konnte sehen, hier hatte es einige Menschenleben gekostet. Vielleicht war es ein glücklicher Zufall gewesen, dass sich zu der Zeit nur drei Passagiere im Zug aufhielten. Es hatte mich überrascht.
Aber nun stand ich hier und tatsächlich, da kam die Panik. Dabei durften Saviors wirklich niemals Panik bekommen. Es zeigte Schwäche und hier standen Menschenleben auf dem Spiel. Eines zumindest.
Also lief ich wie ein tollwütiges Huhn (konnten Hühner Tollwut bekommen?) über die Brücke und raufte mir die kurzen Haare.
Kein Mädchen, nirgends war ein Mädchen zu sehen. Nicht einmal der Schatten eines Mädchens lag über dem Land, unter der Brücke, am blauen Himmel.
Ich sah wieder auf die Watch. Das digitale Bild zeigte immer noch den Zug und hin und wieder sah ich ein schemenhaftes Gesicht oder zwei, die hinter den Fenstern auftauchten und sich ihren Träumen hingaben. Aber ich war nicht ihr Retter, ich war der Retter des kleinen Mädchens.
Noch einmal lief ich eine Runde, ging selbst auf die Schienen, las auf meiner Watch die Zeit ab, die das Mädchen noch bis zum Aufprall zu leben hatte. Die Uhr war schon sehr praktisch. Von ihr bekam ich alle nötigen Informationen. Nur eine nicht: Wo war das Mädchen? Ich konnte auf die Watch einschlagen wie ich wollte, diese Information rückte sie nicht heraus. Es war, als wüchse ein Gesicht auf dem Bildschirm, das mich anlächelte und freundlich sagte: „Kümmere dich selbst drum, fauler Sack.“
Das mochte vielleicht sogar stimmen. Vielleicht war ich faul geworden, aber daran wollte ich in diesem Moment wirklich nicht denken.
Ich checkte noch einmal alles ab. Von oben bis unten, von links nach rechts, dann sah ich wieder auf die Watch, die mir den Namen der Brücke, die Informationen des Zugs und die Namen aller Beteiligten verriet.
Und dann stellte ich nach fünfzehn Minuten wilden Herumrennens fest: Falsche Brücke. Du bist auf der falschen Brücke, Idiot.
Hast du eigentlich Salami im Kopf?, fragte ich mich, als ich die Beine in die Hand nahm. Die nächste Brücke war etwas mehr als zwei Kilometer entfernt. Ich war zwar sportlich, aber kein Sportler. Das konnte heikel werden. Und all das nur wegen meiner eigenen Dummheit. Noch nie war mir etwas Vergleichbares passiert. Nicht einmal während meiner Anfänge bei der Savior Agency. Deshalb ärgerte ich mich nun nur noch mehr, als ich mit berstenden Lungen entlang der Gleise sprintete. Ich verfluchte mich. Ich verfluchte und hasste mich in diesem Moment so sehr.
Einmal, während meiner Anfänge bei der Savior Agency, hätte ich beinahe einen Auftrag nicht erfüllen können. Ich hatte einen Mörder von seiner Tat abbringen und ihn anschließend ausliefern sollen, doch wir gerieten in einen Kampf und schlugen uns grün und blau. Sein rechter Haken in meinem Kiefer, mein Fuß in seinem Magen. Ich hatte Angst, da ich zum ersten Mal einem waschechten Mörder gegenüberstand – wissentlich zumindest. In meiner Ausbildung wurde ich zwar an derartige Situationen herangeführt, dennoch war es etwas ganz anderes, so etwas dann praktisch zu erleben.
Mittlerweile hatte ich mich daran gewöhnt. Auch die Rettung bei einem Zugunglück war nun nichts Besonderes mehr. Vielleicht noch etwas gefährlicher als sonst. Nicht ganz so gefährlich wie der Einsatz, bei dem ich einen Flugzeugabsturz verhindern musste, zugegeben. Aber Lewis hatte mich auf diesen Einsatz geschickt, weil ich einer seiner besten Männer war. Es hatte seinen Grund.
Nun rannte ich schon, bis der blaue Himmel in meinen Augen verschwamm, bis mir Tränen im Blick standen, bis mein Hals schmerzte und ich nach Wasser keuchte. Man kann nicht immer alles haben, so wie ich in eben diesem Moment kein Wasser haben konnte.
Die zweite Brücke war nicht mehr weit, jedenfalls sagte ich mir das. Nur noch fünf Minuten, so stellte ich mit einem Blick auf die Uhr fest. Fünf Minuten bis zum Aufprall.
Ich hatte noch nie bei einem Auftrag versagt, aber hier stand ich kurz davor. Vielleicht würde ich mit leeren Händen zu meinem Chef zurückkehren, ohne Ergebnisse, ohne eine Rettung. Damit konnte ich das Ansehen vergessen, das ich anstrebte. Er würde zum ersten Mal so richtig enttäuscht von mir sein, vielleicht würde er meinen Kollegen den Orden anheften und mir bedauernd zunicken.
Mein Ehrgeiz packte mich. Ja, dieser Ehrgeiz konnte ein Segen sein. Ein Charaktermerkmal, welches mich schon sehr oft aus unangenehmen Situationen des Scheiterns befreit hatte. So auch gerade jetzt, in diesem fliegenden Sprint.
Nun hörte ich den Zug nicht nur durch die Übertragung meiner Watch, sondern auch in meinem realen Umfeld. Ich konnte ihn sehen, er kam mir entgegen. Die Brücke lag nicht mehr weit entfernt, ich konnte sogar die weiße Figur eines Kindes erkennen. Da war das Mädchen und nun war es wirklich existent, ihr schwindendes Leben lag vor mir, in meiner Hand. Ich musste den Abhang hinunter, blieb mit den Zehen an einer Wurzel hängen und legte mich längs hin, rollte nach unten, schlug mit dem Kopf auf den Gleisen auf.
Es brummte. Ich konnte die Vibration im Metall spüren. Die Beule wuchs augenblicklich und ich hob den Kopf. Ich war desorientiert. Ich verhielt mich wie ein verdammter Anfänger, aber das musste die Hektik sein. Ich erblickte das kleine Kind, konnte entfernte Rufe von Erwachsenen hören, wahrscheinlich auf der Suche nach ihrem Mädchen.
Sie sah mich an und brabbelte etwas vor sich hin, spielte mit den Kieseln, die zwischen den Gleisen verstreut waren. Ihr weißes Kleid war beschmiert mit Erde und Staub. Sie hatte sich einfach hingesetzt, weil sie die Gefahr nicht verstand. Aber so saß sie direkt vor mir. Nicht nur das, der Zug saß auch direkt vor mir, schaute mich an und streckte seine Nase immer weiter in meine Richtung.
Ich hatte natürlich schon einmal ein kleines Kind im Arm gehalten, aber das war Jahre her. Ich hielt das Mädchen sicher fest und versuchte, mich auf diese Weise aufzurichten. Meine Hose war zerrissen, mein Schädel brummte, mein Herz raste, der Zug war nur noch wenige Meter entfernt. Nun streckte er seine Zunge aus und leckte schon über uns beide, schmeckte sein nächstes Mahl.
Aber das würde ich ihm niemals geben.
Ich sprang.
Ich sprang und machte einen so großen Satz, dass ich dem Zug, der nun hinter mir entlang rauschte, hätte zuwinken können.
Die Bremsen kreischten. Der Zugführer hatte erneut gehandelt und somit sich und jeden anderen in Gefahr gebracht.
Ich kam auf der anderen Seite des Grabens auf, diesmal sicher und geübt. Und als ich mich umdrehte, konnte ich noch die Funken sehen, als der steinalte Zug während der Fahrt wegkippte und langsam abhob. Dadurch stieß er gegen die niedrige Brücke. Es knallte und schepperte. Kleine Feuerwolken stiegen auf und zeigten an: Hier geschieht eine Tragödie.
In diesem Moment starben die vier Menschen, die sich im Zug befunden hatten. Der Zugführer und drei Passagiere. So wie ich es noch vor meinem Einsatz in der Zeitung gelesen hatte.
Denn dieses Unglück war vor genau zwei Tagen geschehen, jedenfalls wenn man von meiner Zeit ausging. Ich war zurückgereist, denn das machten Saviors.
Doch was Saviors sicher nicht machten, war all den Menschen beim Brennen zuzusehen.
Der Zug war nicht mehr als solcher zu erkennen. Das kleine, klapprige Ding aus wenigen Wagons war Altmetall – so wie die Menschen in ihm auch längst verloren waren.
Ich wandte mich ab, da ich nicht länger hinsehen wollte. Nun war es an der Zeit die Eltern des Kindes zu finden, das ich hier im Arm trug, und ihnen ihre geliebte Tochter wiederzugeben. Und das Lächeln und die Dankbarkeit, das waren nur zwei der Gründe, aus denen ich ein Savior geworden war.
„Geht es dir gut?“, fragte ich das Mädchen und sie lutschte an ihren Fingern herum, sah mich mit großen Augen an. Das arme Kind hatte keine Ahnung, was gerade passiert war. Nur der laute Lärm war für sie ein Grund, dass ihr die Tränen in die Augen stiegen und ich sie in meinen Armen wiegen musste.
Bei der Gelegenheit gab ich den Befehl an meine Savior-Watch:
Dokumentiere – Mission erfolgreich beendet.
Kapitel 2
Vielleicht habt ihr nicht ganz verstanden, was da gerade abgelaufen ist. Keine Sorge, ich werde es euch erklären.
Ich saß nämlich nur ein paar Stunden später in unserer Abteilung der Savior Agency und wartete. Wir einigen uns einmal darauf, dass sich Zeitangaben nach meinem Zeitempfinden richten. Eigentlich, wenn wir nach dem Fluss der Zeit gehen, war es mehrere Tage später. Das Leben eines Zeitreisenden ist verwirrend.
Durch den Gang liefen ab und zu schwerbeschäftigte Saviors, telefonierten oder sprachen mit ihrer Watch. Ich nicht, ich saß einfach nur da und wartete auf Lewis, der mich dort abholen wollte.
Natürlich war ich müde nach diesem Auftrag. Mein Kopf schmerzte an der Stelle, an der ich auf den Gleisen aufgekommen war. Ich hatte mich noch nicht einmal umziehen können. Meine Hose war staubig und an den Knien zerrissen, mein Hemd sah ähnlich mitgenommen aus.
Ich besaß keine Arbeitskleidung. Wenn die Menschen jemanden in einem T-Shirt mit dem Savior-Logo sehen würden, würde bei ihnen wahrscheinlich die blanke Panik ausbrechen. Denn wo ein Unglück geschehen sollte, da waren wir.
„Sie sehen nicht gut aus“, sagte nun plötzlich der Schatten vor mir und ich musste den Kopf heben, um in Lewis’ Gesicht zu sehen. Ich konnte den wahren Ausdruck darauf nicht deuten, aber mein Boss verzog die schmalen Lippen zu einem Lächeln.
„Kommen Sie, Mr Dagger? Ich muss mit Ihnen sprechen. Am besten, wir gehen in mein Büro.“
Ich hob überrascht die Augenbrauen, stand aber auf. Man konnte ein persönliches Gespräch positiv oder negativ deuten. Ich bekam trotzdem immer Knie wie Pudding. Dieser Beruf war das, was mich erfüllte, es machte mir Spaß, andere Menschen zu retten. Es gefiel mir.
Also folgte ich Lewis und schaute dabei zu, wie dieser die Tür zu seinem Büro aufschloss. Diese Abteilung des Gebäudes war etwas ruhiger. Hier waren die großen, schönen und lichtdurchfluteten Räume, in der riesigen Halle mit Treppenhaus stand ein Wandbrunnen aus Schiefer und alles andere war aus Glas: Wände, Treppen, Aufzüge. Ich fragte mich jedes Mal, wenn ich durch diesen Teil der Agency schlenderte, wer den dunklen Boden immer so rein und gewischt hielt. Es grenzte an Zauberei.
Lewis hielt mir die Tür auf, was mich verunsicherte. Ich betrat den hellen Raum, ging an dem Namensschild vorbei, auf dem stand: W. Lewis – Abteilungsleiter.
Tatsächlich war Lewis manchmal etwas wie eine Vaterfigur für mich. Trotzdem war ich aufgeregt wie ein kleines Schulmädchen vor seinem ersten Tag in der ersten Klasse. Ich war kurz davor auf den Füßen zu wippen, aber ich riss mich zusammen.
Lewis bot mir an, mich vor seinen Schreibtisch zu setzen, während er dahinter Platz nahm. Ich fing sofort zu brabbeln an.
„Mr Lewis, ich wollte Ihnen sagen, dass es eine Ehre war, diesen Auftrag erfüllen zu dürfen und dass ich solchen Aufträgen auch in Zukunft gerecht werde, ich…“
Er hob eine Hand und brachte mich zum Schweigen.
Ich wusste, dass viele meiner Kollegen hinter meinem Rücken über mich sprachen, sich über mich lustig machten, weil ich so ein Arschkriecher war. Aber wie sagte ich immer? Besser Arschkriecher als Arschloch. Und wenn man beides war: gute Nacht. Ich jedenfalls war mit meinem Ruf als Arschkriecher zufrieden. Sollten die anderen doch reden. Ich war ein erwachsener Mann und kein Teenager-Mädchen, was sich über so etwas aufregen musste.
„Mr Dagger, ich weiß Ihre Leistungen sehr zu schätzen. Ich habe Sie auf diesen Auftrag geschickt, weil meine erste Wahl versagt hat. Sie waren der Zweite, der sich auf diese Mission begeben hat. Stellen Sie sich vor, Cole hat bei der falschen Brücke auf den Zug gewartet. Ist das zu glauben?“
Er prustete los und ich zwang mich zu einem höflichen Grinsen, während mir das Blut in den Kopf schoss. Ich musste lächerlich aussehen.
„Jedenfalls“, fuhr Lewis fort, „wollte ich Ihnen dafür danken. Ich hatte Sie unterschätzt.“ Er faltete die Hände vor sich auf dem Schreibtisch aus dunklem Nussbaumholz, dann sah er mir direkt in die Augen. „Deshalb befördere ich Sie mit sofortiger Wirkung zum Sonderbeauftragten für Spezialmissionen. Ab morgen können Sie in Ihr eigenes Büro einziehen. Ich wünsche Ihnen viel Glück.“
Meine Kinnlade fiel nach unten.
Also das hatte ich nicht erwartet.
Kapitel 3
Das Savior-Agency HQ lag in einer Zeitblase. Wir alle, die eine Savior-Watch trugen, kannten die Veränderungen und Abweichungen der einzelnen Timelines. Als ich an meine Uhr gebunden wurde, war das ein kleiner Schock. Nicht nur, weil die Uhr an mein Leben und somit mein Leben an die Zeit gebunden wurde. Nein, ich hatte seitdem auch den Durchblick. Die Zeit gehörte zu mir.
Savior Agency, das war ein Name, der an Anerkennung gewonnen hatte. Die Organisation bestand zu dem Zeitpunkt seit etwa zehn Jahren und die Aufgabe von uns Saviors war eine besondere: Die Uhren halfen uns, uns im Zeitstrom zu bewegen. Wenn ein Kunde kam und für einen Auftrag bezahlte, dann retteten wir dem Menschen das Leben, den er vor kurzem verloren hatte. Es war eigentlich ganz leicht.
Ich fuhr mit den Fingern über meinen neuen Schreibtisch in meinem neuen Büro. Mein erstes Büro, um genauer zu sein. Ich hatte nie ein eigenes Büro gehabt. Seit bestimmt fünf Jahren war ich Agent bei der Savior Agency. Ich konnte nur schätzen. Ich wusste nicht einmal genau wie alt ich war, so oft war ich schon in der Zeit gesprungen. An Tagen konnte ich das nicht mehr messen.
Und nun stand ich hier in meinem eigenen Büro. Ich hatte sogar mein eigenes Namensschild aus silbrigem Metall. Ich wurde als Sonderbeauftragter für Spezialfälle betitelt, obwohl ich nicht wusste, was ich mir darunter vorstellen sollte, da mein erster Auftrag erst heute reinkommen würde. Aber ich konnte das. Immerhin hatte ich noch nie einen Auftrag komplett verhauen, niemals.
Der Sessel war viel zu groß und viel zu weich, als dass man darin sitzen konnte. Aber immerhin konnte man sich damit drehen. Ein Drehstuhl – endlich!
Ich ließ mich fallen und drehte mich einige Runden auf der Stelle, sah Holz und Glas und künstliche Zimmerpflanzen an mir vorbeirauschen. Ich konnte meine Freude nicht verbergen und war für den Moment wieder fünf Jahre alt. Aber nur bis die Tür aufging und mein Stuhl zu einem jähen Stopp kam.
„Oh, es tut mir leid“, sagte die ältere Frau, die in meiner Bürotür (ich betone: meiner Bürotür!) stand. „Ich hätte klopfen sollen, ich hätte…“ Ihre Stimme brach ein, obwohl ich nichts gesagt hatte. Sie versagte einfach mitten im Satz. So stellte ich fest, dass mit ihr gerade mein erster Auftrag ins Zimmer gekommen war, denn sie trauerte eindeutig.
„Was kann ich für Sie tun? Möchten Sie einen Kaffee, Mrs…?“
„Nein, danke. Und nennen Sie mich Betty.“ Sie zwang sich zu einem Lächeln. Ihr ergrautes Haar zeigte Spuren von Braun und ihre Augen waren freundlich. Sie war leicht rundlich und sah so aus, wie man sich die freundliche Dame von nebenan vorstellte, die immer gerne selbst gebackene Kekse vorbeibrachte. Dazu trug sie eine Strickjacke in zartrosa.
„Setzen Sie sich doch, Betty“, bot ich an und deutete auf den Stuhl vor meinem Schreibtisch. Betty nickte und setzte sich. Ihre Finger umklammerten zitternd eine kleine Handtasche, die mit Rosenblüten bestickt war.
Auch mein Stuhl bekam mich zurück. Ich wurde förmlich verschluckt von dem Monstrum aus Kunstleder. Dann sah ich Betty abwartend an.
Sie holte tief rasselnd Luft. „Also, Mr…“ Sie blickte auf mein brandneues Namensschild. „… Dagger. Ich habe gehört, Sie nehmen sich den besonderen Fällen an und…“ Sie schluckte und kniff die Augen zusammen.
Ich blinzelte. Ich hatte noch nie Kunden persönlich empfangen und jetzt wusste ich auch wieso. „Beruhigen Sie sich, Betty. Atmen Sie einmal tief durch und sagen Sie mir ganz genau, was ich wissen muss. Wen haben Sie verloren?“
Ihre Augen mieden meinen Blick. Stattdessen schaute sie auf ihre zitternden Hände und befolgte meinen Rat, atmete tief durch. Dann, endlich, hatte sie die Kraft zu sprechen. „Ich möchte Sie beauftragen, dass Sie jemanden retten. Er ist vor zwei Wochen gestorben. Ich konnte erst heute kommen, früher habe ich es nicht geschafft.“
Ich versuchte, ihr nach und nach alle wichtigen Fragen zu stellen: „Wie hieß er denn?“
Nun schaute sie auf und einer ihrer Mundwinkel deutete ein halbes Lächeln an. „Sein Name war Hektor.“
„Hektor“, wiederholte ich langsam. „Wie der Trojaner.“
„Ganz genau“, sagte sie und ihre Stimme klang sehr leise und tonlos. „Er war mein Neffe. Wir hatten eine ziemlich gute Beziehung, aber ich konnte ihn nur selten besuchen. Ein armes Kind war er, die Eltern schon gestorben, da war er noch ganz klein. Er ist nicht bei mir aufgewachsen, ich hätte mich nicht um ihn kümmern können, sondern er bekam Pflegeeltern zugesprochen – mehrere Male. Er war nämlich sehr besonders, müssen Sie wissen. Deshalb wechselte er so oft. Kein Elternpaar kam mit ihm klar. Und es tut mir so unendlich leid, dass ich ihn nicht nehmen konnte. Er war ein Mensch mit diesem außerordentlichen Talent.“
Ich fragte mich zwar die ganze Zeit, warum mir Betty nun lang und breit die Lebensgeschichte ihres Neffen erzählte, aber nun wurde ich doch hellhörig. „Was denn für ein Talent? War er Sportler? Wissenschaftler? Koch?“
Ihr Lächeln wurde deutlicher und stolzer. „Künstler.“
Okay. Künstler waren Menschen, die ich nicht leiden konnte. Vielleicht fehlte mir die Gabe, aber ich sah einfach in einem blauen Strich an einer weißen Wand kein Kunstwerk. Das konnte ich auch. Man gebe mir einen Eimer mit blauer Farbe und ich erschaffe ein Kunstwerk, mehr gibt es da nicht zu sagen. Jeder, der sagte, er erkenne in diesem Strich eine höhere Botschaft als pure Willkür, der log schlichtweg. Da gab es nichts zu erkennen. Das war bloß ein blauer Strich an einer weißen Wand. Aber natürlich wollte ich Betty nicht enttäuschen und mir ihren Bericht weiter anhören.
„Er war Künstler und was er erschaffen hat, das konnte einen verzaubern. Keiner hat es gesehen, niemand hat bemerkt, was für wunderschöne Bilder er geschaffen hat. Es hat einem das Herz brechen können. Viel Geld hatte er nicht und vor ein paar Monaten sind seine Mitbewohner ausgezogen und haben ihn allein gelassen.“
„Ich weiß, dass ist sicher schwer für Sie…“, sprach ich mit allergrößter Vorsicht. „Könnten Sie mir möglichst genau erklären, wie und wann Hektor gestorben ist? Es ist schwer, aber leider notwendig, damit ich mich am richtigen Ort zur richtigen Zeit befinde.“
Sie nickte und fummelte geschäftig an den Rosen auf ihrer Tasche herum. „Er… Er hat sich umgebracht.“ Ihr Atem rasselte. „Vor genau zwei Wochen, auf den Tag. Am Dienstag. Hat eine Handvoll Tabletten geschluckt, sich in sein Bett gelegt und ist wahrscheinlich eingeschlafen. Ich weiß es nicht genau, sie wollten mir nicht sagen, ob er Schmerzen hatte oder nicht. Noch am selben Tag hat ihn der Paketbote gefunden, weil die Tür offen stand. Dann haben sie mich angerufen und… Das war es.“ Das Lächeln war noch da, allerdings diente es jetzt wohl nur noch dazu, die Tränen zurückzuhalten.
Ich nahm mir einen Bleistift aus dem Döschen auf meinem Tisch und tippte damit auf meiner Tischplatte herum, schwenkte ihn zwischen den Fingern. „Ich verstehe. Und ich soll nun zu diesem Tag reisen und verhindern, dass Ihr Neffe… tut, was er tut.“
„Nein.“
Ich sah auf. „Nein?“
Sie bestätigte: „Nein.“
„Gut… Was soll ich dann tun?“
„Ich möchte nicht, dass Sie ihn bloß von dieser Tat abbringen. Wenn Sie das machen, wird er es ein zweites Mal versuchen und er wird seines Lebens nicht mehr glücklich sein. Ich möchte, dass sie weiter zurückreisen. Ich bezahle ihnen ein Vermögen, wenn Sie Hektor ein Freund sind und ihm einen Grund geben, weiterzuleben.“
Völlig perplex starrte ich sie an und wusste nicht, was ich denken sollte. Diese Frau verlangte von mir viel mehr, als mir beigebracht wurde. Viel zu viel!
„Betty, das ist nicht meine Aufgabe. Es tut mir leid. Ich biete Ihnen an, Hektor von seinem Selbstmord abzubringen, aber wenn er es noch einmal versucht, kann ich nichts dagegen tun.“
„Deshalb bitte ich Sie, dass Sie es versuchen. Reisen Sie ein paar Monate zurück in der Zeit und finden Sie Hektor. Ich gebe Ihnen alles, was ich habe. Er war doch so allein. Bitte helfen Sie ihm.“ Nun brachte auch das Lächeln nichts mehr. Es fiel von ihrem Gesicht und sie schlug die Hände vor ihre Augen, um zu verbergen, dass sie weinte. Ich sah es trotzdem, ihre Schultern hoben und senkten sich kurz und schnell, da sie schluchzte.
Weinende Menschen verwirrten mich. Ich wollte etwas tun, aber ich hatte das Gefühl, dass ich es mit jedem einzelnen Wort nur noch schlimmer und schlimmer machte. Ich wollte helfen, aber niemanden verletzen. Weinende Menschen führten bei mir zu einem Konflikt zwischen mir und mir. Es war egoistisch, das wusste ich selbst. Aber diesmal hatte ich die Wahl. Ich konnte Betty enttäuschen oder ich konnte meine Meinung ändern.
„Vielleicht lässt sich da was machen…“, murmelte ich und schon sah Betty wieder auf. Ihre Augen waren rot angelaufen und glänzten von den Tränen.
„Das würden Sie tun?“
„Jaaa…“, antwortete ich zögernd. „Es ist möglich, dass ich das mache. Aber ich kann nicht versprechen, dass mein Chef damit einverstanden sein wird.“
„Oh, Ihr Chef hat gesagt, dass Sie das möglich machen können. Er sagte, es hinge von Ihrer Entscheidung ab.“
Verdammt, Mr Lewis. Ich knirschte mit den Zähnen. Nie bekam man hier gesagt, wenn etwas Besonderes anstand. Aber ich ließ mir nicht anmerken, dass ich über das Verhalten meines Chefs ein wenig verärgert war. Ich lächelte Betty zu und diese wischte sich die Tränen aus dem Gesicht.
„Ich nehme den Auftrag an, Betty. So wie es aussieht, werde ich Urlaub in der Vergangenheit machen müssen. Besser, ich packe gleich.“
Lewis stand neben mir und überprüfte noch einmal die Zeit auf meiner Savior-Watch. Es war wichtig, dass er das machte. Wenn es ein Problem gab, würde mich die Uhr in den Tod reißen. Und dann würde mein Körper für immer in der Raumzeit verschwinden.
Vielleicht sollte ich erwähnen, mein Beruf ist nicht ohne Risiko. Wenn ein und dieselbe Person mehrere Male zur selben Zeit existiert, dann wird diese strapaziert. Die Zeit ist nämlich wie ein Gummiband. Je öfter sie gedehnt wird, desto mehr Risse bekommt sie – und vielleicht, irgendwann, könnte sie reißen. Und genau aus diesem Grund spielen wir auch nicht mit der Zeit herum. Somit wird sie auch niemals reißen. Problem gelöst. Dennoch besteht ein Risiko für mich, diese Lebensgefahr. Aber wir stellen die Zeit über uns, ansonsten wären wir schon alle in einem Zeitstrudel gefangen.
Opfer mussten gebracht werden, obwohl es wirklich nur äußerst selten geschah, dass ein Agent in der Zeit verloren ging. Zweimal bis jetzt, ich brauchte mir also kaum Sorgen zu machen.
„Sind Sie bereit?“, fragte Lewis mich und ich hob die große Sporttasche mit meinen Sachen hoch. Meine Besitztümer hatte ich in dieses Ding gestopft, jedenfalls alles, was mir wenigstens ein bisschen wichtig war.
Wir hatten einen speziellen Raum für die Abreise und Ankunft von Agenten. Alles hatte seine Ordnung.
Wenn wir in der Zeit reisten, bildete sich für kurze Zeit eine Blase um uns herum. Alles, was in dieser Blase war, wurde in der Zeit befördert. Wenn dir also jemand zu nahe stand und beispielsweise ein Arm dieser Person in die Blase gelangte: Tja, dann reiste der Arm eben alleine mit dem Agenten. War alles schon passiert.
Jetzt aber hatte ich nicht vor, irgendwelche meiner Kollegen mit mir zu reißen, weshalb wir spezielle Kabinen hatten. Ich stellte mich also in eine dieser weißen Kabinen, die zu drei Seiten weiße, feste Wände hatten. So konnte mir niemand zu nahe kommen.
Natürlich hätte die Blase auch die Wände mit eingeschlossen, aber es war genug Platz, sodass ihre Ränder nicht bis zu den Wänden reichten. Dafür sorgte ein großes X auf dem Boden, das die Position angab, an die ich mich stellen musste. Genau das tat ich, stellte mich in die Mitte des großen X’ und Lewis sah mich von weitem aus an. Er sah aus, als wüsste er bereits, dass ich für ihn in wenigen Momenten wieder mit einer Nachricht zurück sein würde. Für ihn würden nur wenige Sekunden vergehen – für mich sechs Wochen. Ich hatte sechs Wochen, um den erfolglosen Künstler zu retten.
Das würde nicht allzu schwer werden, trotzdem hatte ich Bedenken, weil ich noch nie mit Menschen umgehen konnte. Aber das tat nichts zur Sache. Ich hatte eine Mission zu erfüllen und genau das würde ich tun. Ich musste schließlich keine Bombe entschärfen oder mich vor einen fahrenden Zug schmeißen, ich musste einfach nur mit diesem Mann reden und ihn retten. Das tat ich immer. Und ich hatte kein einziges Mal in meinem ganzen Leben versagt, niemals während meiner Zeit in diesem Traumberuf.
Ich schaute auf das Display meiner Uhr. Die richtige Adresse war eingegeben und auch die richtige Zeit. Genau zwei Monate. Natürlich hatte ich mir alle wichtigen Informationen eingespeichert und kannte sie sogar auswendig. Nur zur Sicherheit.
Lewis nickte mir zu und ich lächelte selbstsicher. Dann drückte ich auf das grüne Feld, welches soeben auf meiner Uhr erschienen war.
Und versank in der Zeit.
Kapitel 4
Ich wusste nicht, wo ich war. Der Wirbel aus verwischten Farben legte sich langsam und ich sah eine Straße, die mit gepflegten Vorgärten gesäumt war.
Ich musste zum Haus mit der Nummer 23. Schnell gefunden war es nicht, ich hatte manchmal den Orientierungssinn einer Steckrübe (ich sage nur Brücke). Aber als ich das richtige Haus gefunden hatte und es betrachtete, bekam ich ein eigenartiges Gefühl. Es war, als würde ich mich zu dem Ort hingezogen fühlen. Nicht nur wegen meines Auftrags, sondern einfach so.
Ich musste klingeln, eine unsichtbare Kraft drängte mich dazu.
Ich stieg die zwei Treppenstufen nach oben, auf das blau gestrichene Haus zu. Es war ein Bungalow, nicht sonderlich groß, aber schön anzusehen.
Mein Daumen drückte auf den Klingelknopf. Zwar nach kurzem Zögern, was mir gar nicht ähnlich sah, aber letztendlich überwand ich mich. Eine angenehme Melodie ertönte und ich war überrascht. Ich hatte ein schrilles, nervenzerreißendes Klingeln erwartet.
Lange Zeit stand ich nicht vor der Tür, bis etwas geschah. Aber was geschah, das verwirrte mich wirklich sehr.
Die Tür öffnete sich einen Spalt. Es war nur ein Haarbreit und ich konnte die Gestalt dahinter nicht ausmachen. Aber ich wusste, derjenige hinter dieser Tür sah mich an.
„He, du.“ Das waren die ersten Worte, die ich von ihm hörte. Einfach nur He, du. Keine großen Fragen, kein Gehen Sie wieder weg oder Was ist Ihr Anliegen? oder etwas Ähnliches.
„Hey“, entgegnete ich erstaunt und hob eine Hand zum Gruß. „Ich bin hier wegen… öhm… also…“
„Wegen der Wohnung?“
„Bitte was?“
„Na, willst du dir die Wohnung anschauen? Seit die anderen weg sind, ist es etwas unaufgeräumter als sonst und ich glaube, irgendjemand hat im Wohnzimmer mit Sprengstoff um sich geworfen, aber das heißt nicht, dass wir das nicht wieder erledigen können, ich meine…“
„Entschuldigung, aber können… kannst… äh… Kannst du die Tür aufmachen? Ich seh’ dich schlecht.“
Eine kurze Pause entstand, in der er nachzudenken schien, und ich schaute nur auf die Tür und wartete. Es dauerte tatsächlich einige Sekunden, bis er sich entschloss und die Tür komplett öffnete.
Ich muss zugeben, ich war fast vollkommen planlos gekommen, nach dem Motto, mir würde schon ein Grund einfallen, warum ich bei irgendwelchen Fremden an der Tür klingelte. Aber nun war mein Plan, den es nicht gab, geändert. Ich hatte die Tatsache, dass Hektor vor kurzem mehrere Mitbewohner verloren hatte, komplett außer Acht gelassen. Ich hatte mir sogar schon überlegt, wo ich die Nacht oder die nächsten sechs Wochen verbringen sollte, aber wenn ich direkt einzog, würde das wohl passen.
Dazu war ich es gewohnt, mit zukünftigen Toten zu sprechen. Bei meinen ersten Einsätzen war ich noch sehr aufgeregt gewesen, wenn mich eines der Opfer angesprochen hatte. Oder ich das Opfer, wie dieses Mal.
Ich sah mir Hektor in Ruhe an und überlegte derweil, ob dieser Auftrag so eine gute Idee gewesen war. Dieser Mann sah aus, als hätte er in die Steckdose gefasst und das nicht zu knapp. Seine braunen Haare standen gerade von seinem Kopf ab und er wirkte blass wie eine Leiche. Was er im Grunde genommen auch war. Nichts weiter als eine Leiche. Eine Leiche, mit der ich mich wohl oder übel anfreunden musste.
Deshalb machte ich den Anfang und begann zu lächeln. „Darf ich reinkommen?“
Hektor, oder zumindest glaubte ich, dass es Hektor war – jemand anderen hatte ich nicht erwartet – schaute nach links oben, dann wieder zu mir, dann wieder nach links oben und dann wieder zu mir. Ich verlor die Geduld.
„Also?“
„Ich überlege noch.“
„Was gibt es da zu überlegen?“
„Eine ganze Menge, schätze ich.“ Er machte einen Schritt zur Seite und deutete mit einer Handbewegung an, dass ich das Haus betreten durfte.
Der Kerl war mir suspekt. Besonders seine Haare. Ich hatte nicht gedacht, dass irgendein Mensch so eine Frisur ohne einen Weltvorrat an Haargel zustande bringen konnte, aber Hektor war der Beweis, dass ich mich irrte.
Der Flur war sehr eng und es lagen Taschen, Rucksäcke und Jacken verstreut auf dem Boden. Die Wände waren weiß und blau gestrichen und es roch irgendwie eigenartig. Aber diesen seltsam beißenden Geruch ignorierte ich erst einmal und sah Hektor an, der noch immer an der Tür stand.
Wie eine Waldelfe, ein besserer Vergleich fällt mir dazu nicht ein, schwebte er nun an mir vorbei und ging durch die erste Tür rechts von mir. „Wie heißt du denn? Ich bin Hektor, aber das hast du sicher schon in der Anzeige gelesen. Nur kann ich deinen Namen nicht hellsehen. Würde ich gerne können, zugegeben. Hellsehen muss etwas Tolles sein. Aber ich bin kein Hellseher, ich bin sogar ziemlich blind, ich habe neulich meinen Schlüssel verlegt und mich ausgesperrt. Drinnen hab ich dann nach ihm gesucht und irgendwann gemerkt, dass er in meinem Spülbecken lag. Ich weiß bis heute nicht, wie der da hingekommen ist.“
Ich blinzelte. Mir war nicht gesagt worden, dass der Typ so viel redete. Ich hatte ihn mir ehrlich gesagt ganz anders vorgestellt. Irgendwie… trauriger. Der Mann vor mir war die Lebensfreude in Person.
„Also, hier haben wir die Küche, da ist besagtes Waschbecken. Das dort ist die Spülmaschine, alles ganz fein. Oder zumindest war es mal fein. Ich entschuldige mich für die Flecken auf dem Boden, einer meiner alten Mitbewohner hat dahin gekotzt, als er besoffen nach Hause kam, und ich musste mitten in der Nacht die Fliesen schrubben. Ist etwas ausgeartet, deswegen sind sie an der Stelle heller. Das Haus hat halt hier und da ein paar Gebrauchsspuren. Ich hoffe, du kommst damit klar. Du hast mir noch immer nicht deinen Namen gesagt.“ Er blieb stehen, verschränkte die Arme vor der mageren Brust und sah mich erwartungsvoll an, bis ich wusste, dass ich jetzt antworten musste.
„Joshua. Joshua Dagger. Ich arbeite…“ Jetzt komm schon, denk dir was aus! Wo arbeitest du? Du darfst ihm nicht sagen, dass du ein Savior bist. Er wird Angst bekommen, weil du seinen Tod ankündigen könntest. Du bist hier, um ihn zu retten, dazu sind Saviors da.
„Ich arbeite in einem Restaurant.“
„Super! Dann kannst du ja kochen!“
Ich konnte nicht kochen. „Nein, ich bin da bloß… die Bedienung. Ist ein sehr gutes Restaurant, sehr vornehm. Und du?“ Ich wusste es natürlich schon, aber ich fragte trotzdem nach.
Da breitete sich das stolzeste aller Lächeln auf Hektors Gesicht aus. Und ich konnte nicht anders, als das Lächeln zu erwidern, denn er wirkte wirklich begeistert von der Frage, als würde er jeden Moment auf den Küchentisch springen und einen Bauchtanz vollführen. Da ich ihn nicht einschätzen konnte, hoffte ich inständig, dass das nicht eintreten würde.
Ich schüttelte das Bild ab, das vor meinem inneren Auge entstanden war. Wahrscheinlich machte ich nun ein verkrampftes Gesicht und sah vollkommen lächerlich aus.
Aber dann führte Hektor mich um die nächste Ecke und ich sah das Wohnzimmer und somit auch Hektors Bilder zum ersten Mal.
Ein besonders großes Gemälde hing über dem kleinen Fernseher. Es sprang sofort ins Auge. Darauf zu sehen war ein Gesicht. Das schöne Gesicht eines Mädchens mit Blumen im Haar. Aber die Blumen waren nicht das Auffälligste, sondern die vielen Zahnräder, die sich um ihren Kopf legten. In verschiedenen Größen, aus verschiedenen Metallen, in verschiedenen Farben.
Hektor sprach weiter. „Das mache ich. Ja, die Bilder sind verbesserungswürdig und es geschieht eigentlich nur sehr selten, dass mir etwas abgekauft wird. Weißt du, deshalb kann ich es mir nicht leisten, hier alleine zu wohnen.“
Eine kurze Pause entstand. Aber diesmal sah ich mich erstaunt um.
„Aber nicht, dass du denkst, ich wäre zu faul zum Arbeiten oder so, wirklich nicht. Ich arbeite sehr viel, nur male ich eben. Das ist auch arbeiten. Wirklich, also wenn du mir nicht glaubst…“
„Nein, ich schaue mich doch bloß um. Schön ist es hier, die Bilder schaffen eine angenehme Atmosphäre. Ich denke, wir würden gut miteinander auskommen. Denkst du, ich kann heute schon hier einziehen?“
Jetzt verengte Hektor seine Augen zu Schlitzen. „Ich kenne dich nicht. Du könntest mich im Schlaf ermorden und meine Leiche durch den Fleischwolf drehen, mich anschließend essen und diabolisch gen Himmel lachen. Und wahrscheinlich verspeist du mich mit Sahnesoße. Roh, versteht sich.“
„Sehe ich so gefährlich aus?“
„Nein, aber man kann ja wohl noch Misstrauen gegenüber gruseligen Fremden haben, oder?“
„Ich bin gruselig?“
„Und wie. Noch nie hat jemand an meiner Tür geklingelt und gefragt, ob er bei mir wohnen kann, nachdem er sich gerade einmal das halbe Haus angeguckt hat. Setz dich doch und erzähl mir, warum du das machst.“
Na schön. Jetzt würde ich alles erzählen müssen, was ich mir vorher ausgedacht hatte. Ich bin nicht kreativ, was solche Dinge angeht. Ganz im Gegenteil. Aber dennoch setzte ich mich jetzt auf das alte Sofa und hörte das ohrenbetäubende Quietschen der rostigen Federn im Polster. Man konnte schon anhand der vielen bunten Flicken erkennen, dass dieses Sofa durch mehrere Generationen gegangen war. Und dieses Quietschen hätte nicht lauter sein können.
Hektor blieb stehen, was ich zu ignorieren versuchte.
„Nun“, begann ich. „In meiner alten Wohnung habe ich mit meiner Freundin gewohnt. Jetzt Exfreundin. Leider hat sie mich rausgeschmissen. Ich bin noch nicht darüber hinweg, natürlich nicht. Es war immerhin erst gestern. Aber ich muss mir einen neuen Wohnsitz suchen, so schnell wie möglich. Und mir ist alles recht, egal wie die anderen Zimmer aussehen mögen. Du bist in allen Häusern und Wohnungen der einzige Mitbewohner, der mir sympathisch genug erscheint, dass er mich aufnehmen könnte.“
Das Lügen fiel mir so unglaublich leicht, dass es mich selbst überraschte. Aber ich durfte meine wahre Identität nicht preisgeben. Ich hoffte, dass Hektor mich anhand meiner Uhr nicht als Savior erkannte, aber genau aus diesem Grund waren Uhren entwickelt worden, die ganz genau so aussahen wie unsere Savior-Watches. Und die waren der allerletzte Schrei. Also sahen unsere Uhren aus wie normale Uhren und normale Uhren sahen aus wie unsere.
Mein Herz setzte einen Schlag aus, als Hektor einen Blick auf mein Handgelenk warf, aber er sagte nichts.
„Das hättest du mir früher sagen sollen. Ich habe ein Herz für die Verstoßenen und Vergessenen. Ich kann kein Tierheim betreten, ohne in Tränen auszubrechen.“ Er lachte und legte eine Hand direkt über besagtes Herz. „Du kannst gerne bleiben. Sieh dir alles in Ruhe an, aber mein Zimmer ist tabu. Und falls du mich doch essen willst, die Tür dazu ist nachts abgeschlossen. Und wenn du eine Tierhaar-Allergie hast, dann würde ich dir ohnehin nicht empfehlen, es zu betreten.“
„Wir haben noch einen Mitbewohner?“
Hektor nickte, wobei seine Haare ein Kunststück vollführten. „Willst du ihn sehen? Soll ich ihn holen?“ Er wartete keine Antwort ab, sondern lief schon den zweiten Flur im Haus entlang. Ich hörte ein paar scheppernde Geräusche und fragte mich, was da hinten gerade vor sich ging, dann schlug eine Tür zu und Hektor kam zurück. Ich sah ihn an und er erwiderte den Blick, aber sein Gesicht verriet nicht, wo denn jetzt besagtes Haustier war. Dann schaute eine Schnauze hinter seinem Ohr hervor und ich zog beide Augenbrauen hoch.
Er nahm den Haufen Fell von seiner Schulter und in seine Hand. Das Tier, das er mir entgegenhielt, guckte mich grimmig an. So grimmig, wie Ratten nun mal gucken konnten.
Vorsichtshalber wich ich ein kleines Stück zurück. „Die sieht ja… freundlich aus.“
Hektor nahm die Ratte in eine Hand und zeigte mir den Zeigefinger der anderen. Eine lange Narbe zog sich über den ganzen Finger bis hin zum Handrücken. „Das hat er angestellt, als ich ihn gekauft habe. Aus dem Grund habe ich ihn Achilles genannt. Ein wenig schwarzer Humor hat noch nie geschadet.“
Ich glaubte, die Ratte schnauben zu hören, und er setzte sie sich wieder auf die Schulter. „Ich hoffe, du hast nichts gegen Ratten. Sonst gibt es schon zwei Menschen in diesem Haushalt, die das kleine Kerlchen hassen. Aber süß ist er doch, nicht wahr? Ich schwebe gerade ein bisschen in Lebensgefahr. Ich sollte ihn wirklich nicht so nah an meinen Hals lassen.“ Ihm wurde anscheinend gerade die Situation bewusst, und dass er gerade eine aggressive Ratte auf seiner Schulter sitzen hatte, deshalb lief er plötzlich schnell davon und ich war wieder allein.
Schräger Typ, schoss es mir durch den Kopf. Aber viele Künstler waren schräg und ich musste mich daran gewöhnen, dass ich die nächsten sechs Wochen hier mit ihm verbringen sollte.
Ich sah mich erneut um. Ja, es war wirklich sehr klein und eng hier und die vielen farbenfrohen Bilder dämmten den Platz noch einmal ein. Aber dafür war es gemütlich. Jedenfalls wenn man von dem alten, quietschenden Sofa einmal absah. Die Zimmer waren das Gegenteil von schmucklos, also das Gegenteil meiner Wohnung am Savior Agency HQ.
Ich war nicht der Typ, der gerne Bilder aufhängte oder gerahmte Fotos auf Kommoden und Tische stellte. Ich hatte nicht einmal Vorhänge, nur graue Fensterläden. Einrichtung war für mich überflüssig. Aber in diesem Haus fiel mir auf, dass man sich wirklich wohl fühlte mit vielen persönlichen Gegenständen um einen herum. Der Wohnzimmertisch musste mit einem Buch (Kunst – Malen und Zeichnen für Idioten) gestützt werden und jedes Polster war mindestens dreimal geflickt worden. Der abgenutzte Dielenboden quietschte ebenso schrill wie das Sofa, nur nicht annähernd so laut. Der eigenartige Geruch kam wahrscheinlich von der Farbe, die auf einem der vielen Bilder noch leicht nass schimmerte.
Ich fühlte mich tatsächlich wohl. Vielleicht sollte ich das nicht in der Wohnung eines Toten. Andererseits würde er bald nicht mehr tot sein.
Der Tote kam schon wieder zurück und diesmal setzte er sich mir schräg gegenüber im Schneidersitz auf den Fernsehsessel. Die Ratte hatte er anscheinend in ihren Käfig entsorgt. Er strahlte jetzt wieder. „Also, ich wollte heute Abend zum Chinesen gehen. Vielleicht möchtest du mitkommen, dann können wir uns ein klein wenig austauschen. Du kannst mir sagen, woher du kommst und was du gerne machst. Was ich gerne mache, ist kaum zu übersehen.“ Er lachte wieder und seine Augen blitzten auf. Es war, als zitterte er vor Freude, immer wenn er die vielen Bilder ansprach.
Ich nickte. Es war ein guter Vorschlag. Ich musste mich mit ihm anfreunden, ich musste. Das war meine Mission. Meine Mission war noch nie gewesen, dass ich mich mit jemandem anfreundete. Ich konnte das nicht. Ich hatte ja schon in der Gegenwart keine Freunde, warum sollte ich es in der Vergangenheit schaffen? Aber ich würde diese Mission nicht abschließen können, wenn ich mich nicht mit Hektor anfreundete. Ich musste ihm sagen, was er hören wollte, ich musste zu der Person werden, die er brauchte. Das klang so schrecklich leicht. Himmel, ich war kein Therapeut.
Ich lächelte, legte meine Tasche neben dem Sofa ab und zuckte mit den Schultern. „Ich habe heute nichts mehr vor. Essengehen klingt super, wann soll’s denn losgehen?“
Hektor schaute an die Decke. „Von mir aus gleich, ich muss mich nur umziehen. Warte hier oder bring deine Sachen in dein Zimmer. Den Flur runter, die letzte Tür links. Die erste Tür ist das Badezimmer. Also wenn du dich waschen willst oder so, geh dahin. Wir haben nur fünf Minuten Fußweg.“
Fünf Minuten bis zu einem vernünftigen Restaurant. Mich hätte es schlimmer treffen können. Aber so ließ es sich tatsächlich aushalten, ich würde jedenfalls nicht verhungern. Ich stand auf, nahm meine Tasche wieder an mich und bewegte mich in Richtung des besagten Zimmers. Ein Blick in den Raum und mir war klar, dass mir ein paar schlaflose Nächte bevorstanden.
Ich war meine moderne Wohnung gewöhnt, mit den schwarzen und weißen Möbeln und den grauen Wänden. Aber hier war eine komplette Wand blau gestrichen. Es war ein schönes Blau, zugegeben, aber Blau störte mich einfach. Farben störten mich beim Einschlafen. Ich wusste nicht, woran das lag, aber es war nun einmal so und ließ sich nicht ändern.
Viel Kleidung zum Wechseln hatte ich leider nicht dabei, deshalb blieb ich, wie ich war. Ich fühlte mich auch gleich besser, da ich wusste, dass ich in wenigen Minuten locker zum essen gehen konnte und mich nicht herauszuputzen brauchte, wie wenn ein Savior-Geschäftsessen anstand. Ich war schon ewig nicht mehr einfach nur beim Chinesen gewesen.
Ich schaute kurz auf den Flur und sah, dass Hektor noch nicht fertig war. Deshalb schaute ich mir das Badezimmer an. Immerhin war es hier nicht fröhlich bunt gefliest, sonst wäre ich augenblicklich schreiend nach draußen gerannt. Es war normal in Weiß- und Grautönen gehalten, was mir mehr zusagte. Es gab sowohl Dusche als auch Badewanne.
Ich warf einen Blick in den Spiegel und sah mein eigenes Gesicht. Das Gesicht eines Mannes, der jetzt schon mit seinem neuen Job überfordert war. Ich musste mich mal wieder rasieren. Ich wollte schließlich nicht, dass mein Bart irgendwann noch zu einem Vollbart mutierte. Als Savior musste man immer sehr gepflegt aussehen und dazu gehörte auch, dass man sich regelmäßig rasierte. Mein Drei-Tage-Bart war noch im Rahmen. Es regte mich schon auf, dass wir regelmäßig Anzüge tragen mussten. Deshalb liebte ich auch Aufträge. Hier konnte ich oft tragen, was ich wollte, um nicht aufzufallen. Denn das Dasein als Savior hatte auch viel mit Schauspielerei zu tun.
Ich verließ das Badezimmer wieder und wäre fast mit Hektor zusammengestoßen, der um die Ecke rauschte.
„Ah, du siehst dich um. Perfekt.“ Er rieb sich die Hände, als schmiedete er irgendeinen fiesen Plan. Da er aber aussah wie ein Igelbaby, wirkte das nicht wirklich bedrohlich.
Er hatte sich umgezogen und trug nun ein hellblaues T-Shirt ohne Aufdruck. Seine Haare hingegen sahen noch immer so aus wie ein Atomunfall. Wahrscheinlich würde sich das niemals ändern.
„Halte deine Hände auf“, befahl er mir und griff hinter sich zur Kommode.
Ich hielt meine Hände auf.
„Ah-ah. Augen zu. Sonst ist es keine Überraschung mehr.“
„Was sind das für Kinderspiele?“, fragte ich, schloss aber widerwillig meine Augen. Wenig später spürte ich, wie ein Gegenstand in meine Hände fiel.
„Wirst du schon sehen. Aufmachen.“
Dann öffnete ich auf das Kommando hin die Augen und sah den Schlüssel, der dort vor mir lag. Es war ein silbernes Ding mit einem Schlüsselring und einem Anhänger in Form eines kleinen Hundes aus Frottee. Ich hätte mich wahrscheinlich bedanken sollen, aber stattdessen fragte ich: „Du hast noch Schlüssel? Keine Karten?“
„Karten sind schrecklich. Und dieses Haus ist ein Altbau. 2002 erbaut.“ Er sah stolz aus. „Ich habe keinen elektronischen Scanner installieren lassen. Diese Schlüsselkarten sind so kompliziert.“
„Aber sicherer. Vor allem wenn du Angst hast, dass Fremde eindringen und dich essen könnten.“
„Das Risiko bin ich schon eingegangen, als ich dir den Schlüssel gegeben habe. Ich hoffe, du hast gesehen, dass in deinem Zimmer von innen auch ein Schlüssel steckt. Im Badezimmer ebenso. Von denen kannst du Gebrauch machen.“
„Und warum ist da ein Hund dran?“
„Süß, nicht? Habe ich selbst gebastelt. Ich weiß, er hat nur ein Auge und sieht irgendwie aus, als wäre er atomar verstrahlt, aber süß ist er dennoch. Drück mal drauf. Dann singt er was.“
„Äh… Jetztnicht. Warum sind deine alten Mitbewohner nochmal ausgezogen?“ Ich spielte darauf an, dass sie wahrscheinlich von seinem schrägen Charakter vergrault wurden, aber Hektor antwortete ganz ernst.
„Lucilia und Manny wurden ein Paar und ich habe anscheinend gestört. Deshalb sind sie abgehauen. Meine Tante hat mir dieses Haus ausgesucht und ich habe hier schon länger gewohnt, deshalb mussten sie gehen und nicht ich. Ich hatte davor auch schon einige Mitbewohner.“
„Dieses Haus hat nicht einmal eine Gegensprechanlage. Selbst ich habe das bald in…“ Ich hatte ‚In meinem Büro’ sagen wollen, konnte mir aber noch rechtzeitig auf die Zunge beißen und somit die Worte zurückhalten.
„Warum schaust du so gequält?“, fragte Hektor.
„Ich habe mir auf die Zunge gebissen.“ Ich winkte ab. „Ist ja auch egal. Wir wollten essen gehen.“
Es roch nach Erdnusssoße. Zur Erklärung: Ich hasse Erdnusssoße. Hektor nicht. Er hatte seinen ganzen Teller mit dem Zeug geflutet und ich unterdrückte einen Brechreiz.
„Also.“ Er versuchte vergeblich, mit den Essstäbchen irgendeinen Klumpen Reis aufzusammeln, was ihm wegen der Seen von Soße reichlich schwerfiel. Ich hatte schon fast alles aufgegessen und Hektor noch nicht einen Bissen, weil es einfach unmöglich war. Vielleicht war er deshalb so mager. Ich überlegte schon, für ihn nach einem Löffel zu fragen, beschloss dann aber, dass das peinlich werden könnte.
„Also?“
Er spießte ein Stück Fleisch mit dem Stäbchen auf und ich glaubte, sämtliche chinesische Köche dieser Welt laut aufschreien zu hören. „Woher kommst du?“
Da musste ich nicht einmal lügen. „Von hier. Ich wohne hier schon seit… immer.“ Das Savior Agency HQ war in der Stadt. Ich habe in meinem ganzen Leben nie meinen Heimatort gewechselt. Nur meinen Wohnsitz. Natürlich hatte ich für einige Savior-Treffen und Aufträge außerhalb schon oft woanders übernachten müssen. Aber weggezogen war ich nie.
„Die Stadt ist schön. Ich wohne erst seit ein paar Jahren hier, aber sie ist mir ans Herz gewachsen. Hier gibt es eine der schönsten Kunstgalerien des Landes. Ich könnte dich mitnehmen und herumführen, allerdings bin ich da nicht wirklich gern gesehen.“
Ich wurde augenblicklich hellhörig. „Und warum nicht?“
Er seufzte tief und ließ dabei die Schultern hängen. „Die können mich nicht ausstehen. So etwas als Künstler zu hören, ist natürlich eine große Enttäuschung. Sie sagen, meine Bilder sind schlecht.“
Natürlich hatte ich noch nie Ahnung von Kunst gehabt, aber ich hätte niemals etwas so Schönes erschaffen können wie Hektor. Ich kann nicht einmal Strichmännchen malen. Die Tatsache, dass früher ‚Kunst’ ein Pflichtfach an Schulen war, erschütterte mich noch immer. Ich wäre sicherlich durchgefallen. Da gab es keine Zweifel.
Die meisten Bilder, die ich in Hektors kleinem Atelier (dem Wohnzimmer) gesehen hatte, zeigten entweder bunte Blumen oder Menschen, meistens junge Frauen, und viele Tiere. Was das über ihn aussagte, wusste ich auch nicht. Kunst und ich, das verstand sich noch nie gut.
„Deine Bilder sind der Wahnsinn. Ich weiß nicht, was sie dagegen haben könnten. Bist du dir sicher, dass es keinen Auslöser gab, der dich so unbeliebt gemacht hat?“
„Sie können mich einfach nicht leiden. Sie sagen, ich produziere nur Müll und ich sei ein Verrückter. Ich will nicht darüber reden. Hast du irgendwelche Hobbys?“
Die Arbeit fühlte sich für mich eigentlich immer an wie ein Hobby. Ich habe mir dieses Leben schließlich ausgesucht und somit mein altes zurückgelassen. Natürlich werden den Saviors auch Sportkurse angeboten, aber an diesen nahm ich nicht teil. Vielleicht sollte ich das. Irgendwann.
„Rein gar nichts. Ich mache… rein gar nichts, um mich zu beschäftigen.“
„Klingt traurig. Ich könnte ohne nicht überleben, weißt du?“
Okay, jetzt musste ich mich beherrschen, nicht meinen Reis quer über den Tisch zu spucken. Ich schluckte und hustete, um mir nichts anmerken zu lassen. Hektor hob eine Augenbraue.
„Äh… Geht’s dir gut?“
Ich schnappte nach Luft. „Ja… Alles gut. Beachte mich gar nicht.“ Hör einfach auf, über deinen Tod zu reden! „Ich habe mich bloß verschluckt.“
„Tückisch, dieser Reis. Der klumpt so schnell.“
„Deiner nicht mehr“, murmelte ich.
„Was?“
„Nichts.“
Hektor stocherte weiter und durchbohrte das unschuldige Hühnchen mit den Essstäbchen, um wenigstens etwas zu beißen zu bekommen. „Vielleicht können wir dir eine Beschäftigung verschaffen. Siehst du, ich will nicht, dass wir bloß Mitbewohner werden, die einander anschweigen. Das ist keine angenehme Wohnatmosphäre. Das hatte ich schon zur Genüge mit meinen anderen Mitbewohnern. Ich bin mir sicher, dass wir gute Freunde werden.“
„Wenn du meinst.“ Ich schluckte den letzten Klumpen Reis hinunter und beendete meine Mahlzeit. Ab jetzt konnte ich wohl nur noch Hektor zusehen, wie dieser versuchte, an seine Beute zu kommen. Es sah sehr unappetitlich aus.
„Ja, das meine ich. Sonst wäre es doch einfach nur angespannt, wenn wir uns zu Hause über den Weg laufen. Schrecklich, kann ich dir sagen. Du magst bei deiner Freundin gewohnt haben und das nicht kennen, aber Wohngemeinschaften können echt nerven. Du bist mit einem Haufen von Fremden unter einem Dach, mit denen du nicht oder kaum sprichst. Das will ich nicht noch einmal wiederholen.“
Also war meine Aufgabe quasi schon halb erledigt. Das war vielleicht einfach. Ich hatte mir das Ganze so viel schwerer vorgestellt, aber Hektor bettelte geradezu, mich als Freund zu gewinnen. Ich musste wohl nichts machen außer Urlaub in der Vergangenheit. Das konnte sogar angenehm sein.
„Wie alt bist du? Ich bin vor zwei Monaten achtundzwanzig geworden. Ich hatte eine schöne Feier, ich bin in die Galerie gegangen.“
Ich hatte keine Ahnung, wiealtich war. „Einunddreißig.“ Grob geschätzt kam das hin. Da ich ein Savior war und regelmäßig mehr Zeit in der Vergangenheit verbrachte, aber immer wieder zum Zeitpunkt meiner Abreise zurück in die Gegenwart reiste, brauchte ich für zehn Minuten mehrere Stunden. Diesmal sogar sechs Wochen. Mein Boss würde mich nicht lange vermissen. Mein Ich in sechs Wochen würde ihn nur ein paar Sekunden später begrüßen. Es war kompliziert, aber das war nun einmal das Leben eines Zeitreisenden. Und da ich schon einige Jahre für die Savior Agency arbeitete, machte mich das etwas älter, als man es anhand meines Geburtsjahres annehmen könnte. Ich wäre wahrscheinlich nur ein bis zwei Jahre älter als Hektor. Durch die Zeitreiserei waren es knappe drei Jahre.
„Weißt du, Hektor…“
„Du kannst Hek sagen. Aber nur, wenn ich Josh sagen darf. Wir sind schließlich Freunde.“
Das ging ja schnell. Und mich hatte noch nie jemand Josh genannt. Ich trug diesen Namen immerhin erst seit einigen Jahren. Aus diesem Grund war ich ein klein wenig überfordert mit dieser Anrede.
„Hek. Ich muss dir sagen, dass ich mit Kunst nichts anfangen kann. Ich hoffe, das akzeptierst du.“
„Machst du Witze? Akzeptanz ist das Wichtigste, was ich mir an anderen Menschen wünsche. Deswegen zeige ich sie auch. Ich würde dich niemals verurteilen, nur weil wir uns unterscheiden, Josh.“
Der Kerl war einfach nur komisch. Ich hatte keine Ahnung, worauf das alles hinauslaufen sollte. Ich konnte nicht mit Menschen umgehen, ich konnte sie schon gar nicht davon abhalten, sich verdammt nochmal umzubringen. Aber er wollte mein Freund sein, das war schon einmal die halbe Miete.
Irgendwann schob er seinen Teller von sich und bestellte mit dem Touchpad auf der Tischplatte einen Geschirrwagen. Wir luden unsere Teller dort ab und standen auf, um zu bezahlen. Ich musste zugeben, dass das gemeinsame Essen eine gute Idee gewesen war. Ich hatte jetzt einen näheren Eindruck von Hektor. Zwar den, dass er verrückt war, aber es ließ sich mit ihm aushalten.
Da es bereits Abend war, machten wir uns wieder auf den Weg ‚nach Hause’. Ich würde es wahrscheinlich niemals ein Zuhause nennen können, dafür war es mir einfach zu eng und zu bunt. Vor allem zu bunt. Auf dem Heimweg erzählte Hektor mir etwas über seine Familie.
„Ich habe meine Eltern nie wirklich kennengelernt, weißt du? Ich hatte Pflegeeltern, immer neue. Aber was erzähle ich dir das? Dich interessiert es bestimmt nicht.“
„Doch, doch. Sprich nur weiter.“
„Warum erzählst du mir nichts über deine Familie?“
O nein. O nein, nein, nein. Eher würde ich sterben als diesem Typen etwas über meine Familie zu erzählen. Außerdem hatte ich ihm zuvor ohnehin eine Lüge darüber aufgetischt. Deshalb beschloss ich, nur etwas über meine Eltern zu sagen. „Meine Mutter hat sich schon vor Ewigkeiten von meinem Vater getrennt und mich rausgeschmissen, als ich achtzehn wurde. Deshalb bin ich dann zu meiner Freundin gezogen.“
„Die, die dich jetzt hat sitzenlassen? Dann seid ihr aber schon echt lange zusammen gewesen.“
Verdammt. Das geschah also, wenn sich Lüge und Wahrheit bissen. „Nein, jemand anderes. Aber das ist auch nicht wichtig.“ Himmel, was war das hier? Ein Kummerkasten? Eher würde ich mir die Zunge rausreißen, als über sie zu sprechen. Und warum fragte er mich überhaupt solche privaten Dinge? Freund hin oder her, wir kannten uns erst seit ein paar Stunden! Und das Schlimmste: Ich war auch noch dabei, ihm alles zu erzählen. Ich Idiot. Als nächstes kam wahrscheinlich so etwas wie: Ach übrigens, ich bin ein Agent aus der nahen Zukunft und will dich vor deinem unmittelbaren Tod bewahren. Nicht mit mir.
Wir verfielen in Schweigen, als wir unseren Weg fortsetzten. Hektor kickte ständig Kieselsteine vom Wegesrand und es machte immer wieder dasselbe Geräusch, was mir irgendwann in den Ohren widerhallte. Insgesamtwirkte er nicht wie ein achtundzwanzig jähriger Mann, sondern wie ein achtjähriger Junge. Sein Verhalten war einfach eigenartig. Ich wusste nicht, ob ich damit klarkommen konnte. Was sollte ich tun? Sollte ich Hektor an die Hand nehmen und ihn über die Straße geleiten? Was machte man mit so einem Menschen? Einfach freundlich sein, ermahnte ich mich.
Als wir wieder ‚zu Hause‘ ankamen, war es schon dämmrig geworden. Während Hektor mit dem Schlüssel an der Haustür herumhantierte, wurde mir klar, dass ich in den letzten Jahren keine einzige Tür mit einem Schlüssel geöffnet hatte. Ich würde mich umgewöhnen müssen. Auch hatte ich in dem Haus noch keinen einzigen Putzroboter gesehen. Hektor schien die neue Technologie nicht ausstehen zu können, wie ein verbitterter, alter Greis.
Wir ließen uns am Küchentisch nieder und besprachen noch ein paar notwendige Punkte bezüglich der Bezahlung. Als ich einen Putzplan ansprach, meinte Hektor nur: „Bisher haben meine Mitbewohner den Putzplan gemacht. Hektor macht immer alles. Und dabei ist es auch geblieben. Aber wenn du helfen willst, kannst du es gerne tun. Lieb von dir.“
Ich seufzte. Manchmal konnte einem Hektor ein wenig leidtun. Ein klein wenig. Ich sah aber noch immer keinen Grund, warum er sich umbringen wollte. Hatte er von einem Todesfall erfahren? Nein, davon hätte mir Betty erzählt. Misserfolg als Künstler? Sehr gut möglich, aber niedergeschlagen wirkte er deshalb noch lange nicht. Irgendwelche gescheiterten Liebesbeziehungen, von denen seine Tante nichts wusste? Konnte gut sein. Ich würde die verschiedenen Möglichkeiten im Hinterkopf behalten und mich bewusst nach anderen Auslösern umsehen. Hier im Haus mussten sich Hinweise finden lassen.