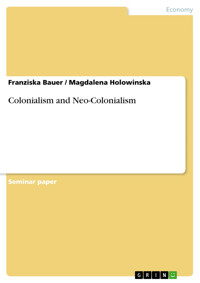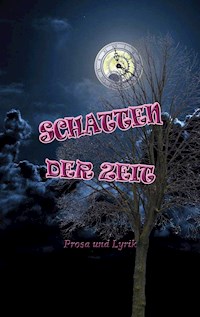
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dachten Sie bereits irgendwann einmal nach, wie man die Zeit beschreiben kann? Sie ist nicht nur vergangen, gegenwärtig und zukünftig, späte oder frühe, Winter- oder Sommerzeit. Sie ist auch kostbar, verloren, unruhig, keck, friedlich, gesegnet, hungrig, wohltuend, schwierig, krisenhaft, unbarmherzig, dunkel, wahnsinnig und vieles mehr. Sie ist auf allem, was uns umgibt und was sich in uns befindet, auf ihr liegt der Schatten der Vergangenheit. Gerade sie stellt unsere Wurzeln dar. In diesem Buch schilden die Österreichischen Autorinnen und Autoren ihre Betrachteten der Zeit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
„Jemand hat mir mal gesagt, die Zeit würde uns wie ein Raubtier ein Leben lang verfolgen. Ich möchte viel lieber glauben, dass die Zeit unser Gefährte ist, der uns auf unserer Reise begleitet und uns daran erinnert, jeden Moment zu genießen, denn er wird nicht wiederkommen. Was wir hinterlassen ist nicht so wichtig wie die Art, wie wir gelebt haben. Denn letztlich [...] sind wir alle nur sterblich.“ Jean Luc Picard
INHALT
DIE ZEIT – Einführung
Franziska Bauer
Sophia Benedict
Victoria Bösze
Cornelia Divoki
Franz Forster
Sidonia Gall
Marianne Gruber
Sonja Henisch
Ingried Karner
Ernst Karner
Elfriede Klima
Anton Marku
Eva Meloun
Rosa C. Nowak
Eva Novotny
Jordi Rabasa Boronat
Elisabeth Schawerda
Ferdinand Schelenbacher
Elisabeth Schöffl-Pöll
Ingrid Schramm
Rosemarie Schulak
Claudia Taller
Horst Weber
Peter Paul Wiplinger
DIE ZEIT – ALLMÄCHTIG, SCHONUNGSLOS, UNERBITTLICH
Von Diana Wiedra
Dachten Sie bereits irgendwann einmal nach, wie man die Zeit beschreiben kann?
Sie ist nicht nur vergangen, gegenwärtig und zukünftig, späte oder frühe, Winter- oder Sommerzeit. Sie ist auch kostbar, verloren, unruhig, keck, friedlich, gesegnet, hungrig, wohltuend, schwierig, krisenhaft, unbarmherzig, dunkel, wahnsinnig und vieles mehr. Sie ist auf allem, was uns umgibt und was sich in uns befindet, auf ihr liegt der Schatten der Vergangenheit. Gerade sie stellt unsere Wurzeln dar.
Worüber erzählt uns die antike Mythe von Kronos? Kronos ist die personifizierte Zeit, er schafft sie, und dann frisst er seine Kinder. Schon in der Antike sehen wir die ersten Versuche des Menschen, Zeit in ihren historischen Aspekten zu betrachten, gerade sie bestimmt das Selbstbewusstsein der Kulturen. Platon teilt alles Existierende ins Dasein und Entstehen – das Erste existiert ewig, das Zweite entsteht und geht in der Zeit verloren. Die Zeit ist die bewegliche Form der Ewigkeit, sie ist zusammen mit dem Himmel entstanden.
Der Philosoph Mark Aurelius sieht in der Zeit den Strom der Veränderungen, der die Welt ständig erneuert – der unaufhörliche Lauf der Zeit schenkt der grenzenlosen Ewigkeit die Jugend. Wie kann man in diesem Strom etwas Bestimmtes zum Gegenstand der Verehrung machen, wenn es unmöglich ist, darin stehenzubleiben? Es ist so, als ob jemand gewünscht hätte, einen fliegenden Vogel zu fangen – jetzt siehst du ihn, und im folgenden Moment ist er aus den Augen verschwunden. So ist auch, nach Meinung des Philosophen, das Leben von jedem von uns – jetzt ist es hier, jetzt atmen wir, und in uns fließt unser Blut, aber es wird die Stunde kommen, in der wir diese Fähigkeit, die uns bei der Geburt gegeben wurde, zurückgeben müssen – dorthin, von wo wir sie bekommen haben. Der Tod hat Alexander den Großen mit seinem Maultiertreiber gleichgestellt, beide sind in Atome zerfallen. Im Körper und in der Seele jedes von uns entsteht etwas, und dauernd stirbt eine Menge der Erscheinungen.
Diese Wörter von Mark Aurelius sind traurig, aber in ihnen steckt auch ein großer Trost: Wozu sich fürchten, wenn es keinen Tod gibt, es gibt nur die Zeit, und ich bin nur ein Teil dieser ewig existierenden Zeit. Alles koexistiert in dieser Welt einheitlich und ganz. Wer die Gegenwart sah, der sah alles – sowohl Ehemaliges als auch Zukünftiges. Alles in der Welt ist untereinander verschlungen und befindet sich in Zusammenarbeit miteinander. Auch in der Natur befindet sich die schöpferische Kraft.
Alice in Wunderland sagt: "Ich habe immer gedacht, die Zeit wäre ein Dieb, die mir alles stiehlt, was ich liebe. Aber jetzt weiß ich, dass sie gibt, bevor sie nimmt, und jeder Tag ist ein Geschenk. Jede Stunde. Jede Minute. Jede Sekunde."
Das waren die Worte der Klassiker.
In diesem Buch befinden sich die Gedanken unserer Zeitgenossen über die Zeit in all ihrer zerstörenden und schöpferischen Kraft.
Franziska Bauer
geb. 5.1.1951 in Güssing, Studium der Russistik und Anglistik an der Universität Wien, wohnhaft in Großhöflein bei Eisenstadt, Gymnasiallehrerin im Ruhestand, Alphabetisierungstrainerin, Schulbuchautorin, schreibt Lyrik, Essays und Kurzgeschichten.
Paradigmenwechsel
Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Er geht lieber ausgetretene Wege als neue Pfade. Das mag angehen, solange alles funktioniert und halbwegs im Lot ist. In Krisenzeiten allerdings und in Zeiten des Umbruchs – und in solchen befinden wir uns gerade – wirkt diese mentale Trägheit nicht nur erschwerend bei der Lösung anstehender Probleme, nein, sie verunmöglicht sie nachgerade.
Wie der amerikanische Futurologe Jeremy Rifkin, studierter Soziologe und Ökonom, in seiner 2014 auch auf Deutsch erschienenen Ausgabe des Buches „The Zero Marginal Cost Society: The internet of things, the collaborative commons, and the eclipse of capitalism“ bemerkt, bedingt eine grundlegende Änderung der drei Schlüsselfaktoren Energiegewinnung, Informationstechnologie und Transportwesen stets auch eine völlige Umgestaltung der Wirtschaft und der Gesellschaft. Eben das geht gerade vor sich, wir befinden uns mitten in einer industriellen Revolution. Es kracht im Gebälk, und zwar mächtig. Der resultierende Wandel ist allgegenwärtig und unumkehrbar, ist aber noch nicht entsprechend in unser Bewusstsein getreten. Ebenso wenig wie die bereits 1972 vorgestellte Studie des Club of Rome, deren zentrale Schlussfolgerungen waren, dass bei unverändertem Anhalten der Zunahme von Weltbevölkerung, Industrialisierung, Umweltverschmutzung, Nahrungsmittelproduktion und Ausbeutung von natürlichen Rohstoffen die absoluten Wachstumsgrenzen auf der Erde im Laufe der nächsten hundert Jahre erreicht sein werden. Viele von uns ziehen es jedoch vor, sich den Problemen zu verweigern, indem sie den Kopf in den Sand stecken, anstatt an deren Lösung zu arbeiten.
Wo aber – in Krisenzeiten – Verunsicherung Platz greift, wächst leider auch die Sehnsucht nach einfachen Lösungen für komplexe Probleme. Sündenböcke müssen her, Mauern werden aufgerichtet, man geht rechtspopulistische Irrwege. Das trägt zwar rein gar nichts zur Problemlösung bei, beruhigt aber die Irregeleiteten – zumindest für ein kurzes Weilchen. Die wahren Kausalitäten werden durch „alternative Fakten“ vernebelt, krude Verschwörungstheorien verdrängen fundierte Problemanalysen, seriöser Journalismus muss sich als Lügenpresse bezeichnen lassen. Die etablierten Parteien üben sich in Untätigkeit und Stillstand und manövrieren sich mit ihrer unseligen Vogel-Strauß-Politik in ein hoffnungsloses Patt. Anstatt mutig neue Wege zu suchen, wurstelt man im Status quo weiter und enttäuscht und verprellt die Wählerschaft.
Eigentlich, meinen etliche, wäre die Zeit reif für eine Revolution, wieso also tut sich da nichts? Der in Seoul geborene Philosoph Byung-Chul Han1, Professor der Philosophie und Kulturwissenschaft an der Universität der Künste in Berlin, schreibt dies dem neoliberalen Herrschaftssystem an sich zu. Er hält eine Revolution derzeit für unmöglich, da die neoliberale systemerhaltende Macht nicht unterdrückt, sondern verführt. Sie ist nicht mehr auf den ersten Blick sichtbar. Der Neoliberalismus suggeriert den unterdrückten Arbeitenden, sie seien freie Unternehmer. Der Klassenkampf verwandelt sich in einen inneren Kampf mit sich selbst. Wer heute scheitert, beschuldigt sich selbst und schämt sich dafür, sucht die Schuld für den Misserfolg im persönlichen Bereich und nicht bei der Gesellschaft. Eine Herrschaft, die Freiheit unterdrückt und angreift, ist nicht stabil. Das neoliberale Regime immunisiert sich gegen Widerstand, indem es von der Freiheit Gebrauch macht und sie ausbeutet, anstatt sie zu unterdrücken. Depression, Burnout, hohe Selbstmordraten zeigen, dass der Druck mehr und mehr nach innen geht. Die Aggression aber müsste nach außen gehen, sich vernetzen, um zur Revolution zu werden. Aus erschöpften, depressiven, vereinzelten Individuen lässt sich schwer eine Revolutionsmasse formen. Es ist dem Neoliberalismus also offenbar gelungen, die Arbeiterschaft so gründlich auseinanderzudividieren, dass sie vergessen hat, was sie bisher durch gemeinsamen Schulterschluss erreicht hat, obwohl sie gut daran täte, sich der nunmehr vergessenen Solidarität wiederzubesinnen, um in Zeiten der Demontage des Sozialstaates das so mühsam Ereichte nicht wieder zu verlieren.
Interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Festrede des in Wien wohnhaften deutschen Historikers und Schriftstellers Philipp Blom anlässlich der Eröfffnung der Salzburger Festspiele 2018. Er erklärt dieses hartnäckige Festklammern am status quo, ja diese Rückwärtsgewandtheit damit, dass Zukunft nicht als Verheißung, sondern als Bedrohung empfunden wird:
„Wir werden nicht noch reicher werden, noch sicherer und noch privilegierter. Die schönste Hoffnung unserer Gesellschaften ist es deswegen geworden, Zukunft überhaupt zu vermeiden und in einer nie endenden Gegenwart zu leben. Diese Zukunft aber kommt längst zu uns: in Form warmer Winter und cleverer Algorithmen, aber auch zu Fuß oder in Booten, in Gestalt von Menschen. Reiche Gesellschaften können sich Zeit kaufen, um große Veränderungen hinauszuschieben, aber sie kaufen sie auf Kredit von ihren Kindern.“2
Anstatt uns der Zukunft und ihren Anforderungen zu stellen, sehnen wir die guten alten Zeiten zurück, auch wenn diese gar nicht so gut gewesen sein sollten. Wer den Wandel ausschließlich als Bedrohung sieht, wird ihn auch in seinen positiven Konsequenzen nicht zu Ende denken können. Philipp Blom meint, wir seien zwar Kinder der Aufklärung, um aber erwachsen zu werden, müssten wir uns unseren Ängsten stellen. Anstatt uns beim Suchen der Auswege auf unsere Vernunft und Denkfähigkeit zu verlassen, lassen wir eine Demontage der Aufklärung zu, die weit über Europa hinausreicht:
„Auf dem ganzen Globus entstehen autokratische Staaten, werden längst überwunden geglaubte, autoritäre Strukturen und nationalistische Identitäten zum Programm oder zur Praxis, verlieren Wahrheit und Wissenschaft an Verbindlichkeit, greift freiwillige Verdummung Raum.“2
Eben dieser freiwilligen Verdummung müssen wir gegensteuern, denn zu viel steht auf dem Spiel: Es geht um nicht mehr und nicht weniger als um unser aller Zukunft. Wir können uns nicht leisten, die Situation als hoffnungslos zu betrachen und untätig auf ein Wunder zu hoffen, nein, wir müssen unangenehme Fragen stellen und den Mut aufbringen, der Wahrheit ins Auge zu blicken. Wir müssen Holzwege verlassen und neue Wege beschreiten. Wir müssen unser ganzes Hirnschmalz zusammennehmen und uns einen neuen Blickwinkel auf die globale Lage erarbeiten. Dazu braucht es Visionen, lebendige innere Bilder davon, „was wir ersehnen von der Zukunft Fernen“, um mit Freiligrath zu sprechen. Wir müssen uns unsere Zukunft also mit unserer ganzen mentalen Kraft herbeiimaginieren, so, wie wir sie haben wollen. Es muss einen Ausweg geben, der, wenn nicht in einer Umkehr, so doch in einer drastischen Richtungsänderung zu bestehen hat.
Immanuel Kant nannte dies eine Reform der Denkungsart. Revolutionen können zwar unerträgliche Herrschaftsverhältnisse beseitigen, bringen aber den gedankenlosen großen Haufen nicht notwendigerweise zur wahren Reform der Denkungsart, zum fundamentalen Umdenken also:
„Durch eine Revolution wird vielleicht wohl ein Abfall von persönlichem Despotismus und gewinnsüchtiger oder herrschsüchtiger Bedrückung, aber niemals wahre Reform der Denkungsart zustande kommen; sondern neue Vorurteile werden ebensowohl als die alten zum Leitbande des gedankenlosen großen Haufens dienen.“3
Was mithin gefordert ist, ist die Μετανοια/Metánoia, die Sinnesänderung, das mutige Umdenken, und zwar das Umdenken möglichst vieler. Dabei soll man nicht verzagen, wenn es anfangs nur einzelne sind, die dies tun.
Wie uns Malcolm Gladwell4 in seinem Buch „The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference“ dartut, genügen bereits wenige, um eine nachhaltige Trendumkehr zu bewirken. Wir kennen alle das Beispiel vom Popcorntopf, in dem zuerst nur vereinzelte Körner platzen, bis nach Erreichen einer bestimmten Temperatur alle aufpoppen. Nach dem Gesetz der Wenigen genügen einzelne Vordenker und Multiplikatoren, um Veränderungen herbeizuführen, wenn es ihnen gelingt, ihre Botschaft so zu vermitteln, dass sie haften bleibt, und wenn die Umweltbedingungen stimmen.
Das Wagnis der Metánoia, der wahren Reform der Denkungsart, ist ein geistiges Problem. Spiritualität, also im weitesten Sinne Geistigkeit im Gegensatz zur Materialität, droht neuerdings leider zum schwammigen Modewort zu verkommen. Oft wird sie ausschließlich dem Bereich der Religion zugeschrieben oder gar als bloßer Teilbereich der Esoterik verstanden. Dabei ist sie nichts anderes als das bewusste Ausleben und Praktizieren einer als richtig erkannten Geisteshaltung. Spiritualität stellt die Frage nach der Sinnhaftigkeit unseres Daseins, nach unserer Verantwortung in dieser Welt.
Spiritualität beinhaltet das Streben nach Gerechtigkeit, das Vorhandensein von Empathie und Solidarität und das Eintreten für Demokratie und Menschenrechte. Eine so definierte Spiritualität eint Gläubige, Agnostiker und Atheisten.
Spiritualität bedeutet letztendlich Wahrheitssuche. Der Philosoph und Neurowissenschaftler Thomas Metzinger definiert Spiritualität als eine ethische Grundhaltung der bedingungslosen Aufrichtigkeit zu sich selbst, die man braucht, um auf der Suche nach Wahrheit Irrtum und Selbsttäuschungen zu vermeiden. Er nennt diese Haltung „intellektuelle Redlichkeit“. Sapere aude! Wer über diese Art von Redlichkeit verfügt, geht furchtlos seinen eigenen Weg und wagt es, sich dabei seines eigenen Verstandes zu bedienen. Täten dies in einem Kollektiv möglichst viele, dann hätten wir sie, die geistige Revolution – die Reform der Denkungsart.
Die Sanduhr
Der Mensch ist in der Endlichkeit gefangen,
so, wie im Stundenglas der feine Sand.
Wie Sand verrinnt die Zeit ihm.
Wird sie langen,
das Glück zu finden, fragt ihn sein Verstand?
Sein Herz gibt Antwort: Ja, er wird genesen
am Schnittpunkt von „wird sein“
und „ist gewesen“.
Im Hier und Jetzt, im flüchtgen Augenblick –
dort und nur dort erwartet ihn das Glück.
Ritornell
Angesichts der Ewigkeit
währen kurz nur Glück und Leid
und des Menschen Lebenszeit.
Kurz nur währen Glück und Leid
und des Menschen Lebenszeit
angesichts der Ewigkeit.
Hölzerner Methusalem
Wo sich die Kalkalpen erstrecken,
da sieht man einen stolzen Baum
die Krone in den Himmel recken,
der ist so alt, man glaubt es kaum.
Fünfhundertsiebenundvierzig Jahre
macht er es sich dort schon bequem.
Sein Alter grenzt ans Wunderbare:
Ein hölzener Methusalem!
Auf vierzehnvierundsiebzig weisen
die ersten Jahresringe hin.
Ein Bohrkern konnte jetzt beweisen,
dass dieser Rotbuche Beginn
in eine Zeit fiel, als soeben
der Buchdruck erst erfunden war.
Den Sämling hat es schon gegeben,
da war noch völlig undenkbar,
eh man Amerika entdeckte,
dass man die neue Welt bereist,
entgegen älterer Aspekte,
dass unsre Erd‘ die Sonn‘ umkreist.
Im Kreise ihrer Artgenossen
trotzte die Buche Sturm und Frost,
ist jeden Frühling neu gesprossen,
und bot dem Waldgetier zur Kost
die fetten Eckern. All die Jahre
hat sie im Urwald überlebt,
sodass, damit man sie bewahre,
der Mensch den Wald zu schützen strebt.
Dass Bäume so lang überdauern,
lässt Menschen ehrfurchtsvoll erschauern.
Ewige Fragen
Wer hat die Weltenuhr wohl aufgezogen,
ja, mehr noch, wer hat sie gebaut?
Was hat den Meister wohl dazu bewogen,
zu fügen, was man vormals nie geschaut?
Ist gar von selbst das Nichts ins Sein getreten,
hat sich das All mit Sternen selbst befüllt?
Warum wohl kreisen Monde und Planeten
um Sonnen im galaktischen Gefild?
Wodurch und wie erblühte all das Leben
auf unsrer Heimaterde wundersam?
Um es zu lieben, wie es uns gegeben,
musst du nicht wissen, wie es dazu kam.
Nur schwer sind diese Fragen zu ergründen.
Die Antwort musst du für dich selber finden.
1https://neue-debatte.com/2016/05/20/byung-chul-han-erklaert-warumheute-keine-revolution-mehr-moeglich-ist/
2http://www.salzburg.com/download/2018-07/Rede_Blom_final.pdf
3http://gutenberg.spiegel.de/buch/-3505/3
4 Gladwell, Malcolm: The Tipping Point: How Little Things Can Make A Big Difference. Boston 2000 (Little, Brown)
Sophia Benedict
geboren in der UdSSR. Universitätsabschluss mit dem Diplom für Publizistik. Arbeitete in Zeitungen, Zeitschriften, Radio und Fernsehen. Weiterbildung in Wien (1984). Langfristige Akkreditierung als Journalistin und Pressefotografin beim Österreichischen Bundeskanzleramt. Gleichzeitig widmete sie sich der Wissenschaftsjournalistik. Zahlreiche Publikationen in Zeitungen und Fachzeitschriften, über 20 Buchveröffentlichungen in Deutsch und Russisch – Sachbücher, Übersetzungen, Lyrik und Prosa.
Einsamkeit im Blut
Seltsam, im Nebel zu wandern!
Leben ist Einsamsein.
Kein Mensch kennt den andern,
Jeder ist allein. (Hermann Hesse)
„Ich erzähle Dir jetzt, wie es war“, sagte eine meiner russischen Freundinnen, „Hör‘ zu und unterbrich mich bitte nicht! Ich muss das alles von der Seele reden.“
„Ich bin ganz Ohr!“, sagte ich.
Da ist Ihre Erzählung.
Bei dieser Hitze sollte man in die Berge fahren. Ob jetzt in einem Hotel ein Platz frei wäre? Ich sollte einfach ins Blaue fahren, das heißt, wohin die Augen schauen – Hauptsache, Richtung Norden, solange der Urlaub noch nicht zu Ende ist.
Das Telefon klingelte.
„Mein Auto ist kaputt, und ich muss zu den Festspielen nach Bayern!“, hörte ich die verzweifelte Stimme einer Freundin. „Ich spiele dort die Siebente von Beethoven. Kennst du vielleicht jemanden, der mir ein Auto borgen könnte?“
„Ich kann dich mitnehmen. Ich bin unterwegs.“
„Wie meinst du das? Wohin fährst du?“
„Ich weiß es noch nicht, allerdings, in deine Richtung. Wann willst Du mit mir fahren? Dann bleibe ich dort für einen Tag, um deine Siebente zu hören, und fahre weiter nach Norden, wo es nicht so heiß ist!“
„Ich rufe dich zurück“, war die Antwort und im Hörer wurde es still.
Nach einer Stunde klingelte das Telefon wieder, und ich hörte Larissas fröhliche Stimme:
„Hurra! Das Hotel ist reserviert und bezahlt! Dafür versprichst du mir eine Publikation über das Festival!“
Altmühlental. Die zierlich gebogene Brücke hing über den Fluss, an den felsigen Abhängen schwebten die Schlösser mit scharfkantigen Dächern, über das Wasser glitt ein Schiff – ein Relikt aus dem neunzehnten Jahrhundert, das Wasser im Fluss war grün. Irgendwo, fast in den Wolken, versteckte sich ein rundes Gebäude mit Säulen. Eine Kirche? Aber warum ohne Glockenturm und ohne Kreuz? Plötzlich, hinter der Wendung, blitzten die bunten Dächer des Städtchens, und versteckten sich wieder hinter dem Hügel. In einer Minute fuhren wir bereits zwischen den Vorgärten mit Georginen und reichlichen Geranien auf den Fensterbrettern. Hinter dem Fluss auf dem hohen Hügel leuchtete ein schneeweißer Barockpalast, umgeben von einem Englischen Garten.
Das Pflaster des Hauptplatzes war mit einem Teppich bedeckt, damit die Damen in ihren Abendschuhen es bequem hatten. Die Sessel wurden in halbrunden Reihen aufgestellt, und die Bühne nahm fast die Hälfte des Platzes ein. Das Orchester, bestehend aus nicht weniger als zwei hundert Musikern, probte gerade das zweite Konzert von Rachmaninow. Wir gingen rund um den Hauptplatz, bogen in eine kleine Gasse ein und standen plötzlich vor einem zweigeschossigen, alt aussehenden Steinhaus mit farbigen Butzenscheiben.
Die Tür ging auf.
„Kommt rein, kommt rein!“, lud uns der Hausherr gastfreundlich ein.
Er war groß, und sein Körperbau war sehr kräftig. Er hatte Shorts und ein blaues, offenes Hemd an. Mich hat der Anblick seines nackten Körpers ein wenig verwirrt, er hat das aber nicht bemerkt. Die Bläue des Hemdes spiegelte sich in seinen lächelnden Augen.
„Ach, Sie sind das! Sie sind eine Russin? Also, Pawlowa!“, sagte er und streckte mir beide Hände entgegen.
„Ja, natürlich, wenn ich eine Russin bin, muss ich unbedingt eine Ballerina sein“, lachte ich zurück, „warum aber Pawlowa und nicht Plissetzkaja?“.
Er achtete nicht auf meine Ironie, hielt meine Hand fest, neigte seinen Kopf nach altmodischer Art und schaute mir in die Augen:
„Sie haben ein schönes Kleid an!“
Er versteht auch etwas von Kleidern …
Das Erdgeschoß seines Hauses stellte einen einzigen großen Raum dar. Nach der hellen Sonne draußen gewöhnten sich unsere Augen nicht sofort an die Finsternis des Raumes. Das Licht, das durch die Butzenscheiben drang, warf auf die Wände, auf die Möbel, auf den Fußboden vielfarbige Lichtflecken und ließ den Raum ähnlich einem Tempel aussehen. Anstatt des Altars standen hier zwei Flügel. In samtige Sesseln eingesunken unterhielten sich ein wohlgestalteter alter Mann und zwei hübsche junge Frauen, die uns nur mit einer Kopfneigung begrüßten und ihr Gespräch weiter führten.
Diese Frauen … Larissa vertraute mir unterwegs ein Geheimnis an, das schon längst kein Geheimnis mehr war: Martin hatte zwei Freundinnen – Ilse und Mary, beide waren Musikerinnen, und beide erfüllten freiwillig die Pflichten einer Sekretärin, Librettistin und das Kopieren der Noten.
Martin – ehemaliger bekannter Klavierspieler, jetzt ein nicht weniger bekannter Komponist – organisierte und inspirierte die Festspiele in diesem Städtchen. Er war mir bekannt, ich sah ihn öfter im Fernsehen, er komponierte gute Musicals, und ich fragte mich immer, warum lebt so ein Mensch in einem Provinznest, warum versucht er nicht wenigstens nach München zu ziehen, sozusagen näher zur Zivilisation. Hier verstand ich alles. Die Schönheit dieser Gegend wirkt inspirierend auf jeden Künstler, und die Zivilisation kommt von selbst zu ihm. Das Publikum zu seinen Festspielen kommt aus ganz Europa und sogar von anderen Kontinenten. Die lokale Regierung verehrt und vergöttert ihn, doch sind die Zuschauer lebendiges Geld, das in die Kommunalkasse fließt.
Am Abend herrschte auf dem Hauptplatz eine anschauliche und festliche Atmosphäre. Es schien, als ob hier niemand arbeitete, keiner organisierte etwas, keiner verfügte über etwas, keiner gab die Hinweise, anscheinend floss alles von allein. Das musste ich unbedingt in meinem Bericht erwähnen.
Martin begrüßte die Gäste. Er war jetzt in voller Montur, aber ohne Krawatte. Die breiten Aufschläge seines Hemdes mit Schillerkragen lagen frei auf seinem Tweed Jackett. Sein Lächeln – was für ein Lächeln! Offen und zu gleicher Zeit ein wenig schüchtern. Etwas Kindliches spiegelte da durch, ein Reiz des verwöhnten Kindes, das mit der Welt und auch mit sich selbst zufrieden ist. Dieses Lächeln machte seine Sache gut: In meinem Herzen begannen Geigen zu singen.
Nach dem Konzert wanderte ich durch die kleinen Gassen des Städtchens, mit den Teichen, den Kastanienalleen, den verzauberten Gärten zwischen den niedrigen Häuschen. Plötzlich geriet ich auf eine breite Wiese, die sich in eine riesige Freilichtbierstube wandelte. Gut! Ich setzte mich zu einem langen Tisch, wo bereits über zehn Leute saßen, und bestellte ein kleines Bier und eine Käseplatte. Die Wartezeit war lang. Endlich kam die Kellnerin, angezogen in einem schönen Trachtenkleid. Sie stellte einen Halbliterkrug Bier und eine riesige Holzplatte mit großzügigen Stücken Käse verschiedener Sorten, einem Häufchen gefrorener Butter und einer roten Rispe mit blitzenden Tautropfen auf den Tisch.
„Ich wollte ein kleines Bier“, sagte ich unschlüssig und fragte mich dabei, für welche Armee so ein Berg Käse gedacht sei.
„Das ist das Kleine!“, antwortete die Kellnerin mit rauer Freundlichkeit.
„Und wie sieht bei Ihnen ein großes Bier aus?“, ich wurde neugierig.
„So!“, sie nickte in Richtung Theke, wo auf großen Haken ein- und zweilitergroße Bierkrüge hingen.
Am nächsten Tag nach dem Frühstück ging ich zum Hauptplatz. Das Orchester begann zu proben. Martin war da. Er lächelte mich an. Wieder dieses Lächeln! Das Gefühl eines grundlosen Glücks erfüllte mein Herz. Ich winkte ihm zu und nahm Platz. Die Sonne blendete meine Augen. Das Orchester dirigierte der Ehemann meiner Freundin, ein großer, bildhübscher Blonder mit wunderbar beweglichen Händen. Ich wusste bereits, dass fast alle Musiker im Orchester Russen waren, weil Martin ein großer Bewunderer der russischen Musik und der russischen Musiker war, er nannte sie Interpreten.
Zum ersten Mal hörte ich klassische Musik nicht in einem Konzertsaal, sondern unter den Strahlen der brennenden Sonne. Die Augen abgedeckt beobachtete ich Martin. Er unterhielt sich durch das Fenster mit dem Toningenieur, dessen Zimmer sich im zweiten Stockwerk jenes Hotels befand, in dem ich wohnte. Er beendete das Gespräch, winkte und ging in meine Richtung. Das Lächeln verließ seine Lippen nicht. Zur Begrüßung stand ich vom Platz auf. Vorbeigehend, machte er eine Bewegung … Mir schien, er wollte meine Taille umfassen. Er machte aber nichts Derartiges, das war wahrscheinlich nur mein Wunsch. Ich lachte. Martin blieb für eine Sekunde stehen, und ich hätte wieder schwören können, dass er seine Hand fast auf meine Taille gelegt hätte. So ein Teufelswerk! Martin ging vorbei, wendete sich aber, wir schauten einander an, und wir beide lachten. Auf irgendeine Weise machte er sich wirklich über mich lustig! Oder hatten sich meine Gedanken einfach konkretisiert, ich hatte seine Berührung fast gespürt.
Ich nahm einen anderen Platz im Schatten ein, schloss meine Augen und lauschte dem Spiel des Cellos. Wie viel Zeit so vergangen war, wusste ich nicht, plötzlich fühlte ich seine Anwesenheit. Martin saß neben mir.
Ich musste natürlich die Gelegenheit ausnutzen und um ein Interview bitten.
„Aber zuerst gehen wir essen!“, sagte Martin in einem Befehlston.
Am Tisch saßen bereits einige Personen, dazwischen auch seine beiden Freundinnen. Ilse war groß und hübsch und hatte die Gangart eines Models. Nein, sie war eher sympathisch. Um hübsch zu sein, war ihr Gesicht viel zu willensstark. Die Engländerin Mary war dagegen klein, zierlich bis mager und ziemlich scheu, sie sah wie ein Teenager aus. Zu Proben kam sie selten, und wenn, dann setzte sie sich in die dritte Reihe und hörte zu, es schien, sie interessierte sich für nichts außer Musik.
Ungeachtet meiner Proteste verlangte Martin, dass ich mich an die Spitze des Tisches setzte. Als ob ich ein Ehrengast wäre. Ich war verlegen, ich mag es nicht, Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, meine Sache ist – zu beobachten und im Schatten zu bleiben. Neben Martin auf der anderen Seite nahm der Librettist Klaus Platz, dessen blaue Augen so eine merkwürdige Schattierung hatten, die in der Natur nicht vorkommt, offensichtlich trug er lavendelfarbene Linsen. Er hatte auch unangenehm weibliche Manieren und schaute mich so an, als ob er eifersüchtig wäre.
Es war heiß. Essen wollte ich nichts, stattdessen bestellte ich ein großes Glas Apfelgespritzten.
„Sie wollen schlank bleiben, und ich muss essen?!“, warf Martin mir vor.
Er wurde schnell satt und ging zum benachbarten Tisch, wo einige von seinen Musikern saßen. Während der ganzen langen Besprechung blieb er stehen. Als er zurückkam, fragte er mich:
„Wohin gehen wir?“
„Setzen wir uns irgendwo in ein anderes Restaurant, wo es ruhiger ist“, sagte ich.
„Es ist nirgendwo ruhig“, antwortete Martin und lenkte mich in die Richtung meines Hotels. Als wir die Halle betreten hatten, eilte ich zum Wirt:
„Haben sie vielleicht einen Raum, wo wir uns mit dem Maestro ruhig unterhalten könnten?“
Als der Wirt Martin sah, eilte er zu ihm. Bald saßen wir im leerstehenden Bankettsaal.
„Warum gehen wir nicht in Ihr Zimmer?“, fragte Martin bestürzt.
Ich wusste nicht sofort, was ich antworten sollte, dann sagte ich etwas Dummes:
„Dort ist totale Unordnung.“
„Na und? Bei mir herrscht auch immer Unordnung!“
„Was bewegt Sie, russische Musiker so zu mögen?“, beeilte ich mich mit meiner ersten Frage, um ihn vom Thema abzulenken.
Martin fing an, mir seine Gedanken über Russland und russische Musik mitzuteilen, er dehnte sie auf die russische Seele aus, alles das waren allgemeine Floskeln, die ich längst satt hatte. Dann aber sagte er ganz einfach:
„Ich liebe meine Russen für ihre innere Freiheit. Unsere Musiker, wenn sie einmal ein Stück gespielt haben, werden sie es niemals anders spielen können – die russische Seele dagegen ist immer in Bewegung. Die russischen Musiker sind sehr empfindlich, sie haben irgendwelche feine Antennen ...“
Eine Stunde später beschlossen wir, dass es höchste Zeit wäre, ein Musical über die deutsche Prinzessin Sophie Auguste Friederike von Anhalt-Zerbst zu machen, über ihre jungen Jahre, als sie noch nicht ahnen konnte, dass sie einmal zur russischen Kaiserin Jekaterina der Großen würde.
„Ja, man muss an beide unsere Völker denken, weil deutsche und russische Geschichte sich im Laufe der Jahrhunderte mehrmals gekreuzt haben. Der Zweite Weltkrieg hat unsere Kulturen getrennt, jetzt aber ist die Zeit gekommen, die Gleichheit wieder herzustellen“, fügte Martin hinzu und setzte den Endstrich zu unserem Gespräch.
Ich schaltete das Diktiergerät aus.
Wir standen auf wie auf Befehl.
„Du gefällst mir sehr“, sagte Martin.
Diesmal fasste er mich wirklich um die Taille, und ich legte meine Hände auf seine Schultern.
In der Pause holte er mich in der Galerie ein. Er atmete schwer, so als ob er mir nachgelaufen wäre, befürchtend mich in der Menge zu verlieren.
„Nach dem Konzert gehen wir alle ins Restaurant „Post“, komm auch!“
Und ich kam. Das Restaurant war riesig, mit einer Menge von Räumen, und die waren voll. Unentschlossen blieb ich vor der Tür stehen.
„Was, keine Plätze mehr?“, Martin erschien hinter meinem Rücken, fasste mich um die Taille und führte mich hinein. Kaum gingen wir ein paar Schritte, als ihn jemand ansprach. Es war der Finanzdirektor des Festivals. Beide fingen an, etwas scheinbar Wichtiges zu besprechen. Durch den Lärm konnte ich kein Wort hören. Das Gespräch dauerte lange, im Gang war es heiß und feucht, und ich ging nach draußen, wo ich mich weiter langweilte. Auf der anderen Straßenseite sah ich ein anderes Restaurant. Jemand winkte mir durch das Fenster. Ich erkannte russische Musiker, die ich vor kurzem kennengelernt hatte. Ein ungezwungenes Geschwätz in der Muttersprache, das tat mir gut. Dann kam der Bus, um die Musiker in ihr abgelegenes Hotel zu bringen.
Ich stand wieder auf der Straße und schaute mich um. Dann hörte ich eine Stimme:
„Komm her! Wo warst du? Wir haben dich gesucht!“
Auf der Terrasse des Restaurants „Post“ standen meine Freundin und Martin.
Ich bin die Treppe hinaufgestiegen.
„Leute, ich muss gehen“, sagte Larissa und verschwand.
„Wo bist du gewesen?“, fragte Martin, „Ich habe dich den ganzen Abend gesucht!“
Er fasste mich am Ellbogen und führte mich fort.
In der dunklen Kastanienallee blieben wir stehen. Unsere Lippen berührten sich. Es war kein richtiger Kuss, Martin drückte einfach ganz fest seine Lippen auf meine.
„Ich brauche dich!“, sagte er.
Er sagte das so, dass ich ihm sofort glaubte. Vor lauter Aufregung konnte ich keine Worte finden, anstatt der Antwort legte ich meine Hände um seinen Hals.
Wir blieben so stehen, ohne Worte, ohne Bewegung.
Plötzlich war es so, als ob Martin aufgewacht wäre:
„Ach, ich habe vergessen, ich muss einen Musiker zu mir nach Hause bringen. Er übernachtet bei uns.“
Er nahm meine Hand, und wir eilten zu seinem Haus.
Ein kahlköpfiger Bursche mit steiler Stirn schaute mich genauso unfreundlich an, wie der Librettist Klaus. Es schien, jeder hier hielt Martin für sein Eigentum.
Martin lud uns ins Haus ein.
„Nein, ich werde auf dich hier warten!“, sagte ich
„Aber du wartest!“, sagte Martin im Befehlston.
Bald kam er zurück. Wir gingen über die kleine steile Brücke und kamen in einen dichten Tunnel, der vom Gestrüpp einer Heckenrose gebildet wurde. Bitteres Aroma füllte die Luft. Man konnte hören, wie das Wasser im Bach rauschte.
„Ist das dein Bach?“
„Und wie!“
„Hast Du hier auch Forellen?“
„So viel du willst!“
Martin nahm meine Hand, ganz leicht, ohne Händedruck. Seine Hand war zart und stark zugleich, sie war einem riesenhaften nächtlichen Schmetterling ähnlich. Wir wollten gerade die Straße überqueren, um zu den Teichen hinunterzusteigen, als wieder jemand Martin anrief.
„Es tut mir leid“, sagte Martin, mich tröstend, „Warte, ich muss kurz mit ihnen reden!“
Ich hatte das satt! Und überhaupt, es war nicht gut! Zu fliehen, etwas heimlich zu machen … Wozu das alles? Ich warf mir vor, dass ich mich … O Gott, Martin hat in meinem Herzen so ein großes Gefühl erzeugt … Nein, ich will mich nicht verlieben!
„Warum warst du so plötzlich weg?“, entrüstete sich Martin wieder, „ich habe dich gesucht. Ilse ist in Regensburg, wir könnten zusammen verweilen ...“
Ja … Heimlich … Vielleicht war es gut, dass ich weg wollte.
„Warum ich? Ich kann sie dir nie ersetzen …“, sagte ich.
„Was, was hast du gesagt?“
„Ich würde gerne … Aber ich kann nicht.“
„Niemand soll niemanden ersetzen!“
„ Du hast recht.“
„Ich brauche dich!“
„Ich brauche dich auch!“, sagte ich, das waren aber nicht die Worte, die ich sagen wollte, und andere wusste ich nicht.
Martin schwieg lange, dann sagte er nachdenklich und traurig:
„Ein Mensch kommt kaum zur Welt, und er ist bereits betrogen.“
Am Morgen überflutete das weiße Feuer der Sonnenstrahlung den Hauptplatz. Feuer drang schmerzlich sogar durch die geschlossenen Augenlider. Das Orchester repetierte „Chatiwka“. In Hebräisch bedeutet das ‚Hoffnung‘. Traurig klang das Klavier, es schluchzte die Klarinette. Der Klarinettist hatte runde traurige Augen eines beleidigten Kindes.
Die Hoffnung … Aber warum weint sie so bitter?
Nach dem Spiel, kaum stieg der Klarinettist in den Saal hinunter, entflammte zwischen ihm und Martin plötzlich ein Streit. Ich hörte kaum die Worte, das alles war einer Pantomime ähnlich, beide erwiesen sich als Meister der Gestik. Martin bewegte sich, er konnte überhaupt nicht auf einem Platz lange stehen, wenn er sich mit jemandem unterhielt, machte er einen Schritt vorwärts und sofort trat er wieder rückwärts zurück, es schien, als ob sein Körper auf eine geheime Musik reagierte, die sich in seinem Inneren abspielte.
Schließlich verstand ich. Martin sagte, der Klarinettist müsse leiser spielen, er aber meinte, dass ihn dann in den hinteren Reihen niemand hören würde. Der Klarinettist kannte aber diesen Platz nicht, der über eine zauberhafte Akustik verfügte: Die Häuser stehen so dicht nebeneinander, dass sie die Töne besser spiegeln als in einem griechischen Theater. Die beide zerstritten sich so sehr, dass es bei mir keinen Zweifel gab, dass der Klarinettist seine Sachen nun einpacken und heim fahren würde.
Eine Minute später saß Martin am Klavier, und der Klarinettist tat so, als ob nichts gewesen wäre, stieg auf die Bühne und beide begannen zu improvisieren. Ihr Spiel war einem Wettbewerb ähnlich: Schau, wie ich das kann; schau du, ich kann es noch besser! Eine Flamme riss sich aus dem geöffneten Flügel und warf goldige Funken herum. Die Klarinette, gleich einem Wasserfall, versuchte, diese Flamme zu löschen …
Als das Klavier verstummte, verstummte auch die Klarinette. Martin umarmte den Israeli, zusammen verließen sie die Bühne.
Mein Herz schlug ganz laut vor Begeisterung, meine Augen wichen nicht von Martin ab. Ein leichtes Lächeln spielte auf seinem Gesicht. Er bewegte sich in meine Richtung. Aber er setzte sich nicht neben mich, er blieb hinter meinem Rücken stehen.
„Es ist dumm, wir sollen nicht voneinander weglaufen“, sagte er und neigte seinen Kopf zu mir.
Ich spürte die feuchte Wärme seiner Haut. Das Blut in meinen Adern lief schneller, der Strom war so stark, dass ich fürchtete, er würde meine Haut zerreißen.
„Greife mich an!“, habe ich geflüstert.
Hier hat mein Deutsch mich verraten, ich wollte, dass Martin seine Hand beiläufig auf meine Schulter legen würde, also das richtige Wort sollte „Berühre“ sein. Ob es einfach meine nicht ausreichende Kenntnis der deutschen Sprache war?
Martin fragte entschlossen:
„Welche Zimmernummer hast du?“
Er führte mich, und ich habe mich ihm unterworfen, schamlos, ohne Angst, ohne Zweifel … „Leiser, leiser“, flüsterte er und versuchte meinen Mund mit Küssen zu schließen.
Warum nennt man das ‚er hat mich genommen‘? Hat er mir etwas weggenommen? Hingegen … Alles, was in ihm war, ist in mich übergegangen, und mein Körper erzitterte ... Er schaute mir in die Augen und küsste meine Hände. Ich spürte Tränen in meinen Augen.
„Ich liebe dich“, flüsterte Martin.
„Und ich liebe dich.“
„Liebste …“
„Liebster ...“
Martin ist gegangen, die Freude blieb. Sie füllte mich, alles in mir sang und bebte. Ich konnte nicht weiter im Zimmer bleiben.
Die Nachmittagshitze tauchte die Stadt in schläfrige Stille. Ich stieg zum Fluss hinunter. Lange stand ich auf der Brücke – und ein dummes Lächeln wanderte auf meinem Gesicht umher. Ein Mann, nackt, schwamm über den Fluss. Er blickte nach oben, sah mich und lächelte zurück. Die Bewegungen seiner Hände wurden energischer, er zeigte mir, was für ein ausgezeichneter Schwimmer er war. Nur die Deutschen können das, zu flirten, wenn sie nackt sind. Die Hemmschwelle ist bei ihnen sehr niedrig … Hemmschwelle … Bei mir ist sie anscheinend auch ziemlich niedrig geworden …
Ich wurde hungrig. Ein kleiner Tisch auf der Terrasse des küstennahen Restaurants war frei. Ich bestellte Salat und noch etwas.