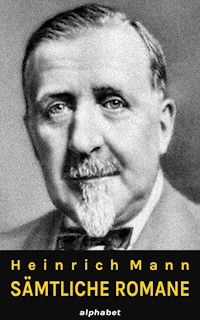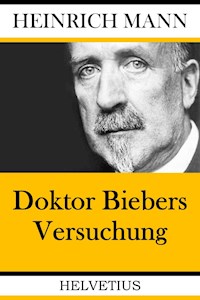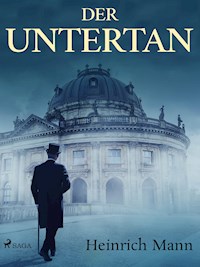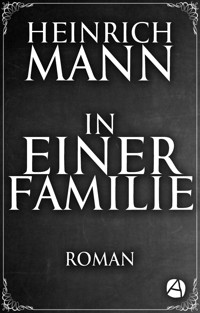Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Heinrich Manns Drama über das Schicksal einer erfolgreichen Schauspielerin: Die Protagonistin Leonie ist auf dem Höhepunkt ihrer Karriere und führt keineswegs das prekäre Künstlerleben, das man erwarten würde. Ihre Selbstständigkeit und ihr luxuriöser Lebensstil machen sie in der Männerwelt durchaus attraktiv, und schon bald buhlt nicht nur ein Verehrer um sie...-
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 107
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Heinrich Mann
Schauspielerin
Saga
Schauspielerin
Coverimage/Illustration: Shutterstock
Copyright © 1906, 2021 SAGA Egmont
Alle Rechte vorbehalten
ISBN: 9788726885217
1. E-Book-Ausgabe
Format: EPUB 3.0
Dieses Buch ist urheberrechtlich geschützt. Kopieren für gewerbliche und öffentliche Zwecke ist nur mit der Zustimmung vom Verlag gestattet.
Dieses Werk ist als historisches Dokument neu veröffentlicht worden. Die Sprache des Werkes entspricht der Zeit seiner Entstehung.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - ein Teil von Egmont, www.egmont.com
I
Leonies Familie behielt trotz den geschäftlichen Einbußen und dem Aussterben aller älteren männlichen Mitglieder noch viel Gesetztheit und Regelrechtheit – abgesehen von einem kleinen Kapellmeister, der aber auch nicht ohne bürgerliche Strebsamkeit war. Mit Leonie ging scheinbar alles gut, bis sie neunzehn war. Sie hatte jahrelang bleich, lang und mager auf dem Sofa gelegen, Butterbrote mit Wurst und ganze Leihbibliotheken verschlungen und dann, die Arme unterm Kopf, entgeistert zur Decke gestarrt. Nun aber brach aus ihr heraus die Theatersucht, und zwar mit den Zügen des Hofschauspielers Hellfried. Leonie kannte ihn längst, und nie hatte sie etwas Besonderes empfunden bei seinem Auftreten. Plötzlich kam ihr eine Unruhe, die Ahnung, was seine Partnerin dort oben rede und handle, das könnte sie selbst ebensogut und vielleicht besser. Da schob sie sich auch schon, von ihrem Parkettplatz aus, der andern unter, hielt nun selbst, mit zurückgeworfenem Oberkörper und die Arme nach vorn gespreizt, eine berauschende Tirade, fühlte Armands Feuer um sich her, seine auf sie eindringenden Gebärden und seinen klingenden Atem, der über sie hinflog wie der Heilige Geist! Sie saß da, als mächtige und glückliche Künstlerin – bis zum Fallen des Vorhangs, bis sie sich wiederfand in Kleinheit und Ohnmacht, gejagt von Scham und Zorn nach Hause gelangte und Tränen vergoß über ihrem einsamen Teller mit dem erkalteten Abendessen. Am Morgen war der ärgste Jammer vorbei, und sie konnte üben, was sie gestern gelernt hatte.
Mit ihrer Freundin – aus der später dennoch nichts anderes ward als eine Familienmutter – stand sie jeden Abend Posten vor der Tür der Bühnenmitglieder; zweimal, bei ihrer Ankunft und wenn sie gingen. Noch mehrere junge Leute waren so pünktlich. Mädchen, die Hellfrieds Rivalen zuliebe da waren, verachteten die beiden Freundinnen und wurden von ihnen verachtet. Er erschien, mit dem künstlich ungezwungenen Schritt des berühmten Mannes, der sich belauert weiß und nichts merken will. Mehrmals gab er doch dem Zwang ihrer unverwandten Anbetung nach und sah hin. Sein Blick schlug durch sie hindurch; sie spürte ihn in den Fußsohlen und meinte, der Asphalt unter ihr müßte davon aufgerissen sein. Nach der Vorstellung dagegen mochte sie hinlechzen; – er schlüpfte nur, leicht gebeugt, ein Tuch um den Hals, ein anderes fest vor den Mund gedrückt, über das Trottoir; sah von Besorgnis verstört aus; verschwand hurtig in einer Droschke. Und Leonie war namenlos stolz auf ihn; sein auf der Straße fortgesetztes Komödienspiel beglückte sie fast mehr als sein durch sie hinstreichender Blick.
Sie erklärte im Familienkreise das Komödienspielen laut für das Höchste; für wichtiger als die bürgerlichen Ziele; für das einzige, wobei man lebe. Sie fing selbst an, jeden Augenblick auf ihre Wirkung zu achten, bei Zeitungsnachrichten Affekte zu üben, wegen eines Nichts eine ihr lehrreiche Szene hervorzurufen. Dies alles vermochte sie jetzt schon mit rollendem »r«. Sie sprach so unverhohlen von Armand, daß niemand sie für ernsthaft verliebt hielt. Sie erzählte, daß er es sei, der die Reisinger wegintrigiert habe, »weil er genug von ihr hatte«.
Dann sei er ja eigentlich ein gemeiner Kerl. »Ist er auch!« sagte Leonie triumphierend. Mit ihrer Freundin besprach sie bewundernd seine Äußerung: eine, mit der er gut zusammen spielen solle, müsse er gehabt haben. Sie wußten Züge aus der Zeit vor seiner Scheidung. Er hatte seinen Schwiegervater vor einen verschlossenen Schrank geführt. »Ihre Tochter ruiniert mich. Ich habe den Schlüssel nicht; aber da drinnen sind Toiletten für zehntausend Mark; ich kann das nicht leisten!« Als der Vater sie zur Rede stellte, öffnete Frau Hellfried den Kasten und zeigte einen Lodenrock vor und zwei alte Mullkleider. Die Toiletten für zehntausend Mark hingen bei seiner Geliebten. Leonie kam in Verzückung über solche Züge. Sie neigte nicht dazu, rosige Legenden um ihn her zu ranken. Er war nicht der edle Mime, der junge, ahnungslos in sein Zimmer geschlichene Mädchen mit väterlichen Belehrungen und einem Kuß auf die Stirn entläßt; der einem König die Wahrheit sagt; der, von allen unerwartet, vor Gericht erscheint, um einen Unschuldigen zu retten. Leonies Schwärmerei war neueren Stils. »Wie ist er vermimt und verschminkt!« rief sie herausfordernd aus. Was daran so erfreulich sei, meinten die anderen; und Leonie verdrehte voll Mitleid die Augen. Oder sie frohlockte: »Also es ist Tatsache, statt Armand Hellfried heißt er, weiß Gott, Aaron Fried!« Ob sie das schöner finde? »Allerdings. Und er müßte nicht mal Fried heißen, sondern Konstantinopler oder Pfefferminzblüt.« Man zuckte die Achseln; sie zog ihn ins Groteske. Alle ihre Äußerungen waren jetzt so gewaltsam geworden, diese ganze Lebensperiode krankhaft, meinte man, und offenbar aussichtslos. Dennoch gab sie, kaum, daß der Kapellmeister aus seinem Winterengagement zurück war, ihren festen Willen kund, dramatischen Unterricht zu nehmen. Der Vetter solle sie zu dem alten Kersten bringen. Er machte sich, von der ganzen Familie angstvoll souffliert, daran, es ihr auszureden. Zuerst brachte er vor: den wütenden, wenig sauberen Konkurrenzkampf beim Theater; und da kein anständiger Mensch ihn aushalte, die geringe Herkunft und skrupellose Verfassung der Mitkämpfer. Die geringe Herkunft, entgegnete Leonie, habe ganz andere Gründe. Temperament und Leidenschaft gebe es nicht bei Bürgergänsen, noch dazu bei deutschen Bürgergänsen. »Ihr seid ja so gräßlich zahm.« Man riß die Augen auf; rechnete sie sich nicht mehr dazu? »Drum sind es heim Theater auch alles Juden«, schloß sie sieghaft.
»Na, leidlich gescheit ist sie«, bemerkte der Kapellmeister. »Nun muß sie bloß noch wieder friedlich werden.« Er nannte weiter: die gesellschaftliche Abgeschlossenheit des Standes und die damit zusammenhängenden Sitten. Die unverheirateten Tanten schlugen die Augen nieder. Der Kapellmeister mißbrauchte seine Aufgabe und belegte diesen Punkt mit selbsterlebten Beispielen. Leonie hörte ihn zu Ende an; dann erklärte sie: das mache ihr nichts. Alle zuckten auf. Der Kapellmeister sagte:
»Mir auch nicht. Wenn du bloß überhaupt Talent hättest, meine Liebe. Bei dir ist das natürlich die bekannte Krise; ich weiß doch Bescheid.«
»Das laß meine Sorge sein«, sagte Leonie; und er:
»Und dann, Schauspielerin, was ist denn das? Deswegen stellt man doch keine Familie auf den Kopf. Hast du Stimme, reflektierst du auf die Oper? Nein. Na, dann laß gut sein, beim Schauspiel ist doch nichts zu machen.«
»Weil die Musik euch ganz verblödet«, entschied sie. Der Kapellmeister stellte fest:
»Eine Antwort hat sie auf alles.«
Um sie loszuwerden, brachte er sie zum alten Kersten. Im Sommer und den folgenden Winter machte sie bald hochgemute Zeiten durch, in denen kein Zweifel an ihrer Sonnenzukunft zu ihr hinfand; dann ein Vorbehalt des Lehrers, das Mißlingen einer Rolle oder eine Erkältung und die Angst, mit den körperlichen Mitteln nicht auszureichen – und sie stürzte über durchweinte Nächte, ebenso viele dunkle Stufen hinunter in Trostlosigkeit. Im Wartezimmer des Halsarztes traf sie einmal mit Hellfried zusammen. Er ließ ihr den Vortritt; das nächste Mal erfuhr sie vom Doktor, er habe gefragt, wer sie sei. Auf der Straße grüßte er sie jetzt; – und die Spannung, ob er ihr begegnen werde, machte, daß sie nach jedem Ausgang, ganz erschlafft, sich auf das Bett strecken mußte. Sie wünschte sich nicht mehr, ihn zu sehen; sie konnte es kaum noch ertragen. Dabei ließ sie ihre Kleider und Kosmetiken unbezahlt und gab all ihr Geld für Theaterbilletts aus; sie müsse arbeiten, es sei Arbeit, wenn sie dort sitze. Aber lernen konnte sie dort nur noch wenig und nicht von ihm. Solange er auf den Brettern fehlte, tat sie nichts als ihn erwarten. Kam er, begann sie zu zittern, ward kurzatmig, verlor alle Fähigkeit, sich Rechenschaft abzulegen, wohnte, halb blind, einem verhängnisvollen Schattenspiele bei. Der alte Kersten ließ sich, selten einmal, auf der Bühne des Hoftheaters von ihr vorspielen. Für die Beurteilung zog er einen der Kollegen hinzu. Welche Qualen, bis sie wußte, wen! Wäre er es, sie war versichert, sie würde beim Spiel unter seinen Augen zur Göttin werden, aber tot umfallen. Ihre Hoffnung, daß er es sei, nein, ihr fassungsloser Gedanke an die Möglichkeit, war ein Himmelsflug und ein Selbstmord … Es war niemals er.
Wie der Kapellmeister das nächste Mal auf Ferien kam, war sie eben im Begriff abzureisen. Er konnte sie gerade noch fragen: »Na, soll's nun wirklich losgehn?« Sie ging zu einer Sommerbühne und von dort für den Winter gleich mit demselben Ensemble an ein kleines Stadttheater. Er gab ihr rasch einige Ratschläge.
»Frechheit ist das erste beim Theater! Bis auf weiteres mußt du jeden Menschen, der dir begegnet, für ein unanständiges Individuum halten.«
Dazu neige sie ohnehin, sagte Leonie.
»Deinen Alten sitzenlassen, sobald du weißt, es ist für deine Rolle kein Ersatz da. So bringt man der Bande Respekt bei.«
»Wird gemacht.«
»Na, mit Gott.«
Und Leonie stieg in eine Droschke. Begleitung hatte sie sich verbeten. Als der Schnellzug abfuhr, stand sie im Korridor am Fenster und atmete mehrmals stark auf. Endlich blieb Hellfried dahinten, dachte sie mit gehässigem Jubel. Er hatte sie krank genug gemacht; die Seuche, die er war, sollte nicht noch in der Ferne Kraft behalten. Sie wollte damit fertig werden, sich von ihm erlösen. Wie, wußte sie nicht.
In Kürze trafen bei ihrer Familie glänzende Rezensionen ein und sieghafte Briefe. Wenn man früher, noch als Schülerin, beim Vorspielen auf der Bühne hatte gewärtigen müssen, daß im leeren, dunklen Parkett der Kopf eines Hellfried erschien, oh, dann fragte man wenig nach jedem anderen Publikum! Leonie hatte von vornherein niemals Lampenfieber gehabt; sie verachtete die Leute und war bei ihnen rasend beliebt. Später, im Winter, erfolgten keine Nachrichten mehr, nur auf Anfragen gute Kritiken, so viele man wollte. Endlich kam sie heim – es durfte niemand am Bahnhof sein – und bezog wieder ihr Mädchenzimmer, auf dessen Schwelle sie stutzte. Sie erklärte, daß sie für diesen Sommer ihre Verpflichtung mit Hilfe des Arztes zu lösen gedenke; ihr fehle jedoch nichts, sie habe nur das Komödiespielen für den Augenblick satt. Sie schien müde; ihrem Gesicht gaben Blässe und leichte Gedunsenheit einen krankhaften Reiz. Sie war voller geworden, trug ihre Bühnenkleider zu Hause auf und kein Korsett. Der Kapellmeister langte auch an und stellte gleich fest: »Du hast dich aber großartig herausgemacht! Was die mit ihrer Frisur anfängt! Dein Haar ist ja heller geworden!« Er bemerkte auch ihre rosig geschminkten Nägel, ging schnuppernd um seine Kusine herum und belebte sich sichtlich. Er hatte sie der Beachtung noch wenig wert, ihr Selbstbewußtsein und ihre schneidende Art eher ärgerlich gefunden. Jetzt sah er sie auf eine beunruhigende Weise zum Weibe erhoben, fing unvermittelt an, sich ihr unterzuordnen, sie gegen die Familie zu unterstützen, sich durch Gefälligkeiten an sie heranzudrängen, und versäumte keine Gelegenheit, an ihre Kollegenschaft zu erinnern. »Du bist schließlich nur ein Musikmensch«, meinte Leonie; aber sie benützte seine Begleitung, um in Restaurants zu gehen – wo man sie für sein Verhältnis ansah. Der Kapellmeister nahm es übel, wenn jemand sie erkannte.
Im Hoftheater klatschte sie, sooft Hellfried herausgerufen ward, mit dem gewissen aufmunternden »Ich gönn's dir«, woran sich die Kollegen erkennen.
Sie schüttelte den Kopf.
»Merkwürdig, wenn man so einen Menschen jetzt ansieht. Ich habe ihn ja eigentlich noch niemals ruhig angesehen.«
Ob das tatsächlich so gewesen sei.
»Na!«
Und jetzt sei gar nichts übrig?
»Nur wohlwollende Erinnerung.«
Und sie lächelte höhnisch. Der Kapellmeister zögerte.
»Einfach vergessen?« fragte er und bekam keine Antwort.
»Wie macht man das sonst?«
Aber ihr Lächeln ward immer rätselhafter.
»Wenn der wüßte, was er alles angerichtet hat«, sagte sie endlich, mit sinnender Ironie; und nochmals, beinahe ausgelassen:
»Ja, wenn er das wüßte! …«
Der Kapellmeister konnte im letzten Akt nicht stillsitzen und seufzte viel.