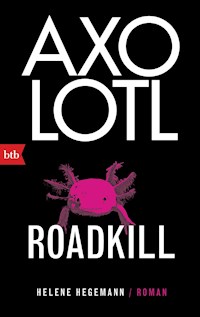12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Fünfzehn radikale Lebensäußerungen, geschrieben von einem der großen Ausnahmetalente der deutschsprachigen Literatur. In fünfzehn Episoden sprengt Helene Hegemann mit luzidem Blick und großer sprachlicher Wucht sämtliche Kategorien, über die wir die Gegenwart zu begreifen versuchen. Ein Pfau wird mit einem Golfschläger getötet und entlarvt die Doppelmoral der amerikanischen Kulturelite. Eine junge Frau will zu ihren Eltern in die österreichische Provinz fahren und verpasst immer wieder ihre Station. Ein Bad in der Wolga markiert das Ende einer zerstörerischen Beziehung. Ein Junge verliebt sich in einen anderen, während sie von fünfzig Wildschweinen umzingelt werden. Eine Snowboarderin wacht unter einer Schneedecke auf. Ein Gemälde von Monet stürzt einen Kunstexperten in eine tiefe Sinnkrise. Es sind versehrte, kraftvolle Figuren, die Helene Hegemann durch das Buch und eine Welt wandern lässt, in der Gewalt am gefährlichsten ist, wenn sie unterdrückt werden soll, in der das Abarbeiten an Widersprüchen schmerzhaft, aber auch ein großes Vergnügen sein kann. Nach und nach setzt sich ein perfide konstruiertes Psychogramm unserer Gesellschaft zusammen, das verstörend und beglückend zugleich ist. »Ich lief auf die Wolga zu, zog im Gehen meine Klamotten aus. Ich blieb so lang unter Wasser, bis mein Körper wieder atmen wollte.«
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 283
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Helene Hegemann
Schlachtensee
Stories
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Helene Hegemann
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Helene Hegemann
Helene Hegemann, 1992 geboren, lebt in Berlin. 2008 gewann sie mit ihrem ersten Film »Torpedo« den Max-Ophüls-Preis. 2010 debütierte sie als Autorin mit dem Roman »Axolotl Roadkill«, der in 20 Sprachen übersetzt wurde. Die Verfilmung, bei der sie selbst Regie führte, wurde beim Sundance Festival 2017 mit dem World Cinema Dramatic Special Jury Award for Cinematography ausgezeichnet. 2013 erschien ihr zweiter Roman »Jage zwei Tiger«, 2018 folgte »Bungalow«, der für den Deutschen Buchpreis nominiert war. 2021 schrieb sie in der »KiWi Musikbibliothek« über Patti Smith und Christoph Schlingensief. Sie inszeniert für Oper, Theater und Film.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
Ein Pfau wird mit einem Golfschläger getötet und entlarvt die Doppelmoral der amerikanischen Kulturelite. Eine junge Frau will zu ihren Eltern in die österreichische Provinz fahren und verpasst immer wieder ihre Station. Ein Bad in der Wolga markiert das Ende einer zerstörerischen Beziehung. Ein Junge verliebt sich in einen anderen, während sie von fünfzig Wildschweinen umzingelt werden. Eine Snowboarderin wacht unter einer Schneedecke auf. Ein Gemälde von Monet stürzt einen Kunstexperten in eine tiefe Sinnkrise.
In perfide konstruierten Episoden von enormer literarischer Kraft katapultiert uns Helene Hegemann einmal um die Welt und mitten hinein ins Herz der Gegenwart.
Inhaltsverzeichnis
Snoopy, das Meer und ich
Die Pfauengeschichte
Надрыв
Schwarzach, St. Veit
Das Lamm und das Gespenst
You have killed me and there is no point saying this again, but I forgive you, I forgive you
Himmel
Wie fühlt es sich an, ein verletzter Krebs zu sein
Mäusesticker
Airramp
Befreiungskriege
Sex und Macht
La Grenouillère, 1869
Sie ist geschäftlich in ...
Zitatnachweise
Nachweis der Veröffentlichungen
Snoopy, das Meer und ich
Bevor sie ihren Vater zurückruft, kippt sie verschimmelten Parmesan aus einer Metalldose auf ihr Essen. Sie weiß nicht, warum sie das tut. Sie weiß auch nicht, dass der Parmesan verschimmelt ist. Dann steht sie auf, läuft zwischen Restaurant und Surfshop auf und ab, schmiert den Sonnenbrand in ihrem Gesicht mit neonfarbener Zinksalbe ein und blickt auf Wellen, die in der Nähe von Grönland entstanden sind und jetzt mit ihrer ganzen ursprünglichen Gewalt auf die Sandbänke einer Touristenhochburg in Nordfrankreich knallen. Ihr Vater sagt, es gebe schlechte Neuigkeiten. Unbesiegbarer Krebs, der auf die Lymphbahnen übergegangen sei. Dann fügt er hinzu, dass er sich sein ganzes Leben lang auf diesen Moment vorbereitet habe. Und sich und der Welt deshalb schuldig sei, eine Art progressiven Umgang mit dem eigenen Tod zu finden, einen Umgang, von dem er noch nicht wisse, ob er leidenschaftlich oder revolutionär sein werde. »Auf jeden Fall beispiellos. So wie bei den Peanuts«, sagt er. »Du weißt, was Snoopy gesagt hat?«
»Nein«, antwortet sie.
»Das weißt du nicht?«
»Nein, ich weiß nicht, was Snoopy gesagt hat.« Sie atmet tief ein, um nicht zu heulen.
»Das ist einer der klügsten Sätze, die überhaupt jemals jemand gesagt hat. ›Eines Tages werden wir alle sterben.‹«
»Das ist von Snoopy?«
»Nein, von Snoopy ist nur die Antwort. Eines Tages werden wir alle sterben. Und Snoopy sagt: ›Ja, aber an allen anderen Tagen nicht.‹«
Zwei Stunden nach dem Telefonat wird sie bewusstlos an den Strand gespült. Ihr Surfbrett ist zerbrochen. Die gezackten Kanten aus Fiberglas haben ihr unter Wasser die Haut am Oberschenkel zerschnitten, sie ist mit dem Kopf auf dem Meeresgrund aufgeschlagen und kotzt jetzt jede Schmerztablette, jeden Croissantkrümel, jeden Schluck Wasser aus, sie kotzt alles aus, was sie zu sich nimmt. Sie hat Glück, dass sie noch lebt.
Als Reaktion auf diesen Vorfall liest sie am nächsten Morgen ein Buch über Männerforschung, rauchend in einem Hotelbett an der französischen Atlantikküste, mit einem Hämatom am Rücken, das tiefschwarz ist, sich vom Schulterblatt bis zum Steißbein zieht und die Form von Ostdeutschland hat. Sie darf nicht lesen, sie liest trotzdem. Sie liest ein Buch über die psychologischen Voraussetzungen für den Zweiten Weltkrieg, über die Kultur der seit Jahrtausenden manifestierten und sich verselbstständigenden Gewalt in männlichen Körpern. Je weiter sie in dem Buch liest, je mehr sie über das liest, was bei Soldaten zu Lustgewinn durch die Tötung anderer Menschen geführt hat, desto konkreter wird das Bild ihres Vaters, der vor diesen Männern steht und gegen sie verlieren wird. Sie sieht ihn nackt, mit verkrampften dünnen Armen, wie er sich abwendet und dabei einen Laut zwischen verschlucktem Kreischen und dem Wimmern eines Kleinkinds ausstößt, heiseres Baby, in der Intensität so animalisch wie der Schrei eines Wesens, das bei lebendigem Leibe ausgeweidet wird, das hat nichts mehr mit Stimme zu tun, nur noch mit dem Abgrund eines Organismus, der nicht vergehen will. Sie sieht ihn als jemanden, der bedroht ist, als jemanden, der sich angesichts dieser Bedrohung zu einem diffusen, nicht mehr greifbaren Schatten verflüchtigt. Ihr wird nicht schlecht, wenn sie ihn sich in diesem Zustand vorstellt, das Gefühl ist ein anderes. Vielleicht fühlt sich das ein bisschen nach Schmetterlingen in Zwerchfellnähe an, allerdings nach welchen, die in einem verlorenen Überlebenskampf stärker flattern als je zuvor. Nettes Bild, aber besser geeignet für etwas anderes. In diesem Fall sind es eher Motten. Oder Miniaturversionen der Staubsaugeraufsätze, die sie vor dem Urlaub bei Amazon bestellt hat. Leblose Tentakel aus Plastik, mit denen man besser in die Ecken kommt. Oder nicht in die Ecken. An die Kanten. Zu den Schmutzschichten auf den Bilderrahmen oder in die Zwischenräume einer Tastatur. Am schlimmsten ist wirklich der Quadratmeter unter der Badewanne, sieht nicht mehr wie Staub aus, sondern wie ein Flokatiimitat aus ergrautem Schamhaar.
Als die Sonne untergeht, humpelt sie in ein Café am Strand mit WLAN. Kopfschmerzen, Augenringe. Sie bucht ihren Rückflug um. Danach beobachtet sie einen elffachen Surfweltmeister dabei, wie er sich selbst fotografiert. Er sitzt am Nachbartisch. Sie kennt ihn aus dem Fernsehen und aus dem Supermarkt. Sie hatten da ein kurzes Gespräch über den Fettgehalt von Schafmilchjoghurt. Er hat einen dritten Daumen und in zwei Staffeln Baywatch mitgespielt. Und gestern hat er auf Instagram zuerst Fotos von seinem Baby und danach ein Video der Welle veröffentlicht, die sie vom Brett gerissen und fast umgebracht hat. Er hebt den Kopf, weil Kinder an dem Café vorbeilaufen. Ein Dutzend vorpubertäre, braun gebrannte Oberschichtsmädchen, die vor Erschöpfung keuchend ihre Bretter zum Strand schleppen. Er ruft ihnen zu, dass sie sich nicht so anstellen sollen. »Jesus hat sein Kreuz auch selbst getragen.« Dann fällt sein Blick auf ihr verbundenes Bein in Jeansshorts. Er scannt die Blutergüsse in ihrem Gesicht und erkennt sie wieder. Sie sieht in seine Surferaugen, hellgraue, vernebelte Surferaugen, der Blick von Menschen, die surfen, verändert sich, als spiegelte sich das Wasser selbst dann noch in ihrem Gesicht, wenn sie auf Beton starren. Sie hat diese Beobachtung lange für Einbildung gehalten. Dann für eine Art esoterische Konsequenz daraus, dass Surfer auf das Einschätzen von Wellen konditioniert sind und jahrelang auf Weltmeere geglotzt haben, auf Wasserflächen, die eine zyklische Wiederkehr behaupten, obwohl sie völlig unberechenbar sind. Bisschen wie Weltgeschichte. Das verändert das Bewusstsein. Und somit zwangsläufig auch das Gesicht. Das war ihre These zum vernebelten Blick von Wassersportlern. Bis sich vor zwei Jahren ihre eigenen Augen zu verändern begannen und ein Arzt ihr den medizinischen Grund dafür mitteilte.
Es sind Bindehautwucherungen. Surfer gucken zu viel in die Sonne. Die transnationale Elite, die eins mit der Natur werden will und deshalb in Langstreckenflieger steigt, die diese Natur zerstören, guckt beim Surfen zu viel in die Sonne. Dadurch entwickeln sich gutartige Tumore. Tumore, die sich wie Schleier über die Pupillen legen.
Sie geht auf den Weltmeister zu. Er fotografiert inzwischen nicht mehr sich selbst, sondern zum dritten Mal den Burger, der vor ihm steht. Sie fragt, ob er ihr beibringen könne, wie man vier Minuten lang unter Wasser die Luft anhält. Besser fünf Minuten oder sechs.
Er lacht nicht, nickt nur und bedeutet ihr mit einer Art wirbelförmiger Geste, dass sie sich setzen soll. Sie bestellt Wodka. Er trinkt Limo aus fermentierten Teeblättern. Er sagt, sie könne vier Minuten innerhalb von drei Wochen schaffen. Locker. Für fünf Minuten bräuchte sie aber ein Jahr. Und dass das im Grunde nur eine Sache der Konzentration sei. Er selbst habe mal zwei Stunden lang in einem Eisbad gelegen und nur durch mentale Anstrengung seine Körpertemperatur auf einem konstanten Level gehalten, wenn sie ihm nicht glaube, solle sie das googeln. Es sei alles möglich, man müsse nur lernen, sich länger als ein paar Sekunden auf seinen eigenen Herzschlag zu konzentrieren. Das klinge simpel, aber das sei nicht simpel, das schaffe fast niemand.
Dann erzählt er, dass er eine feste Abfolge von Bildern im Kopf habe, eine Art Film, den er ablaufen lasse, sobald ihn eine zu große Welle unter sich begrabe und er die Orientierung verliere. Die einzige Chance zu überleben, sei Entspannung, Auslieferung, sonst gehe zu viel Sauerstoff drauf, und man ertrinke, bevor man wieder auftauchen und Luft holen könne. Man müsse kalkulieren, welche Bewegung wie viel Anstrengung erfordere. Einen einzigen Schwimmzug könne man unter bestimmten Bedingungen mit zwanzig Sekunden Bewegungslosigkeit aufrechnen, Leute seien ertrunken, weil sie zum falschen Zeitpunkt einen einzigen Schwimmzug gemacht hätten. Er stelle sich unter Wasser immer seine Familie vor, seine Kinder am Küchentisch, Mehl, Butter, Eier, was noch? Milch. Und dann die Arbeitsschritte. Wie alles abgewogen, miteinander verrührt und dann in eine Form gegossen wird. Normalerweise spuckt die Welle ihn aus, bevor seine Tochter diese Form aus dem Schrank geholt hat. Aber letztes Jahr auf Hawaii war der Kuchen fertig. Und er war noch immer unter Wasser, er war der Kraft des Wassers ausgeliefert und wusste nicht mehr, woran er denken sollte, der Kuchen war fertig, ihm fiel nichts mehr ein, er kriegte keine Luft mehr und fand sich mit seinem Ertrinken ab. Dann hat er überlegt, was das letzte Bild sein soll, das er vor seinem Tod sehen will. Es war ein Weihnachtsbaum. Seine Familie unter einem Weihnachtsbaum. Und dann hat er kurz noch ausgerechnet, dass der Sauerstoffrest in seinen Lungen für zwei oder drei Schwimmzüge reichen müsste und er die ja jetzt noch ausführen könnte, einfach nur der Geste wegen, und dann ist seine Hand über der Wasseroberfläche gewesen, und sein Kumpel hat ihn gepackt und hochgezogen, das ist die Geschichte, die Geschichte ist, dass er ohne den Weihnachtsbaum aufgegeben hätte und gestorben wäre. Sie stehen auf und laufen zu einer Felsformation, er zieht sein T-Shirt aus und bringt ihr bei, länger die Luft anzuhalten. Dabei sieht er aus wie eine Mischung aus Krankenschwester und männlichem Rehkitz. Sie saugt Luft ein, ihre Rippen stehen hervor. Er sagt ihr, woran sie denken soll. Sie schafft drei Minuten. Er fragt, ob sie eine Gehirnerschütterung hätte, sie sagt Ja. Er fragt, ob sie rauche, sie bejaht erneut. Dann zeigt er ihr eine raue Stelle an seiner Fingerkuppe und fragt, ob so etwas vom Rauchen komme, er mache sich ein bisschen Sorgen.
»Nein«, sagt sie. »Das kommt nicht vom Rauchen. Wahrscheinlich hast du heute Nacht geträumt, dass du Cello spielst. Daher kommt das.«
»Wie heißt du?«, fragt er.
»Esther«, sagt sie.
Er schleppt sich zurück zum Strand, in dieser für gerade wach gewordene Profisportler typischen Breitbeinigkeit, sie betrachtet seinen Rücken, diesen Männerkörper, der sich seiner eigenen Erschöpfung nicht bewusst ist. Dahinter ein Himmel, der nicht mehr wie Weltmeer aussieht, sondern wie ein Steinbruch an irgendeinem Stausee im Ruhrgebiet, so ein nüchternes Übereinander zweier Grautöne, eine Wolkendecke, von der man nicht weiß, ob sie gleich von Gottesfingern durchbrochen wird oder ob ein Monsun in ihr lauert.
Auf dem Rückflug sehen die Wolken aus wie weißes Moos, sie hört Alberta Hunter, danach Missy Elliot und Timbaland, deren Kollaboration der New York Times zufolge sämtliche Errungenschaften der amerikanischen Kultur zusammenfasse. Dann kommt Al Green. Simply Beautiful. Sie will nicht wissen, wie viele Kinder zu diesem Song gezeugt worden sind. Sie will auch nicht wissen, was diese Kinder jetzt alle so machen. Sie würde nicht sagen, dass sie Menschen, die zu Al Green Sex haben, verachtet. Sie langweilen sie einfach. Es geht da um Leben und Tod. Sie muss sofort in die Opposition gehen und sich im Detail vorstellen, wie sie ihre ehemalige Englischlehrerin auf einer Autobahntoilette zu Rammstein vergewaltigt.
Danach zwingt sie sich, einen Podcast mit dem Kulturtheoretiker zu hören, dessen Buch sie liest. Ein Buch über die Auflösung von Körpergrenzen, ein Buch darüber, dass Soldaten im Zweiten Weltkrieg ihre Existenz nur spüren konnten, wenn sie Fremde und Frauen zerfleischten. Darüber, dass die Killer sowohl sich selbst als auch die Frauen ihrer Grenzen zu entledigen versucht hätten in diesem Akt des Killens. Sie sieht immer nur einen Blutstrom vor sich, wenn sie an das Buch denkt oder es irgendwo liegen sieht. Hat aber eventuell auch mit der Farbe des Covers zu tun. Rot, nein, Pink, die Farbe, die in ihrer Intensität der von echtem Blut am nächsten kommt, man kann sich nicht dazu durchringen, wieder wegzugucken. Alles in ihr weigert sich, sich mit den Frauen zu identifizieren, die unter diesen Berserkern gelitten haben, oder mit den Fremden, die von ihnen abgeschlachtet worden sind, sie sieht sich selbst mit den Brutalos verschmelzen, sie merkt, dass sie die Bewegungen von Menschen nicht mehr von sich selbst unterscheiden kann, jeder Schritt, jedes Schnarchen, jeder Gesichtsausdruck eines anderen dringt direkt in sie ein und reißt sie in Stücke. Sie kann verstehen, dass da nur das Töten hilft. Natürlich hält sie diese Einsicht für ein schlechtes Zeichen.
Der Autor erzählt, dass er nach seinem Nebenjob als Student abends immer eine Stunde lang Rost gespuckt hat. »Abends dann immer ’ne Stunde Rost gespuckt«, sagt er. Er musste irgendwo putzen. Den Maschinenraum von einem Militärstützpunkt.
Sein Tonfall ist vergleichbar mit dem ihres Vaters. Was heißt, vergleichbar. Keine vage Ähnlichkeit, sondern eine fast identische Art, wie sich Melodie und Stimme mit etwas vermischen, das sie für Dialekt hält, das aber auch was mit dem abgefärbten Gestus einer anderen Person zu tun haben könnte, das heißt, sie weiß nicht, ob ihre Gemeinsamkeit darin besteht, dass sie aus Norddeutschland kommen, oder ob sie von denselben Philosophen beeinflusst worden sind. Interessant wird es bei beiden, wenn bestimmte Katastrophen als überwunden gekennzeichnet werden sollen. Das ist so eine »Normale Härte«-Oktave, wenn von prügelnden Vätern oder der Pest die Rede ist oder von halb zu Tode malträtierten Balletttänzerinnen oder der Rollstuhlfahrerin, die vor Kurzem in ihrer Nachbarschaft ausgeraubt und erschossen wurde, die Sätze, mit denen sie Katastrophen schildern, werden immer leiser, als wollten sie das Ende der Aussage verschlucken. Falsch, das ist es nicht. Da wird nichts verschluckt. Der Tonfall geht hoch, die Emotion runter. Wie ein Befehl an den Zuhörer, die vermeintliche Abgeklärtheit zu teilen, bisschen passiv, bisschen aggressiv, eine unvorstellbare Härte wird phonetisch zu etwas Selbstverständlichem gemacht, das man hinnehmen muss, gegen das man nichts unternehmen kann. Hat was Wehleidiges. Oder eher was von der versteckten Beschwerde irgendeiner Großtante aus Ostfriesland darüber, dass das Essen mal besser geschmeckt habe, ja, sie denkt bei diesen Männern immer an Großtanten. Der Tonfall impliziert, sie hätten etwas durchdrungen, was man nicht durchdringen kann, ohne daran zu sterben. Bei dem Autor kommt die Diskrepanz zwischen seinem Gesicht und seinem Sound hinzu, bei ihrem Vater auch, sie sehen auf Fotos wie Gewalttäter aus und kompensieren das live dann mit einer Stimme, die nach dem Gegenteil der Gefahr klingt, die ihre Körper ausstrahlen. Leichtes Lispeln, immer nach Worten suchend, nichts Hartes, Vorgefertigtes, Abgeschlossenes, nichts, was fest genug wäre, um jemandem gefährlich zu werden, der körperlich schwächer ist als sie.
Zu Hause putzt sie. Sie putzt wie eine Irre. Sie denkt an Kinder, die als Reaktion auf die Nachricht, dass ihre Eltern tot sind, unbedingt ihren Puppen die Haare kämmen müssen.
Am nächsten Tag humpelt sie im Regen eine Prachtstraße entlang, klingelt an der Kellertür und befiehlt ihrem Hund, sich auf den Treppenabsatz zu setzen. Ihr Vater öffnet die Tür. Eine Sicherheitstür, die sich nach dem Schließen hörbar automatisch wieder verbarrikadiert. Im Treppenaufgang hängen Fotos gefesselter Frauen. Frauen, die gebondagt von der Decke baumeln. Es sind Originalabzüge eines japanischen Fotografen, der behauptet, er umschnüre die Körper von Frauen nur deshalb, weil er ihre Seelen nicht zu fesseln vermöge.
Sie lässt sich ein Glas Leitungswasser ein und muss sich an der Anrichte abstützen, ihr wird schwarz vor Augen.
»Was ist?«, fragt er.
»Ich werde ohnmächtig.«
Er schweigt, sieht sie panisch an, sie wird doch nicht ohnmächtig.
»Aristotische Hypotonie«, diagnostiziert er und beruhigt sich wieder. Er sieht eine Unberechenbarkeit vor sich, spricht aus, worum es sich seiner Einschätzung nach bei dieser Unberechenbarkeit handelt, und konzentriert sich dann wieder auf etwas anderes, in diesem Fall auf einen Vortrag über seine Firma. Der einzige Moment, in dem er an diesem Nachmittag nicht druckreif spricht, also zu stammeln beginnt und nicht weiß, wie er einen Satz zu Ende bringen soll, ist der, in dem er erklärt, dass eine Tischtennisplatte nicht reiche, um ein Unternehmen zu modernisieren. Er will ein weiteres Beispiel nennen, aber ihm fällt nur ein ziemlich schlechtes ein. »Für die Modernisierung eines Unternehmens braucht man mehr als eine Tischtennisplatte und, ÄH, ÄH, ÄH – Masseure.«
Sie lacht.
»Was ist mit deinem Gesicht passiert?«, fragt er.
Sie erzählt vom Surfen. Er demonstriert mit einem Nicken sein Mitgefühl, dann erzählt er detailreich, wie er sich bei der Biopsie zuerst gefoltert und dann vergewaltigt gefühlt habe. Eine halbe Stunde später, als sie vor einer Fünfminutenterrine sitzen, in die er zur Verfeinerung ein bisschen Sahne gekippt hat, fügt er hinzu, dass er auf alles entgegengesetzt reagieren würde wie der Rest der Menschheit und das schon immer so gewesen sei. Es geht um die Hormontherapie. Man hat ihm weibliche Hormone gespritzt, damit das Testosteron den Tumor nicht vergrößert. Er wirkt seitdem aber nicht weiblicher, sondern männlicher. Das sagen alle, denen er begegnet, ein medizinisch nicht erklärbares Kuriosum. Bei ihm sei alles andersrum, wiederholt er. »Oder umgekehrt.« Das hieße, dass der Krebs seine Lebenserwartung nicht verkürzen, sondern verlängern müsste. »Aber ich weiß nicht, ob ich das überhaupt will.«
Als ihr Vater ins Badezimmer geht, googelt sie den Weltmeister. Sie findet ein Foto von ihm aus den Neunzigern. Das Jahrzehnt kann sie identifizieren, weil er blond gefärbte Haarspitzen hat und eine Badehose mit Tribalmuster trägt. Er hat einen anderen Surfer aus dem Wasser auf sein Brett gezogen und sich über ihn gebeugt, er hält mit beiden Händen seinen Kiefer auf, man weiß nicht, ob er ihn wiederbeleben oder küssen will, sieht jedenfalls maximal schwul aus, ist es auch, es ist das schärfste Foto, was sie je gesehen hat.
Die Schmerzen beginnen zwei Wochen später gegen fünfzehn Uhr, ihr Vater hat sich gerade zwei Bratwurstschnecken aus dem Kühlschrank geholt und sie fallen lassen. Dann ist er schreiend ins Bad und wieder zurück ins Schlafzimmer gerannt. Sie hängt in der Warteschleife des Notrufs. Sie spürt eine Panik, die sich mit einer Art gespannter Bereitschaft abwechselt, bisschen, als wäre sie wieder im Wasser, als würde sie irgendeine Kraft zurück in die Intensität ziehen, mit der ein Weltmeer einen Menschen verschlucken und ihn aus Langeweile wieder ausspucken kann. In der Notaufnahme sitzt sie neben einem Skater unter achtzehn, er scheint sich das Schienbein gebrochen zu haben und sieht sich auf seinem iPad die Handyaufnahme eines Russen an, der neben einem lebendigen Braunbär am Steuer seines Kleinwagens sitzt.
Ihr Vater ist benebelt. Er fragt mehrfach, ob er einschlafen kann, ohne zu sterben, die Narkoseschwester habe ihm nach dem Aufwachen gesagt, dass er die Augen offen lassen müsse, Esther fragt den Arzt, ob das stimme, es stimmt nicht.
Am nächsten Tag ist er wieder zurechnungsfähig, beschwert sich über das Essen und über das Personal, so nennt er das. Sein Gesicht erinnert sie an das eines Hundes, der sich im Schuppen versteckt, um in Ruhe sterben zu können. Er sagt, sie solle nicht so schreien, sie sagt, sie schreie nicht, sie flüstere eher, sie könne sich ja selbst kaum hören. Sie ahnt, dass er noch ein bisschen am Leben bleiben wird. Er hat Augenringe, fummelt am Gummizug seiner Sweatshirtjacke herum und sein Sprechen klingt, als hinge die wahre Bedeutung der Worte irgendwo auf der Mitte seiner Stimmbänder fest, kurz davor, ihn zu ersticken. Und es spielt sich etwas in ihr ab, das sich seit ihrer Gehirnerschütterung in Frankreich häufig in ihr abspielt.
Sie beschreibt das ihrem Vater folgendermaßen: als schwarzen, imaginären Strom, der sich nach Zappen durch die Schrecken der Geschichte anfühlt. Eine Mischung aus Zwangsvorstellung und Diashow und Zeitreise. Eine zerstörerische Kraft, die einen Kanal freischaufelt, in den der Betrachter, in diesem Fall sie selbst, hineingezogen und dann in eine Abfolge von Unregelmäßigkeiten zwischenmenschlicher Verstrickungen katapultiert wird, sie sieht eine Person und sämtliche Tiefpunkte ihres Stammbaums, das steigert sich, bis man in den Schützengräben ankommt. In den Massengräbern, in den Kerkern. Die Überblendung von Folterungen. Alles läuft auf das immer gleiche Bild eines nicht zu identifizierenden, in Ketten gelegten, verhungernden, blutüberströmten und zur Hälfte gehäuteten Mannes hinaus, komischerweise blond, der sich im letzten Moment, bevor die Gewissheit über seinen bevorstehenden Tod endgültig jede Regung zu unterdrücken schafft, mit übermenschlicher Kraft gegen etwas aufzulehnen versucht, was ihm längst angetan wurde. Im Hintergrund, in der Unschärfe, ist ein Berg aus ähnlich versehrten Körpern zu sehen, alle bisschen zombieartig und in Ketten, die Ketten sind nicht wegzudenken, das Destillat der größten Schmerzen, denen ein Mensch ausgeliefert sein kann, kommt offenbar nicht ohne Ketten aus. Die anderen Körper sind teilweise reglos. Das ist echt eine Landschaft aus sterbendem Fleisch. Hundert verschwommene Menschen, grau und rot, bisschen schwarz, und noch eine Farbe, sie weiß nicht, ob es für die einen Namen gibt. Sieht aus, als hätte jemand in das Beige vom Aquarellkasten geascht. Vielleicht ist dieser Menschenberg ein einziger Muskel. Durchdrungen von Fasern, die abgestorben sind. Und dann noch von welchen, die weiterzucken, bis zum Ende. Und immer schwarze, lange Haare im Hintergrund. Hervorstehende Rippen, Menschen, die maschinell einer Kette größtmöglicher Qualen ausgeliefert wurden. Es könne nicht sein, dass man ständig willkürlich in ein Kriegsgefecht vor zweihundert Jahren katapultiert werde, sagt ihr Vater, und sie sagt, das stimme, aber dass ihr das wirklich passiere. Sie schwört es ihm. Und sie glaube, das sei der Grund, warum sie in gewissen Momenten zu einer Maschine werde. Deren Handeln nichts mehr mit einer unmittelbaren Reaktion auf etwas zu tun hat, sondern mit einem zum Zerreißen gespannten Gefüge antrainierter Automatismen. Bewältigungsstrategien, die die Unebenheiten zu einer glatten Fläche plattwalzen müssen, nicht mal Marmor, einfach nur polierter Stahl.
»Das ist ja schrecklich«, sagt ihr Vater.
Sie will antworten: »Ach, so schrecklich ist das gar nicht.« Schließlich bildet sie sich den Zusammenhang zwischen Folterkellern und dem Abgrund in seinen Augen nicht nur ein. Stattdessen ergänzt sie ihre Ausführung um einen wichtigen, bisher nicht berücksichtigten Faktor.
Sie erklärt ihm, dass diese pure, animalische Verzweiflung wie eine Filmszene wirkt, für die alle Schauspieler so geschminkt wurden, dass sie nach Ölgemälde aussehen. Die Szene ist kein Gemälde, das sich verselbstständigt. Sondern eine reale Szene, die versucht, zu einem Gemälde zu werden.
Und sie erklärt ihm, dass diese Zwangsvorstellung nur auftritt, wenn ihr Männer gegenüberstehen.
Bei Frauen ist der Kern der generationenübergreifenden Folter eher Sex. Und auch weniger konkret. Das sind abstrakte Bilder von jungen Mädchen, die der Perversion eines Einzelnen zum Opfer fallen, ja, junge Mädchen, die nicht zum Opfer der Welt, sondern zum Opfer der Verirrung eines Einzelnen werden. Immer Mischung aus Bilderbuch und Expressionismus, nie eindeutig und greifbar, manchmal auch Kupferstiche. Frauen mit gespreizten Beinen vor Kaminfeuern, davor der Rücken von irgendetwas zwischen King Kong und Rumpelstilzchen.
»Denk noch mal daran«, sagt er.
»Mach ich gerade.«
»Ist es schlimm?«
»Nicht wirklich.«
»Gutes Zeichen.«
»Nehme ich auch an.«
Dann sehen sie gemeinsam ein Video auf ihrem Handy an, das den elffachen Weltmeister irgendwo an der Küste von San Francisco zeigt. Er reitet eine große Welle. Fünfzehn Meter hoch. Er bezwingt sie, er bezwingt dieses Wasser, das wie eine Steilwand aussieht, wirklich wie ein Hochhaus, fällt aber vom höchsten Punkt auf die andere Seite. Ein Jetskifahrer kommt, um ihn vor der nächsten Welle zu retten, obwohl dieses Manöver den Tod von beiden bedeuten könnte. Und er schafft es. Er rettet ihn. Der Weltmeister hält sich an dem Jetski fest, und sie schaffen es. Als sie in Sicherheit sind, geben sie einander High Five, sonst nichts.
»Das zieht einem echt den Stecker«, sagt ihr Vater, und sie fragt ihn, ob er Bock auf Vietnamesisch hat.
Die Pfauengeschichte
Sie hört die Pfauengeschichte jetzt zum fünften Mal. Alle erzählen ständig die Pfauengeschichte. Bevor derjenige, der sie erzählt, zum entscheidenden Kern der Pfauengeschichte vordringt, wird für gewöhnlich erst das Grundstück von Matthews Nachbarn deskribiert.
Das ist das Grundstück, auf dem sich die Pfauengeschichte abgespielt hat. Das Wort »Nachbar« führt in die Irre. Der Mann wohnt zwei Kilometer entfernt. Zwischen Matthew und ihm liegen naturgeschützter Morast und ein bisschen Schilf, vielleicht noch ein Fluss mit Alligatoren und kleinen Bambuswäldchen am Ufer. So stellt Phoebe sich das vor. Die Pfauengeschichte spielt in South Carolina.
Matthew und sein Nachbar müssen gelegentlich über Bäume und Sichtverhältnisse diskutieren, der Nachbar will, dass die jahrhundertealten Eichen auf Matthews Grundstück gefällt werden. Die versperrten ihm die Sicht. Die Sicht auf was auch immer. Wasser, wie Phoebe annimmt. Dieses Detail wird der Pfauengeschichte mit der immer gleichen hektischen Abfolge missbilligender Kommentare vorangestellt. Vermutlich, um den Nachbarn von Beginn an als Arschloch zu diskreditieren. Ist wohl auch ein echtes Arschloch. Obwohl Phoebe ihr Hauptaugenmerk bei der Pfauengeschichte immer eher auf die Arschlochhaftigkeit von Matthew richtet. Ein Arschloch schließt das andere Arschloch ja nicht zwingend aus. Ganz im Gegenteil. Bei ihr selbst handelt es sich übrigens auch um eins, sonst würde sie diese Geschichte nicht veröffentlichen.
Matthew hat einen soft spot für Pfauen. Die kommen von einer ehemaligen Sklavenplantage über den Ashley River geschwommen und hängen ab und zu auf seinem Grundstück rum, ihr ist nicht klar gewesen, dass die Dinger schwimmen können, muss aber so sein, sie werden wohl kaum die Fähre nehmen. Oder fliegen die? Können Pfauen fliegen? Er ruft dann manchmal den tierärztlichen Notdienst. Oder den Naturschutzbund. Um die Pfauen retten oder verarzten zu lassen oder einfach so.
In Toronto hat Phoebe die Pfauengeschichte zum ersten Mal gehört. Zum zweiten Mal in New York, und zwar von Matthews Frau, einer weißblonden Innenarchitektin, deren Tante in den Achtzigern als die schönste Frau Dublins gegolten hatte. In ihrer Version kam, wenn Phoebe sich recht entsinnt, zusätzlich ein weißer Lieferwagen vor, mit dem die Pfauen eines Tages aus völlig undurchsichtigen Gründen abtransportiert werden sollten. Und Matthew sei dem Lieferwagen dann hinterhergerannt und habe sie gerettet. Keine Ahnung, vor wem oder vor was.
Wegen irgendetwas, das mit diesen Pfauen zu tun hatte, hat Matthew seinem Nachbarn kurz vor Ostern einen Besuch abstatten müssen. So geht die Pfauengeschichte los. Und damit, dass Matthews Nachbar keine einzige Pflanze auf seinem Grundstück hat, nur Betonflächen in Pastellfarben. Jedes Mal, wenn sie die Pfauengeschichte hört, verschwimmt Phoebes Vorstellung des Anwesens mit ihrer Erinnerung an ein Computerspiel, das sie als Kind mit ihrer besten Freundin Jacoby gezockt hat. Sie waren zehn Jahre alt und Diplomatenkinder. Ihre größte Gemeinsamkeit bestand darin, dass sie nicht von ihren Eltern aufgezogen worden waren, sondern von deren Hunden. Das Computerspiel war eine Mischung aus Realitätssimulation und Sozialexperiment, in der man aus verpixelten Steinplatten Einfamilienhäuser entwerfen und gottgleich den Alltag der dort eingezogenen Menschen gestalten konnte. Sie haben die Leute abwechselnd Kinder zeugen und per Mausklick im Pool ertrinken lassen. Wurde das zu langweilig, kauften sie ein. Soundsystem, Sprungbrett, flamingoförmige Vasen. Sofas mit Zebrabezug, ein drittes Stockwerk. Wendeltreppen, japanische Zierkirschen. Und Haustiere. Unmengen exotischer Haustiere.
Genauso stellt sich Phoebe das Grundstück von Matthews Nachbarn vor. Vielleicht sogar sein ganzes Leben. Ihn selbst im rosa Poloshirt. Oder in einem zu engen Hemd mit Längsstreifen, randlose Brille, Haare nach hinten gekämmt, dann dieses spezielle Stück Bauchhaut, das sich über der Gürtelschnalle wölbt und bei einer millionenstarken Horde vergleichbar aufgestellter Finanzdienstleister identisch aussieht, auf identische Weise den untersten Hemdknopf fast zum Abspringen zwingt, man denkt da an giftige Gase, die eine Oberfläche zum Zerreißen spannen, an Gase, die entstehen, während etwas verrottet.
Dieser Nachbar hat einen Pfau auf seinem Grundstück erschlagen. Mit einem Golfschläger. Er hat das Matthew voller Stolz erzählt. Der Pfau hat ihn genervt und er hat ihn deshalb mit einem Golfschläger erschlagen. Im Pyjama, nimmt Phoebe an. Matthew sei seiner Frau zufolge daraufhin in Tränen ausgebrochen, beziehungsweise seien ihm daraufhin Tränen in die Augen geschossen, ich denke, das ist ein Unterschied.
Das ist die ganze Pfauengeschichte.
Phoebe glaubt, die Geschichte sei vor allem deshalb eindrucksvoll, katapultiere vor allem deshalb so viele der Zuhörer in einen Zustand existenzieller Zerrüttung, weil die Vorstellung des mit einem Golfschläger erschlagenen Pfaus eine gewisse geistige Herausforderung darstellt. Und weil der Akt des Erschlagens eine kaltblütige Präzision erfordert haben muss, die den Affekt, aus dem er resultiert ist, auf spannungsgeladene Weise kontrastiert.
Das ist einfach ein saugutes Bild. Besser als wahllos abgeschlachtete Menschen, oder nennen wir das lieber: eindrücklicher.
Sie könnte die Pfauengeschichte als genau das empfinden: ein eindrückliches Bild. Anrührend, erschütternd, nette Farben. Am Abend, an dem Matthews Frau ihr die Pfauengeschichte in New York erzählte, fügte sie jedoch etwas hinzu, das sie irritierte.
Sie aßen Gänsestopfleber in einem Restaurant. Es gab keinen Anlass. Das moralische Dilemma, auf das Phoebe hinauswill, ist nicht die Gänsestopfleber. Man darf Gänsestopfleber essen und sich gleichzeitig über den Mord an einem Pfau echauffieren, das schließt sich nicht zwingend aus. Sie hält es nicht mal für einen allzu großen Widerspruch, sich in einem Maserati sitzend über soziale Ungerechtigkeit zu beschweren. Das geht schon irgendwie. Das muss drin sein. Es ist fragwürdig, wenn jemand mit strassbesetzter Schirmmütze auf dem Golfplatz behauptet, er wäre linksradikal. Aber manchmal gelingt es Phoebe, diese Widersprüche zu akzeptieren oder zu tolerieren. Sie will auf etwas anderes hinaus.
Matthews Frau saß am Kopfende einer langen Tafel, Matthew über sein iPhone gebeugt ihr gegenüber, acht Menschen zwischen ihnen, unter anderem Phoebe, näher an ihr als an ihm. Er zeigte seinem Tischnachbarn eine Internetseite. Irgendwelche Immobilien in Irland. Irgendwelche Cottagehäuser. Aus den Gesprächsfetzen, die sie aufschnappte, ging hervor, dass beide ganz gerne eins kaufen wollten.
Plötzlich erhob sich seine Frau. Rotweinglas in der Hand. Sie unterbrach ihn und rief: »Matthew.«
Er rief: »Ja?«
Sie rief: »Warum haben bei der Wahl in Schweden achtzehn Prozent für die Rechtsradikalen gestimmt?«
Der Tisch verstummte. Matthew legte die Ausnahmeimmobilien weg, eine mechanische Reaktion. Dann begann er, einen fundierten Vortrag über die auseinanderklaffende Schere zwischen Arm und Reich zu halten. Darüber, dass soziale Missstände zu Totalitarismus und Gewaltherrschaft führten, darüber, dass diese Welt eine schlechte sei. Alle hörten zu. Er kann das gut. Und er weiß Bescheid. Er ist Marxist. Ein Marxist mit fünfzehn Karren in der Garage, daneben ein überdachter Tennisplatz. Ich meine das nicht kritisch, Phoebe auch nicht. Aber beginnt man, diese Verhältnisse neutral zu dokumentieren, schwingt die Kritik an ihnen in jedem Satz mit. Man kann nichts dagegen tun.
Einige Zeit später, zwischen Dessert und Käse, nach der Pfauengeschichte und dem bezeichnenden Exkurs zum Thema soziale Spaltung, erzählte seine Frau Phoebe, dass auf ihrem Südstaatengrundstück am Vortag vier Hähne angeliefert worden seien.
Sie mochten Tiere. Sie hätten Hühner, Chinchillas, Kaninchen. Immerhin keine Großkatzen, aber einen Luchs. Sie hätten auch zwei Weißkopf-Seeadler in einer Voliere. Es sei das dritte Paar. Die Pärchen davor seien alle nach einigen Monaten an einem speziellen Katzenvirus verreckt. Das Virus hieße Toxoplasmose. Laut eines Uberfahrers, der Phoebe tags zuvor von Downtown L.A. nach Malibu zu einer Dinnerparty bei einem kasachischen Oligarchensohn gefahren hatte, dessen Privatbank nach seiner Bulldogge benannt war und der kurz vor Mitternacht grundlos, unter Tränen, in einem Anfall betrunkener, hundserbärmlicher Sentimentalität ein abstraktes Gemälde aus dem Jahr 2015 in den Kamin geworfen hatte, dessen Wert auf 1,8 Millionen geschätzt worden war und das eine Landschaft gezeigt hatte, von der man nie ganz sicher gewesen war, ob es sich bei ihr nicht doch um eine Massenvergewaltigung gehandelt hatte, könne dieses Virus Menschen zwar nicht umbringen, bei weiblichen Menschen unter Umständen jedoch zu Depressionen führen. Das sei seiner Frau passiert. Die habe sich umgebracht. Und er glaube nicht nur, der Grund dafür sei Toxoplasmose gewesen. Er wisse es.
Phoebe fragte Matthews Frau, warum. Warum vier Hähne. Sie antwortete, die Hähne hätten sie im Internet gefunden. Sie hätten eigentlich nur einen Hahn gewollt, aber die anderen seien auch niedlich gewesen, und deshalb hätten sie alle vier genommen und sie dann vom Hausmeister in den Stall zu den Hennen sperren lassen.
Phoebe sagte: »Das kann doch nicht gut ausgehen.«
Jeder Vorschüler ahnt intuitiv, dass so etwas nicht gut ausgehen kann.
»Ist auch nicht gut ausgegangen«, sagte Matthews Frau. Die Hennen seien psychotisch geworden. Die hätten sich im Kreis rennend das eigene Gefieder ausgerupft, ein paar seien verblutet. Und die Hähne hätten sich tot gekämpft, noch am Nachmittag ihrer Ankunft. Und Phoebe kommt nicht umhin, auf einen gewissen Furcht einflößenden Widerspruch hinzuweisen, wenn sie Matthews Reaktion auf den ermordeten Pfau mit der Reaktion seiner Frau auf den Tod der durch ihr Verschulden in den Wahn getriebenen Hennen und Hähne vergleicht, deren Ableben, im Gegensatz zu dem Ableben des Pfaus, von beiden bloß mit einem reumütigen, fast belustigten Achselzucken quittiert worden war.
Sie muss da an Leute denken, denen ein bedeutsamer Flüchtigkeitsfehler unterläuft. Ein Flüchtigkeitsfehler in der Größenordnung von: Hui, aus Versehen den Atomknopf gestreift. Und die dann wirklich annehmen, es würde ausreichen, als Entschuldigung anzuführen, dass sie in dem betreffenden Moment »nicht auf ihrer geistigen Höhe« gewesen seien.
Das sind dieselben Leute, die Wortfindungsstörungen vorgeben, statt einzugestehen, dass sie Scheiße labern.
Um ehrlich zu sein, sagt Phoebe zu Jacoby, von der sie die Pfauengeschichte gerade erneut gehört hat, sei ihr jemand lieber, der seinem Feind ins Auge sieht und ihn mit einem Golfschläger erledigt, als jemand, der seine Freunde einander auffressen lässt und wegguckt. Sie kann zunächst nicht beurteilen, ob es Jacoby genauso geht. Sie murmelt unentschieden vor sich hin. Schließlich stimmt sie Phoebe zu.