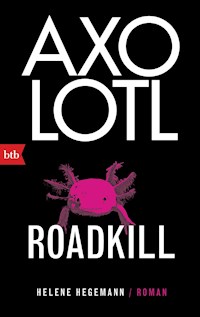19,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Striker« ist ein elektrisierender Roman über eine Gegenwart, in der die Grenzen zwischen Verschwörungsmythen, Klassenkampf und roher Gewalt zunehmend verschwimmen. Mit Wucht und Tempo erzählt Helene Hegemann von Kampfsport und Obdachlosigkeit, von Reichtum und Verdrängung. Von dem Moment, in dem die Angst vor Unterdrückung zu Gewalt führt, und der Schwäche, die man zulassen muss, um diese Gewalt zu verhindern. N wohnt an einer Bahnlinie, die einen Problembezirk mit dem Villenviertel am anderen Ende der Stadt verbindet. Zwei Welten. N kennt beide. Und eine dritte in der Mitte: die Kampfsportschule, in der sie unterrichtet, sich auf Wettkämpfe vorbereitet und eine Affäre mit einer Politikerin aus dem Verteidigungsausschuss beginnt. Gegensätze prägen ihre Existenz: Arm und Reich, Ohnmacht und Muskelaufbau, größte Disziplin und maßlose Aggression gegen sich selbst. Eines Morgens entdeckt N rätselhafte Zeichen an der Brandmauer gegenüber ihrer Wohnung. Keine Buchstaben, keine Hieroglyphen, keine Bilder. Doch, dass sie etwas bedeuten, spürt sie sofort. Es treibt sie um. Und dann stehen plötzlich Koffer und Tüten vor ihrer Tür. Sie gehören einer jungen Frau, die im Treppenhaus übernachtet und behauptet, mit den Zeichen in Verbindung zu stehen. Wer ist sie? Was will sie von ihr? Und warum beschleicht N bei jeder ihrer Begegnungen das kaum zu bewältigende Gefühl, sich selbst gegenüberzustehen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 208
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Helene Hegemann
Striker
Roman
Kurzübersicht
Buch lesen
Titelseite
Über Helene Hegemann
Über dieses Buch
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Hinweise zur Darstellung dieses E-Books
zur Kurzübersicht
Über Helene Hegemann
Helene Hegemann, 1992 geboren, lebt in Berlin. 2008 gewann sie mit ihrem ersten Film »Torpedo« den Max-Ophüls-Preis. 2010 debütierte sie als Autorin mit dem Roman »Axolotl Roadkill«, der in 20 Sprachen übersetzt wurde. Die Verfilmung, bei der sie selbst Regie führte, wurde beim Sundance Festival 2017 mit dem World Cinema Dramatic Special Jury Award for Cinematography ausgezeichnet. 2013 veröffentlichte sie ihren zweiten Roman »Jage zwei Tiger«, 2018 folgte »Bungalow«, für den sie für den Deutschen Buchpreis nominiert war. 2021 schrieb sie in der KiWi Musikbibliothek über Patti Smith und Christoph Schlingensief, 2022 erschien ihr Kurzgeschichtenband »Schlachtensee«. Sie inszeniert für Oper, Theater und Film.
zur Kurzübersicht
Über dieses Buch
»Striker« ist ein elektrisierender Roman über eine Gegenwart, in der die Grenzen zwischen Verschwörungsmythen, Klassenkampf und roher Gewalt zunehmend verschwimmen. Mit Wucht und Tempo erzählt Helene Hegemann von Kampfsport und Obdachlosigkeit, von Reichtum und Verdrängung. Von dem Moment, in dem die Angst vor Unterdrückung zu Gewalt führt, und der Schwäche, die man zulassen muss, um diese Gewalt zu verhindern.
N wohnt an einer Bahnlinie, die einen Problembezirk mit dem Villenviertel am anderen Ende der Stadt verbindet. Zwei Welten. N kennt beide. Und eine dritte in der Mitte: die Kampfsportschule, in der sie unterrichtet, sich auf Wettkämpfe vorbereitet und eine Affäre mit einer Politikerin aus dem Verteidigungsausschuss beginnt. Gegensätze prägen ihre Existenz: Arm und Reich, Ohnmacht und Muskelaufbau, größte Disziplin und maßlose Aggression gegen sich selbst.
Eines Morgens entdeckt N rätselhafte Zeichen an der Brandmauer gegenüber ihrer Wohnung. Keine Buchstaben, keine Hieroglyphen, keine Bilder. Doch, dass sie etwas bedeuten, spürt sie sofort. Es treibt sie um.
Und dann stehen plötzlich Koffer und Tüten vor ihrer Tür. Sie gehören einer jungen Frau, die im Treppenhaus übernachtet und behauptet, mit den Zeichen in Verbindung zu stehen. Wer ist sie? Was will sie von ihr? Und warum beschleicht N bei jeder ihrer Begegnungen das kaum zu bewältigende Gefühl, sich selbst gegenüberzustehen?
Inhaltsverzeichnis
Hinweise
Motto
Ist die Jahreszeit wichtig?
Es geht hier nicht um dich.
Hat funktioniert, macht sie seitdem ständig.
Du bist nicht so wichtig.
Oder, wenn ihr langweilig wird:
You are worthless.
Die zweite Strategie besteht darin, ...
Fuck The Elite.
Sie zählt all das nicht
Danke
Einzelne Passagen hier und hier orientieren sich an dem Text Situationen der Gewalt von Michael B. Buchholz und Andreas Sadjiroen, enthalten in: Die dünne Kruste der Zivilisation, Beiträge zu einer Psychoanalyse der Gewalt, erschienen 2021 im Psychosozial-Verlag.Die Passage zu Akiyama Shirobei Yoshitoki hier ist zu Teilen entnommen aus: de.wikipedia.org/wiki/Jiu_Jitsu.
Soldiers! Don’t give yourselves to brutes, men who despise you, enslave you, who regiment your lives, tell you what to do – what to think and what to feel! Who drill you, diet you. Treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don’t give yourselves to these unnatural men, machine men with machine minds and machine hearts, you are not machines, you are not cattle, you are men! You have the love of humanity in your hearts, you don’t hate. Only the unloved hate. The unloved and the unnatural.
Soldiers!
Don’t fight for slavery!
Fight for liberty!
Charlie Chaplin, The Great Dictator, 1940
Ist die Jahreszeit wichtig? Ja, wahrscheinlich. Am 8. November knallt der Himmel durch die Fensterfronten der Sportschule wie eine Stahlwand, in der sich Abgase spiegeln, sie zieht ihre Schuhe aus, verbeugt sich mit gekreuzten Unterarmen und sagt ein Wort, das sie seit zehn Jahren wiederholt, ohne seine Bedeutung zu kennen oder wissen zu wollen. Oss. Sie unterwirft sich damit keiner Gottheit. Sie unterwirft sich einem ehemaligen Türsteher. Jürgen antwortet. Shomen ni Rei. Bedeutet irgendwas Richtung Demut. Demut, Anerkennung, Respekt für die, deren Wissen er weitergibt. Samurai, von denen keine Sau mehr weiß, wie sie hießen. Dann atmet er ein und zählt die Namen der Kämpferinnen auf, gegen die sie in Tiflis antreten wird. Er hält ihr ein Schlagpolster hin, flüstert, dass sie diesen ganzen, halb zu Tode gebotoxten Chayas jetzt mal richtig schön in die Fresse hämmern und sich mehr wie ein Handwerker hinstellen solle, nicht wie ein Boxer, wenn sie irgendeinen Vorteil in diesem Sport habe, dann den, dass sie kein Mann sei, das müsse sie doch langsam gerafft haben.
Danach schmeißt er ihr einen Medizinball gegen die Bauchdecke. Zwanzigmal. Vierzigmal. Er ist sechsundfünfzig, hat ein Jagdgewehr und einen Zweitwohnsitz in Kapstadt. In der DDR hat er illegale Kämpfe in Bunkern organisiert, sie weiß bis heute nicht, wer an diesen Kämpfen teilgenommen hat, vermutet aber, dass da eine Menge Nazis am Start waren. Er selbst ist keiner. Er ist Unternehmer. Halbkubaner, sieht man aber nicht. Hat was von Clint Eastwood. Verachtet Versager. Es gibt ein Video, aufgenommen in einer Turnhalle, in dem ein oberkörperfreier Teenager auf einer Bank liegt. Auf dem Bauch des Teenagers liegt eine Melone. Jürgen steht hinter ihm und hat ein Schwert in der Hand. Er schafft es, die Melone mit diesem Schwert zu spalten, ohne den Jungen zu verletzen. Danach grinsen beide händeschüttelnd in die Kamera, als hätten sie gerade einen Staatsakt vollzogen. Figuren aus einem Tarantinofilm, die jemand in die falsche Kulisse gephotoshoppt hat.
Jürgen würde besser in irgendeinen japanischen Tempel passen, stattdessen steht er in dieser Ostberliner Turnierhalle zwischen Tapeziertischen und Wasserspendern rum und liest sich im Internet Bewertungen von Handstaubsaugern durch. Er schwitzt nicht, nie. Er scheißt seine Schüler auch nicht unkontrolliert zusammen. Bei Kämpfen ist er der einzige ihr bekannte Coach, der hinter dem Käfiggitter nicht brüllt, sondern flüstert.
Er sagt ihr, dass er sich Videos von Ronda Shephard angesehen habe. Dass Ronda gerade nichts anderes mache, als aus Thailand angereiste Sparringspartner in Nahdistanz zu verdreschen. Dass die Sache klar sei, dass sie mit den herkömmlichen Trainingsmethoden bei ihr nicht weiterkomme, sie müsse sich auf diesen Fight gegen Ronda Shephard vorbereiten wie auf einen dreckigen Straßenkampf, »sonst hast du keine Chance. Wenn du normalerweise im Käfig deinen Job machst, alles geil und so, das ist aber immer wieder so rein und raus und auseinander und zusammen. Das klappt mit der nicht, die ist ein Berserker geworden, seit sie dich ausgeknockt hat, da kommst du nicht weit, die bleibt an dir dran, die ganze Zeit, und haut dir so lange in die Fresse, bis du auf dem Arsch liegst.«
»Können wir das nächste Woche besprechen?«
»Nein.«
Er sagt ihren Namen, damit sie sich konzentriert. Zweimal hintereinander.
»Hör mir zu. Auf der Straße hast du keine Angst davor, getötet zu werden. Du hast Angst, jemanden töten zu müssen. Guck nicht so verständnisvoll, du tust so, als würdest du wissen, worum es hier geht. Aber du hast keine Ahnung. Die Angst, töten zu müssen, um nicht selber draufzugehen, wird zu einer Spannung, die du nicht lange aushältst. Zumindest solange es keine Fluchtmöglichkeit gibt und du nur Feinde siehst. Wenn diese Feinde stolpern oder stürzen, baut sich die Spannung nicht ab. Sie ändert nur ihre Richtung. Und diese Richtungsänderung –«, er hält kurz inne, um ihr endgültig klarzumachen, dass es sich hier um eine Lektion handelt: »Das ist der Killerinstinkt.«
Dann atmet er aus. Fünf Sekunden. Sechs Sekunden. »Das instinktive Verlangen, zu töten. Es setzt ein, wenn der andere längst verloren hat. Im Krieg bedeutet das unfassbare Zerstörung, im Zweikampf einfach nur unfassbare Brutalität. Hat die Natur scheiße eingerichtet. Man will die Situation, in der man unter Umständen jemanden töten muss, beenden. Deshalb tötet man ihn. Und deshalb beobachten auch alle immer die Hände, sie warten auf einen schwachen Moment. Du vermeidest Augenkontakt und guckst dir die Hände an, einfach kurzer Freeze, ah, kommt da jetzt noch was von dem oder nicht, und in beiden Fällen muss er vernichtet werden. Dauert zwanzig Sekunden, nicht länger.«
Er deutet die Schläge an, zieht seine Karatejacke aus, hat nur ein Unterhemd drunter, man sieht einen Teil der Skyline von Greifswald, die er sich kurz vor der Bundeswehr auf die Brust hat tätowieren lassen, daneben das traditionelle Thaitattoo und die Babyfaces seiner Kinder.
Die Angst, jemanden umbringen zu müssen, löst sich erst dann auf, wiederholt er, wenn das Opfer am Boden liegt. Und dann killt man es. Einfach so. Das sei in militärischen Auseinandersetzungen ähnlich, könne sie ruhig mal ihrer Affäre aus dem Verteidigungsausschuss erzählen. Wenn der Gegner sich zurückziehe oder panisch fliehe, passierten die grausamsten Tötungsakte.
Sie wird an diesem Nachmittag ohnmächtig. Jürgen behauptet, sie habe zu wenig gegessen. Aber sie kennt ihren Körper gut genug, um zu wissen, dass er nicht einfach so aus Unterzuckerung zusammenbricht.
Ein Teenager aus Albanien donnert sein Schienbein auf ihren Oberschenkel, sie verliert das Gleichgewicht, knallt auf den linken Rippenbogen und merkt, dass ihr Quadrizeps zittert. Der Typ hat was von einer Lokomotive. Zu viele Muskeln für sein Alter. Einer dieser affektierten Bulldozer, deren Väter sich schon vor dem Brutkasten geschworen haben, ihren Säugling zu einer Kampfmaschine zu machen. Es gibt eine Menge davon. Irgendwann, sofern sie sich dagegen nicht gewehrt oder angefangen haben, Gedichte zu schreiben, sehen die sich alle ähnlich, haben den gleichen Gesichtsausdruck und enden depressiver und fetter und bekloppter, als ihre Väter es sich hätten vorstellen können. Er ist einer der wenigen hier, die Aggressivität in diesem Sport für effektiv halten. Hat letzte Woche einem Anfänger das Jochbein gebrochen. Wiegt achtundzwanzig Kilo mehr als sie.
Sie steht wieder auf, verdrängt den Schwindel, tritt zurück, lässt seinen nächsten Tritt, statt ihn abzufedern oder aufzunehmen, an ihrem angewinkelten Schienbein abprallen, greift mit der rechten Hand in seinen nassen Nacken, zieht mit ihrem rechten Bein einen Halbkreis, stellt sich dabei vor, sie wäre die Spitze des Zirkels, mit dem sie in der Grundschule ganze Weltkriegsgefechte in den Umschlag ihres Mathehefts geritzt hat, und schafft es, weil er mit dieser Bewegung nicht gerechnet hat und sein Gleichgewicht verliert, ihn in eine Position zu bringen, in der sie einen Kniestoß in sein für den Bruchteil einer Sekunde zu Boden gerichtetes Gesicht landen könnte. Lässt sie aber. Kurz vor seiner Stirn bremst sie ab. Spürt, wie ihre Knie nachgeben, fällt hin, kämpft sich wieder ins Stehen, merkt, dass ihr schlecht wird. Sie stützt sich mit durchgestreckten Armen auf den Oberschenkeln ab und verliert das Bewusstsein, das heißt, ihr wird schwarz vor Augen, nur kurz, drei oder vier Sekunden. Sie fällt, steht auf. Schafft zwei Schritte. Und sackt sofort wieder in sich zusammen, wie eine fallen gelassene Marionette.
Nachts wird sie zum ersten Mal von Schritten wach. Ein schnelles Gehen, immer im Kreis. Es klingt nicht nach Einbrechern, eher, als würde jemand unter Zeitdruck ein religiöses Ritual ausüben. Die Schritte dröhnen durch die Decke. Sie wohnt im fünften Stock. Über ihr ist der Dachboden. Er ist zu niedrig, um darin stehen zu können, deshalb hält sie die Schritte für Einbildung und schläft wieder ein. Nein. Sie schläft nicht ein, nie, sie lässt sich von ihrem Körper zu Erholungsphasen zwingen, aus denen sie beim leisesten Windhauch aufschreckt.
Der nächste Sound ist sanft und abgehackt und dringt durch das gekippte Küchenfenster, bisschen wie Meeresrauschen, als würde jemand meditative Wellenklänge auf einem Tonband abspielen und immer wieder die Stopptaste drücken.
Als sie die Augen öffnet, ist es hell. Sie guckt von ihrem Bett aus durch das Küchenfenster. Selbst im Hochsommer erweckt dieser Ausblick den Eindruck einer komplett im Nebel versunkenen Umgebung, weil sie jeden Morgen die Brandmauer, die ihr die Sicht versperrt, mit dem Himmel verwechselt. Es wirkt, als hätte jemand seinen Aschenbecher in der Fassadenfarbe ausgeleert, eine trübe Fläche, die nicht zu durchdringen ist. Heute ist etwas anders. Sie begreift nicht sofort, was, sieht nur, dass das Grau von massiven schwarzen Strichen durchzogen wird.
Sie stürzt zum Fenster, wie ein Tier, das von einem Schuss aufschreckt. Die Wand ist mit Zeichen bemalt. Keine Buchstaben, keine Hieroglyphen. Eher runenartig. Jedes der Zeichen ist knapp einen Meter groß. Wirkt wie eine verlorene Sprache. Ein archäologischer Fund. Mit der linken Hand tastet sie auf der Fensterbank nach Zigaretten, die rechte ballt sie zur Faust. Die Zeichen bedeuten etwas. Das spürt sie. Sie spürt es nicht nur, sie weiß es. Sie starrt und starrt, in derselben, aussichtslosen Heftigkeit, mit der sie versuchen würde, durch Telepathie einen Stahltresor zu knacken. Und sie wird ungeduldig, weil das Starren nichts bringt, weil ihr auch durch das Starren nicht mal im Ansatz klar wird, was der Scheiß soll. Sie hält die Zigarette so weit es geht nach draußen. Die Zeichen sind zwei oder zweieinhalb Meter von ihren Fingerspitzen entfernt.
Chromfarbe. Extrem hohe Deckkraft. Hat was von Kornkreisen. Ein Phänomen, das übersinnlich wirkt und für das es am Ende eine enttäuschend einfache Erklärung gibt. Aber die Intention, diese Zeichen aussehen zu lassen, als gäbe es keine Erklärung; als wären sie von einer allmächtigen, jede Logik übertreffenden Kraft gestaltet worden, ist fast genauso verunsichernd, wie diese Kraft es selbst wäre. Sie kommt nicht drauf, wie diese Zeichen entstanden sein könnten. Es gibt keine Leitern, die lang genug wären. Vielleicht ist da so ein Fensterputzding angebracht worden, denkt sie, wo die Fensterputzer eben immer draufstehen und hoch- und runterfahren, aber dann müsste es sich ja um eine offizielle Angelegenheit handeln und mit Genehmigung des Hausbesitzers passiert sein. Vielleicht haben diejenigen, die für diese Zeichen verantwortlich sind, direkt auch noch die Fenster geputzt. Aber die Fenster sind genauso dreckig wie gestern.
Sie atmet sechs Sekunden lang ein. Acht Sekunden lang aus. Zwingt sich, den Blick von der Mauer abzuwenden und zur Beruhigung nach links zu starren, auf das Wasser im Kanal. Zwischen den Eisschollen und den Ölschlieren schlafen die Schwäne, am Ufer elf Menschen. Drei von ihnen kennt sie.
Den dicken, tätowierten Südamerikaner, der eine schwarze Plane über seinem USA-Sweatshirt trägt, sonst nichts, nicht mal Socken oder Schuhe, auch nicht im Winter.
Den Russen, der nachmittags oft an der Kreuzung steht und seinen Reisepass anstarrt. Leicht nach vorn gebeugt, konzentriert, mit ausgestrecktem Arsch. Grenzt an Kniebeuge und sieht ein bisschen obszön aus, fast so, als hätte man ihn schockgefrostet, während er sich gerade aufs Klo setzen wollte. Beim Yoga schaffen die Leute fünf Atemzüge in dieser Haltung, er hält sie ein bis zwei Stunden durch. Sie hat Wochen gebraucht, um darauf zu kommen, an wen er sie erinnert. An ihre Mutter. Daran, wie sich ihre Mutter manchmal besoffen in einem kleinen Taschenspiegel angestarrt hat. Je öfter sie den Russen in seinen Pass starren sieht, desto klarer wird ihr, weshalb. Ihre Mutter wollte wissen, ob es sie wirklich gab. Will er auch. Wollen alle.
Der dritte Mann, den sie erkennt, ist der mit den guten Schuhen. Jeden Tag spaziert er nach dem Aufstehen vor ihrer Haustür auf und ab. Das ist sein Morgenritual. Andere lächeln ihr Spiegelbild an oder machen funktionelle Gymnastik, er debattiert mit seinen Dämonen, kreischt abgehackte Reden in die Dämmerung. Manchmal fällt das Wort Gaskammer, manchmal beschreibt er Foltermethoden, manchmal formuliert er Sätze, die in Schlachthäusern beginnen und mit Fetzen aus der Tagespolitik enden. Er weiß über den neuen Haarschnitt des Finanzministers Bescheid oder über Konjunktursignale aus China, offenbar liest er Zeitung. Sie sieht ihn aber nie mit einer. Wenn er schreit, kommt ihr das Schweigen der Gesunden, die mit Mehrwegbechern an ihm vorbei zur U-Bahn stürmen, wie eine krankhafte Verdrängungsleistung vor. Er schreit die Studenten auf dem Weg zu ihren Nebenjobs an, aber er richtet sich nicht an sie. Er richtet sich an die Frauen in Südasien, die ihre Klamotten genäht haben und verhungert sind. Er sieht keine iPhones in den Händen der Fußgänger. Er sieht die Fallnetze, die gespannt werden, weil sich zu viele Arbeiter von den Dächern der Fabriken stürzen, in denen diese iPhones hergestellt wurden. Wahrscheinlich ist Sehen der falsche Begriff, er sieht nichts, er lässt sich von seinen Trieben zertrümmern. Und von der ganzen Welt. Er scheint von einer Masse unentzifferbarer Zeichen umgeben zu sein. Und wenn sie genauer darüber nachdenkt, sich wirklich auf dieses Bild einlässt, realisiert ein Teil von ihr, dass sie davon genauso umgeben ist wie er. Dass er recht hat. Dass er nachvollziehbarer auf diese Tatsache reagiert als sie selbst. In seinem Schreien ist Angst zu spüren, vielleicht auch irgendwas Richtung Schuld. Er schreit stellvertretend für alle auf der Welt, die ohne Zeugen ermordet wurden oder in exakt dieser Sekunde ermordet werden. Mittags beruhigt er sich. Sie sieht ihn dann häufig vor einem der Restaurants, die um diese Uhrzeit noch zu sind. Er sitzt auf gestapelten Stühlen, vor sich ein Bier oder ein spendierter Kaffee. Sie glaubt, dass er meditiert, aber nicht mit Absicht. Zum Schlafen zieht er sich abends in ihrem Hauseingang um. Und niemals hat sie eine so ruhige Akribie bei einem Obdachlosen erlebt wie die, mit der er sich danach sein Essen zubereitet. Er besitzt einen Bunsenbrenner, ein Holzbrett und ein Taschenmesser. Damit schneidet er Knoblauch und Suppengemüse, um seine Konserven zu veredeln. Er beeindruckt sie. Sie ist beeindruckt von der Zuverlässigkeit, mit der er seine Tage nach dem immer gleichen Muster durchreitet, sie ist beeindruckt von seiner Sorgfalt und Ruhe und davon, dass er selbst die aggressivsten Identitätsverwirrungen in eine Art Struktur zu pressen geschafft hat. Seine Klamotten sehen gebügelt aus, vielleicht sind sie es sogar, würde sie nicht wundern.
An diesem Morgen kniet er an der Uferkante. Er macht irgendwas mit seinen Armen. Sie kann nicht erkennen, was. Entweder bekreuzigt er sich oder reißt Brot für die Schwäne in Stücke.
Sie lässt die Zigarette fallen und zieht den Arm zurück. Der Arm ist dreckig, sie sieht das in der Spiegelung des Fensters. Nach einem ähnlichen Prinzip schminkt sie sich manchmal das Kinn schmaler, hat sie von den Kardashians gelernt. Contouring. Gesichtszüge sind nur eine Frage der mit Make-up gefälschten Schatten, offenbar trifft das auch auf die Oberarmmuskulatur zu, kein Mensch muss Sport machen, damit sich der Trizeps abzeichnet, es reicht, sich mit dem Arm auf einem versifften Fensterrahmen abzustützen.
Die Gründe, warum sie in diese Gegend gezogen ist, spielen keine Rolle. Sie ist sich unsicher, ob die Geschichte, die an diesem Morgen beginnt, auch nur das Geringste mit ihr und ihrer Vergangenheit zu tun hat. Es geht hier nicht um sie, oder kaum, es geht eher um ein schwer einzugrenzendes Gefühl, das zu dieser Zeit die Empfindungen jedes halbwegs besonnenen Menschen zu überschatten beginnt, nicht nur ihre, egal welche Vergangenheit, egal welche Gegend. Das Viertel, in dem sie lebt, steht für dieses Gefühl allerdings besser, als es der Stadtrand von Gelsenkirchen tun würde oder das Schützenvereinsheim im Sauerland, in dem sie ihre Kindheit verbracht hat.
Die Wohnung ist bezahlbar, mehr nicht. Ein Zimmer mit sieben schlecht isolierten Fenstern. Alle bodentief, nur nicht das in der Küche. Würde jemand von außen zu ihr reingucken, dann direkt wieder raus. Durch die Fenster in den Himmel und auf das Wasser und die Penner. Zu den Hochhäusern am anderen Ufer. Dem Hauptsitz von Zalando. Den Gewerbebauten von Mercedes. Investoren-Architektur. Dem umgebauten Kühlhaus für Hühnereier, auf dem inzwischen das Logo von Universal prangt und hinter dem der Mauerstreifen beginnt, zu dem die Touristen und Schulklassen in ihren Steppjacken pilgern. In den Sechzigern sind im Kanal fünf Kinder ertrunken, weil sich Ost- und Westberlin noch nicht geeinigt hatten, wer im Grenzgebiet retten durfte. Genau an der Stelle liegt jetzt ein vierstöckiges Partyboot mit Palmen-Ambiente. Es wird für Junggesellenabschiede vermietet. Dahinter Brachland. Ein Einkaufszentrum, gegen dessen Bau wochenlang mit Stinkbomben und Farbbeutelattacken demonstriert worden ist. Baulücken, durch die sie das Industriegelände und die Clubs sehen kann.
Je mehr sie die Bedeutung der Zeichen an der Brandmauer durchdringen will, desto mehr durchdringen die Zeichen sie. Aber sie merkt es nicht. Sie tut die Zeichen als Vandalismus ab, wie den Junkiemüll vor der Haustür oder die abgebrannten Autos. Trotzdem fühlen sie sich nach drei Tagen vertrauter an als die Gegenstände in ihrer Wohnung. Sie sind nicht schwarz, wie sie im ersten Moment gedacht hat, sondern dunkelblau und rot. Und jedes Mal, wenn sie die Zeichen betrachtet, bemerkt sie ein neues Detail, manchmal bloß eine Unebenheit in einer der Linien, eine Art Zittern.
Am fünften Tag sind es die Umrisse eines kleinen Gespensts, vielleicht so groß wie ihre Hand. Es hat zwei Augen und lächelt. Sie kann sich nicht erklären, warum es ihr bisher nicht aufgefallen ist. Es erschreckt sie, weil es bedeutet, dass ihr auch jetzt nicht alles auffällt, dass ihr niemals alles auffallen wird. Wenn sie die Augen schließt, zeichnen sich die Linien vor dem Schwarz ihrer Lider ab. Sie fangen an zu pochen, legen sich über alles, woran sie denkt, wie Wasserzeichen.
An was denkt sie? An Schläge in die Leber. An die seitliche Eindrehung, die ihr Körper macht, bevor sie das Knie anwinkelt und dem Gegner ihre Ferse in die Rippen stößt. An die Politikerin, mit der sie ab und zu Sex hat. Sie denkt an die geretteten Fledermäuse und Babyeulen, die sie sich jeden Morgen in der U-Bahn auf Instagram anguckt. An die Leute, von denen sie trainiert wird, an die Leute, mit denen sie trainiert, und an die, denen sie Privatstunden gibt und die das Ganze eher als eine Mischung aus Survivaltraining und Wellness wahrnehmen, Diplomaten, Künstler, Banker, Stewardessen, eine Oligarchenwitwe, Mitte dreißig, die neben ein bisschen Coretraining selten etwas anderes üben will, als mit der rechten Handkante Holzbretter zu zerschlagen. Ein Kripo-Kommissar in Frührente, der ständig von der Selbsttötung der Samurai spricht und alle Techniken, die sie ihm beibringt, zu Hause in einem Skizzenbuch von Albrecht Dürer wiederzufinden glaubt. Sie hat auch mal vier Einheiten lang einen Lidl-Angestellten trainiert, der aus irgendeinem Kaff im Allgäu stammt und Kokain in Bananenkisten nach Tschechien geschmuggelt hat. Anfangs hielt sie das für eine Lüge, bis er begann, ihr Fotos davon zu zeigen, als wären es Aufnahmen seiner Autos oder seiner Kinder. Nach der vierten Einheit konnte sie ihn nicht mehr erreichen, eine Woche später las sie in der Bild-Zeitung, dass er aufgeflogen war.
Abends riechen ihre Klamotten nicht nach ihrem eigenen Schweiß, sondern nach dem der Männer, mit denen sie sich auf dem gepressten Schaumstoff gewälzt hat, jeder von ihnen scheint innerhalb von zwei Stunden die zehnfache Menge an Giftstoffen auszuscheiden wie sie selbst, das heißt, dass ihr Oberteil nach dem Kämpfen so nass ist, als wäre sie in einen Pool geschmissen worden, und jetzt, am 14. November, als sie am Fenster vor den Zeichen steht und es zum Trocknen über dem Küchenstuhl hängt, stinkt es bestialisch, erfüllt die ganze Wohnung wie ein Parfum, bei dem sie jede einzelne noch so feine Note demjenigen zuordnen kann, der sie beim Training abgesondert hat.
Die Intensität, mit der die Zeichen an der Brandmauer prangen, scheint nicht aus einem netten Gruppenprojekt hervorgegangen zu sein. Es ist das Werk eines Einzelnen, genauer, das eines einzelnen Mannes, komischerweise empfindet sie das nach sieben Tagen als eindeutig, der, allein oder in Begleitung, in den Dachboden eingebrochen ist. Die Zeichen sind kunstfertig und präzise. Trotzdem kommen sie ihr inzwischen plump vor. Oder hochmütig. Ja, das ist es. Eine Frau hätte die bis zum Himmel strotzende Hybris, mit der sie an die Wand gesprayt worden sind, besser zu tarnen gewusst und dafür gesorgt, dass man beim Betrachten nicht vom Größenwahn des Entstehungsprozesses abgelenkt wird. Sie begreift den Entstehungsprozess noch immer nicht, sie checkt nicht, wie dieses von oben bis unten über eine gesamte Brandmauer gezogene Graffiti entstehen konnte. Aber sie denkt darüber nach, die ganze fucking Zeit.
Morgens Kraft und Kondition. Präzision der Schläge und Tritte. Sie springt Seil, arbeitet am Sandsack, rennt durch die Stadt. Zwei Stunden, manchmal drei. Nachmittags kämpft sie.
Am 16. November läuft sie fünfundfünfzig Minuten lang die Treppen im Regierungsviertel auf und ab. Es gibt eine Mentalität, die sie nie entwickelt hat und die andere Kämpfer diese Anstrengungen als etwas Vorübergehendes empfinden lässt, die kriegen es hin, die Zukunft, in der sie die Strapazen überlebt haben werden und wieder Luft holen können, nicht vollständig auszublenden, sie kriegt das nicht hin, der Schmerz versetzt sie vielmehr in eine Vorstufe von Todesangst, gegen die sie in jeder Sekunde mit den immer gleichen Beschwichtigungsfloskeln ankommen muss. Intervalltraining hat nichts Selbstverständliches für sie, genauso wenig wie in die Fresse geschlagen zu werden, jede dritte Sekunde geht dafür drauf, sich davon abzuhalten, das Ganze für immer abzubrechen. Man kann die eigene Hormonausschüttung regulieren. Versucht sie seit Jahren, klappt nur bedingt. Machen auch Soldaten, wenn sie auf die Front vorbereitet werden. Es gibt da Trainingseffekte, verschwindend gering, aber es gibt sie, nach einer gewissen Anzahl überstandener Extremsituationen wird bei der nächsten weniger Cortisol produziert. Das System fühlt sich nicht mehr von Auslöschung bedroht, es kann sich abschalten, die Angst vor der Ohnmacht wird weniger, man wird zu einer Maschine, die sich bedingungslos dem Wettbewerb unterwirft, oder dem Krieg, dem Abschlachten von Zivilisten.