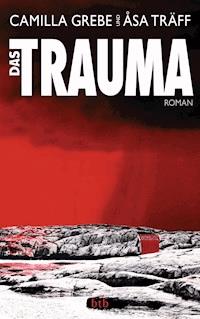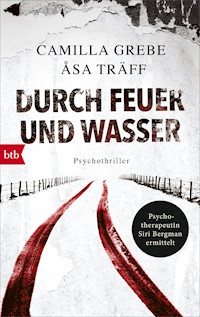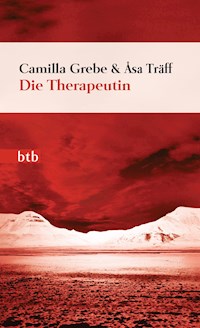12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Profilerin
- Sprache: Deutsch
Das Böse lauert selbst in der friedlichsten Umgebung … Der Nr.-1-Besteller aus Schweden.
Als der achtzehnjährige Samuel in einen schief gelaufenen Drogendeal verwickelt wird, ist er gezwungen, unterzutauchen. Zuflucht findet er auf dem Archipel nördlich von Stockholm bei einer Familie, die einen Betreuer für ihren schwerbehinderten Sohn sucht. Doch als Samuel bei der schönen Rakel und ihrem Sohn Jonas in das abgelegene Haus am Meer einzieht, merkt er bald, dass nichts so ist, wie es scheint ... In der Zwischenzeit werden in den Schären die Leichen junger Männer angeschwemmt. Kommissar Manfred Olsson sieht sich mit komplizierten Mordermittlungen konfrontiert und beschließt, sich an die in Ormberg lebende Profilerin Hanne zu wenden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 566
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Zum Buch
Als der achtzehnjährige Samuel in einen schiefgelaufenen Drogendeal verwickelt wird, ist er gezwungen unterzutauchen. Zuflucht findet er im Schärengürtel nördlich von Stockholm bei einer Familie, die einen Assistenten für ihren schwerbehinderten Sohn sucht. Doch als Samuel bei der schönen Rakel und ihrem Sohn Jonas in das abgelegene Haus am Meer einzieht, merkt er bald, dass nichts so ist, wie es scheint ... In der Zwischenzeit werden in den Schären die Leichen junger Männer angeschwemmt. Kommissar Manfred Olsson sieht sich mit komplizierten Mordermittlungen konfrontiert und beschließt, sich an die in Ormberg lebende Profilerin Hanne zu wenden.
Zur Autorin
CAMILLAGREBE, geboren 1968 in Älvsjö in der Nähe von Stockholm. Gemeinsam mit ihrer Schwester schrieb sie die erfolgreiche Krimireihe um die Stockholmer Psychotherapeutin Siri Bergman. »Wenn das Eis bricht« war ihr erster eigener Roman, der für seine einzigartige Stimme in der Presse hochgelobt wurde, und Auftakt der Thrillerserie um die Profilerin Hanne. Der zweite Band, »Tagebuch meines Verschwindens«, wurde mit dem Skandinavischen Krimipreis ausgezeichnet. »Schlaflos« ist der dritte Band der gefeierten Serie.
Camilla Grebe
Schlaflos
Psychothriller
Aus dem Schwedischen von Gabriele Haefs
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel Dvalan bei Wahlström & Widstrand, Stockholm.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Deutsche Erstausgabe März 2023
Copyright © der Originalausgabe 2018 by Camilla Grebe
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023 by btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Published by agreement with Ahlander Agency.
Umschlaggestaltung: semper smile, München
Umschlagmotiv: © plainpicture/BY
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
MA · Herstellung: sc
ISBN 978-3-641-25200-7V001
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Für Marie
»It’s funny how the colors of the real world only seem really real when you watch them on a screen.«
Anthony Burgess, A Clockwork Orange
MANFRED
Wir waren eine ganz normale Familie. Es war ein Morgen wie alle anderen.
So einer, dem man eigentlich keine besondere Bedeutung zumisst. Einer von den vielen bedeutungslosen Tagen, denen man eigentlich kein Gewicht gibt, weil man zu wissen glaubt, dass sie sich nicht von den anderen unterscheiden werden. Es war einfach noch ein Tag, den ich hinter mich bringen, den ich durchleben musste. Den ich meistern und ausfüllen musste, wie einen Vordruck, der noch vor siebzehn Uhr auf die Post gebracht werden muss.
Afsaneh stand als Erste auf, um Nadja ihren Brei zu geben.
Ich hörte ihre Schritte: leicht, fast zaghaft, als sie von der Diele in die Küche tappte. Als ob sie sich über dünnes Eis bewegte. Danach das Klappern, das Rauschen des Wasserhahns und den kleinen Knall, als sie den Kochtopf auf den Herd stellte. Am Ende das rhythmische Kratzen des Quirls über das Metall, als sie das Breipulver mit dem Wasser vermischte.
Von meinem Platz im Bett aus – das von Afsanehs Körper noch warm war – hörte ich im Kinderzimmer nebenan Nadja wimmern und husten.
Es waren die Geräusche einer ganz normalen Familie; die der Frau, meiner jungen Gattin, die vielleicht zu jung war – jedenfalls gab es Leute, die das so sahen –, und die meiner Tochter. Und da war die Stille, hinterlassen von den drei älteren Kindern, die ausgezogen waren, und von meiner Exfrau, die die Wohnung an einem Frühlingsmorgen, gar nicht so anders als dieser, mit einer so schweren Reisetasche verlassen hatte, dass sie diese nicht hätte tragen können, wäre sie nicht so wütend gewesen.
All das dachte ich nicht bewusst, als ich da lag, noch dösig von den Träumen der Nacht und der Wärme des Betts. Erst im Nachhinein gewinnen all diese kleinen Geschehnisse an Gewicht und zeigen ihre Bedeutung.
Es war ein Morgen wie alle anderen. Außerdem war es Nadjas dritte Erkältung in ebenso vielen Wochen, und Afsaneh und ich waren beide todmüde von den Nachtwachen und dem Hin und Her mit unserer geliebten, aber trotzigen Zweijährigen.
Wir konnten darüber Witze machen, dass Nadja sich wie ein Säugling aufführte, wenn sie Schnupfen hatte. Und Afsaneh sagte oft, dass ich mir all das selbst zuzuschreiben hätte, da ich mit über fünfzig noch einmal Vater geworden war.
Afsaneh öffnete die Schlafzimmertür einen Spaltbreit.
Sie setzte sich Nadja auf die Hüfte, und als sie sanft in die Knie ging und Nadja höher hob, um einen besseren Griff zu haben, öffnete sich ihr Bademantel und entblößte ihre Brust, diese schöne Brust, die gegen alle Wahrscheinlichkeit jetzt mir gehörte.
Afsaneh fragte, ob ich mir freinehmen könnte, um mich um Nadja zu kümmern, und ich erklärte, dass ich doch vorhatte, einen Sprung ins Haus zu machen.
Das Haus war das Polizeigebäude auf Kungsholmen in Stockholm. Mein Arbeitsplatz seit über zwanzig Jahren und gleichbedeutend mit Job und Tretmühle. Der Ort, an dem ich in Morden und anderen schweren Verbrechen ermittelte. Wo ich mich mit den allerschlimmsten Seiten der Menschheit beschäftigte, den widerwärtigen Abarten menschlichen Verhaltens, mit denen der Rest der Bevölkerung sich nicht abzugeben braucht.
Wie konnte ich das für so wichtig halten?
Sollen sie sich doch gegenseitig umbringen, dachte ich. Sollen sie sich gegenseitig vergewaltigen und zusammenschlagen. Sollen die Drogen alles überfluten und die Vororte in der Nacht wie Fackeln auflodern. Aber lasst mich aus diesem ganzen Dreck heraus.
Ich weiß noch, dass Afsaneh die Stirn runzelte, als ich das Haus erwähnte. Sie erinnerte mich daran, dass Christi Himmelfahrt war, und fragte, was ich denn so wahnsinnig Wichtiges zu erledigen hätte. Dann erklärte sie geduldig, dass sie mit einer ihrer Doktorandinnen zum Kaffee verabredet war und dass sie das beim Essen am Vorabend zweimal erwähnt hatte.
Und so ging es eine ganze Weile weiter.
Wir stritten uns darüber, wer sich freinehmen sollte, als ob das wirklich irgendeine Bedeutung hätte. Wir stritten uns auf diese unreflektierte, ermüdende Weise, wie es wohl die meisten Familien an einem ganz normalen Morgen in dem sicheren und wohlmeinenden Land Schweden tun, dachte ich.
Als Afsaneh dann zu dem Treffen mit ihrer Doktorandin gegangen war und Nadja neben mir in unserem breiten Bett lag und ihre verrotzte kleine Nase an meine Wange drückte, war das doch ein richtig gutes Gefühl. Was hätte ich im Haus auch ausrichten sollen? Die Toten konnten bis morgen warten, und die meisten meiner Kollegen hatten ohnehin frei.
Ich erinnere mich nicht genau, aber ich glaube, dass ich am späteren Vormittag durch die Wohnung gewandert bin und ein bisschen aufgeräumt habe. Mein Knie tat verdammt weh, und ich nahm zwei Voltaren. Vielleicht rauchte ich auch heimlich unter der Rauchabzugshaube. Nadja saß vor dem Fernseher, und ich musste ihn lauter drehen, um den Lärm der Straßenarbeiten draußen im Karlaväg zu übertönen.
Meine älteste Tochter, Alba, rief aus Paris an und wollte Geld leihen. Ich erklärte ihr ruhig, aber entschieden, dass sie sich an ihre Mutter wenden sollte, von mir hatte sie in diesem Monat schon dreitausend zusätzlich bekommen. Außerdem hatten ihre Geschwister, Alexander und Stella, gar nichts erhalten. Und man musste doch gerecht bleiben, oder?
Gerechtigkeit, was für ein seltsames Konzept, so im Nachhinein betrachtet.
Am Ende wurde Nadja vor dem Fernseher müde. Sie schrie und schrie, und ich trug sie in einem vergeblichen Versuch, sie zu beruhigen, durch die Wohnung. Ihr kleiner Körper war glühend heiß, und ich gab ihr ein Alvedon, obwohl Afsaneh damit sicher nicht einverstanden gewesen wäre – auch das war ein ständiger Grund für Auseinandersetzungen. Afsaneh fand, kleine Kinder dürften nur Medikamente bekommen, wenn sie fast im Sterben lagen.
Vielleicht beruhigte sich Nadja durch das Alvedon, vielleicht war es auch das Butterbrot, das ich ihr gab. Oder die Straßenarbeiten draußen konnten sie endlich ablenken.
Ich hob sie auf die Fensterbank im Wohnzimmer, wo sie lange wie verzaubert stand und den Bagger beobachtete, der sich drei Treppen tiefer langsam durch die Fahrbahn fraß, während sie mit ihrer spitzen kleinen Zunge gleichzeitig die Butter vom Brot und den Rotz von ihrer Oberlippe leckte. Wir plauderten eine Weile über Bagger und Autos und Lastwagen und Motorräder. Über alle möglichen Kraftfahrzeuge.
Nadja liebte alles, was einen Motor hatte und Krach machte – das hatten Afsaneh und ich schon häufiger festgestellt.
Ungefähr da rief Afsaneh aus dem Café an.
Ich stellte die laut protestierende Nadja auf den Boden und ging in die Diele, um ungestört reden zu können – der Lärm der Straßenarbeiten ließ die gesamte Wohnung vibrieren.
Afsaneh wollte wissen, wie es Nadja ging, und ich sagte, ihr gehe es ziemlich gut, sie verzehre gerade ein Butterbrot, und so schlimm könne es wohl nicht sein, wenn sie noch aß und trank.
Natürlich sagte ich kein Wort von dem Alvedon.
Als wir auflegten, merkte ich sofort, dass etwas nicht stimmte. Es war, als hätte sich die Luft verdichtet, als zöge sie sich um mich zusammen, eine greifbare Veränderung angesichts einer herannahenden Gefahr. Gleich darauf begriff ich, dass es eher das Fehlen von etwas war, das mich zu einer Reaktion veranlasste.
Es war still.
Die Straßenarbeiter hatten offenbar eine Pause eingelegt, und das Einzige, was ich hörte, waren meine eigenen Atemzüge.
Ich ging ins Wohnzimmer, um nach Nadja zu sehen, aber das Zimmer war leer, bis auf ihre Nuckelflasche, die in einer Saftlache auf dem Boden lag, und den Haufen von Spielsachen, die sie im Laufe des Morgens angeschleppt hatte.
Vielleicht geschah es in diesem Augenblick, dass die Unruhe zum Leben erweckt wurde, dieser Urinstinkt, den wir alle in uns haben, der Drang, unsere Kinder vor allem Bösen zu beschützen.
Dann wurde ich von einem Sonnenstrahl geblendet, einem grellen Lichtstreifen, der dort nicht hingehörte, aus dem einfachen Grund, weil das Wohnzimmerfenster im Schatten lag.
Ich drehte mich zu dem Licht um, kniff die Augen zusammen und schaute in die Küche.
Das Fenster stand offen, und das Sonnenlicht spiegelte sich in der Scheibe.
Plötzlich begriff ich: Afsaneh hatte am Vortag das Küchenfenster geputzt. Vermutlich hatte sie vergessen, die Kindersicherung zu aktivieren. Aber Nadja hatte doch wohl nicht nach oben klettern und das Fenster aufmachen können. Und warum hätte sie das überhaupt tun sollen?
In der Sekunde, in der ich in Gedanken diese Frage formulierte, begriff ich auch schon: der Bagger, der verdammte Bagger!
Ich stürzte zum offenen Fenster.
Ich stürzte zum Fenster, weil das das Einzige war, was ich tun konnte. Ich stürzte zum Fenster, weil man das musste, weil man dazu gezwungen war. Man darf sein Kind nicht fallen, nicht sterben lassen. Das ist das Einzige, was man in diesem Leben nicht tun darf.
Mit allem anderen kommt man auf irgendeine Weise durch.
Draußen spielten die Sonnenstrahlen im zarten Grün der Bäume, und unten standen die Straßenarbeiter still da und schauten mit leeren Blicken zu mir hoch. Zwei von ihnen stürzten mit ausgestreckten Armen auf unser Haus zu.
Nadja hing an der Fensterbank, und das Seltsame war, dass sie ganz still war, genau wie Kinder, die kurz vor dem Ertrinken sind, das habe ich gehört.
Ihre Fingerchen klammerten sich fest, und ich warf mich auf sie, weil man das eben tut. Man wirft sich auf seine Kinder, man geht durch Feuer und Wasser.
Man tut alles und noch etwas mehr.
Und ich bekam sie zu fassen, ich erreichte sie und spürte, wie ihre von der Butter glitschigen Fingerchen langsam aus meiner Hand glitten. Aus meinem Zugriff rutschten wie ein Stück nasse Seife.
Sie fiel.
Mein Kind fiel auf die Straße, und ich konnte es nicht verhindern.
Alles, was nötig gewesen wäre, war, eine Sekunde früher zu kommen, noch einen Meter mehr zu schaffen in dem Zeitraum, in dem die Zeit stillzustehen schien und der Schrei der Stille in meinen Ohren widerhallte.
In einem anderen Leben, in einem parallelen Universum, hätte ich sie retten können.
Aber mein Kind fiel.
Nadja fiel aus dem dritten Stock auf die Straße, und ich konnte nichts tun, um es zu verhindern.
Wir waren eine ganz normale Familie.
Es war ein Morgen wie alle anderen, aber danach war nichts mehr wie vorher.
TEIL I Die Flucht
»Mache dich auf und geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen.« Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des HERRN.
Jona 1:2 – 3
SAMUEL
Ich brauchte genau zehn Tage, um mein Leben in die Scheiße zu reiten.
Ich schaue aus dem Fenster.
Von meinem Zimmer aus blicke ich auf einen Parkplatz, und dahinter kann ich die Umrisse des Krankenhauses Långbro ahnen, ein ehemaliges Irrenhaus, das in fetzige Eigentumswohnungen umgewandelt worden ist.
Gerade heute ballen sich dunkle Wolken über den Gebäuden zusammen. Die hellgrünen Blätter der Bäume bilden einen Kontrast zu den violetten Wolken. Das Gras um den Parkplatz schießt üppig in die Höhe, aber es ist noch immer arschkalt, obwohl schon der 11. Juni ist.
Ich höre Mama in der Küche herumwirtschaften.
Sie ist verdammt anstrengend. Mit anstrengend meine ich nicht nur, dass sie immer will, dass ich irgendwas mache – mir einen Job suche, zum Arbeitsamt gehe, den Abwasch erledige und so weiter, in alle Scheißewigkeit –, sondern dass sie sich so verdammt viele Sorgen macht. Und diese Sorgen fressen sich in mich hinein, und dann juckt es mich am ganzen Leib, und winzige Ameisen scheinen unter meiner Haut herumzukrabbeln.
Sie scheint einfach nicht zu kapieren, dass ich erwachsen bin.
Ich bin vor einem Monat achtzehn geworden, aber trotzdem läuft sie hinter mir her wie eine Superglucke und will über jeden einzelnen meiner Schritte informiert werden.
Als wäre das ihre verdammte Lebensaufgabe.
Das geht mir ganz schön auf die Nerven.
Ich glaube, es würde ihr sehr viel besser gehen, wenn sie mit dieser Tour aufhören könnte. Wenn sie einfach loslassen könnte, nur ein bisschen. Wo sie doch immer davon redet, was sie alles für mich geopfert hat – warum legt sie sich dann kein eigenes Leben zu, jetzt, wo sie das endlich kann?
Alexandra, meine Freundin, oder vielleicht eher die-mit-der-ich-schlafe, sagt, dass ihre Mutter genauso ist, aber das ist gelogen. Sirpa belauert Alexandra jedenfalls nicht in der Stadt, stalkt nicht per Handy ihre Kumpels und sucht nicht in ihren Taschen nach Gras oder Kondomen.
Und übrigens, Kondome: Mama sollte sich doch freuen, wenn sie Kondome fände? Wollen das nicht alle Eltern: dass ihre Kinder sich schützen? Denn ich vermute, dass es zu ihren größten Ängsten gehört, dass ich ein Mädchen schwanger machen und dann genauso werden könnte wie sie.
Alleinerziehend.
Oder ein Einelternhaushalt, wie sie in Mamas Gemeinde sagen, wenn sie versuchen, so höflich inkludierend zu sein, dass sich selbst noch der letzte Sozialfall willkommen fühlt.
Mama und ich wohnen in einem dreistöckigen Haus in der Ellen Keys gata in Fruängen, einem südlichen Vorort von Stockholm, der total okay ist. Mit der U-Bahn brauchen wir genau neunzehn Minuten bis zum Hauptbahnhof, und auf neunzehn Minuten von seinem Leben kann man doch schon verzichten, ohne dass das besonders schwer wiegt.
Oder?
Neunzehn Minuten in die City und neunzehn nach Hause, das macht pro Tag achtunddreißig Minuten. Wenn man diese Fahrt jeden Tag unternimmt, sind das dreizehntausendachthundertsiebzig Minuten pro Jahr, und das entspricht zweihunderteinunddreißig Stunden oder fast zehn Tagen.
Zehn Tage verlorenes Leben: Das ist alles in allem gar nicht so wenig.
In zehn Tagen kann viel passieren, das ist ja bekannt.
Der Punkt ist der, dass es wichtig ist zu rechnen, bevor man zu übereilten Schlussfolgerungen kommt, wie zum Beispiel, dass neunzehn Minuten in der Bahn keine Rolle spielen.
Mathe war das einzige Fach in der Schule, in dem ich richtig gut war. Früher vielleicht noch Schwedisch. Denn ich habe gern Bücher gelesen. Aber damit habe ich jetzt aufgehört, man will in der U-Bahn ja nicht gerade mit einem Buch in der Hand gesehen werden.
Doch bei Mathe kam noch etwas Besonderes dazu. Ich brauchte mich nie anzustrengen, ich sah die Zahlen sozusagen im Kopf und wusste die Antwort längst, bevor die anderen auch nur die Hand nach dem Taschenrechner ausgestreckt hatten. Und obwohl ich fast nie zum Unterricht aufgetaucht bin, hat mein Mathelehrer mir in der vorletzten Klasse auf dem Gymnasium eine 1 gegeben.
Er wollte mich sicher damit ermutigen, aber ich habe die Schule trotzdem geschmissen. Ich konnte einfach keinen Sinn darin sehen, weiter hinzugehen.
Eine Bewegung im Augenwinkel fängt meine Aufmerksamkeit ein. Das Amseljunge im Käfig auf dem Boden – das bald kein Junges mehr sein wird – macht einen Sprung. Es pickt ein bisschen zwischen den Körnern herum, erstarrt mitten in der Bewegung, legt den Kopf schräg und sieht mich mit seinen gelbumrandeten Knopfaugen an.
Amsel. Turdus merula.
Doch, es gibt noch etwas außer Mathe, das mir liegt, und das sind Vögel. Schon als Kind war ich von Vögeln total besessen, aber jetzt habe ich damit aufgehört.
Ich bin schließlich kein Nerd.
Doch als ich das Amseljunge in dem Container gefunden habe, musste ich es einfach retten.
Ich schaue den Vogel noch einmal an. Sehe das glänzend schwarze Gefieder und den hellgelben Schnabel, der sich ruckartig auf dem Boden seinen Weg pickt.
Ich füttere ihn mit Körnern und kleinen Talgstücken. Ich habe ihm sogar beigebracht, mir aus der Hand zu fressen, wie ein blödes dressiertes Haustier.
Ich hebe mein Handy zwischen Daumen und Zeigefinger hoch. Gehe auf Snapchat.
Liam hat einen Film über eine explodierende Bierdose gepostet. Es sieht fast so aus, als ob jemand sie in Stücke schießt, vielleicht mit Liams Luftpistole. Alexandra hat ein Bild von sich im Bett geschickt. Obwohl sie sich die Decke fast bis an die Nase zieht, kann ich an ihren Augen sehen, dass sie lacht. Um sie herum pulsieren rosa Herzchen, die sie ins Bild gelegt hat.
Ich öffne Whatsapp; noch immer nichts von Igor.
Tatsache ist, dass ich glücklich wäre, wenn ich nie mehr etwas von ihm hören würde. Leider hab ich Scheiß gebaut und muss jetzt den Preis dafür zahlen.
Zehn Tage.
Genauso lange habe ich gebraucht, um in Igors klebrigem Netz hängenzubleiben. Genauso lange, wie es dauert, ein Jahr lang jeden Tag mit der U-Bahn in die Stadt und zurückzufahren.
Aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, dann hat alles viel früher angefangen. Mama sagt immer, ich hätte einfach keine Urteilskraft und könnte mich nur so lange auf etwas konzentrieren, wie ich brauche, um ein Glas Milch zu trinken. Sie hat es nie offen gesagt, aber es kommt schon durch, dass sie glaubt, ich hätte das von meinem Vater geerbt. Und da der mir nie über den Weg gelaufen ist, kann ich ihr da ja wohl kaum widersprechen.
Mama hat natürlich keine derartigen Probleme.
Jedenfalls nicht, wenn es darum geht, mich zu stalken. Sie verliert nie die Konzentration, gibt niemals auf.
Sie ist wie ein verdammter Bluthund.
Der Schulpsychologe hat mich zur Kinder- & Jugendpsychiatrie geschickt, und die KiJu hat mich dann weitergereicht an eine Spezialistin. An eine blöde Psychologin mit schweißnassen Händen, wuchtigem Silberschmuck und so braunen Zähnen, als hätte sie Kacke gefressen.
Ich konnte sie nie leiden.
Vor allem nicht, als sie anfing, von neuropsychiatrischer Funktionsreduktion zu faseln. Sie sagte sogar, dass ich, obwohl ich mich nicht für eine Diagnose qualifizierte, doch arge Probleme mit Konzentration und Impulskontrolle hätte. In genau diesem Moment habe ich aufgehört zuzuhören. Mama auch, da sie nicht zugeben wollte, dass mir etwas anderes fehlte als der gesunde Menschenverstand.
Einige Monate später habe ich in einer Klatschzeitung über einen Promi gelesen, der sagte, es sei verdammt gut, endlich eine Diagnose zu haben, da das irgendwie so viel erklärte. Als ob er gestört sein wollte, als ob die Diagnose eine fette Lederjacke wäre oder ein schönes Tattoo, das er gern vorzeigte.
Wie bin ich eigentlich in diesen Scheiß hineingeraten?
Liam und ich haben angefangen, in der City herumzuklauen. Anfangs war das einfach cool. Wir ließen Kleinkram mitgehen, Parfüm oder Klamotten. Aber bald ging uns auf: Wenn wir Elektronik mitgehen ließen – kleine Festplatten, Ohrstöpsel und iPhone-Lautsprecher –, konnten wir den Kram weiterverticken. Liam kaufte von Janne aus unserer Klasse eine Booster Bag – einen mit mehreren Schichten Alufolie gefütterten Rucksack –, und jetzt brauchten wir uns nur unter den Überwachungskameras durchzuducken, den Kram aus dem Regal zu fischen, ihn in den Rucksack zu stopfen und davonzuspazieren.
Das war fast schon zu einfach.
Wir wurden wirklich verdammt gut, wir wurden nie erwischt, und ziemlich bald füllte sich der Kellerraum von Liams Mutter. Es war auch ganz schön viel Arbeit, die ganze Beute über Blocket.se zu verscheuern. Außerdem wollte Mama wissen, warum ich mehrere Handys hatte und immer in meinem Zimmer verschwand, wenn eins klingelte.
Dann haben wir angefangen, die Sachen an einen Tschetschenen namens Aslan zu verkaufen, einen richtig fiesen Typen, der Tattoos in der Visage hatte und nie lachte.
Aslan bezahlte nicht besonders gut, wir haben nur ein Viertel von dem bekommen, was die Sachen bei Blocket eingebracht hätten, aber er kaufte alles auf einmal und stellte nie irgendwelche Fragen.
Für das Geld haben wir Alk, Sneakers, Gras und ab und zu ein paar Gramm Kola gekauft. Einmal sind wir zum Stureplan gegangen und haben in einem Restaurant Hummer bestellt, als wären wir reiche Schweine, aber meistens rauchten wir einfach in aller Ruhe bei einem spannenden Film.
Tagsüber hingen wir bei mir zu Hause herum, abends bei Liam, weil seine Mutter im Krankenhaus von Huddinge Nachtdienst hatte.
Wir störten wirklich keinen Menschen.
Die Läden waren doch versichert, die kriegten die Kohle zurück. Und wir beklauten nie Privatpersonen, sondern immer nur die großen reichen Ketten wie Media Markt und Elgiganten, die schließlich den ganzen Tag den normalen Leuten das Geld aus der Tasche ziehen.
Gras und Kola kauften wir von einem Typen namens Malte, der unten in der Billardhalle abhing. Malte war groß, krankhaft mager, hatte zitternde Hände und war für einen Dealer ungewöhnlich sympathisch.
Ich glaube, es war Liam, der gefragt hat, ob wir mit Elektronikkram bezahlen könnten. Aber Malte hat sich nur die knochigen Hände gerieben, so sehr gelacht, dass ihm die Goldzähne in der Fresse funkelten, und erklärt, das sei nicht sein Business. Aber wenn wir gratis rauchen wollten, könnten wir ihm in einer anderen Sache behilflich sein, sagte er.
Und so fing es an. Von nun an arbeiteten wir ab und zu für Malte.
Schon bald ging uns auf, dass er ein wichtiges Rädchen in der Maschinerie war, die Stockholm mit Rauchkram und Kola versorgte. Außerdem stand er sich richtig gut mit dem Boss, Igor. So gut, dass Liam Malte ab und zu Igors Arschbubi nannte.
Darüber lachten wir sehr.
Unsere Aufträge für Malte waren Kleinkram, nichts Ungesetzliches oder so.
Wir holten und lieferten an allerlei Adressen Pakete ab, oder wir nahmen per Whatsapp von der Kundschaft Bestellungen entgegen. Obwohl alle Kommunikation über die App verschlüsselt war, hatten Malte und seine Bande noch reichlich bescheuerte Codes für die Waren festgelegt. Wenn jemand anrief und »Pizza« bestellte, dann musste ich fragen, was für eine er wollte. »Capricciosa« war zum Beispiel Gras und »Hawaiiana« Kola. Wenn ein Kunde also fünf »Hawaiiana« wollte, dann bedeutete das fünf Gramm Kokain.
Der Preis für ein Gramm erstklassiges Kola liegt bei achthundert Mäusen, es waren nicht gerade billige Pizzen. Aber die Kundschaft bekam die Ware auch innerhalb einer halben Stunde ins Haus geliefert, das Serviceniveau war also auch hoch.
Unsere Geschäfte waren strictly old school: Kola, Speed, Gras und so etwas. Keine Medikamente und solcher Dreck. Und Heroin verkauften wir natürlich nicht – der Markt gehörte den Gambiern unten im Kungsträdgården.
Ab und zu erzählte Malte von den alten Zeiten, wo sie die Sachen noch direkt auf der Straße verkauft hatten wie die Eisverkäufer. Und von den Bullen natürlich ganz leicht erwischt wurden.
Was hab ich gelacht!
Es war unvorstellbar, wie man vor dem Internet und den ganzen Apps hatte überleben können.
Ich fühlte mich wie ein Fisch im Wasser, Liam dagegen war nervös und wollte lieber aussteigen. Am Ende musste ich ihm versprechen, dass wir nicht mehr lange für Malte arbeiten würden, ich sagte vor allem ja, um ihm eine Freude zu machen.
Nach einigen Monaten schwammen wir nicht nur in Gras, sondern auch in Geld. Ich rechnete mir schnell aus, dass ich bei einem normalen Job nie im Leben so viel verdienen könnte.
Liam kaufte von einem Typen in Bredäng einen alten BMW und schien zum ersten Mal seit langer Zeit richtig zufrieden zu sein. Ich selbst traute mich nicht, mir etwas Teures zuzulegen, denn Mama stellte ohnehin schon so verdammt viele Fragen, woher ich die neuen Klamotten und Schuhe hatte und so.
Als könnte sie riechen, dass etwas nicht stimmte.
Eines Tages wurde ich zu Maltes Boss Igor zitiert, einem riesigen Russen mit aufgepumpten Muskeln und rasiertem Schädel.
Igor war aus drei Gründen legendär.
Zum einen hatte er einen Großteil von Stockholms Drogenhandel unter sich. Zum zweiten behauptete Liam, er habe drei Typen, die ihn um Geld betrogen hatten, umgebracht, indem er ihre Handgelenke und Knöchel mit Kabelbinder aneinandergefesselt und sie wie Katzenjunge ertränkt hatte.
Und drittens schrieb er offenbar Poesie und hatte mehrere Bücher veröffentlicht.
Wenn ich ehrlich sein soll, fühlte ich mich ein bisschen geschmeichelt, als Igor sagte, er habe gehört, dass ich meine Sache sehr gut machte, und als er fragte, ob ich auch bei anderen, größeren Aufgaben aushelfen wollte. Ich würde gut bezahlt werden, und wenn ich weiter so gute Arbeit leistete, würde es in seiner Firma viele Möglichkeiten geben.
Ja, er nannte es wirklich »Firma«. Als ob er damit an der Börse wäre.
Er redete viel darüber, den Kunden in den Mittelpunkt zu setzen, wie wichtig es sei, die Käufer niemals zu betrügen und immer service minded zu sein.
Es war fast, als hätte er so einen Kurs besucht, den das Arbeitsamt veranstaltet und bei dem man lernt, wie man eine Firma aufmacht, mit Mehrwertsteuern und Überstundenzahlung und dem ganzen Scheiß.
Ich nahm sein Angebot sofort an. Erst als ich nach Hause ging, kamen mir Zweifel.
Aber da war es irgendwie zu spät.
Später an diesem Abend hat Igor mich zum Freitagsbier der Firma eingeladen. Ich weiß nicht, ob das ein Witz sein sollte, aber er sprach wirklich von after work.
Wir tranken Bier und spielten Billard. Das heißt alle außer Igor, der offenbar nie einen Tropfen Alkohol anrührte, sondern einfach hinten im Raum saß und uns sozusagen überwachte.
Liam war nicht da.
Später erzählte er, dass Igor ihm dasselbe Angebot gemacht, er aber abgelehnt hatte. Er sagte, ich sei doch total verrückt und dass ich in Teufels Küche kommen würde, wenn ich nicht lernte nachzudenken, bevor ich etwas machte.
Außerdem hätte ich doch versprochen, nicht mehr für Igor und seinen Arschbubi zu arbeiten. Doch jetzt hätte ich ihn wie üblich im Stich gelassen und so weiter. Bla, bla, bla.
Das ist genau zehn Tage her.
In der Woche darauf musste ich mit Malte durch die Gegend fahren, um Geld von Kunden einzutreiben, die anschreiben lassen durften. Und da ging mir auf, dass der Umgang der Firma mit Krediten nicht gerade kundenfreundlich war und dass Malte nicht so ein netter Dealer war, wie Liam und ich geglaubt hatten.
Die Sache lief ungefähr so ab: Wir klopften bei dem Kunden an die Tür, und wenn er aufmachte, erklärte ihm Malte, dass wir das Geld holen wollten, das der Kunde schuldete. Ab und zu bezahlte der Kunde sofort, dann bedankten wir uns überschäumend, wünschten noch einen schönen Abend und zogen ab wie überaus höfliche Mormonen.
Oft sagten die Kunden, sie hätten gerade kein Geld, würden aber bald blechen. Wenn es der erste Besuch war, antworteten wir, wir würden in einer Woche zurückkommen, und dann wäre es »besser für alle Beteiligten«, wenn sie bezahlten, worauf Malte mit zitternden Händen etwas in seine App eingab, wo alle Schulden registriert waren.
Aber wenn es der zweite oder der dritte Besuch war, dann setzte es Prügel.
Was beim vierten passierte, weiß ich nicht, aber ich nehme an, dass dafür nicht Malte zuständig war, sondern ein echter Brutalo. Vermutlich der, der Igor geholfen hatte, diese drei Typen zu ertränken. Wenn die Geschichte überhaupt stimmte, meine ich, Liam redete manchmal ganz schön viel Scheiß.
Meine Aufgabe war es, den Kunden festzuhalten, während Malte schlug und trat wie der übelste Psycho. Frauen bedrohte er allerdings mit dem Messer: Er presste ihnen die bläulich schimmernde, gezähnte Schneide an die dünne Haut gleich unter dem Auge, ritzte ein bisschen, bis es blutete, und erzählte, welche scheußlichen Narben das geben würde, während er ihnen an die Titten fasste.
Nur einmal verzichtete Malte darauf, jemanden zusammenzuschlagen – eine Braut natürlich –, obwohl es der zweite Besuch war. Es war ein junges Mädchen mit langen roten Haaren. Sie hieß Sabina. Als sie die Tür aufmachte, merkte ich sofort, dass sie Malte schon kannte und dass Malte scharf auf sie war. Sie redeten so lange miteinander, dass ich mich langweilte und fragte, ob ich die Toilette benutzen dürfte.
Das durfte ich.
Als ich zurückkam, sah ich, dass Malte der Braut ein Bündel Tausender gab, nicht umgekehrt.
Einfach so.
Die Braut sah froh aus und versprach, alles bald zurückzuzahlen.
Kaum hatte sie das gesagt, als Malte mich entdeckte. Er packte mich am Kragen, drückte mich gegen die Wand und fauchte mir ins Ohr:
»Kein Wort über das hier, ist das klar? Sonst bin ich tot. Und du auch.«
Ich nickte nur.
Was dachte er denn? Dass ich ihn bei Igor verpfeifen würde? Dass ich jetzt einer von Igors Arschbubis wäre?
Aber die rothaarige Braut war, wie gesagt, die einzige Ausnahme. Alle anderen bezogen Prügel.
Viele schrien. Manche weinten.
Große Kerle mit Gorillabizeps und Totenkopftattoos jammerten wie kleine Kinder und flehten um Gnade. Ein Typ kotzte meine neuen Gucci-Sneakers voll, nachdem Malte ihm eine volle Rechte in den Magen gesemmelt hatte.
Es war widerlich.
Eine Sache war es, im Media Markt Elektronik zu klauen oder Bestellungen für eine Pizza anzunehmen, hinter der sich eigentlich Kola verbarg, aber hier wurden Menschen verletzt. Ich schaffte das nicht. Ich weiß, ich habe so einiges getan, was verboten ist, aber hallo, ich bin doch kein Monster!
Am Ende fasste ich mir ein Herz und sagte Igor ganz offen, dass ich es nicht über mich brachte, Leuten die Scheiße aus dem Leib zu prügeln.
Er nickte ernst und lächelte. Ließ sich im Sessel zurücksinken, so dass seine fette Lederjacke knarrte. Dann erklärte er, dass das eben keine Aufgabe für alle sei und dass es andere Dinge gab, bei denen ich behilflich sein könnte, wenn ich denn so eine kleine Fotze sei, die sich zu fein war, richtig zuzupacken.
Beim letzten Satz grinste er, und ich merkte, dass ich mich schämte und rot wurde, obwohl ich das gar nicht wollte.
Aber dann wurde Igor wieder ernst und sagte, er glaube an die Vielfalt und wir hätten alle unterschiedliche Stärken. Und um eine starke Organisation aufzubauen, brauche man Leute mit den verschiedensten Kompetenzen.
Dann beugte er sich vor, griff nach einem Paket, so groß wie eine Packung Butter, das in braunes Papier gewickelt war, und warf es mir zu.
»Komm am Montagabend ins Gewerbegebiet. Wir treffen uns um neun vor der stillgelegten Autowerkstatt. Keine Minute später. Schalt dein Handy aus, ehe du reingehst, und bring das Paket mit. Das ist wichtig, klar? Du musst Wache halten, während ich einen Kunden treffe. Einen verdammt wichtigen Kunden. Einen Zwischenhändler.«
Er legte eine Pause ein und schien mich forschend zu mustern, dann fügte er hinzu:
»In dem Paket sind Warenproben, ich brauche dir also nicht zu erklären, wie wichtig es ist, dass du es nicht verlierst?«
Ich nickte und verließ Igors Büro hinter der Billardhalle, erfüllt von einer seltsamen Mischung aus Scham und Erleichterung. Aber die Erleichterung war stärker: Ich brauchte nie wieder jemanden zusammenzuschlagen, und alles war ja wohl besser als das.
Aber jetzt ist Sonntag, und die Erleichterung, die ich in Igors zugerauchtem Büro verspürt habe, ist langsam einem schleichenden Unbehagen gewichen.
Ich wiege das Paket in der Hand und schaue aus dem Fenster. Die Wolkendecke über der alten Klapse ist dichter geworden, und es nieselt. Der Asphalt auf dem Parkplatz ist schwarz und blank, wie das Eis auf einem frisch zugefrorenen und sehr tiefen See.
Das Paket ist nicht schwer, ich tippe auf an die hundert Gramm. In meiner kurzen, aber intensiven Karriere in der Firma habe ich meine Fähigkeit, das Gewicht von Tüten und Paketen zu schätzen, bis zur Vollendung trainiert.
Darin bin ich jetzt fast so gut wie im Kopfrechnen.
Hundert Gramm. Vermutlich Kola. Das bedeutet einen Straßenpreis von achtzigtausend Kronen.
Es klopft. Reflexmäßig lege ich das Paket auf den Tisch und drehe mich zur Tür um.
Mama kommt herein.
Sie sieht müde aus.
Ihre langen braunen Haare haben graue Strähnen und fallen ihr leblos über die Schultern. Das Jeanshemd spannt über der Brust, und in der Öffnung funkelt das goldene Kreuz. Die sorgfältig gebügelte sandfarbene Hose ist so abgetragen, dass sie unten schon ausfranst. In der einen Hand hält Mama einen Müllsack.
»Was machst du?«, fragt sie, ihr Blick irrt ein wenig umher, und sie schiebt sich eine Haarsträhne hinter das Ohr. »Ich meine, machst du irgendwas Besonderes? Oder sitzt du nur so rum und … Ich meine, das ist ja auch in Ordnung. Wenn du nichts Besonderes machst. Meine ich.«
Mama redet immer zu viel. Die Wörter scheinen direkt aus ihrem Mund zu fliegen, ohne beim Gehirn vorbeizuschauen. Wie Vögel, die gerade aus einem Käfig entwischt sind.
»Nichts«, sage ich und hoffe, dass sie geht, ich hab jetzt einfach keinen Nerv auf Streit mit ihr.
»Hast du heute bei Ingemar angerufen? Ich glaube wirklich, dass du das tun solltest. Ihn anrufen, meine ich.«
Ingemar ist einer der Ältestenbrüder in Mamas Gemeinde. Ein alter Kerl von Mitte sechzig mit grauen Locken und dicken roten Lippen. Er lächelt immer, sogar wenn der Pastor über die Hölle und das Jüngste Gericht redet. Ingemar besitzt eine kleine Kette von Imbissbuden, wo immer Leute gebraucht werden, das behauptet Mama jedenfalls.
Aber warum sollte ich für neunzig Kronen Würstchen grillen, wenn ich bei Igor mindestens zehnmal so viel verdienen kann?
»Nö. Noch nicht dazu gekommen.«
Mama lässt den Müllsack los. Der fällt mit einem feuchten Knall auf den Boden.
»Aber Samuel! Du hast es versprochen! Was hast du denn gemacht, was so wichtig war?«
Ich gebe keine Antwort, denn was sollte ich auch sagen? Dass ich den ganzen Tag vor einem Computerspiel gesessen habe?
Sie kommt ein paar Schritte auf mich zu und verschränkt die Arme vor der Brust. Um den Müllsack auf dem Boden bildet sich eine feuchte, glänzende Lache.
»So geht das nicht, Samuel. Du musst endlich mal aktiv werden. Du kannst nicht einfach nur zu Hause rumsitzen und … und …«
Ihre Stimme versagt, und ihr gehen ausnahmsweise einmal die Wörter aus. Ich sehe, dass ihr Blick über den Vogelkäfig gleitet, und sie schüttelt fast unmerklich den Kopf.
Dann erstarrt sie.
»Was ist das da?«
Sie schnappt sich Igors Paket vom Tisch.
»Gib das her«, sage ich, springe auf und sehe sofort, dass ich mich durch meine überstürzte und heftige Reaktion verraten habe.
Mama schüttelt das Paket, als ob sie hören könnte, was darin ist.
»Verdammt! Her damit!«
Ich strecke die Hand nach dem braunen Päckchen aus.
»In meinem Haus wird nicht geflucht!«, faucht Mama.
Und dann:
»Also: Was ist das jetzt?«
Sie weicht ein paar Schritte zurück, aber ihr Blick sagt alles. Der Blick ist nicht besorgt oder wütend, nur enttäuscht.
Wie immer.
Ich bin ihre große Enttäuschung.
»Nichts«, sage ich.
»Dann macht es ja wohl nichts, wenn ich es mitnehme. Wenn es nichts Wichtiges ist. Dann spielt es doch keine Rolle, wenn ich es mitnehme. Oder?«
Mama fingert an dem Paket herum, betrachtet es von allen Seiten, als könnte es eine Bombe sein. Mit zitternden Fingern reißt sie das Klebeband ab und zerrt an dem Papier. Am Ende gibt das braune Packpapier nach, und an die zwanzig winzig kleine durchsichtige Plastiktüten mit weißem Inhalt fallen zu Boden und landen vor ihren Füßen wie Herbstlaub um einen großen Baum.
»Was zum Teu…«
»Das ist nicht das, was du glaubst. Das ist …«
Aber mir fällt keine brauchbare Erklärung ein, denn was könnte man in kleinen Zip-Tüten denn sonst aufbewahren außer Schnee?
Mama wippt mit offenem Mund auf ihren Fußballen hin und her. Ihr stehen Tränen in den Augen.
»Raus mit dir, Samuel. Sofort. Und das ist mein Ernst.«
Ihre Stimme ist ruhig, obwohl sie aussieht, als hätte sie soeben bei helllichtem Tag ein Gespenst gesehen.
»Ich …«
»Raus!«, brüllt sie und geht in die Hocke. Rafft die kleinen Tüten zusammen, geht zu dem Müllsack und presst sie zwischen alte Milchkartons, Krabbenschalen und Apfelreste. Dann nimmt sie den Müllsack und läuft in die Diele.
Ich sehe den feuchten Fleck auf dem Boden an und höre, wie sie die Wohnungstür öffnet. Dann ist das vertraute polternde Geräusch des Müllschachts zu hören, dessen Klappe zugeschlagen wird.
Schritte nähern sich, und die Wohnungstür wird geschlossen.
»Raus!«, schreit sie noch einmal, diesmal vom Gang her.
Ich suche meinen Kram zusammen, stecke alles in den Rucksack, ziehe meine Kapuzenjacke an und trete hinaus in die Diele.
»Verschwinde aus meiner Wohnung«, faucht Mama. »Und nimm das hier mit!«
Sie streift das Armband aus den bunten Glasperlen ab, das ich in der ersten Klasse für sie gebastelt habe, und schleudert es auf den Boden. Danach stürzt sie schluchzend aus dem Zimmer.
Ich hebe das Armband auf – sie trägt es schon, solange ich mich erinnern kann. Ich reibe die Glasperlen zwischen meinen Fingern. Sie sind noch warm.
Der Hausschlüssel passt auch für den Müllraum im Keller, und nachdem ich eine Weile im Schloss gestochert habe, gleitet die schwere Tür mit einem knirschenden Geräusch auf. Ich atme den erstickenden Gestank von halbverfaulten Lebensmitteln, alten Windeln und saurem Wein ein.
Irgendwo draußen ist ein Lastwagen zu hören, der sich entfernt.
Ich taste an der Betonwand nach dem Lichtschalter, finde ihn, drehe ihn um, und gleich darauf ist der Raum in kaltes Licht gebadet.
Die Müllsäcke sind verschwunden.
Neue, leere Müllsäcke hängen ordentlich am Müllkarussell. Sie flattern und rascheln im Luftzug, der von der Tür hereinkommt.
Mein Herz überschlägt sich in meiner Brust, und ich stürze zur Haustür hoch, reiße sie auf und laufe hinaus in den Regen, gerade noch rechtzeitig, um den Müllwagen mit Kola für achtzigtausend Mäuse davonfahren zu sehen.
Das war wirklich nicht meine Schuld.
Ich hatte immer schon eine schlechte Impulskontrolle, das hat sogar die Psychologin mit den Kackezähnen gesagt, und die muss es ja wissen.
Ich habe nie jemandem schaden wollen, auch wenn Mama zu glauben scheint, dass ich ganz bewusst versuche, ihr das Leben zu versauen.
Wenn wir früher Kram geklaut haben, dann immer nur von reichen Ketten, die bis über alle Ohren versichert waren, und Gras und Kola haben wir doch an Erwachsene verkauft, Kunden, die selbst beschlossen haben zu zahlen, um high zu werden.
Wo es Nachfrage gibt, gibt es auch einen Markt.
Wir haben nichts anderes getan, als der Nachfrage schnell, effektiv und verdammt service minded nachzukommen.
Und die Geldeintreiberei mit Malte?
Nein, darauf bin ich wirklich nicht stolz, und wenn ich die Uhr zurückstellen könnte, würde ich nein sagen, wenn Igor die Frage stellt. Aber man kann die Uhr nun mal nicht zurückdrehen. Die Zeit geht nur in eine Richtung. Die Scheißuhr tickt und tickt.
Neunzehn Uhr sechsunddreißig.
In genau einem Tag, einer Stunde und vierundzwanzig Minuten muss ich mich im Gewerbegelände einfinden.
Ich weiß noch genau, was Igor gesagt hat.
Das Paket enthält Warenproben, ich brauche dir also nicht zu erklären, wie wichtig es ist, dass du es nicht verlierst?
Wenn ich da ohne das Paket auftauche, dreht Igor durch. Aber wenn ich nicht hingehe, wage ich nicht einmal, mir vorzustellen, was passiert. Ich nehme an, sie würden den Brutalo auf mich hetzen, den, der für den vierten Hausbesuch zuständig ist.
Ich gehe in die Hocke. Kauere auf dem feuchten Asphalt, mit dem Rücken an der Hausfassade.
Das Armband aus Glasperlen schimmert im Licht der Straßenlaterne. In vier Perlen sind Buchstaben eingeprägt.
Ich blinzele einige Male und lese das vertraute Wort.
MAMA.
PERNILLA
Der Regen trommelt gegen das Fenster, und ich höre das Geräusch des hydraulischen Hebers, als der Müllwagen den Abfall aus dem Mehrfamilienhaus holt. Eine Sekunde später ertrinken meine Gedanken im Lärm, als er weiterfährt.
War es falsch von mir, Samuel vor die Tür zu setzen?
Es ist nicht das erste Mal – in den vergangenen drei Monaten habe ich ihn dreimal rausgeworfen. Aber wir haben uns immer rasch wieder versöhnt.
Ein bisschen zu rasch vielleicht, denn meine Freunde in der Gemeinde sagen, dass ich einfach zu gutmütig bin. Dass ich mich trauen muss, Grenzen zu setzen und loszulassen. Dass ich ihn nicht, zwei Stunden nachdem ich ihn rausgeworfen habe, wieder aufnehmen darf.
Ich habe versucht, ihnen zu erklären, dass das Problem ist, dass ich nicht weiß, wie ich ihm am besten helfen kann. Soll ich verständnisvoll sein? Forderungen stellen? Die seltenen, aber immerhin vorkommenden Gelegenheiten loben, wenn er sich erwachsen verhält und Verantwortung übernimmt?
Und im tiefsten Herzen lauert die unentrinnbare Schuld, die wie ein Tumor mit jedem Mal wächst, wenn Samuel wieder eine Dummheit begeht. Mit jedem Jahr, das vergeht, ohne dass er Jesus in sein Herz aufnimmt.
Alles ist meine Schuld.
Ich falte die Hände und schließe die Augen. Spreche ein kurzes Gebet.
Lieber Gott. Mach, dass Samuel begreift, dass du ihn trägst. Nimm ihn unter deine Fittiche und zeige ihm den richtigen Weg. Und leite mich, damit ich helfen kann. Und vergib mir. Vergib mir. Vergib mir für alles. In Jesu Namen. Amen.
Ich lasse mich auf den Boden sinken und lege die Hände auf das kühle Linoleum. Lasse die Blicke durch den Raum wandern.
Noch immer klebt der Stundenplan am Kühlschrank, obwohl Samuel schon vor Monaten vom Gymnasium abgegangen ist. Ich habe den Plan in doppelter Vergrößerung ausgedruckt und ihn dort angebracht, damit Samuel keine Stunde vergisst. Dienstag und Donnerstag sind rot markiert. »Turnsachen nicht vergessen!«, habe ich darüber geschrieben. Der Montag ist grün. »NB! Erste Stunde 08.05!«, steht daneben. Auf der Anrichte in der Küche stehen die Dosen mit den Lebertrandragees. Eine Frau in meiner Bibelgruppe hat mir versichert, dass sie selbst die schlimmsten Konzentrationsschwierigkeiten verschwinden lassen.
Lebertran und Gebete natürlich.
Aber Samuel wollte die Dragees nicht nehmen. Er hat behauptet, sie stänken nach faulem Fisch, was durchaus stimmen kann.
Alles ist meine Schuld, denke ich wieder. Meine Vergangenheit hat mich eingeholt, meine Sünde kommt an den Tag, noch einmal.
Ich hatte eine phantastische Kindheit, bis ich neun wurde.
Ich bin in einer tiefgläubigen Familie aufgewachsen. Mein Vater, Bernt, war Pastor in einer freikirchlichen Gemeinde und meine Mutter, Ingrid, Hausfrau. Meine Eltern wollten eine große Familie, aber sie bekamen nur ein Kind, und ich habe lange versucht, eine musterhafte Tochter zu sein, um das auszugleichen.
Eine mindestens doppelt so gute Tochter wie alle anderen Töchter.
Wir wohnten in Huddinge, im Süden von Stockholm, in einem kleinen gelben Holzhaus beim See Trehörningen.
Wir waren eine normale Familie, hatten einen Volvo, zwei Golden Retriever – natürlich ein Ersatz für die Geschwister, die sich nie einstellten – und einen großen Garten voller Obstbäume und Beerensträucher. Ich engagierte mich schon früh in der Gemeinde, und ich hatte in der Schule immer die besten Noten.
Aber falls meine Eltern auf mich stolz waren, dann sagten sie das nicht.
Ich habe den Verdacht, sie fanden, dass ich nur tat, was von mir erwartet wurde.
Vater arbeitete viel – es gehörte zu seinem Amt, immer für die Gemeindemitglieder ansprechbar zu sein, und ab und zu schien er Seelsorger, Bank und Polizei in einem zu sein.
Bei uns zu Hause war immer Betrieb – Freunde, Gemeindemitglieder, die Hilfe und Unterweisung brauchten, alle brachen das Brot in unserer spartanisch möblierten Küche, während die Hunde mit großen Augen danebensaßen und bettelten.
Damals nahm ich alles als gegeben hin, das Materielle, meine liebevolle Familie und nicht zuletzt den Glauben, der heute so vielen fehlt. Es war ein Segen, unreflektiert an diesem Glück teilzuhaben, aber auch eine Sünde, denn ich begriff nicht, welches Geschenk das war, vermochte mich nicht auf die Gnade des Herrn besinnen.
Eines Tages, als ich neun Jahre alt war, kam ich früher aus der Schule zurück und fand Mutter nackt auf dem Sofa mit einem unserer Nachbarn, dem Vater eines Klassenkameraden.
Ich weiß noch genau, wie die Sonnenstrahlen ihre schweißnassen Körper trafen, die ineinander verschlungen auf dem senfgelben Cordsofa lagen. Wie Mutters lange dunkle Haare nahezu Jöns Brustkorb zu fluten schienen und wie seine Hand träge auf ihrer geröteten Hinterbacke lag.
Damals sah ich meine Mutter zum letzten Mal.
Am nächsten Morgen war sie verschwunden.
Mutter war schön, viel schöner, als gut für sie war. Außerdem wollte sie Vater nicht gehorchen.
Ein Gesicht wie ein Engel und ein Herz wie eine Schlange. Eine aufrührerische Versucherin, so nannte Vater sie im Nachhinein, und dabei verwies er gern auf den Brief an die Epheser, den siebten Brief des Paulus, den er während seiner Gefangenschaft in Rom geschrieben hatte: »Frauen, ordnet euch euren Männern unter wie dem Herrn.«
Aber Vater war kein Tyrann, auch wenn es vielleicht so klingt. Er liebte Mutter – sogar nachdem sie uns in einer finsteren Leere zurückgelassen hatte.
Obwohl sie sich von Jesus abgewandt hatte und bis zu ihrem Tod in Unzucht lebte.
Auch wenn Mutters Verschwinden ein Trauma gewesen war, so war es doch nichts gegen das Schweigen der folgenden drei Jahre. Kein Anruf, kein Brief. An jedem Geburtstag hoffte ich, von Mutter zu hören. Ich betete innig und lange, dass sie auftauchen würde.
Aber sie erschien nie, und an meinem dreizehnten Geburtstag kam sie nur wenige Kilometer von unserem Haus entfernt bei einem Autounfall ums Leben.
Ich stehe auf, nehme mein Handy und gehe ins Badezimmer. Spüle mein Gesicht lange mit kaltem Wasser und mustere mein Spiegelbild. Die strohigen braunen Haare, die missmutige Falte am Mundwinkel, den Bauch und den Hintern, die aus der zu engen Hose quellen. Die rotgeränderten Augen und die unter den Augen verschmierte Wimperntusche.
Dennoch sehe ich es, da ist etwas mit Augen und Wangenknochen – ich bin die Tochter meiner Mutter.
Aber ich habe mehr geerbt als nur Mutters Gesichtszüge. Ich habe auch diesen Trieb zur Unzucht geerbt, der in Mutters Brust lauerte. Vielleicht hat sie ihn mir mit der Muttermilch eingeflößt, wie ein unsichtbares, aber tödliches Gift, getarnt als Nahrung und Liebe.
Das hat jedenfalls Vater gesagt, als ich mit achtzehn Jahren Isaac Zimmermann kennenlernte.
Isaac war alles, was ein guter Christ nicht ist. Zum einen war er kein Christ, sondern Jude. Allein das war schon eine Katastrophe und eine gewaltige Schande. Zweitens war er fünf Jahre älter, Amerikaner und ein »verkommener Musiker«.
Vater wollte ihn nicht in das gelbe kleine Haus lassen.
Aber jung und dumm, wie ich war, trotzte ich meinem Vater und traf mich weiter mit Isaac. Ich fand ihn unwiderstehlich mit seinem schlaksigen Körper, seinen zerlumpten Kleidern und seinen langen Locken.
Er sah fast aus wie Jesus.
Und ich fiel. Ich fiel in die offenen Arme des Verderbens, und ich genoss es, denn ich war töricht.
Ich glaubte, dass die Liebe zu Isaac und das brennende Begehren die von meiner Mutter hinterlassene Leere füllen könnten. Dass sie die Wunde heilen würden, die noch immer in meiner Seele brannte.
Doch das Einzige, was passierte, war, dass ich schwanger wurde.
Isaac drängte mich zur Abtreibung, aber das war für mich keine Alternative. Natürlich spielte meine Herkunft eine Rolle, dieses ganze Gerede über die Unverletzlichkeit des Lebens, aber wichtiger war meine absolute Überzeugung, dass ich den kleinen Menschen liebte, der da in mir heranwuchs. Dass ich, nachdem ich schon meine Mutter verloren hatte, nicht auch noch mein Kind hergeben wollte. Dass ich mich nicht gegen das Kind entscheiden konnte, so wie Mutter sich gegen mich entschieden hatte.
Denn das Letzte, was ich wollte, war, so zu werden wie sie.
Ein Gesicht wie ein Engel und ein Herz wie eine Schlange.
Isaac war wütend, ging nach Värmland auf Tournee und ließ wochenlang nichts von sich hören.
Dann kam ein Brief, in dem er erklärte, dass er nicht bereit sei, eine Familie zu gründen, und wenn ich dieses Kind zur Welt bringen wollte, würde ich mich auch darum kümmern müssen.
Und so geschah es.
Nach fast einem halben Jahr ohne irgendeinen Kontakt zu meinem Vater kehrte ich in das kleine gelbe Haus zurück.
Achtzehn Jahre und hochschwanger.
Wenn Papa sich schämte, dann zeigte er das jedenfalls nicht. Und die Gemeinde nahm mich mit offenen Armen auf. Ich war zwar eine Sünderin, aber ich war bereit, Buße zu tun, meine unsterbliche Seele zu retten, ehe es zu spät war.
Nur ein einziges Mal sagte Vater es ganz offen: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
Es war an einem stürmischen Herbstabend, als wir uns stritten, ich weiß nicht einmal mehr weshalb, aber er wurde laut und erklärte, ich sei genau wie meine Mutter.
Und hätte den Teufel im Leib.
Und jetzt habe ich das Böse an Samuel weitergegeben.
Ich habe alles getan, was ich konnte, damit es ihm gut geht. Ich habe dafür gekämpft, uns versorgen zu können. Ich habe mir in all den Jahren seit Samuels Geburt nie eine Ferienreise gegönnt, und ich bin nie eine neue Beziehung eingegangen – nicht weil ich das nicht gewollt hätte, sondern weil Samuel ein anspruchsvolles Kind war, vom ersten Tag an. Ein Kind, das meine Energie an sich zog, wie ein unersättliches schwarzes Loch im Weltall.
Ich habe alles getan.
Und ich habe gebetet.
Aber Gott hat offenbar beschlossen, dass meine Prüfung noch nicht zu Ende ist, und damit muss ich mich abfinden.
Ich weiß nur nicht, wie ich das ertragen soll.
Es heißt, dass der Herr uns nicht mehr schickt, als wir ertragen können, aber bisweilen bin ich mir da nicht so sicher.
Ich trockne mein Gesicht mit einem Handtuch ab. Es wird schwarz von der Schminke, und ich werfe es auf den Boden. Greife zu meinem Handy und schreibe eine kurze Mitteilung. Bitte Samuel, nach Hause zu kommen. Schreibe, dass ich ihn liebe und dass es mir leidtut, dass ich so wütend geworden bin.
Dann setze ich mich auf die Toilette und pisse.
Aus Samuels Zimmer ist ein Kratzen zu hören. Das muss die Amsel sein, die im Käfig rumort.
Er kann doch Verantwortung übernehmen, wenn er will, denke ich. Wenn es um jemanden oder etwas geht, das ihm wichtig ist.
Wie um eine Amsel.
Ich lösche die Mitteilung und werfe das Handy auf den Boden.
Es rutscht von der Badematte weg und bleibt vor der Dusche liegen.
Nein, denke ich.
Diesmal wird es anders sein.
Diesmal muss er seine Lektion lernen.
MANFRED
Wir sitzen jeweils auf einer Seite des Betts, Afsaneh und ich. Zwischen uns liegt Nadja, umgeben von Apparaten, die sie am Leben erhalten. Die Elektronik piept und rauscht. Ein Arm von Nadja steckt in einem dicken Gips, und von dem kleinen Loch in ihrem Hals führt ein Schlauch zu der Maschine, die für sie atmet.
Um sie herum stehen Bildschirme, die Puls, Temperatur, Sauerstoffgehalt und Druck im Gehirn anzeigen. Mit der ganzen Elektronik komme ich mir fast wie in einem Raumschiff vor.
Vom Korridor her sind Schritte zu hören, die eilig irgendwohin unterwegs sind, vermutlich zu einem kranken Kind.
Hinter dem Kopfende des Betts sitzt Angelica, die Ärztin von der Intensivstation, an dem kleinen weißen Tisch, auf dem der Computer steht.
Sie ist eine gute Ärztin. Alle hier auf der Station sind gut – der Intensivstation für Kinder –, auf die wir nach der ersten Woche auf der Neurointensivstation verlegt worden sind. Sie kümmern sich nicht nur um die Kinder, sondern auch um uns, die Angehörigen. Sie holen etwas zu essen, Kaffee. Sie erklären alles, was sich nicht erklären lässt. Sie halten Hände und trocknen Tränen.
Ich begreife nicht, wie sie das schaffen.
Nadja liegt in einem künstlichen Koma.
Sie hat sich bei ihrem Sturz aus dem Fenster schwere Schädelverletzungen zugezogen, und die Ärzte haben sie betäubt, damit ihr Kopf Zeit hat, sich zu erholen. Aber noch weiß niemand, ob sie jemals wieder aufwachen wird und, wenn ja, was das für ein Leben sein wird.
Inzwischen sind drei Wochen vergangen.
Ich hatte mir vorgestellt, dass es mit der Zeit leichter werden würde, dass es einfacher werden würde, mit der Unsicherheit umzugehen, aber das Gegenteil ist der Fall. Mit jedem Tag, der vergeht, wird das Leben im Unklaren schmerzlicher.
Ich lasse Nadjas feuchte, warme Hand los und lehne mich auf dem Stuhl zurück. Sehe Afsaneh an, die mir in sich zusammengesunken gegenübersitzt, den Kopf in die Hand gelegt, den Ellbogen aufs Knie gestützt.
Es hat etwas Symbolisches, fast Schicksalhaftes, so wie wir hier sitzen, auf beiden Seiten von Nadja. Ich kann Afsaneh nicht erreichen und sie mich nicht, selbst wenn sie das wollte, denn Nadja ist zwischen uns.
Ihr Unglück ist zwischen uns.
Zu Hause ist es nicht anders.
Afsaneh und ich reden kaum miteinander, und sie berührt mich nicht mehr.
Berühre ich sie?
Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern.
Ich kann mich an so vieles nicht erinnern.
Die Tage gleiten vorüber wie Schiffe am Horizont, ohne dass ich darüber nachdenke. Es kommt vor, dass ich morgens aufstehe, stundenlang auf dem Wohnzimmersofa sitze, um dann plötzlich zu entdecken, dass die Dämmerung eingesetzt hat.
Die Zeit existiert nicht mehr. Alles ist nur ein einziges endloses Jetzt, ein schmerzliches Warten auf den Tag, an dem Nadja endlich zu sich kommt oder uns endgültig verlässt.
Afsaneh reckt sich und massiert sich mit einer Hand den Nacken.
»Ich hole einen Kaffee«, sagt sie, ohne zu fragen, ob ich etwas möchte.
Ich gebe keine Antwort. Ich schaue aus dem Fenster, wo die Sonne von einem strahlend blauen Himmel scheint und der Wind in den grünen Baumwipfeln spielt.
Angelica schaut von ihrem Platz hinter dem Computer auf.
»Möchtest du etwas?«, fragt sie. »Ich wollte ohnehin in der Küche vorbeischauen.«
»Danke, danke. Ist brauche nichts.«
Ich verspüre keinen Hunger mehr. Ich habe immer gerne gegessen, ich war schon als Teenager dick, doch in den vergangenen Wochen habe ich mindestens zehn Kilo abgenommen.
Die wirkungsvollste Diät aller Zeiten: das Leben mit einem schwerkranken Kind.
Du brauchst nur für einen Moment nicht aufzupassen, gerade lange genug, damit dein Kind aus dem Fenster stürzen, auf die Straße hinausrennen oder vom Steg ins Wasser fallen kann.
Das Leben lässt sich Zeit. Das Leben ist ein müder alter Esel.
Aber der Tod ist schnell wie der Blitz. Der Tod braucht nur eine Sekunde, einen Meter, einen Atemzug. Der Tod ist eine Kobra, die ohne jegliche Vorwarnung zuschlägt. Er ist verdammt noch mal schneller als sein eigener Schatten, genau wie Lucky Luke.
Mein Handy klingelt, und ich starre es verständnislos an, bevor ich mich melde.
»Manfred? Hier ist Malin.«
Ich brauche eine Sekunde, um zu begreifen, dass meine Kollegin Malin Brundin anruft.
Malin, die normalerweise in Katrineholm arbeitet, war mit in der Gruppe, die in dem Mord in Ormberg ermittelt hat – eins von Schwedens aufsehenerregendsten Verbrechen aller Zeiten.
Die Ermittlung nahm eine überraschende Wendung, die Malins Leben für immer veränderte. Es stellte sich heraus, dass eine von ihren Verwandten viele Jahre lang eine Frau in einem Keller gefangen gehalten hatte und dass Malin noch dazu das Kind dieser Frau war. Mit anderen Worten war die Frau, bei der Malin aufgewachsen und die sie ihr Leben lang Mama genannt hatte, nicht ihre biologische Mutter.
Wie überlebt man so etwas?
Es erstaunt mich wirklich, dass sie die Truppe nicht verlassen hat, um nach Stockholm oder in eine andere Großstadt umzuziehen, wo sie sich leichter vor Presse und Neugierigen verstecken könnte.
Malin macht über den Sommer eine Vertretung in Stockholm, auf mein Anraten hin. Ich glaube, ich hatte so eine vage Vorstellung, dass es ihr guttun würde, von Ormberg wegzukommen. Dass es auf irgendeine Weise die schreckliche Wunde heilen könnte, von der ich mir vorstelle, dass sie sich damit herumquält.
»Hallo«, sage ich.
»Wie sieht es aus?«, fragt sie.
Was antwortet man auf so eine Frage?
Ich werde dauernd gefragt, wie es mir geht, aber ich antworte darauf nicht wahrheitsgemäß, denn ich schaffe es nicht mehr, mich zu erklären. Und außerdem weiß ich nicht mehr so genau, wie es mir geht, denn ich habe aufgehört nachzuspüren.
»Unverändert«, sage ich nach einigem Zögern.
»Du, wir haben uns nur gefragt, ob du auf dem Weg bist, wir wollten jetzt anfangen.«
Verdammt.
Plötzlich fällt es mir ein.
Heute sollte ich doch wieder anfangen zu arbeiten. Die Krankschreibung ist abgelaufen, und das Leben – jedenfalls das Arbeitsleben – geht wieder los.
»Verdammt, Malin, tut mir leid«, setze ich an. »Ich muss die Tage verwechselt haben. Ich bin bei Nadja im Krankenhaus und habe total vergessen …«
»Ist schon gut«, sagt sie so rasch, dass mir der Verdacht kommt, dass sie mit genau dieser Antwort gerechnet hat. »Du kannst morgen kommen, wenn das besser ist.«
»Nein, nein, ich komme jetzt.«
Sie schweigt.
»Warte noch einen Moment«, sagt Malin. »Wir haben einen neuen Fall. Ein männlicher Leichnam wurde an einem Felsen im südlichen Schärengürtel angespült. Wir fahren in einer Stunde in die Rechtsmedizin nach Solna. Wir können uns da treffen.«
Sie zögert noch einmal kurz, dann fügt sie hinzu:
»Ich meine, du bist ja ohnehin schon im Karolinska.«
Die Sonne knallt auf den heißen Asphalt, vom Wolkenbruch des Vortags ist nichts mehr zu merken.
Malin steht vor dem Eingang des Klinkerbaus und tastet an ihrem Handy herum. Ich lasse, so diskret ich nur kann, meine Zigarette fallen und gehe auf sie zu.
Die langen braunen Haare, der schlanke und doch muskulöse Körper. Die dunklen Augen, die unter den markanten Augenbrauen in die Sonne blinzeln, und der etwas harte Zug um den Mund – Malin hat sich nicht verändert. Aber ihre Wangen sind voller geworden, ihre Hüften runder, und das T-Shirt spannt über dem hervorstehenden Bauch.
Malin und Andreas bekommen ein Kind.
Sie haben bei der Ermittlung in Ormberg zusammengearbeitet und sich dabei pausenlos gestritten. Über alles, von Zuwanderung bis zu Sozialhilfe, sie konnten sich nicht einmal darüber einigen, aus welchem Imbiss wir das Mittagessen holen sollten.
Jetzt werden sie also einen neuen kleinen Menschen in die Welt setzen.
Das ist gelinde gesagt eine Überraschung.
»Rauchst du noch immer heimlich?«, fragt Malin, zieht eine Augenbraue hoch und nickt zu der Kippe auf dem Boden hin.
Ich gebe keine Antwort, sondern klopfe ihr auf die Schulter.
Ein Stück rechts von Malin steht Gunnar Wijk, auch Lasses genannt.
Ich schiele zu ihm hinüber.
Sein Bart ist grau und struppig. Die Augenlider sind so schwer, dass sie den Blick durch die dünne Brille mit dem Stahlgestell eigentlich erschweren müssten. Der Bauch wölbt sich bedenklich unter dem kurzärmligen Hemd, die Hose aus Synthetik ist ein bisschen zu kurz und zeigt sockenlose, leicht geschwollene Knöchel, die in einem Paar abgenutzter brauner Sandalen verschwinden.
Gunnar ist legendär. Er kommt aus einer richtigen Polizeifamilie, einer, die einen hohen Preis für ihre Zugehörigkeit zur Truppe bezahlen musste. Vor allem bekannt ist er aber als der größte Casanova, den die Stockholmer Polizei jemals hatte. Ein Herzensbrecher von Rang, der nach allgemeiner Auskunft alles verführen konnte, das einen Puls hatte. Und wenn die endgültige Entscheidung anstand, wenn er den letzten Widerstand ersticken wollte, kam er mit seinem vielzitierten Spruch: Lass es geschehen.
Natürlich dauerte es nicht lange, bis Gunnars Modus Operandi bekannt war, und kurz darauf hatten die Scherzkekse in der Truppe ihn Lass-es-geschehen getauft. Im Laufe der Jahre wurde dieser Spitzname zu dem kürzeren und schneidigeren Lass-es zusammengezogen, woraus dann schließlich Lasses wurde.
Ich begrüße ihn. Wir haben noch nie zusammengearbeitet, aber wir kennen einander natürlich, wenn auch nur oberflächlich.
Er ist offenbar wirklich ein hervorragender Polizist, auch wenn er mit den Jahren ein wenig mürrisch geworden ist. Die, die am nächsten mit ihm zusammenarbeiten, behaupten, dass er vor allem dann griesgrämig ist, wenn gerade nichts läuft.
»Was haben wir?«, frage ich.
»Mann um die zwanzig«, sagt Lasses und fährt sich mit der Hand über den Bart. »Gestern von einem Hobbyfischer gefunden.«
»Und warum sind wir hier?«
Eine naheliegende Frage. Bei verdächtigen Todesfällen ermittelt meistens nicht die NOA – die Nationale Operative Einheit.
»Wir glauben, dass der Tote im Zusammenhang mit einer laufenden Ermittlung stehen kann«, sagt Malin. »Außerdem haben die Kollegen in Stockholm nicht genug Leute. Sie haben um Unterstützung gebeten.«
»Wissen wir, wer das Opfer ist?«
»Nicht mit Sicherheit«, sagt sie und beschattet die Augen vor der Sonne.
Ihr Blick gleitet über mich hinweg.
Ich sehe sicher grauenhaft aus. Ungeduscht, unrasiert und unvorbereitet. Das passt so wenig zu dem alten Manfred, wie es nur geht.
Der wäre niemals so zur Arbeit erschienen.