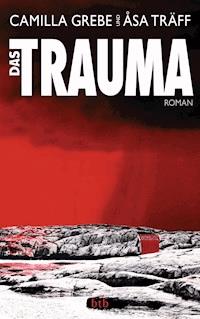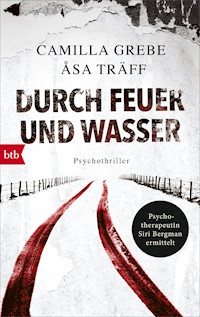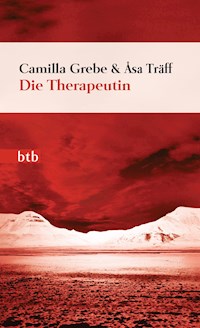9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: btb Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Profilerin
- Sprache: Deutsch
In der Wohnung des reichen Geschäftsmanns Jesper Orre wird die Leiche einer jungen Frau gefunden – auf brutale Art ermordet. Von ihm fehlt jede Spur. Vor zehn Jahren gab es einen ganz ähnlichen Fall – ungelöst. Hanne, die Kriminalpsychologin von damals, soll deshalb ermitteln. Sie muss in die Vergangenheit eintauchen, dabei verschwimmt gerade ihre Gegenwart – sie fürchtet, an beginnendem Alzheimer zu leiden. Ihre Existenz bekommt zunehmend Risse, und die beiden Fälle verbinden sich auf ungute Weise. Kann Hanne sich selbst und ihren Erinnerungen trauen? Ist sie auf der richtigen Spur? Wann bricht das Eis, und was kommt darunter zum Vorschein?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 614
Veröffentlichungsjahr: 2017
Sammlungen
Ähnliche
Zum Buch
In der Wohnung des reichen Geschäftsmanns Jesper Orre wird die Leiche einer jungen Frau gefunden – auf brutale Art ermordet. Von ihm fehlt jede Spur. Vor zehn Jahren gab es einen ganz ähnlichen Fall – ungelöst. Hanne, die Kriminalpsychologin von damals, soll deshalb ermitteln. Sie muss in die Vergangenheit eintauchen, dabei verschwimmt gerade ihre Gegenwart – sie leidet an beginnendem Alzheimer. Ihre Existenz bekommt zunehmend Risse, und die beiden Fälle verbinden sich auf ungute Weise. Kann Hanne sich selbst und ihren Erinnerungen trauen? Ist sie auf der richtigen Spur? Wann bricht das Eis, und was kommt darunter zum Vorschein?
Zur Autorin
CAMILLA GREBE, geboren 1968 in Älvsjö in der Nähe von Stockholm. Sie studierte an der Stockholm School of Economics, hat den Hörbuchverlag „StorySide“ gegründet und betreibt ein Beratungsunternehmen. Gemeinsam mit ihrer Schwester schrieb sie die erfolgreiche Krimi-Reihe um die Stockholmer Psychotherapeutin Siri Bergman. Wenn das Eis bricht ist ihr erster eigener Roman, der für seine einzigartige Stimme in der Presse hochgelobt wurde und in Hollywood verfilmt wird. Camilla Grebe lebt mit ihrer Familie in Stockholm.
Camilla Grebe
Wenn das Eis bricht
Psychothriller
Aus dem Schwedischen von Gabriele Haefs
Die schwedische Originalausgabe erschien 2015 unter dem Titel »Alskaren Från Huvudkontoret« bei Wahlström & Widstrand, Stockholm.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Copyright © 2015 by Camilla Grebe,
published by agreement with Ahlander Agency
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 by btb Verlag in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: semper smile, München nach einem Entwurf von Miroslav Šokčić
Umschlagmotiv: © Arcangel/Stephen Carroll; Shutterstock/dwph
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN: 978-3-641-19617-2V003
www.btb-verlag.de
www.facebook.com/btbverlag
Besuchen Sie auch unseren Literaturblog www.transatlantik.de
Für Estelle und Fredrik
Wer dein Freund und wer dein Feind ist, weißt du erst, wenn das Eis unter deinen Füßen bricht.
Inuitisches Sprichwort
PETER
Ich stehe im Schnee vor Mamas Grabstein, als das Telefon klingelt. Es ist ein schlichter Grabstein, knapp kniehoch, aus grob zurechtgehauenem Granit. Wir haben eine Weile nachgedacht, meine Mutter und ich. Darüber, wie schwierig es ist, in einer Stadt Polizist zu sein, in der sich niemand für andere interessiert, nur noch für sich selbst. Und vielleicht noch wichtiger: über die Schwierigkeit, Mensch zu sein, in einer solchen Stadt, in einer solchen Zeit.
Ich trete den feuchten Schnee von den Turnschuhen und drehe mich weg. Es kommt mir nicht richtig vor, an einem Grab zu telefonieren. Vor mir breitet sich die wellige Friedhofslandschaft aus. Nebelschwaden liegen zwischen den Tannenwipfeln, unter ihnen ragen die dunklen Baumstämme aus dem Schnee wie Ausrufezeichen, die auf die Vergänglichkeit des Lebens hinweisen. Es tropft aus den Baumkronen und von den Grabsteinen. Überall Schmelzwasser. Es dringt durch meine dünnen Schuhe, es sammelt sich um meine Zehen wie eine feuchte Erinnerung daran, dass ich mir endlich Stiefel kaufen sollte. Weiter vorn auf dem Gelände ahne ich dunkle Gestalten, die sich durch den Wald entfernen. Vielleicht wollen sie Laternen aufstellen. Oder Tannenzweige auslegen.
Bald ist Weihnachten.
Ich mache einige Schritte auf den sorgfältig geräumten Weg zu und werfe einen Blick auf das Display, obwohl ich sowieso schon weiß, wer anruft. Das Gefühl in meinem Zwerchfell ist unverkennbar. Das bohrende, pochende Gefühl, das ich so gut kenne.
Ehe ich antworte, drehe ich mich ein letztes Mal zum Grabstein um. Winke unbeholfen und murmele etwas in der Art, dass ich bald wiederkommen werde. Das ist natürlich unnötig, sie weiß ja, dass ich immer zurückkomme.
Der Nynäsväg liegt schwarz und fast leer da, als ich auf die Stadt zufahre. Nur die roten Rücklichter einiger Autos glitzern vor mir auf der Fahrbahn, zeigen den Weg. Am Straßenrand türmen sich große Haufen aus schmutzigbraunem Schnee vor den niedrigen, deprimierend eintönig gebauten Häusern auf, die die Einfahrt nach Stockholm säumen. Einzelne Weihnachtssterne leuchten hinter den Fenstern, wie ein Flackern in der Nacht. Es schneit jetzt wieder. Ein Gemisch aus Regen und Matsch lagert sich an den Rändern der Windschutzscheibe ab und verwischt die scharfen Umrisse der Umgebung, macht die Landschaft weicher. Das Einzige, was ich höre, ist das Geräusch der arbeitenden Scheibenwischer, das sich mit dem sanften Schnurren des Motors vermählt.
Ein Mord.
Noch ein Mord.
Wenn ich früher, als relativ junger Polizist und frischgebackener Ermittler, an einen Tatort gerufen wurde, fand ich die Nachricht über einen Mord immer überaus anregend. Der Tod war für mich ein Synonym für ein Mysterium, das geklärt werden sollte, aufgerollt wie ein verwickeltes Wollknäuel. Denn alles konnte man klären, aufrollen. Wenn man nur Energie und Ausdauer besaß und zur richtigen Zeit am richtigen Faden zog. Die Wirklichkeit war einfach ein komplexes Gewebe aus solchen Fäden.
Kurz gesagt: Die Wirklichkeit konnte entwirrt werden, geklärt.
Jetzt bin ich mir da nicht mehr sicher. Vielleicht habe ich das Interesse an diesem Gewebe verloren, das Gespür dafür, an welchem Faden ich ziehen muss. Mit der Zeit hat auch der Tod eine andere Bedeutung bekommen. Mama, die im feuchten Boden des Waldfriedhofs schläft. Annika, meine Schwester, die auch hier liegt, ein kleines Stück weiter. Und Papa, der sich an der Sonnenküste nach und nach zu Tode säuft, wird wohl auch bald dort landen. Die Verbrechen, mit denen ich zu tun habe, kommen mir nicht mehr so wichtig vor. Natürlich kann ich dazu beitragen, sie aufzuklären. Kann das Unfassbare – jemand ist ums Leben gebracht worden – in Worte fassen und die Ereignisse beschreiben, die dazu geführt haben. Vielleicht kann ich auch feststellen, wer der Schuldige ist, und bestenfalls dazu beitragen, dass dieser Jemand vor Gericht gestellt wird. Aber die Toten sind doch weiterhin tot, oder?! Inzwischen fällt es mir schwer, den Sinn meiner Tätigkeit zu sehen.
Bei Roslagstull setzt die Dämmerung ein, und mir fällt auf, dass es heute zu keinem Zeitpunkt ganz hell geworden ist. Dass dieser Tag in dem grauen Dezembernebel ebenso unbemerkt vorübergegangen ist wie der gestrige und der davor. Der Verkehr verdichtet sich, als ich auf die E18 nach Norden abbiege. Ich komme an einer Baustelle vorbei, die Löcher in der Fahrbahn lassen den Wagen zittern, der Wunderbaum hüpft bedrohlich vor der Windschutzscheibe auf und ab.
Irgendwo auf Höhe der Universität ruft Manfred an. Erklärt, dass eine verdammte Aufregung herrscht, dass irgendein hohes Tier mit der Sache zu tun hat, und dass es gut wäre, wenn ich verdammt noch mal weniger herumtrödelte, sondern endlich loslegte. Ich schaue aus zusammengekniffenen Augen in die industriegraue Dämmerung, antworte, dass er sich beruhigen solle, die Fahrbahn sei löchrig wie ein Schweizer Käse und ich könnte mir blaue Flecken an den Eiern holen, wenn ich schneller führe.
Manfred lässt sein vertrautes grunzendes Lachen hören, das ein wenig an das Geräusch eines Schweins erinnert. Vielleicht bin ich jetzt ungerecht: Manfred ist ziemlich fett, und vielleicht beeinflusst sein Körperbau mein Bild von seinem Lachen, lässt mich an ein wollüstiges Grunzen denken. Vielleicht klingt sein Lachen auch einfach genauso wie meins.
Vielleicht klingen wir alle genau gleich.
Wir arbeiten seit über zehn Jahren zusammen, Manfred und ich. Jahr für Jahr stehen wir nebeneinander an Obduktionstischen, befragen Zeugen und sprechen mit verzweifelten Angehörigen. Jahr für Jahr nehmen wir Verbrecher fest und machen die Welt zu einem sichereren Ort. Aber tun wir das wirklich? All die Menschen, die in den Kühlfächern der Rechtsmedizin in Solna gelegen haben, sind doch trotzdem tot und werden es auch immer bleiben. Letztlich sind wir nur der Putztrupp der Gesellschaft, der lose Fäden verknotet, wenn das Gewebe gerissen und das Unvorstellbare bereits passiert ist.
Janet sagt, ich sei deprimiert, aber ich höre nicht auf Janet. Außerdem glaube ich nicht an Depressionen. Ich glaube einfach nicht daran. Es ist eher so, dass ich die Bedingungen des Daseins erkannt habe, und das Leben zum ersten Mal nüchtern betrachte. Wenn ich Janet das sage, erwidert sie, es gehöre zum Krankheitsbild, dass der Deprimierte den Blick nicht von seinem eigenen gefühlten Elend heben kann. Ich antworte dann immer, dass Depression die vielleicht einträglichste Erfindung der Arzneimittelbranche ist, und dass ich weder Zeit noch Lust habe, rotzreiche Pharmakonzerne noch reicher werden zu lassen. Und wenn Janet dann weiter über mein Befinden reden will, lege ich auf. Wir sind schließlich seit fünfzehn Jahren nicht mehr zusammen, es gibt keinen Grund dafür, solche Fragen mit ihr zu besprechen. Dass sie zufällig die Mutter meines einzigen Kindes ist, ändert nichts an diesem Sachverhalt.
Albin ist ein Kind, das eigentlich gar nicht existieren dürfte. Nicht, dass an Albin irgendetwas auszusetzen wäre – er ist, wie die meisten halbwüchsigen Jungen nun mal sind: picklig, aller Wahrscheinlichkeit nach total sexfixiert und krankhaft interessiert an Computerspielen. Nein, ich war einfach nicht bereit, Vater zu werden. In meinen düsteren Augenblicken, die sich mit den Jahren häufen, denke ich oft, dass sie es damals darauf angelegt hat. Dass sie die Pille nicht mehr genommen hat und aus Rache wegen der Sache mit der Hochzeit schwanger geworden ist. Ich werde es niemals sicher wissen, und es spielt jetzt auch keine große Rolle mehr. Albin existiert, das ist sicher, und lebt in bestem Wohlergehen bei seiner Mutter. Wir sehen uns manchmal, nicht besonders oft – zu Weihnachten und Mittsommer und an seinem Geburtstag. Ich glaube, so ist es besser für ihn, also, dass wir nicht so besonders viel Kontakt haben. Die Gefahr besteht doch, dass er sonst von mir enttäuscht wäre.
Ab und zu denke ich, ich müsste ein Foto von ihm in der Brieftasche haben wie die anderen, die richtigen Eltern. Ein scheußliches Schulfoto vor bräunlichem Hintergrund in einer Turnhalle, von einem Fotografen, dessen Träume ihn nicht weitergeführt haben als bis zum Gymnasium von Farsta. Aber dann sehe ich doch sehr schnell ein, dass das niemanden täuschen würde, schon gar nicht mich selbst. Eltern zu sein, das verdient man sich nicht so einfach, denke ich. Es ist ein Recht, das sich durch Nachtwachen, Windelwechseln und all das einstellt, was man eben tut, wenn man da ist. Es hängt sehr wenig mit den Genen zusammen, mit dem Sperma, das ich vor ungefähr fünfzehn Jahren gespendet habe, damit Janet sich ihren Traum von einem Kind erfüllen konnte.
Ich sehe das Haus schon aus der Ferne. Nicht, weil das weiße viereckige Gebäude in irgendeiner Weise auffiele in dem exklusiven Villenviertel, sondern weil es von Streifenwagen umringt ist. Das Blaulicht jagt über den Schnee, und der unverkennbare weiße Minibus der Kriminaltechnik steht ein Stück weiter am Straßenrand. Ich halte unten am Hang und gehe das letzte Stück bis zum Haus zu Fuß. Begrüße die Kollegen, zeige meinen Dienstausweis und bücke mich unter dem blauweißen Absperrband, das sich in dem leichten Wind langsam hin und her bewegt, hindurch.
Manfred steht in der Haustür. Seine ausladende Gestalt verbirgt fast die ganze Umgebung, als er die Hand zum Gruß hebt. Er trägt einen Tweedblazer, aus der Brusttasche ragt ein kleines rosa Seidentaschentuch. Die großzügig zugeschnittene Wollhose ist sorgfältig in hellblaue Schuhüberzüge gestopft.
»Zum Teufel, Lindgren. Ich dachte schon, du kommst überhaupt nicht mehr.«
Ich erwidere seinen Blick. Die kleinen Pfefferkornaugen liegen tief eingesunken in dem geröteten Gesicht. Seine schütteren rotblonden Haare sind sorgfältig mit Wasser gekämmt worden, die Frisur erinnert an die eines Schauspielers aus Filmen der Fünfziger. Er sieht nicht aus wie ein Polizist, eher wie ein Antiquitätenhändler, ein Historiker oder ein Sommelier. Aber egal, er sieht jedenfalls nicht aus wie ein Bulle – eine Tatsache, derer er sich zweifellos bewusst ist. So sehr, dass ich den Verdacht habe, dass er das zu seinem Tick gemacht hat, dass es ihn ungeheuer befriedigt, seinen exzentrischen Kleidungsstil zu übertreiben, um die echt wirkenden Bullen zu provozieren.
»Wie gesagt …«
»Ja, ja, schieb du das nur auf den Verkehr«, sagt Manfred. »Ich weiß ja, wie das ist, wenn man einen scharfen Porno gefunden hat. Da kann man sich nicht so leicht losreißen.«
Manfreds ungehobelte Sprache bildet einen Kontrast zu seinem verfeinerten Kleidungsstil. Er reicht mir Schuhüberzüge und Handschuhe und sagt leiser:
»Du. Das hier ist so ungefähr das Scheußlichste … schau’s dir einfach an.«
Ich streife Schuh- und Handschutz über und trete auf die Trittbrettchen aus durchsichtigem Kunststoff, die die Techniker scheinbar ohne System in der Diele ausgelegt haben. Der Blutgeruch ist so intensiv, dass ich fast zurückzucke, obwohl er mir so vertraut ist. Das Pochen im Zwerchfell wird stärker. Obwohl ich schon so viele Tatorte besucht, so viele Leichen gesehen habe, sorgt an jedem plötzlichen, gewaltsamen Tod etwas dafür, dass sich mir die Nackenhaare aufstellen. Vielleicht ist es das Wissen, wie schnell es gehen kann. Wie schnell ein Leben ausgelöscht werden kann. Aber ab und zu kann es natürlich auch das Gegenteil sein, was so schwer auszuhalten ist – wenn ein Tatort oder ein Leichnam von einem unerträglich langen Todeskampf zeugt.
Ich nicke den Kriminaltechnikern in den weißen Overalls zu und schaue mich in der Diele um. Die ist überraschend anonym, fast geschlechtslos. Oder vielleicht einfach nur männlich? Das ist wohl fast dasselbe. Jedenfalls, wenn es um Einrichtung geht. Weiße Wände, grauer Boden. Nirgendwo eine Spur von den persönlichen Dingen, die man sonst in einem Eingangsbereich findet: Kleider, Taschen oder Schuhe. Ich trete auf die nächste Plastikplatte und schaue in eine Küche. Schwarzlackierte Schränke, auch sie glänzend. Ein elliptischer Tisch mit Stühlen, die ich aus irgendeiner Einrichtungszeitschrift kenne. Messer, in einer Reihe an der Wand. Ich registriere, dass keines fehlt.
Manfred legt mir die Hand auf den Arm.
»Hier. Komm.«
Ich steige weiter über die Platten, gehe durch den Flur. Vorbei an einem Kriminaltechniker mit Kamera und Notizblock. Ein großer Blutfleck breitet sich unter den Platten aus. Nein, es ist kein Fleck, es ist schon eher ein See. Ein roter, klebriger See aus frischem Blut, der den ganzen hinteren Teil des Raums zu bedecken scheint. Von Wand zu Wand und weiter über die Treppen in den Keller. Aus dem See führen viele unterschiedlich große Fußspuren zur Haustür.
»Verdammt viel Blut«, murmelt Manfred und läuft überraschend geschmeidig weiter, obwohl die Platten unter seinem Gewicht bedrohlich knacken. Ein Schild mit einer Nummer steht neben einem blutigen Kleiderbündel. Ich sehe ein Bein und einen hochhackigen schwarzen Stiefel, und dann den Unterleib einer Frau. Sie liegt auf dem Rücken und hat den Kopf von mir weggedreht. Ich brauche einige Sekunden, bis ich verstehe, dass sie geköpft worden ist, und dass das, was ich zuerst für ein Kleiderbündel hielt, in Wirklichkeit ein Kopf ist, der auf dem Boden liegt. Oder genauer gesagt: Er steht dort, wie aus dem Boden gewachsen.
Wie ein Pilz.
Manfred holt tief Luft und geht in die Hocke. Ich lasse den makabren Anblick auf mich wirken. Nehme ihn in mich auf – das ist wichtig. Die natürliche Reaktion wäre eigentlich, zurückzuweichen, das Entsetzliche nicht anzusehen, aber als Mordermittler habe ich schon vor langer Zeit gelernt, solche Reflexe zu unterdrücken.
Das Gesicht und die braunen Haare der Frau sind vom Blut verklebt. Wenn ich ihr Alter erraten sollte, was nicht so leicht ist bei dem Zustand, in dem sich der Leichnam befindet, dann würde ich sie auf vielleicht fünfundzwanzig schätzen. Ihr Körper ist ebenfalls mit Blut beschmiert, und ich ahne tiefe Wunden an den Unterarmen. Sie trägt einen schwarzen Rock, eine schwarze Strumpfhose und einen grauen Pullover. Unter ihr, blutdurchtränkt, sehe ich eine Stoffjacke.
»O verdammt.«
Manfred nickt und fährt sich über die Bartstoppeln.
»Sie ist enthauptet worden.«
Ich nicke. Gegen diese Feststellung lässt sich nichts einwenden. Es ist ganz klar, dass genau das passiert ist. Man braucht entweder ziemlich viel Kraft oder muss sich viel Mühe geben, um Kopf und Halswirbel von einem Rumpf zu trennen. Das sagt uns etwas über den Täter. Was genau, weiß ich noch nicht, aber das hier hat kein Schwächling getan. Der Mörder war beeindruckend stark. Oder sehr motiviert.
»Wissen wir, wer sie ist?«
Manfred schüttelt den Kopf.
»Aber wir wissen, wer hier wohnt.«
»Nämlich?«
»Jesper Orre.«
Der Name klingt bekannt, wie der eines alternden Sportlers oder eines abgedankten Politikers. Es klingelt irgendwo, aber ich kann mich nicht erinnern, wo ich ihn schon einmal gehört habe.
»Jesper Orre?«
»Ja. Jesper Orre. Der Geschäftsführer von Clothes & More.«
Und dann weiß ich es wieder. Der umstrittene Chef von C&M, der am schnellsten wachsenden Bekleidungskette Nordeuropas. Der Mann, den die Medien leidenschaftlich hassen. Wegen seiner Managementmethoden, wegen seiner Frauengeschichten und wegen seiner ebenso häufigen wie politisch inkorrekten Äußerungen in der Presse.
Manfred seufzt tief und richtet sich auf. Ich folge seinem Beispiel.
»Die Mordwaffe?«, frage ich.
Er zeigt stumm in die Diele. Ganz hinten, neben der Treppe, die vermutlich in den Keller führt, liegt ein großes Messer, oder vielleicht eine Machete. Ich kann es nicht richtig sehen. Daneben ist ein Schild mit der Ziffer Fünf aufgestellt worden.
»Und Jesper Orre, haben wir den schon erreicht?«
»Nein. Offenbar weiß niemand, wo er sich aufhält.«
»Was wissen wir sonst noch?«
»Die Tote wurde von einer Nachbarin entdeckt, die gesehen hatte, dass die Tür offen stand. Wir haben schon mit ihr gesprochen. Sie ist jetzt im Krankenhaus, bekam durch den Schock offenbar Herzprobleme. Egal, sie hat jedenfalls nichts gesehen, was uns weiterhilft. Leider ist sie hier hin und her gelaufen, wir müssen also abwarten, ob die Technik irgendwelche brauchbaren Fußspuren findet. Es gibt auch noch Blut draußen im Schnee. Vermutlich hat der Täter nach dem Mord versucht, sich dort abzuwischen.«
Ich schaue mich um. Der Boden vor der Haustür ist von einem Wirrwarr aus roten Spuren überzogen. An den Wänden im Haus sehe ich Blutspritzer und blutige Handabdrücke. Das Blut erinnert an ein Bild von Jackson Pollock. Es sieht aus, als hätte jemand rote Farbe auf den Boden gegossen, sich darin gewälzt und dann alles noch einmal mit Farbe übersprüht.
»Der Mord scheint auf eine handfeste Prügelei gefolgt zu sein«, sagt jetzt Manfred. »Die Leiche der Frau weist Abwehrspuren an Unterarmen und Händen auf. Die vorläufige Einschätzung des Rechtsmediziners ist, dass sie gestern zwischen drei und sechs Uhr nachmittags gestorben ist. Das Opfer ist eine Frau von etwa fünfundzwanzig Jahren, und die Todesursache waren vermutlich mehrere Stich- und Schnittwunden am Hals sowie der Kopf, der … ja. Das siehst du ja.«
Manfred verstummt.
»Und der Kopf«, sage ich. »Wie ist er da gelandet, so aufrecht? Kann das ein Zufall sein?«
»Rechtsmedizin und Technik sagen, dass der Mörder ihn vermutlich so aufgestellt hat.«
»Ganz schön pervers.«
Manfred nickt und hält meinen Blick mit seinen kleinen braunen Augen fest. Senkt dann die Stimme, als ob niemand sonst im Raum hören soll, was er sagt, warum auch immer. Hier sind doch nur die Kollegen von der Technik.
»Du, das hier hat verdammte Ähnlichkeit …«
»Das ist doch zehn Jahre her.«
»Aber trotzdem.«
Ich nicke. Kann ja nicht abstreiten, dass eine Ähnlichkeit mit dem zehn Jahre zurückliegenden Mord auf Södermalm besteht, den wir niemals aufklären konnten, trotz einer der umfassendsten Ermittlungen in der schwedischen Kriminalgeschichte.
»Wie gesagt, es ist zehn Jahre her. Es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass …«
Manfred macht eine abwehrende Handbewegung.
»Nein. Ich weiß. Sicher hast du recht.«
»Und dieser Orre, der Typ, der hier wohnt, was wissen wir über den?«
»Noch nicht sehr viel, außer dem, was in den Zeitungen gestanden hat. Aber Sanchez ist schon dran. Sie hat versprochen, sich heute Abend zu melden.«
»Und was steht in den Zeitungen?«
»Tja, der übliche Klatsch. Er wird Sklaventreiber genannt. Die Gewerkschaft hasst ihn, und es laufen mehrere Prozesse vor dem Arbeitsgericht. Offenbar ist er auch ein bekannter Frauenheld. Hat jede Menge Affären.«
»Keine Frau? Kinder?«
»Nein, er wohnt allein hier.«
Ich schaue mich in der Diele um, lasse meinen Blick durch die große Küche wandern.
»Braucht man so ein Riesenhaus, wenn man alleine lebt?«
Manfred zuckt mit den Schultern.
»Was heißt schon brauchen. Die Nachbarin, die Frau, die sie ins Krankenhaus gebracht haben, sagt, dass wechselnde Frauen hier gewohnt haben, aber sie habe längst den Überblick verloren.«
Wir gehen wieder hinaus, streifen Schuhüberzüge und Handschuhe ab. Ein paar Meter weiter, neben dem Eingangstor, steht etwas, das wie ein abgebrannter Schuppen aussieht, er ist zum Teil mit Schnee bedeckt.
Manfred steckt sich eine Zigarette an, hustet und dreht sich zu mir um.
»Das hab ich vergessen. Offenbar hat es vor drei Wochen in seiner Garage gebrannt. Die Versicherungsgesellschaft geht der Sache nach.«
Ich sehe die Reste der verkohlten Balken an, die aus dem Schnee ragen, und muss an die Tannen auf dem Friedhof denken. Die gleichen stummen und dunklen Gestalten, die sich vor dem Schnee abzeichnen. Und sie beschwören dasselbe beunruhigende Gefühl von Tod und Vergänglichkeit herauf.
Als ich in die Stadt zurückfahre, denke ich wieder an Janet. Etwas an den allerbrutalsten Verbrechen, an den schlimmsten Grausamkeiten, erinnert mich immer an sie. Ich vermute, es liegt daran, dass Janet mich aus dem Gleichgewicht geworfen hat, genau wie solche Verbrechen es tun. Oder daran, dass ich auf irgendeiner primitiven, unterbewussten Ebene ab und zu wünsche, sie wäre tot, wie die Frau in dem weißen Haus. Natürlich wünsche ich ihr nicht wirklich den Tod, sie ist doch Albins Mutter, aber das Gefühl ist trotzdem da.
Mein Leben war so unendlich viel einfacher, als wir uns noch nicht kannten.
Janet arbeitete in einem Café in der Nähe der Wache auf Kungsholmen. Wir grüßten uns immer, wenn ich hereinschaute. Ab und zu, wenn nicht so viele Gäste da waren, setzte sie sich einen Moment zu mir. Lud mich zum Kaffee ein und wir redeten ein bisschen. Sie hatte kurze, blondierte und punkige Haare und eine Lücke zwischen den Vorderzähnen, die ziemlich charmant war, vielleicht wurde sie dadurch ein bisschen entstellt, ich bin nicht sicher, aber es war etwas, auf das ich meinen Blick richten, ein fester Punkt, den ich fixieren konnte, wie die an die Wand gemalte Fliege in einem Pissoir. Außerdem hatte sie fantastische Titten. Ich hatte natürlich schon vor ihr Freundinnen gehabt. Viele sogar, aber keine ernsthafte Beziehung. Sie kamen und gingen, ohne bei mir einen tieferen Eindruck zu hinterlassen. Ich glaube auch nicht, dass ich in deren Leben einen tieferen Eindruck hinterlassen hatte.
Aber Janet war anders. Sie war starrköpfig, verdammt starrköpfig. Ich glaube, wir waren vielleicht drei- oder viermal essen gewesen und ungefähr genau so oft im Bett gelandet, und schon wollte sie unbedingt mit mir zusammenziehen. Natürlich sagte ich Nein. Ich wollte nicht mit ihr zusammenwohnen, und Janets ewiges Geplapper über alles und nichts ging mir schon damals auf die Nerven. Ich ertappte mich immer öfter dabei, wie ich mir wünschte, dass sie einfach mal die Klappe hielt. Aber ab und zu, wenn sie schlief, nackt in meinem schmalen Bett, dann fand ich sie unbeschreiblich schön. Stille und Schweigen standen ihr so viel besser als ihr ewiges Gerede. Ich hatte mir damals gewünscht, sie könnte immer so sein. Aber das ist natürlich ein unmöglicher Wunsch. Man kann seine Freundin nicht bitten, stumm und nackt zu sein.
Jedenfalls nicht immer.
Anfangs plapperte sie vor allem über Kleinigkeiten wie Urlaubsreisen. Sie konnte mit der Tasche voller Reisebroschüren nach Hause kommen und sich einen ganzen Abend lang in die Suche nach dem besten Urlaubsort vertiefen. Mallorca oder Ibiza. Die Kanarischen Inseln oder Gambia. Rhodos oder Zypern. Es konnte darum gehen, wo das beste Wetter war, welches Essen am besten schmeckte oder wo man die spannendsten Dinge kaufen konnte.
Am Ende fuhren wir dann tatsächlich in Urlaub, und das war eigentlich gar nicht so schlimm. In dem Dorf an der Ostküste von Mallorca gab es nicht viel zu tun, und Janet saß im Bikini da und las fast die ganze Woche Ayla und der Clan des Bären, was bedeutete, dass sie immerhin stumm war. Und fast nackt.
Und dann hatten wir ja Sex.
Der Sex mit ihr war fantastisch, das kann ich nicht leugnen. Vielleicht halfen uns auch Wein und Sangria dort unten in der Wärme auf die Sprünge. Ab und zu ertappte ich mich bei dem Gedanken, dass ihr Verhalten im Bett fast etwas Männliches hatte. Diese anspruchsvolle, unersättliche Lust, die sofortige Befriedigung verlangte, und das auf fast egoistische Weise. Sie nahm sich, was sie haben wollte, und das war gerade ich, mein Körper. Und vielleicht kam es manchmal vor, in der Hitze des Augenblicks, dass ich ernsthaft mit dem Gedanken an ein Leben mit ihr spielte. Vielleicht sagte ich das auch. Ich erinnere mich nicht mehr.
Es gibt so vieles, woran man sich nicht erinnert.
Aber kaum waren wir wieder zu Hause, fing sie erneut an mit einer gemeinsamen Wohnung. Ich erklärte ihr ziemlich klar und deutlich, dass ich noch nicht bereit sei, mit ihr zusammenzuziehen, aber sie schien das einfach nicht zu begreifen. Wie immer war sie auf ihr Ziel konzentriert, und das Ziel waren eine Wohnung und eine Familie. Und hätte es mir nicht ebenso gehen sollen, ich war doch schon dreiunddreißig?
Sie ließ sich noch dazu meinen Namen auf den Rücken tätowieren, »Peter«, auf eine von zwei Tauben getragene Schleife. Das war mir peinlich, obwohl ich nicht so genau wusste, warum. Eine Tätowierung ist doch für die Ewigkeit, und bei der Vorstellung, die Ewigkeit zusammen mit Janet zu verbringen, lief es mir eiskalt den Rücken runter.
Zu dieser Zeit fing ich dann an, als Ermittler bei der Kriminalpolizei zu arbeiten, und es lag in der Natur der Sache, dass ich sehr viel zu tun hatte. Ich nahm damals jeden Fall sehr ernst, glaubte wirklich, dass ich half, die Welt besser zu machen. Dass es überhaupt möglich sei, zu ergründen, wie die aussehen sollte.
Eine bessere Welt?
Jetzt, fünfzehn Jahre später, weiß ich, dass sich nie etwas verändert. Ich habe eingesehen, dass die Zeit nicht geradlinig verläuft, sondern eher in Kreisen. Das klingt vielleicht hochgestochen, ist im Grunde aber banal. Die Zeit ist ein Kreis, wie ein Ring aus Würsten. Es gibt keinen Grund, lange darüber nachzudenken. So ist es einfach: neue Morde, neue Polizisten, die sich mit einem romantischen Bild von dieser Arbeit in ihre Aufgaben stürzen. Neue Täter, die von noch neueren Verbrechern ersetzt werden, sobald sie im Gefängnis sitzen.
Es nimmt nie ein Ende.
Die Ewigkeit ist eine Kette aus Würsten. Und Janet wollte sie mit mir teilen.
Ich denke oft, dass ich zu Beginn unserer Beziehung standhafter war. Denn damals wehrte ich mich gegen ihre Einfälle. Aber mit der Zeit wurde mein Widerstand zersetzt, vielleicht änderte ich auch meine Abwehrtechnik. Ich wich immer öfter aus. Antwortete: »Vielleicht können wir nächstes Jahr zusammenziehen«, wenn sie die Frage zur Sprache brachte. Fand dann seltsame Makel an allen Wohnungen, die ich mit ihr besichtigen musste: zu weit unten, zu weit oben (Stell dir vor, es brennt!), zu weit von der Stadt entfernt, zu zentral (Laut!), oder was auch immer.
Janet sah immer niedergeschlagen aus, wenn wir von solchen Besichtigungen kamen. Schaute stumm den Asphalt an, und der lange blonde Pony hing wie ein Vorhang vor ihren Augen. Sie drückte sich die Handtasche an die Brust wie einen Schild. Kniff die Lippen zu einem dünnen, blutlosen Strich zusammen.
Janet kannte alle Tricks. Wusste, dass die Schuldgefühle, die sie hervorrief, mich noch schwächer und umgänglicher machen würden. Ab und zu fragte ich mich, wo sie das alles gelernt haben könnte, wie eine so junge Frau schon so geschickt im Manipulieren sein konnte.
Vielleicht war es meine Erfahrung aus meiner Beziehung zu Janet, die dafür sorgte, dass ich von Manfred so fasziniert war, als wir dann einige Jahre darauf anfingen, zusammenzuarbeiten. Obwohl er einen fast komischen Eindruck machte – zum Teil wegen seines Äußeren und seiner unverblümten Sprache –, schien er eine innere Stärke zu haben, die ich sofort bewunderte. Nach nur zwei Tagen nahm er mich beiseite und erklärte, er werde sich scheiden lassen, und das sollte ich doch wohl wissen, da es seine Arbeitssituation beeinflussen könnte.
Manfred war damals mit Sara verheiratet und sie hatten drei Kinder im Teenageralter. Ich weiß noch, dass ich fragte, was Sara denn dazu sagte, und dass Manfred antwortete: »Das spielt keine große Rolle, ich bin ja entschlossen.« Etwas an dieser Aussage gab mir das Gefühl, als seien Ameisen in meinem Kopf freigelassen worden. Er hatte diesen Entschluss also ganz allein gefasst, und er wollte die Scheidung durchsetzen, egal, was Sara davon hielt.
Ich verstand das eigentlich.
Zugleich wurde ich nervös. Denn ich hatte Angst, dass Manfred, der offenbar klarsichtig und stark war, mich durchschauen würde. Und meine Schwäche sehen würde, meine Ambivalenz und meinen Widerwillen dagegen, mich zu binden. Schlechte Eigenschaften, von denen ich gelernt hatte, dass man sie lieber verstecken sollte. Eigenschaften, die stanken, wenn sie an die Oberfläche kamen, wie Abfälle, die in einem Fluss treiben.
Einige Jahre später erzählte ich Manfred die Sache mit der Hochzeit. Zuerst machte er ein überraschtes Gesicht, als habe er nicht richtig verstanden, was ich gesagt hatte, dann lachte er. Er lachte und lachte, bis ihm Tränen über seine runden, geröteten Wangen liefen und sein Doppelkinn bebte. Er lachte, bis er fast auf dem Boden lag.
Man kann vieles über Manfred sagen, aber er besitzt die Fähigkeit, das Leben von der lichten Seite zu betrachten.
Es ist dunkel, als ich die Wache auf Kungsholmen erreiche. Es scheint auch kälter geworden zu sein, denn statt des Schneeregens fallen große flaumige Schneeflocken über die Polhemsgata. Wenn die Wache nicht so verdammt hässlich wäre, könnte das alles ein schöner Anblick sein, aber hier dominieren die riesigen Häuser im Stil der postindustriellen Brutalarchitektur, die in den sechziger Jahren so dermaßen en vogue war. Vierecke aus Licht, die sich an der Fassade abzeichnen, verraten, dass dort Kollegen arbeiten, dass es im Kampf gegen die Verbrecher nie eine Pause gibt. Nicht einmal an einem Freitagabend kurz vor Weihnachten. Und schon gar nicht, wenn eine junge Frau brutal ermordet worden ist.
Auf der Treppe zum dritten Stock begegnet mir Sanchez.
»Du siehst müde aus«, sagt sie.
Sie trägt eine cremefarbene Seidenbluse und eine schwarze Hose, und damit sieht sie genau wie die Schreibtischpolizistin aus, die sie auch ist. Sie hat die dunklen Haare hochgesteckt und ich sehe, dass sie im Nacken tätowiert ist. Ich glaube, mit einer Schlange, die sich vom Rücken zum linken Ohr hochwindet, als zupfe sie ihr am Ohrläppchen.
»Du siehst auch nicht so toll aus«, sage ich.
Sie lacht betont fröhlich und ich weiß sofort, dass ich für diesen Kommentar noch büßen werde.
»Ich habe einiges über Jesper Orre in Erfahrung gebracht. Ich habe das Material bei Manfred abgegeben.«
»Danke«, sage ich und gehe weiter die Treppe nach oben.
Als ich hereinkomme, trinkt Manfred vor seinem Rechner Tee und winkt mir zu, macht ein Zeichen, dass ich mich setzen soll. Auf dem Schreibtisch stehen Bilder seiner jungen Frau Afsaneh und ihrer bald ein Jahr alten Tochter Nadja.
»Was gegessen?«, fragt er.
»Keinen Hunger. Danke.«
»Na. Ist auch nicht so leicht nach dem Anblick.«
Ich denke an den Kopf in der Blutlache. An alles Seltsame, was die Menschen einander antun, manchmal scheinbar ohne irgendeinen Grund, und in anderen Fällen aus Rache in Fehden, die schon seit Generationen fortgesetzt werden und sich immer wieder erneuern. Mir fällt eine Sendung ein, die ich vor einigen Monaten gesehen habe, es ging um die Frage, ob der Mensch ein friedliches oder ein mörderisches Tier ist. Ich fand die Frage an sich schon merkwürdig. Es kann doch kein Zweifel daran bestehen, dass der Mensch das gefährlichste Tier auf diesem Planeten ist, weil wir doch andauernd jagen und töten, und zwar nicht nur andere Arten, sondern auch unsere eigene. Der Firnis der Zivilisation ist so dünn und künstlich wie der schrille Nagellack, den Janet so gern benutzte.
»Irgendwas über Jesper Orre rausgefunden?«
Manfred nickt und fährt mit einem wohlgenährten Finger über den vor ihm liegenden Text.
»Jesper Andreas Orre. Fünfundvierzig Jahre alt. In Bromma geboren und aufgewachsen.«
Manfred legt eine Pause ein und greift nach seiner Lesebrille, während ich überlege. Fünfundvierzig Jahre, also vier Jahre jünger als ich, und hat vielleicht einen bestialischen Mord begangen. Oder er ist auch ein Opfer, das wissen wir noch nicht, wenngleich die Statistik annehmen lässt, dass er in das Verbrechen verwickelt ist. Denn die einfachste Erklärung ist oft die, die sich am Ende auch als die richtige erweist.
Manfred räuspert sich. Fügt hinzu:
»Arbeitet seit zwei Jahren für die Kette Clothes & More. Er ist … sagen wir, umstritten. Ganz einfach unbeliebt, weil er hart zupackt. Er hat offenbar Leute entlassen, weil die bei ihrem kranken Kind zu Hause geblieben sind und sowas. Behauptet jedenfalls die Gewerkschaft. Es laufen gerade etliche Prozesse vor dem Arbeitsgericht. Er hat im vergangenen Jahr vor Abzug der Steuern 4 378 000 Kronen verdient. Nicht vorbestraft, nie verheiratet. Wird oft in den Medien erwähnt, vor allem in der Klatschpresse, und dann geht es meistens um seine Frauengeschichten. Sanchez hat mit seinen Eltern und seiner Sekretärin gesprochen, keiner hat seit gestern was von ihm gehört. Aber am Freitag hat er wie immer gearbeitet und total normal gewirkt.«
Manfred zeichnet mit den Fingern Anführungszeichen in die Luft, als er das Wort normal sagt, und erwidert meinen Blick über den Brillenrand hinweg.
»Irgendwelche Beziehungen?«
»Den Eltern nach nein. Und die Sekretärin sagt, dass er sein Privatleben für sich behält, seit die Medien über ihn schreiben. Wir haben die Adressen einiger seiner Freunde, und Sanchez wird sich da mal umhören.«
»Und was war mit diesem Brand?«
»Eben. Der Brand.« Manfred blättert wieder in seinem Papierstapel. »Jesper Orre hat sich gerade eine Garage gebaut, aber vor drei Wochen ist sie abgebrannt, außerdem zwei Autos, die ihm gehörten. Offenbar ziemlich teure Autos. Ein … mal sehen … MG und ein Porsche. Die Versicherungsgesellschaft ist noch dabei festzustellen, ob es Brandstiftung war. Sanchez wird auch mit ihnen reden.«
Ich schaue aus dem Fenster. Der Schnee fällt jetzt dichter, man kann fast gar nichts mehr sehen. Manfred sieht meinen Blick.
»Bald«, sagt er. »Ich muss auch nach Hause. Nadja hat eine Ohrenentzündung.«
»Schon wieder?«
»Du weißt doch, wie das in dem Alter ist.«
Ich nicke, denke aber, dass ich das eigentlich nicht weiß. Albin ist schon so lange nicht mehr klein, und als er das noch war, habe ich ihn fast nie gesehen. Ohrenentzündung, Kotzgrippen – von alldem habe ich nichts mitbekommen.
»Du«, sagt Manfred. »Es kann ja wohl nicht schaden, noch mal in der alten Ermittlung zu stöbern. Die Herangehensweise ist so ähnlich, dass wir das nicht ignorieren dürfen. Ich kann ein bisschen mit denen reden, die damals dabei waren. Vielleicht auch diese Hexe noch mal ausgraben. Wie hieß sie doch gleich? Hanne?«
Ich drehe mich langsam zu Manfred um. Achte genau darauf, meine Gefühle nicht zu verraten, ihn nicht eine Sekunde lang verstehen zu lassen, welche Wirkung dieser Name auf mich ausübt. Wie die Erinnerungen hervorbrechen, sich in jeder Zelle meines Körpers ausbreiten.
Hanne.
»Nein«, sage ich, vielleicht ein wenig zu schrill, ich weiß nicht. Ich habe meine Stimme nicht mehr unter Kontrolle. »Nein, zu der brauchen wir wirklich keinen Kontakt aufzunehmen.«
EMMA Zwei Monate früher
»Shit, was für ein Riesendiamant!«
Olgas magere Finger reißen mir den Ring aus der Hand und halten ihn ins Licht, als wollte sie überprüfen, ob er echt ist.
»Sehr schön«, stellt sie fest und reicht ihn mir zurück. »Der hat sicher gekostet?«
»Das war ein Geschenk. Danach fragt man doch nicht.«
»Nein?«
»Nein. Das tut man einfach nicht.«
Es wird still.
»Dann erzähl«, sagt Mahnoor. »Wer ist der Prinz?«
»Ich kann nicht …«
»Ach«, Mahnoor schnaubt. »Ihr seid doch jetzt verlobt. Dann kann es doch nicht mehr so geheim sein.«
Ein dicker schwarzer Zopf hängt über ihre Schulter. Um die Augen hat sie einen fetten Kajalstrich gezogen.
»Es ist kompliziert«, beginne ich.
»Meine Tante war mit einem Vetter zusammen. Zehn Jahre lang haben sie das niemandem erzählt«, wirft Olga hilfsbereit dazwischen. »Dann hatten sie sogar zwei Kinder. Das war kompliziert. Aber richtig …«
»Glaubt mir. Es ist kein Verwandter. Es ist nicht so eine Inzestkiste. Es ist nur … kompliziert.«
»Wie bei Facebook? It’s complicated.«
Olga lacht vielsagend.
Es wird still, und der Kühlschrank in der kleinen Teeküche springt mit einem Seufzer an. Ich kann die Neugier meiner Kolleginnen verstehen. Ich würde genauso reagieren. Aber das hier ist anders. Das hier ist eine außergewöhnliche Situation. Es wäre falsch und verantwortungslos von mir, es zu erzählen, vor allem Olga und Mahnoor. Es könnte Jesper und dadurch auch mir selbst schaden.
Außerdem habe ich es versprochen.
Olga fegt die Brotkrümel auf dem Tisch zusammen und zeichnet mit ihren langen weißen Acrylnägeln Muster hinein.
»Ich verstehe das nicht, warum so geheim«, quengelt sie. »Es wäre anders, wenn er verheiratet wäre, aber jetzt seid ihr doch verlobt. Also könntest …«
Mahnoor hebt die Hand.
»Sie will es nicht erzählen. Das musst du einfach respektieren.«
»Danke«, sage ich lautlos, Mahnoor lächelt mich an und wirft den Zopf in den Rücken. Olga presst ihre dünnen Lippen aufeinander und verdreht die Augen.
»Von mir aus.«
Es wird wieder still. Mahnoor räuspert sich.
»Wie war die Beerdigung deiner Mutter, Emma? Ging das gut?«
Mahnoor. Immer so behutsam und fürsorglich. Sanfte Stimme und Worte, die langsam hervorkommen, vorsichtig. Wie kleine weiche Liebkosungen auf der Haut. Ich schiebe den Ring zurecht. Hole Luft.
»Es war schön. Nicht viele Leute, nur die nächsten Angehörigen.«
In Wirklichkeit waren in der kleinen Kapelle nur fünf Personen gewesen. Zwei einsame Kränze lagen auf dem schlichten Holzsarg. Der Organist spielte Choräle, obwohl ich wusste, dass Mama Choräle und Gebete verabscheut hatte. Im Tod wie im Leben muss man sich der Tradition beugen, denke ich.
»Und wie fühlst du dich jetzt?«
Mahnoor sieht besorgt aus.
»Geht schon.«
Die Wahrheit ist, dass ich nicht so recht weiß, wie es mir geht, aber auch das kann ich nicht richtig erklären. Die Situation ist so unwirklich, ich kann nicht begreifen, dass Mama tot ist, dass ihr großer, dicker Leib in diesen Sarg eingepfercht ist. Dass jemand sie angezogen, ihre brüchigen, grell blondierten Haare gekämmt und sie dort hineingelegt hatte. Dass der Deckel geschlossen und zugenagelt worden war, oder was immer man in einem solchen Fall macht.
Was müsste ich denn jetzt empfinden?
Verzweiflung, Trauer? Erleichterung? Meine Beziehung zu Mama war gelinde gesagt kompliziert; nachdem sie angefangen hatte, rund um die Uhr zu trinken, wie eine meiner Tanten das nannte, hatten wir nicht mehr viel Kontakt.
Und jetzt das hier mit Jesper. Mitten in allem Elend schenkt er mir den Ring, sagt, dass er mit mir zusammenleben will. Ich schaue den Diamanten an, der an meinem Finger funkelt, denke, egal, was passiert ist, den kann mir niemand wegnehmen. Ich bin es wert, ich habe es verdient.
Die Tür wird lärmend aufgeschlagen.
»Wie oft muss ich euch noch sagen, dass ihr mich im Laden nicht allein lassen dürft? Ihr sitzt hier rum und raucht, während ich …«
»Wir rauchen nicht«, fällt ihm Olga mit scharfer Stimme ins Wort und fährt sich mit der Hand durch die langen, dünnen Haare.
Ihr Widerspruch überrascht mich. Sich gegen Björne zu wehren, rächt sich meistens. Er erstarrt, reckt seinen langen schmalen Körper und bohrt die Hände tief in die Taschen seiner Jeans, die gerade in diesem perfekten Stadium der Verschlissenheit ist, und genau so weit über dem Hintern hängt, wie sie das tun soll. Dann wippt er in seinen Cowboystiefeln auf und ab, starrt Olga an und hebt das Kinn, was seinen Unterkiefer noch weiter vorstehen lässt als sonst. Er sieht aus wie ein Fisch, denke ich. Ein fieser Fisch, der im trüben Wasser auf der Lauer liegt und auf seine Beute wartet. Die dunklen, verfilzten Haare fallen weit über seinen Hals bis auf die Schultern hinunter, als er den Kopf in den Nacken wirft.
»Hab ich etwa um deine Meinung gebeten, Olga?«
»Nein, aber …«
»Na also. Dann schlage ich vor, du hältst die Klappe und kommst raus und hilfst mir, die Jeans auszuzeichnen, statt hier rumzusitzen und deine neuen russischen Nägel zu bewundern.«
Er dreht sich um und knallt die Tür zu.
»Schwanz!«, sagt Olga, die auch nach zehn Jahren in Schweden nicht immer das passende Schimpfwort für jede Gelegenheit findet.
»Wir gehen wohl lieber raus«, sagt Mahnoor und steht auf, zupft ein wenig an ihrer Bluse, wie um sie glattzustreichen, und öffnet die Tür.
Auf dem Weg nach Hause kaufe ich ein. Jesper isst gern Fleisch, und heute Abend wollen wir feiern – also gibt es Rinderfilet, die teure Biosorte, obwohl ich mir das eigentlich gar nicht leisten kann. Ich kaufe Salat, Kirschtomaten und Ziegenkäse, um Schnittchen zu überbacken. Im Alkoholladen zögere ich lange vor den Regalen. Streiche mit der Hand über die dickbauchigen Flaschen, die in den Fächern hab Acht stehen. Mit Wein kenne ich mich nicht besonders gut aus, aber wir trinken immer roten, und Jesper liebt südafrikanische Weine, deshalb entscheide ich mich endlich für einen Pinotage für fast hundert Kronen.
Als ich über den Valhallaväg nach Hause gehe, ist es dunkel geworden. Ein kalter Wind kommt von Norden, und kleine harte Regentropfen peitschen in mein Gesicht. Ich schaue die nasse schwarze Fahrbahn an und laufe das letzte Stück zur Haustür.
Das Haus wurde 1925 gebaut und liegt genau am Einkaufszentrum Feltöversten auf Östermalm in Stockholm. Eine meiner Tanten hat bis zu ihrem Tod vor drei Jahren hier gewohnt. Aus irgendeinem unerfindlichen Grund habe ich die Wohnung geerbt, was in der Familie ziemliches Aufsehen erregt hat. Warum sollte ich, Emma, die Agneta nicht einmal nahegestanden hatte, ihre Wohnung mitten in der Stadt erben? Wie hatte ich mir dieses Erbe erschlichen? Ganz unlogisch war das aber nicht. Tante Agneta hatte keine eigenen Kinder, und wir hatten durchaus ab und zu Kontakt gehabt. Meine Tanten trafen sich gelegentlich, fest entschlossen, ihr dysfunktionales Matriarchat fortleben zu lassen, und manchmal war ich eben auch dabei.
Ich schließe die Tür auf und drücke auf die Messingklinke. Ein vertrauter Geruch nach Toast und Reinigungsmittel schlägt mir entgegen. Und dann noch etwas anderes, etwas irgendwie Widerliches, das ich nicht identifizieren kann. Etwas Organisches und Bekanntes. Vorsichtig stelle ich meine Tüten auf den Boden, knipse die Lampe in der Diele an und streife meine nassen Schuhe ab. Meinen Mantel hänge ich über einen Kleiderbügel, und danach hole ich ein Handtuch und wische vorsichtig die Regentropfen ab.
Auf dem Boden liegen drei Briefumschläge. Rechnungen. Ich hebe sie auf und gehe damit in die Küche. Lege sie auf den Stapel zu den anderen Rechnungen und Mahnungen. Der Stapel ist beunruhigend hoch und ich nehme mir vor, mit Jesper über das Geld zu sprechen. Vielleicht nicht gleich heute Abend, aber bald. Ich kann die Rechnungen nicht einfach nur sammeln. Irgendwann müssen sie auch bezahlt werden.
Ich rufe Sigge und nehme das Katzenfutter aus dem Schrank. Sobald er die Tür quietschen hört, ist er da. Drückt sich an meine Waden. Ich bücke mich, streichele sein schwarzes Fell, rede ein wenig mit ihm und gehe dann ins Wohnzimmer.
Meine Wohnung ist spärlich möbliert. Die Carl-Malmsten-Sessel habe ich auch von Tante Agneta geerbt. Den kleinen Ausklapptisch und die Stühle in der Diele habe ich übers Internet gekauft, und das Bett ist von Ikea. Ich habe auch einen Schreibtisch, den ich gebraucht gekauft habe. Er ist bedeckt mit Büchern und roten Notizblöcken. Neben meinem Job im Laden versuche ich, das Gymnasium fertig zu machen. Den naturwissenschaftlichen Zweig. Ich habe die Schule abgebrochen. In meinem Leben waren Dinge passiert, die dafür gesorgt hatten, dass ich nicht büffeln konnte und nicht büffeln wollte, obwohl mir das Lernen immer leichtgefallen war. Vor allem Mathe. Die Welt der Ziffern hat etwas Befreiendes. Es gibt keine Grauzonen, keinen Raum für Subjektivität oder Deutungen; entweder rechnest du richtig oder falsch.
Ich wünschte, alles im Leben wäre einfach.
Eine Sekunde lang denke ich an Nagel, seine langen schwarzen Haare, die er im Nacken zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte. Seine Gewohnheit, sich die Hand an die Wange zu legen, wenn er zuhörte – denn er schien immer mit einer erstaunlichen Intensität zu lauschen. Als ob wir alle etwas wirklich Wichtiges zu sagen hätten. Und vielleicht hatten wir das ja. Ich schüttele diese Erinnerung ab und gehe ins Wohnzimmer.
Eines Tages werde ich nicht mehr an Nagel denken, rede ich mir ein. Eines Tages wird die Erinnerung an ihn verblassen wie ein altes Polaroidfoto, und ich werde weitergehen, als ob es ihn niemals gegeben hätte.
Einen wertvollen Gegenstand gibt es in meiner Wohnung – das Bild von Ragnar Sandberg, das im Wohnzimmer hängt. Eine Komposition von Fußballspielern in Gelb und Blau, im Stil naiver Malerei. Ich liebe dieses Bild sehr. Mama meinte oft, ich sollte es verkaufen, dann könnten wir das Geld teilen und sie könnte ihren Anteil versaufen, aber ich weigerte mich. Ich finde es schön, es an der Wand zu haben, dort, wo es immer schon gehangen hat.
Tante Agneta hat mir auch etwas Geld hinterlassen. Hunderttausend, genauer gesagt. Sorgfältig eingewickelte Packen von Hundertern, die ich im Bettzeug im Wäscheschrank fand. Ich habe Mama das nie erzählt. Ich wusste nur zu gut, wie sie reagieren würde.
Ich gehe ans Fenster und schaue hinaus.
Fünf Stockwerke unter mir streckt sich der Valhallaväg aus wie eine riesige schwarze Ader, die den Verkehr zum Lidingöväg und ins Zentrum führt, ein Teil von Stockholms gewaltigem Blutkreislauf. Der Regen ist stärker geworden. Er trommelt gegen mein Fenster, das trüb anläuft. Es ist kalt, fast unter null, denke ich und fröstele.
Ich packe meine Einkäufe aus, schneide den Ziegenkäse und verteile ihn auf Schnittchen. Schalte den Backofen ein und bereite den Salat vor. Dann dusche ich. Spüre, wie das heiße Wasser über meinen Körper strömt. Atme den heißen Dampf ein. Wasche jeden Zentimeter meiner Haut mit der Duschcreme, die er so gern riecht. Meine Brüste fühlen sich wund und geschwollen an, als ich sie massiere. Ich strecke die Hand nach dem Shampoo aus, wasche mir die Haare und steige dann aus der altmodischen Sitzbadewanne.
Der Raum ist voller Wasserdampf, ich öffne die Tür einen Spaltbreit, wische den Spiegel mit einem Handtuch ab und beuge mich vor. Mein Gesicht sieht geschwollen und ein bisschen rot aus. Die Sommersprossen zeichnen sich deutlich auf der bleichen Haut ab, wie hunderte von Inselchen, die einfach so im Meer verstreut worden sind. Einige sind größer, andere kleiner. Manche drängen sich zusammen und bilden auf dem blassen Meer unregelmäßige kleine Kontinente aus rotbrauner Haut.
Vorsichtig fange ich an, meine langen braunroten Haare mit einem grobzinkigen Kamm auszukämmen. Untersuche meine Brüste. Sie sind groß, zu groß für meinen Körper, mit breiten hellrosa Warzenhöfen. Ich habe sie immer gehasst, schon seit die widerlichen kleinen Ausbeulungen anfingen, sichtbar zu werden, wie Eiterbeulen unter meiner blassen Haut. Ich habe alles versucht, um sie zu verstecken: habe weite Pullover getragen und den Rücken gekrümmt. Zu viel gegessen.
Jesper sagt, dass er meine Brüste liebt, und ich glaube ihm. Er liegt zwischen meinen Beinen, streichelt sie wie Hundebabys und redet liebevoll zuerst mit der einen und dann mit der anderen. Ich denke, dass Liebe nicht nur bedeutet, einen anderen Menschen zu lieben, sondern sich auch mit den Augen der geliebten Person zu sehen. Schönheit zu entdecken, wo man vorher nur Fehler und Mängel finden konnte.
Sorgfältig schminke ich mich. Jesper mag es nicht, wenn ich zu viel Schminke trage, was aber nicht bedeutet, sie ganz wegzulassen, es bedeutet nur, dass ich ungeschminkt aussehen soll. Es dauert länger, den richtigen ungeschminkten Look hinzukriegen, als sich das die meisten vorstellen können. Als ich fertig bin, verteile ich Parfüm auf allen strategisch wichtigen Stellen, auf den Handgelenken, zwischen den Brüsten, im Nacken. Ein wenig auch an den Leisten. Dann ziehe ich das schwarze Kleid an, ganz ohne Unterwäsche, trockne mir die Füße sorgfältig an der Badezimmermatte ab und gehe hinaus.
Jesper kommt immer pünktlich, deshalb hätte ich die Schnittchen fast schon um sieben in den Backofen geschoben, aber sie brauchen nur einige Minuten, ich warte also doch besser noch einen Moment. Der Regen trommelt noch immer kräftig gegen die schwarze Fensterscheibe. Irgendwo höre ich Sirenen, dann werden sie leiser. Ich zünde die Kerzen auf dem Tisch an. Der Luftzug, der durch die alten undichten Fenster kommt, lässt sie flackern, und die Schatten im Zimmer erwachen zum Leben, scheinen sich zu bewegen. Wogend zeichnen sie sich an den abgenutzten Schranktüren und dem Tisch ab. Eine Sekunde lang scheint der ganze Raum zu schwanken, und plötzlich wird mir schlecht.
Ich kneife die Augen zusammen, packe einen Stuhlrücken.
Denke an ihn.
Jesper Orre. Natürlich hatte ich von ihm gehört, sein Bild im Fernsehen und in den Klatschzeitschriften gesehen. Und natürlich wurde bei der Arbeit über ihn gesprochen. Der Geschäftsführer des Unternehmens war nicht unumstritten, weder geschäftlich noch in anderer Hinsicht. Er war so eine Art bad boy der Modebranche, und er galt als harter Hund und skrupelloser Geschäftsmann. Bei seinem Amtsantritt feuerte er innerhalb eines Monats den gesamten Vorstand und ersetzte alle durch seine eigenen Leute. Dann kamen die Veränderungen Schlag auf Schlag. Zwanzig Prozent der Angestellten wurden entlassen. Neue Direktiven für den Umgang mit der Kundschaft wurden ausgegeben. Eine strengere Kleiderordnung für das Personal eingeführt. Kürzere Mittagspause. Nicht so viele kleine Pausen zwischendurch.
Als er an dem Tag im Mai den Laden betrat, hätte ich ihn fast nicht erkannt. Seine ganze Erscheinung hatte etwas Verwirrtes. Er stand mitten in der Herrenabteilung und drehte sich langsam um, wie ein Kind, das mitten in einer Zirkusmanege steht und sein Publikum aus großen Augen mustert. Ich ging zu ihm und fragte ihn, wie ich ihm behilflich sein könnte. Das ist meine Aufgabe, und die Firma hat Handbücher mit vorgedruckten Fragen, die wir Angestellten einüben sollen – noch eine von Jespers Ideen, die bei der Gewerkschaft überhaupt nicht gut ankamen.
Er drehte sich zu mir um, noch immer dieser verwirrte Gesichtsausdruck, fuhr sich mit der Hand verlegen über die Hemdbrust und zeigte auf einen großen orangeroten Fleck.
»Ich habe in einer halben Stunde Vorstandssitzung«, sagte er, wich weiterhin meinem Blick aus und schaute sich im Laden um. »Ich brauche ein neues Hemd.«
»Spaghetti bolognese?«
Er erstarrte, die Andeutung eines Lächelns huschte über sein sonnengebräuntes Gesicht. Dann erwiderte er meinen Blick, und in diesem Moment erkannte ich ihn. Zum Glück schaute er schnell wieder weg, denn ich spürte seine Nähe plötzlich so deutlich, so greifbar, dass ich gar nicht wusste, was ich tun sollte. Und er ließ mich in diesem Schweigen allein, konnte mit der Situation überhaupt nicht umgehen.
Einige Sekunden vergingen. Dann riss ich mich zusammen.
»Welche Größe?«
Er schaute mich wieder an und nun bemerkte ich, dass er müde aussah. Dunkle Ringe unter den Augen, breite graue Streifen an den Schläfen, eine traurige Furche zog einen Mundwinkel nach unten, ließ das Gesicht fast bitter wirken. Er sah älter aus als auf den Bildern. Älter und müder.
»Größe?«
»Ja, Ihre Hemdengröße.«
»Entschuldigung, natürlich. Dreiundvierzig.«
»Und welche Farbe hätten Sie gern?«
»Ich weiß nicht. Weiß vielleicht. Etwas Neutrales. Etwas Passendes für eine Vorstandssitzung.«
Er kehrte mir den Rücken zu und sah sich im Laden um. Ich holte drei Hemden, von denen ich annahm, dass sie ihm passen könnten. Als ich zurückkam, stand er noch immer mitten im Raum.
»Meinen Sie denn, Sie könnten mir einen guten Rat geben?«, fragte er.
»Natürlich.«
Das war keine seltsame Frage, es gehörte zur Arbeit, der Kundschaft bei der Auswahl der passenden Kleidung zu helfen. Ich wartete vor der Umkleidekabine, bis er im ersten Hemd herauskam, dem weißen.
»Geht das?«
»Absolut. Das sitzt perfekt. Aber probieren Sie auch die anderen an.«
Die Schwingtür der Umkleidekabine schloss sich lautlos. Zwei Minuten später kam er im nächsten Hemd heraus, einem blauweiß gestreiften mit Button-Down-Kragen.
»Hm.«
»Das gefällt Ihnen nicht?«
Er sah plötzlich so besorgt aus, dass ich fast losgelacht hätte.
»Doch, schon, aber nicht für eine Vorstandssitzung. Dann nehmen Sie vielleicht etwas … Formelleres.«
Er nickte, als wäre er bereit, dem kleinsten Wink zu gehorchen, und verschwand wieder in der Umkleidekabine.
»Soll ich auch das dritte anprobieren, was meinen Sie?«, fragte er von drinnen.
»Das sollten Sie unbedingt.«
Jetzt fand ich die Situation lustig. Es war ein witziges kleines Spiel mit dem Geschäftsführer der Firma, der sich inkognito in den Laden geschlichen hatte. Wie ein König in einem alten Märchen, der sich als Bettler verkleidet, um sich unters Volk mischen zu können.
Die Tür zur Umkleidekabine wurde wieder geöffnet, und er trat in einem hellblauen Hemd heraus.
»Das da ist perfekt. Das nehmen Sie«, sagte ich. »Es ist nüchtern, aber nicht so trist wie das weiße.«
»Also … wir verkaufen in diesem Laden hier triste Sachen?«
Seine Augen waren plötzlich lebendig geworden, und er musterte mich mit einer ganz neuen Aufmerksamkeit.
»Sogar unsere Kundschaft braucht manchmal triste Kleidung.«
»Touché.«
Er lächelte, drehte sich um, blieb aber plötzlich mitten in der Bewegung stehen.
»Sie gefallen mir. Wie heißen Sie?«
»Emma. Emma Bohman.«
Er nickte und verschwand ohne ein weiteres Wort in der Umkleidekabine.
Als er das Hemd bezahlen wollte, passierte das, was mein Leben für immer verändern sollte. Jesper suchte fieberhaft nach seiner Brieftasche. Er fand sie nicht, die Lage wurde ihm immer peinlicher.
»Ich versteh das nicht. Die müsste doch …«
Er suchte in seinen Hosentaschen, schüttelte verzweifelt den Kopf.
»Verdammt«, murmelte er verbissen.
»Aber Sie können das Geld doch später vorbeibringen. Ich weiß ja, wer Sie sind.«
»Nein, das geht nicht. Dann stimmt Ihre Kasse nicht. Ich will Ihnen wirklich keine Schwierigkeiten machen.«
»Wenn Sie mich betrügen, hetze ich Ihnen die Polizei auf den Hals.«
Er schien meinen Scherz gar nicht gehört zu haben. Ich ahnte feine Schweißtropfen, die auf seiner Kopfhaut hervortraten. Sie glitzerten in dem grellen, künstlichen Licht wie Kristalle.
»Verdammt«, sagte er noch einmal, und irgendwie klang es wie eine Frage, als ob er in dieser peinlichen Lage meinen Rat hören wollte.
Ich lehnte mich vor, legte ihm vorsichtig die Hand auf den Arm.
»Hören Sie. Ich lege das Geld aus. Hier, das ist meine Telefonnummer. Sie zahlen es zurück, sobald Sie können.«
Und so geschah es.
Er nahm den Zettel mit erleichterter Miene entgegen. Als er den Laden verließ, schwenkte er ihn durch die Luft, als ob ich ihm eine Art Diplom verliehen hätte, und er lächelte mich noch einmal an.
Ich schaue auf die Uhr, die über dem Fernseher hängt. Zwanzig nach sieben. Wo bleibt er? Vielleicht hat er sich in der Zeit vertan. Er hat vielleicht gedacht, wir wären um acht verabredet und nicht um sieben. Trotzdem krampft sich mein Magen zusammen. Ich habe noch nie einen so pünktlichen Menschen gekannt wie Jesper. Er kommt immer zur verabredeten Zeit. Er bringt immer frische Blumen mit. Er ist, kurz gesagt, ein echter Mann von Welt. Er kann ungehobelt und arrogant wirken, von außen fast brutal, aber innerlich ist er sensibel, feinfühlig und verspielt wie ein Kind. Und pünktlich.
Ich gieße mir noch ein Glas Wein ein und schalte die Nachrichten an. Französische Bauern haben auf der Ringstraße um Paris tonnenweise Kartoffeln abgeworfen, aus Protest, weil die Vorschriften für Zuschüsse von der EU verändert worden sind. Ein Wirbelsturm ist am Nachmittag durch Sala gezogen und hat an einer neugebauten Schule große Schäden angerichtet. Chinesische Forscher haben ein Gen gefunden, das, wenn es defekt ist, Prostatakrebs verursachen kann. Ich schalte den Fernseher wieder aus. Fingere ungeduldig an meinem Telefon herum. Ich will nicht quengeln, aber ich habe Sorge, dass Jesper vielleicht etwas missverstanden hat: Zeit, Ort, Tag?
Ich schicke ihm eine kurze SMS, frage, ob er unterwegs ist, und hoffe, dass das nicht allzu aufdringlich wirkt.
Jesper Orre. Wenn das Olga und Mahnoor wüssten.
Und wenn Mama das wüsste.
Mein Zwerchfell verknotet sich. Jetzt nicht an Mama denken. Aber es ist zu spät. Schon spüre ich ihre Nähe in dem kleinen Wohnzimmer. Nehme den Geruch nach Bier und Schweiß wahr. Sehe ihre bleiche Masse über das Sofa quellen, wo sie in sich zusammengesunken vor dem Fernseher sitzt und laut schnarcht, während eine halbleere Bierdose zwischen ihren Knien klemmt.
Mama hat immer ein großes Gewese darum gemacht, dass sie niemals etwas Stärkeres trank als Bier. Lena, eine meiner Tanten, erwiderte oft, die Bieralkis seien die Tragischsten von allen Säufern, die Süchtigen, die ganz unten ständen, mit einem Fuß schon im Grab, mit dem anderen auf dem Weg zum Supermarkt, um ihren Kühlschrank aufzufüllen.
Das Tragischste war vielleicht, dass Mama nicht immer so war. Vor langer Zeit einmal war sie anders gewesen. Ich kann mich noch immer deutlich daran erinnern, und ab und zu frage ich mich, ob ich der Mama von früher nicht viel mehr nachtrauere als der, die sie bei ihrem Tod gewesen ist.
Eine frühe Erinnerung.
Ich saß mit Mama in meinem schmalen Bett im Zimmer mit den schmutzigen Vorhängen, mit den Abdrücken von Fingern und Handflächen und sogar Füßen. »Was machst du hier eigentlich, kletterst du wie ein Affe die Fenster hoch?«, fragte Mama oft, und dann seufzte sie theatralisch, wenn sie ab und zu versuchte, die Abdrücke mit einem feuchten Lappen wegzuwischen. Draußen war es dunkel. Irgendwer schaufelte im Innenhof Schnee. Ich konnte das scharfe Geräusch des Aufpralls hören, wenn der Spaten durch die Schneedecke schnellte und auf die Pflastersteine, die darunterlagen, knallte. Im Zimmer war es kalt, und Mama und ich trugen Schlafanzüge mit langen Ärmeln und dicke Socken. Das Buch über die drei kleinen Bären ruhte auf Mamas Knie.
»Weiterlesen!«, sagte ich.
»Okay, aber nur noch ein kleines Stück«, sagte Mama, gähnte und schlug die abgegriffene Seite um, die an einer Ecke mit Klebeband repariert war.
Sie musterte den Text mit konzentrierter Miene.
»Wer hat in meinem Bettchen geschlafen?«, fragte ich und folgte den Wörtern mit dem Zeigefinger.
Ich war sieben Jahre alt und ging in die erste Klasse. Ich hatte schon vorher lesen können. Ich weiß nicht mehr, wie ich das gelernt hatte. Ich nehme an, manche Kinder schnappen das einfach auf, knacken den Code auf eigene Faust. Die Lehrerin war jedenfalls sehr zufrieden gewesen, als sie bei Mama anrief und erzählte, dass ich im Lesen den anderen in der Klasse weit voraus war. Und da das »Lesen die Grundlage für alles andere« bedeutet, hieß das doch, dass es mir im Leben gutgehen würde.
»Und die nächste Zeile?«
»Der kleine Bär schaute den großen Bären an und … schüttelte den Kopf«, las ich.
Mama nickte konzentriert. Als ob sie über ein ungeheuer verzwicktes mathematisches Problem nachgrübelte. In diesem Moment wurde leise an die Schlafzimmertür geklopft. Papa schaute herein. Er hielt ein Buch und eine Packung Zigaretten in der Hand. Seine halblangen Haare fielen als sanfte Welle über sein Gesicht. Ich fand immer, dass Papa aussah wie ein Rockstar, mit seinen langen Haaren und seiner lässigen Kleidung. Er war auf ganz andere Weise cool als alle anderen Eltern, und oft wünschte ich mir, dass er mich zur Schule brächte und nicht Mama.
»Ich wollte nur gute Nacht sagen«, sagte er und kam herein. Kam zum Bett, beugte sich über mich und küsste mich auf die Wange. Seine Bartstoppeln kratzten meine Haut, und der Geruch des Zigarettenrauches brannte in meinen Nasenlöchern.
»Gute Nacht«, sagte ich und schaute hinter ihm her, als er wieder ging. Sein magerer Rücken und die Frisur, oder der Mangel an Frisur, und seine Art, im Gehen mit den Armen zu schlenkern, ließen ihn aussehen wie einen Teenager.
Ich sah wieder zu Mama. Sie war wirklich das Gegenteil von Papa. Der Körper groß und länglich, wie ein Tier, das im Meer lebt, ein Seelöwe vielleicht oder ein Wal. Ihre blondierten Haare standen in alle Richtungen ab und die Brüste drohten, den karierten Flanellschlafanzug zu sprengen, wenn sie tief Luft holte.
»Jetzt bist du dran«, sagte ich.
Mama zögerte eine Sekunde, aber dann führte sie langsam den Zeigefinger unter dem Text entlang.
»Ich habe ni… ni…«
»Nicht«, sagte ich.
Mama nickte und machte einen neuen Versuch.
»Ich habe nicht in … in deinem Bett geschlafen, sagte der kl… kl… kleine B… B…«
»Bär«, sagte ich.
Mama ballte die Faust.
»Verflixt aber auch. Bär, das ist ein schwieriges Wort.«
»Bald wirst du es leicht finden«, sagte ich ernst.
Mama schaute mich an. Sie hatte plötzlich ganz glasige Augen und presste meine Hand.
»Glaubst du?«
»Aber klar doch. Alle in meiner Klasse können lesen.«
Dass auch alle Mamas und Papas lesen konnten, sagte ich ihr nicht, denn obwohl ich erst sieben war, wusste ich genau, dass es sie traurig machen würde. Nur ich wusste, dass sie es nicht konnte. Nicht einmal Papa oder Mamas Kolleginnen kannten ihr Geheimnis.
»Wir üben morgen weiter«, sagte Mama und gab mir einen Kuss auf die Wange. »Und kein Wort zu Papa über …«
»Versprochen.«