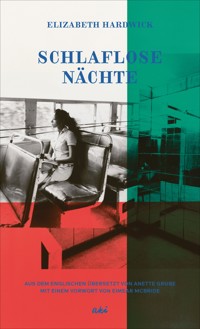
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: AKI Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau blickt zurück auf ihr Leben - die Menschen, die sie gekannt hat, die Orte, an denen sie gelebt hat. Wir begleiten sie zu Pferderennen nach Kentucky, in die Jazzclubs von New York, sehen Billie Holiday in Harlem, besuchen Bostons vornehmstes Viertel, den Beacon Hill, verbringen den Sommer in Maine und den Winter in Manhattan. Auf meisterliche und einzigartige Weise verknüpft Elizabeth Hardwick in ihrem bedeutendsten Roman Fakten und Fiktionen, Erinnerungen, Reflektionen, Porträts, Briefe, Wünsche, Träume - und lässt in funkelnden Vignetten Episoden ihres Lebens aufscheinen: ihre Jugend in Lexington, die beglückenden und die schweren Zeiten mit ihrem Mann, dem Dichter Robert Lowell, die gemeinsamen Reisen nach Europa und durch die USA. Mit einigen wenigen Strichen vermag sie lebendige Porträts der Menschen zu zeichnen, die ihren Weg kreuzten, sowie den Rassismus, den Sexismus und die Armut dieser Zeit zu beleuchten.Schlaflose Nächte ist eines der außergewöhnlichsten Werke der amerikanischen Literatur der vergangenen Jahrzehnte, ein bewegendes Buch der Erinnerung und zugleich eine ebenso feinfühlige wie literarisch brillante Meditation über das Erinnern selbst - elegant, lakonisch, gewagt und weise.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Elizabeth Hardwick
Schlaflose Nächte
Mit einem Vorwort von Eimear McBride
Aus dem Englischen von Anette Grube
Für meine Tochter Harriet
und meine Freundin Mary McCarthy
Ein spätnächtliches MultiversumEimear McBride
Auf den ersten Seiten von Schlaflose Nächte schreibt die Erzählerin über ihre liebevoll erinnerte, lange verstorbene Mutter: »Ich habe nie jemanden gekannt, der der Vergangenheit gegenüber so gleichgültig war. Es war, als wüsste sie nicht, wer sie war.« Es ist ein unsentimentales, nüchternes Urteil über ein Leben, das jetzt ungehindert in eine bald vergessene Vergangenheit gleitet, da diejenige, die es geführt hat, die Gelegenheit zur Selbstbetrachtung kaum wahrgenommen hat. Hardwicks Erzählerin – ebenfalls eine Elizabeth – verurteilt ihre Mutter nicht für dieses unterentwickelte Bewusstsein ihrer selbst oder den Mangel an behaupteter Identität. Vielmehr macht sie sich einfach eine grundsätzlich andere Herangehensweise zu eigen, so wie sie und ihre vielen Geschwister auf die erstaunlich vielen Schwangerschaften ihrer Mutter mit einer außerordentlich niedrigen eigenen Geburtenrate reagieren. Das Leben der Erzählerin von Schlaflose Nächte – zum ersten Mal 1979 publiziert, als die Autorin dreiundsechzig war, anerkannt und geachtet als eine der überragenden Autorinnen auf ihrem Gebiet – steht in krassem Gegensatz zu diesem mütterlichen Modell eines verwaisten Selbst und vor allem eines verwaisten weiblichen Selbst. Es herrscht keine Verwirrung über die individuelle Identität oder Unsicherheit über die Absichten. Diese Erzählerin weiß, wer sie ist, und ist sich im Klaren, wie sie dazu geworden ist. Die daraus folgende widerspenstige Erzählung kommt einem tiefen Eintauchen in ihre Denkprozesse gleich, während sie schlaflos über Ideen, Erinnerungen und Schlussfolgerungen nachsinnt. Für die Leser*innen ist diese Erzählung eine Begegnung mit einem beeindruckenden Geist, der hart arbeitet und den Weg von den Anfängen des Bewusstseins über Myriaden von Wahrnehmungen und Erinnerungen hinaus in die materielle Welt nachvollzieht – wo er sich vielleicht erlaubt, vielleicht aber auch nicht, sich von dem, was er vorfindet, verändern zu lassen –, und das bildet das Rückgrat des Vergnügens, das die fragmentarische Erzählung zusammenhält.
Hardwicks Erzählerin zieht es vor, die Welt zu sehen, statt von ihr gesehen zu werden. Sie lässt uns an ihren intimsten Gedanken darüber teilhaben, worauf immer sich ihre Wahrnehmung stürzt, und verhehlt kaum ihre Verachtung für diejenigen, die zu geblendet von ihrem Interesse an sich selbst und unfähig sind, sich oder ihre Handlungen mit schmerzlicher Aufrichtigkeit zu betrachten. Gleichwohl gibt es keinen Zweifel an ihrer Empathie und Sympathie für das harte, schwer erträgliche Leben der vielen Frauen, auf die ihr Blick fällt. Auch wenn es nicht in ihrer Macht steht, sie zu trösten, sind ihre gewissenhaften Zeugnisse ein Akt respektvoller Wertschätzung, wie sie den meisten von ihnen während ihres turbulenten schwierigen Lebens verweigert wurde. Wichtig ist, dass sie sie sieht, und auch die Art und Weise, wie sie uns diese Frauen und sich selbst sehen lässt, ist von Bedeutung. Die Entscheidung für eine dislozierte Erzählweise verstärkt noch das Gefühl, in ein spätnächtliches Multiversum gezogen zu werden.
Als eine der großen Literaturkritikerinnen ihrer Zeit, wohl aller Zeiten, wollte Hardwick nichts zu tun haben mit der ewig modischen Forderung, dass Literatur weniger nachdenken und mehr Zeit damit verbringen sollte, verschachtelte Plots zu entwickeln. Nach dem Fehlen von Drehungen und Wendungen in ihrem eigenen Werk gefragt, erwiderte sie: »Wenn ich einen Plot will, schaue ich Dallas.« Diese Überzeugung, dass Plot und Geschichte nicht dasselbe sind, dass Plot nicht für jede Erzählung angemessen ist, eine Geschichte aber unerlässlich, treibt das Buch voran und gestattet eine ergiebigere, befriedigendere Erkundung ihrer Themen. Obwohl es also Kapitel gibt, Abschnitte und so weiter, gibt es keinen wirklichen Grund dafür. Die Gedanken der Erzählerin folgen ihrer eigenen, von Schlaflosigkeit bedingten Logik, springen mühelos durch Raum und Zeit, verbunden nur durch einen hauchfeinen assoziativen Faden.
Das Desinteresse an einer strengen Abgrenzung der literarischen Form schlägt sich auch im Inhalt des Buchs nieder. Veröffentlicht als fiktionales Werk, enthält Schlaflose Nächte viele verifizierbare autobiographische Elemente: Hardwick wurde in eine große Familie in Kentucky geboren. Sie zog nach New York und lebte in einer mariage blanc mit einem jungen homosexuellen Mann. Als Autorin hatte sie einen Platz im Zentrum der literarischen Welt inne. Im wahren Leben verbrachte sie Zeit mit Billie Holiday und stürzte aus dem »verbreitetsten Plural«, als der Dichter Robert Lowell sie nach dreiundzwanzig Jahren Ehe verließ. Dennoch ist der Roman formal und intellektuell zu vielfältig, um in die Sackgasse der Autofiktion oder in die Zwangsjacke eines Memoirs gesteckt zu werden. Viele der Orte, die Hardwick persönlich kannte – das Kentucky ihrer Kindheit, das geerbte Haus in Maine, das Sofa im Studentenheim, auf dem sie eine »traurige Nacht« verbrachte, und die schäbigen, aber transformativen Freuden in ihrem geliebten New York, wo sich »die Gräber gleich neben den Banken« befinden –, sind auf stimmige Weise präsent. Präsent sind auch die Menschen, die sie an diesen Orten kannte, mochte und liebte: Eltern, Freundinnen und Freunde, ehemalige Liebhaber, die voller Bitterkeit behaupten, dass »nur Frauen mit Geld die Gesetze der Wahrscheinlichkeit brechen können«, die bereits erwähnte Billie Holiday mit ihrer »mörderischen Ausschweifung« und »leuchtenden Selbstzerstörung«, die Nachbarin, die die Armut »wie ein Bulldozer« überrollte, und die inzestuöse Bourgeoisie des intellektuellen Amsterdam – ganz zu schweigen vom Strom der vom Pech verfolgten Haushaltshilfen. Und wir dürfen den Arzt nicht vergessen, der ihr nach der Abtreibung die Visitenkarte seines Bestattungsinstituts überreichte. Sie fixiert ihn wie die anderen in der Zeit, obwohl sie bezeichnenderweise gerade ihn beinahe vergisst. Die Leser*innen können sich des Eindrucks nicht erwehren, dass diese schönen, zutiefst menschlichen Porträts Personen abbilden, deren Weg sie kreuzte. Dass sie aus eigener Kraft gelebt und gekämpft haben, jenseits der Klischees, zu denen sie so leicht hätten verdammt werden können. »Die Gesellschaft versucht, diese Leben zu schreiben, bevor sie gelebt werden«, sagt Hardwick. »Es gelingt ihr nicht immer.« Sie tappt nicht in diese Falle. Ihre Beschreibungen sind faszinierend sinnlich und von einer sprachlichen Unmittelbarkeit, die jemanden, der träge oder sentimental ist, dazu verführt, jeden Aspekt des Romans mit der zu kurz greifenden Erwartung zu lesen, nur Autobiographisches vorzufinden.
Hätte Hardwick einen historisch verifizierbaren Bericht verfassen wollen, hätte sie sich nicht geziert, es auch zu tun. Ihre Scheidung von Robert Lowell zum Beispiel wird angedeutet, seine skrupellose Aneignung von Material aus ihren persönlichen Briefen an ihn Jahre später und ihr Erscheinen in seinen publizierten Werken bleiben jedoch unerwähnt. Im Licht eines solchen Vertrauensbruchs gelesen, ist der Unwille, in Schlaflose Nächte abzurechnen oder die Dinge richtigzustellen, nicht weniger als bemerkenswert und für gierige Skandaljäger zweifellos enttäuschend. Das Buch hat zwar eine gewisse Intimität, doch es ist nicht die akkurate Schilderung unangenehmer Geschehnisse, die Hardwick des Nachts beschäftigt. Hardwicks Reaktion auf Lowells aggressiv spezifische Frage »Warum nicht aussprechen, was passiert ist?« könnte in der kühlen Gegenfrage »Kann es sein, dass ich das Thema bin?« bestehen. Vielleicht ist es ein latenter Schatten der mütterlichen Selbstvergessenheit, der sich hier zeigt, oder es wäre schlicht die Reaktion einer Frau, die sich ein Selbst erschaffen hat und nicht mehr unter dem Zwang steht, irgendjemandem irgendetwas beweisen zu müssen. Wie auch immer, die Starrheit des Buchstäblichen und Faktischen ist zu einengend für Hardwick. Für sie ist die Summe der Handlungen eines Lebens bei Weitem keine ausreichende Berechnungsgrundlage seines Werts oder seiner Bedeutung, um die Anstrengung zu rechtfertigen, es zu katalogisieren. Folglich und vielleicht nicht überraschend entschied sich Hardwick, sowohl vieldeutig als auch ambivalent hinsichtlich des autobiographischen Stellenwerts von Schlaflose Nächte zu bleiben. Auf Darryl Pinckneys Feststellung von 1985 – in einem Interview für die Paris Review –, dass das Buch »den Tonfall gelebter Erfahrung, einer Art Biographie« habe, erwiderte sie: »Vermutlich. Schließlich habe ich in der ersten Person geschrieben und meinen eigenen Namen, Elizabeth, benutzt. Allerdings ist es nicht sehr bekenntnishaft. Und nicht vollständig aus dem Leben gegriffen, eher weniger, als der Leser vielleicht glaubt.«
Hardwick mag ihre Meinung zu den Einzelheiten für sich behalten haben, um ihr Werk nicht auf eine Übersimplifizierung seiner selbst zu reduzieren, oder sie wollte nicht jener forensischen persönlichen Untersuchung unterzogen werden, der sich heutzutage alle Künstler*innen routinemäßig unterwerfen müssen. Wahrscheinlicher jedoch ist – wie sie im vorletzten Absatz von Schlaflose Nächte schreibt: »Manchmal ärgere ich mich über das Glossar, die Konkordanz der Wahrheit, die viele für mein tatsächliches Leben zu besitzen glauben wie eine zweite Brille. Für mich erschwert dieser Umstand das Erinnern.«
Der Versuch, Schlaflose Nächte in eine einzige identifizierbare Form zu zwängen, ist ein ebenso lächerliches wie unnötiges Unterfangen. Schlaflose Nächte ist so sehr Roman wie Brief, ein Brief, der zu einem Essay wurde, ein Essay gewiss eher als ein Memoir, und eine poetische Chronik der Zeit, des Denkens und des Erfindungsreichtums der Erinnerung und vermag weit mehr als jede dieser Gattungen für sich allein.
Erster Teil
Es ist Juni. Ich habe beschlossen, jetzt mit meinem Leben Folgendes anzufangen: Ich werde die Arbeit umgeformter und sogar verzerrter Erinnerung leisten und das Leben führen, das ich heute führe. Jeden Morgen die blaue Uhr und die gehäkelte Tagesdecke mit den rosa, blauen und grauen Quadraten und Rauten. Wie schön es ist – dieses Werk einer gebrochenen alten Frau in einem armseligen Altersheim. Schönheit und Schmutz und Elend in einem unaufgeregten Kampf miteinander – das sehe ich. Schöner jedoch ist der Tisch mit dem Telefon, den Büchern und Zeitschriften, die Times vor der Tür, das Vogelgezwitscher schwerer, knirschender Lastwagen auf der Straße.
Wenn man nur wüsste, woran man sich erinnern oder vorgeben sollte, sich zu erinnern. Man treffe eine Entscheidung, und was man von den verlorenen Dingen haben will, präsentiert sich von selbst. Man kann es wie eine Konservendose aus dem Regal nehmen. Auf einer Dose würde »Rand Avenue in Kentucky« stehen, und manche würden zumindest die Adresse wiedererkennen. In der Dose sind die schwärzlichen Veranden des Winters, die Roste des Gasherds, das Gewimmel.
Das Sonnenlicht blendet mich. Wenn ich aufschaue, sehe ich verwirrende Elektrizität hinter den Fenstern. Vielleicht werden die Schatten ausreichen, das Licht und der Schatten. Stell dir vor, du wärst in Apollinaires Gedicht:
Da bist du in Marseille inmitten von Wassermelonen.
Da bist du in Koblenz im Gasthaus zum Riesen.
Da sitzt du in Rom unter einer japanischen Mispel.
Da bist du in Amsterdam …
1954
Liebste M.: Da bin ich in Boston, in der Marlborough Street Nummer 239. Ich schaue hinaus in einen Schneesturm. Er kam wie ein großer Waffenstillstand, setzte allen dummen Kämpfen ein Ende. In diesem außergewöhnlichen Schnee laufen die Leute in wunderbaren Kostümen herum – in alten Mänteln mit Pelzkragen, Wollmützen, Schals, Stiefeln, ledernen Wanderschuhen, die wie Kupfer glänzen. Im gelben Licht der Straßenlampen stellt man sich vor, wie es vor vierzig oder fünfzig Jahren war. Die Stille, das offene Weiß – Nostalgie und Romantik in der klaren, stillen weißen Luft …
Mehr oder weniger eingelebt in diesem hübschen Haus. Maßgeschneiderte geblümte Vorhänge, zugeschnittene Läufer auf den Treppen, Bücherregale, Holz für den Kamin. Die vier Stockwerke hinauf- und hinunterzugehen gibt einem das Gefühl von Eigentümerschaft – vielleicht. Es mag deins sein, aber das Haus, die Möbel tendieren zum Üblichen, und bald wird es sich wie eine Regieanweisung lesen: Kulisse – Boston. Dem Gesetz wird Folge geleistet. Kommoden, Tische, Geschirr, häusliche Gewohnheiten passen sich an.
Wunderschöne neoklassizistische Kaminsimse aus verziertem Marmor in bleichen Schwarz- und den blassesten Grüntönen. »Sind allein schon den Preis des Hauses wert« – die hinausposaunte Meinung des Verkäufers und ausnahmsweise wahr. Doch es ist das ganze Haus, das mich beschäftigt. Im ersten Stock zwei Salons. Prächtig, ja, aber 239 hat sicherlich auch Nischen des Mangels, Ecken der Schäbigkeit. Dennoch, es ist eine Kulisse.
Da bin ich im Erkerfenster mit meinem blühenden Hibiskus. Der andere Salon geht auf die schmale Straße zwischen Marlborough und Beacon hinaus. Dort hält ein Idiot einen Hund an der Kette, Tag und Nacht. Junggesellenabfall, Verfall, Verwirrung häufen sich um den Mann. Ich denke mir, dass er einst eine Familie hatte, aber sie lebt nicht mehr bei ihm. Ich stelle mir vor, dass die Kinder ihn besuchen und er sagt: »Kommt und schaut euch den Hund an der Kette an. Er ist ein Geschenk.« Im Interesse des Hundes rufe ich die Polizei. Der Mann blickt verstört zu meinem Fenster herauf und fragt sich, was er falsch gemacht hat. Darwin hat einmal geschrieben, der Gedanke an das immerwährende Leiden der niederen Tierarten sei ihm unerträglich geworden.
In Liebe,
ELIZABETH
Anfang Juni war es heiß. Ich machte eine Reise, und natürlich war alles sofort neu. Wenn man reist, entdeckt man als Erstes, dass man nicht existiert. Der Phlox blühte in blassem Lila; auf dem Hügel phallische Kiefern. Ausländer unter den Arkaden, in den Korbgeschäften. Die Hügelkuppen verschwammen in einem feuchten Dunst. Ein schmutziger matt machender Himmel. Der Sommer schien sich bereits dem Ende zuzuneigen. Bald würden die Boote eingeholt, die Fähren am Pier vertäut.
Suche nach dem Versteinerten, nach etwas – Personen und Orte dick und verkrustet in einer endgültigen Form; stattdessen gibt es viele, viele kleine Fische, die wild herumschwimmen, zitternd, achtsam, um dem Netz zu entgehen.
Kentucky: gehört sicherlich dazu. Meine Mutter lebte als Mädchen in so vielen Städten in North Carolina, dass ich sie in der Erinnerung durcheinanderbringe. Raleigh und Charlotte. Sie kannte ihre Eltern kaum; wie alle Leute damals starben sie schnell, an was immer gerade in der Luft war – Lungenentzündung, Diphterie, Tuberkulose. Ich habe nie jemanden gekannt, der der Vergangenheit gegenüber so gleichgültig war. Es war, als wüsste sie nicht, wer sie war. Sie hatte Brüder und Schwestern und wurde von ihnen großgezogen, gab ihre Namen an uns weiter.
Ihr Gesicht, das meiner Mutter, kann ich nicht klar vor mir sehen. Eine weiche Hübschheit ohne Knochen, kleine braune Augen, hauchdünne Augenbrauen, nachgezogen mit einem Bleistift.
1962
Liebste M.: Da bin ich wieder in New York, in der 67th Street in einem hoch aufragenden Haus mit langen schmutzigen Fenstern. Am späten Nachmittag, unter dem finsteren Winterhimmel, stelle ich mir manchmal vor, es wäre Edinburgh in den Neunzigern. Ich war nie in Edinburgh, aber ich mag Städte vertretbarer Größe, Provinzhauptstädte. Doch das ist definitiv New York, unterhalb und oberhalb von mir. Der Umzug von Boston war nicht leicht. Einer Ozeanüberquerung nicht unähnlich oder einer Fahrt durch das ganze Land – als müssten alle deine Dinge über das Gebirge geschleppt werden. Der aufgebockte Tisch und die Aufsatzkommode waren wirklich schlecht vorbereitet auf das plötzliche Exil, den Regierungswechsel, der in gewisser Weise auch mir bevorstand. Nun, Räuchereiche steht in der Ecke, Flaschen und Eiskübel darauf. Fünf der Teller der Marineakademie sind zerbrochen. Die Uhren haben einen tödlichen Schlag erlitten und werden nie wieder zum Leben erwachen. Die alten Sekretäre stehen starr, gedemütigt, angeschlagen.
Vertriebene Dinge und alte Leute, steif, mit müden Venen und verstopften Arterien, mit Hühneraugen und schmerzenden Fußgewölben, spärlichem Haar und zerstreuten Gedanken, als kämen sie über die Karpaten, aus den Sümpfen – so ist es hier in der heiligen Stadt. Tante Lottes Porträt wird nie wieder ausgepackt werden. Sie findet ihre letzte Ruhestätte im Grab einer Kiste, im Keller, ihr Requiem ist das Brummen der U-Bahn in der Seventh Avenue.
Selbstverständlich gehören die Sachen nicht mir. Ich glaube, man nennt sie für gewöhnlich unsere, dieser Teebeutel von einem Wort, der ins Konditional getaucht wird.
In Liebe, in Liebe,
ELIZABETH
»Aller Anfang ist heiter, die Schwelle ist der Platz der Erwartung«, schrieb Goethe. Wieder einmal New York, das immer bleiben wird, sich auf den großzügigen Annehmlichkeiten ausruht, die es für Frauen bereithält. Lange Kleider, Arroganz, so viele Möglichkeiten, die Betrüger zu betrügen, Vertraute, Verschwörer, Kreditkarten.
Damals war ich ein »Wir«. Er albert herum, lächelt, trinkt Gin nach einem langen Arbeitstag, sagt so etwas wie das hier vor sich hin:
Die Tyrannei der Schwachen ist belastend, und doch ist es besser, von den Schwachen ausgebeutet zu werden als von den Starken … Unterwerfung unter die Mächtigen ist eine Redundanz und sehr ermüdend und letztlich langweilig. Sie hat nichts Subtiles oder Interessantes … vor allem weil diese Übung zu häufig erfolgt. Ein Training am Morgen, ein weiteres Mal am Abend … Mann-Frau: nichts Neues zu entdecken in dieser unerschütterlichen klassischen Tradition. Streit ist wie das Schleifen rostiger Schneiden, der alte Motor und sein ärgerliches Klopfen. Der Hund knurrt. Auch er kennt seinen Text.
Kann es sein, dass ich das Thema bin?
Stimmt, bei den Schwachen passiert ständig etwas: Improvisation, Überraschung, Spannung, Ungerechtigkeit, Manipulation, Hypochondrie, heimliches Trinken, Eifersucht, Lügen, Weinen, Verstecken im Garten, Aufbruch mitten in der Nacht. Die Schwachen haben den reinsten Sinn für Geschichte. Alles kann passieren. Jeder von ihnen ist ein Palmist, der in der eigenen Hand liest. Ja, ich werde entweder ein langes oder ein kurzes Leben haben; er (sie) wird entweder blond oder dunkelhaarig sein.
Fahrkarten, Übersiedlungen, Sorgen, Eigentum, Schulden, Änderungen und Rückänderungen des Namens: Das kommt davon, wenn man viele Bücher liest. Also, von Kentucky nach New York nach Boston nach Maine nach Europa, mitgerissen von einem Fluss aus Absätzen und Kapiteln, reimlosen Versen, dünnen Büchern, übersetzt aus dem Polnischen, dicken Büchern aus dem Russischen – alle gelesen in sitzender Schlaflosigkeit. Genügt das – abgesehen davon, dass es die Wahrheit ist. Sicherlich ist es nicht so dramatisch wie: Ich sah den alten Fregattenkapitän mit dem weißen Bart am Pier und schrieb mich für die Reise ein. Aber schließlich bin »ich« eine Frau.
Ich sitze im Zug von Montreal nach Kingston. Ich fahre für ein paar Tage zur Universität – und vor nicht allzu langer Zeit. Es ist Sonntagabend, tiefer Winter, und wir kämpfen uns durch die kalte, schwarze Leere. Manchmal blitzt in der Ferne das bronzefarbene Glühen eines Autoscheinwerfers auf, flackert in den Kurven wie eine Kerze. Der Zug scheint immer geradeaus zu fahren in dem glücklichen, großen, leeren Land.
Es sind nur ein paar Grad über null, aber im Clubwagen sitzen wir in einer sinnlichen tropischen Hitze, einer männlichen Hitze. Ich bin die einzige Frau in Wagen Nummer 50.
Sie sind sehr laut. Der routinemäßige Lärm und viel unechtes Gelächter einer Gruppe, die zu lange zusammen ist. Die Männer sind in einer gezwungenen Ferienstimmung, die sich ihrem abstürzenden tödlichen Ende nähert. Die meisten sind betrunken, und mehr als einer sieht aus, als wäre ihm schlecht. Kanadier, erbrecht euch nicht auf mich! Wie es scheint, waren sie bei einem Treffen, einer Konferenz. Sie sind über den Beruf miteinander verbunden; vielleicht verkaufen sie etwas. Sie sind gewiss nicht sehr wohlhabend, nein, bestimmt nicht. Dessen bin ich mir sicher aufgrund meiner unwürdigen Kalkulationen, die auf der Arithmetik von Snobismus und Scham fußen.
»Scham ist erfinderisch«, sagte Nietzsche. Und das ist noch längst nicht alles. Aus Scham habe ich auf Kleidung, Schuhe, Ringe, Armbanduhren, Akzente, Zähne, Verhaltensweisen, Redewendungen geachtet. Die Männer im Zug tragen Kleidung für keine bestimmte Jahreszeit, die deswegen nie zur Jahreszeit passt und widersprüchlich ist. Sie ist rau und fadenscheinig, grell und doch leichtgewichtig, hergestellt mit der Unzweckmäßigkeit, die die bestimmende Idee der Ganz-Jahres-Kleidung ist. Pastelltöne, blau wie das Meer, grün wie das Land; Jacketts mit Paisley- und Karofutter; Nähte betont mit breiten Stichen in einer kontrastierenden Farbe; übergroße Revers und Taschen; überwiegend kaltes Blau und Zweifarbigkeit; Nylon und Dacron, bügelfrei, glatt wie Glas. Die Schaffner aus Trinidad dagegen sind traditionell gekleidet wie Prinzen. Schwarze Hose, rotes Baumwolljackett, weißes Hemd, schwarze Fliege und schwarze, strahlende, aristokratische tropische Gesichter.
Die Männer sind sehr weiß, sehr hell, und ihr nussbraunes Haar fällt auf rötlich blonde Brauen. Ihre Blässe erinnert mich daran, dass sie wahrhaft meine Brüder sind, die nach Hause fahren zu meinen Schwestern, meinen Schwägerinnen. Die Anwesenheit der Männer macht mich unruhig; einer weckt meine Erinnerung, weil ein kleines Stück von einem Vorderzahn abgebrochen ist, was eine traurige Nacht auf einem Sofa in einem Studentenheim heraufbeschwört. Ein anderer hat einen zu engen Schuh ausgezogen und schaut lange hingebungsvoll auf seinen befreiten Fuß. Keiner von ihnen ist ein Fremder, so nahe sind mir die blassen Augen, der Scheitel im Haar, die rührende, schwerfällige Heiterkeit.
Borges stellt die Frage: »Sind nicht die leidenschaftlichen Shakespeareaner, die sich einer Zeile von ihm hingeben, sind sie nicht Shakespeare selbst?«
Hier, durch die schwarze Nacht rasend, vermischen sich diese Männer in der grellen Kleidung, unter dem abnehmenden Mond ihrer Trunkenheit, mit meinem eigenen Fleisch, als hätte ich mit jedem von ihnen auf dem Rücksitz eines Autos gesessen, »grübelnd« über ihrem unfertigen Text. Männer mit rot geränderten Augen, schweren Siegelringen ihrer Highschool, weißen Baumwollunterhemden, Tage an der Tankstelle, wo sie sich auf die Mühen für die Familie vorbereiten, die ihnen schon da vor Augen steht.
Der Clubwagen, in dem jetzt Abfall herumrollte, raste rückwärts. Ein Tor quietschte in seinen rostigen Angeln, ein alter Wagen und ein Lastauto standen auf dem Kies, die Tür schließt sich hinter meinen Brüdern und Schwestern, die spät hereinschleichen und wortlos in eins der vielen Betten mit den angenehmen Mulden in der Mitte fallen. Die Seufzer und Tränen, das Ausrufen der Ungerechtigkeit, alle diese Schicksale verbunden durch eine Ähnlichkeit von Stirn und Nase, durch unwiderstehliche Sympathie und große Distanz, und jeder gab sich einer hübschen Eitelkeit hin, der Vorstellung, ein Waisenkind zu sein.
Pasternaks Satz: Leben ist kein Gang durch ein freies Feld. Und auch nicht das Besteigen eines Bergs. Leconte de Lisle sagte voller Neid über Victor Hugo, er sei »so dumm wie der Himalaja«. Das mörderische deutsche Mädchen mit dem Alpenstock, den Wanderstiefeln, ruft dem alten Baumeister zu: Höher, höher! Er stürzt in den Tod, und das ist Ibsens Abscheu vor dem Schwindel oder der Vorstellung von dort oben. Er selbst rückte seine randlose Brille zurecht und zog die Mundwinkel nach unten, wenn begeisterte junge Mädchen ihn für dümmer hielten, als er war. Ibsen war kein glücklicher Mensch. Den ganzen Tag Arbeit, mehr als nur ein bisschen Schnaps am Abend, und daheim, im Hotel, im Gästehaus, in der Pension war seine starke Frau, die nach der Geburt des kleinen Sigurd Ibsen sagte: Das war’s, es reicht.
Weder mehr noch weniger gerade durch das Feld mit dem Ziel der Baumgruppe oder der Steinmauer, die deinen Besitz begrenzt, und auch nicht bergauf, oft außer Atem. Doch unterwegs entzweien tiefgreifende Veränderungen und Umzüge die Gedanken. Wo ist Vermont oder Minnesota, nachdem du deine Sachen gepackt hast und mit deiner alten Frau nach Florida gezogen bist – um zu leben, zu leben, ohne Ofen und Schneepflug? Während du lebst, hat sich ein Teil von dir auf den Friedhof davongeschlichen.
Kentucky, Lexington; Universität, Henry-Clay-Highschool, Main Street. Der Friedhof von einem Elternhaus, Erziehung, Nerven, Erbe und Ticks. Schwinden sie, ist es traurig; bleiben sie, sind sie ein Stachel. Bäume, Blumen, vornehme alte Häuser, prosperierende Farmen am Rand der Stadt – das Herz findet wenig Zerstreuung darin, ehe die antiquarischen Interessen des mittleren Lebensalters einsetzen. Verkäuferinnen und Kellnerinnen sind die Heldinnen meiner Erinnerungen, diese verlassenen Frauen mit Kindern, die sie allein großziehen müssen; sie halten die Dinge offen, erhellen nachts die Main Street, damals das paradiesische Zentrum der Stadt. Woolworth, das Zigarrengeschäft, drei segregierte Lichtspielhäuser, zwei lustbetonte Hotels, wo in den Papierkörben die Kurzmitteilungen für Verabredungen und die übertriebene missgestalte Prosa heimlicher Liebesbriefe lagen.
Es stimmt nicht, dass es nicht wichtig ist, wo man lebt, dass man in Hartford oder Dallas immer nur man selbst ist. Ebenso wenig stimmt es, dass alle von Natur aus mit dem Ort ihrer Herkunft verbunden sind. Viele werden bei ihrer Geburt achtlos irgendwohin geworfen und erleben die Unzulänglichkeit und manchmal den angenehmen Trotz dieser Zufallsplatzierung. Amerikaner, die Deutsche sind, Deutsche, die Franzosen sind, wie Heine vielleicht.





























