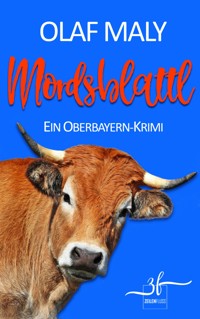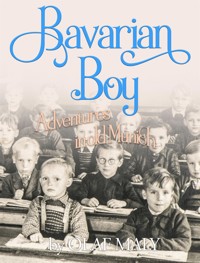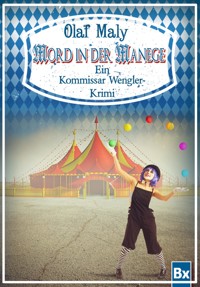4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: BookRix
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der amerikanische Süden. Eine Gegend, in der Fremde nicht erwünscht sind und in der man sich besser nicht verfährt. Diese Geschichte nimmt sich der Menschen an, die dort seit Generationen – vom Rest der Welt vergessen – leben und davon träumen, ihrer Bestimmung zu entfliehen. Wie in vielen Träumen geht es um Geld, und obwohl diese Menschen nicht viel davon haben, nimmt man ihnen auch noch das Wenige. Nur entwickelt sich das für die, die denken, alles perfekt zu kontrollieren, nicht ganz so, wie sie sich das vorgestellt hatten. Es gibt eine Verbindung nach Europa, um die von diesen Menschen erwirtschafteten Gelder sicher und für den amerikanischen Staat nicht erreichbar, anzulegen. Am Ende werden alle verlieren, bis auf eine Person, der man es am wenigsten zugetraut hätte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Schloss im Süden
Ich möchte mich an dieser Stelle noch bei einigen Personen bedanken, ohne deren Hilfe dieses Buch nicht zustanden gekommen wäre. Da wäre zuallererst meine langjährige Partnerin Marita Stepe, die es stets auf sich nimmt, die erste Fassung meiner Bücher zu lesen, und mit konstruktiver Kritik auf die Handlung Einfluss nimmt. Und dann noch meine Lektorin, Theresia Riesenhuber, die mit Engelsgeduld meine Fehler ausmerzt.BookRix GmbH & Co. KG81371 München1
Für Jonathan Hagman begann dieser Dienstag wie jeder andere Tag der Woche. Bleischwer lag die Luft in jedem Zimmer, in jedem Winkel des halb verfallenen Hauses, in jener Eintönigkeit seines Daseins, die er zu ertragen hatte. Der Sommer in Greenville, Georgia, war dieses Jahr besonders zermürbend, heiß, stickig und unerträglich. Der rote Sand, der unentwegt die Luft erfüllte – Tag und Nacht, immer und immer – gab seiner totalen, sinnlosen, Existenz den Rest. Unerträglich und erdrückend waren sie eigentlich immer, diese Sommer hier, und was irgendjemanden dazu gebracht hat, sich hier anzusiedeln, würde für Jonathan Hagman immer ein Geheimnis bleiben. Wie vieles für ihn ein Geheimnis bleiben würde, in seinem trostlosen Leben.
Vor ein paar Tagen hatte auch noch seine Klimaanlage den Geist aufgegeben, die das Leben zumindest ein wenig erträglich gemacht hatte. Das war früher oder später zu erwarten gewesen. Oder aber auch wieder nicht, wie er sich immer wieder einredete. Hatte er sich doch nie darum gekümmert und ganz einfach gehofft, dass so alles seiner Wege gehen würde, so ganz ohne sein Zutun. Es ging nicht seiner Wege. Jedenfalls nicht im Sinne der Funktionalität. Auch nicht nur für mechanische Dinge von Bedeutung, sondern ebenso für alle anderen Dinge, seien sie nun von Bedeutung oder nicht. Sein ganzes Leben war bisher nur davon gezeichnet, eben kein Leben zu sein, sondern mehr ein Hineinversetzen in einen Zustand, den er nicht verstand, an dem er keine Schuld hatte und den er dennoch ertragen musste.
Und natürlich war keiner an dieser Misere schuld, außer all den Umständen, die er so gar nicht beeinflussen konnte und die ihn immer wieder aus der Bahn schmissen. Und Schuld war schon beileibe nicht er selbst, wo er doch immer wieder versucht hatte, auf die Beine zu kommen und etwas aus sich zu machen. Auch wenn alles mal gut lief – was es natürlich nie tat, auch nicht gemessen am Standard seines Lebens. Aber allein der Gedanke an eine bessere Zeit ließ alles besser erscheinen. Und dann das. Alles kam zusammen. Alles brach zusammen und war auf ein Ende ausgerichtet, das zwar noch nicht da war, aber seine Anzeichen schon vorausschickte.
Es half auch nicht, den in seinen letzten Zügen liegenden, manchmal nur noch müde sich dahin drehenden Ventilator einzustecken, der auf einer Kommode direkt vor seinem Bett stand und den ihm einst seine Mutter überlassen hatte. Schlafen war so gut wie unmöglich in diesem Klima, in dieser Hitze, in dieser Schwüle, in diesem Gestank von Verwesung und Verfall. Still vor sich hin liegen kostete Schweißausbrüche. Dann lief das Wasser in kleinen Rinnsalen über sein Gesicht, die Arme, die Beine und alle anderen Extremitäten, sammelte sich in anfangs kleinen und dann immer größer werdenden Pfützen auf dem Kopfkissen, auf dem Bett, auf dem Laken, und tropfte von dort auf den verklebten Boden. Die nassen Stellen am Bettbezug fühlten sich so kalt, unangenehm nass und verfault an, wie ein Pfirsich, der jeden Moment zu explodieren drohte um seine süßen, klebrigen Säfte überall hin zu verteilen.
Trocknen lassen gab es nicht, da nichts und niemand in dieser Feuchtigkeit jemals trocken werden würde. Die Feuchtigkeit war ein Teil des Lebens, war die Buße, die man auferlegt bekommen hatte für die Sünden, die man beging und von denen man noch nicht einmal wusste, dass man sie beging, die aber schon auf einen warteten, damit die Sühne auch zu ihrem Recht kam.
Reverent Gerard, wie er sich nannte, und von dem keiner wusste, woher er diesen Namen hatte, machte einen jeden Sonntagmorgen darauf aufmerksam, wenn er in seiner nicht enden wollenden Tirade über die Schlechtigkeit der Menschen herzog. Er gab einem das Gefühl, nichts auf dieser Welt zu sein, als ein Haufen Mist, ein Nichts, eine Schlechtigkeit, ein verlogenes Bündel miese Schlechtigkeit, wie er es nannte, und noch vieles mehr.
„Und alle sind wir Sünder vor dem Herren“, schrie er in die Halle, die immer bis zum Rand gefüllt war, in der unablässig gesungen wurde und das Saxofon den Ton angab. Nicht, dass es keine Orgel gab, aber es gab niemanden, der sie spielen konnte. Dafür aber jemanden, der halbwegs das Saxofon beherrschte. Also war das Saxofon zur Stimme des Herrn geworden.
„Amen“, rief die Masse im Vollen zurück.
„Und alle werden wir in die Hölle kommen“, schrie Reverend Gerard aus seiner heiseren Kehle wieder und immer wieder.
„Amen“, kam es von der devoten Gemeinde wieder vollhals zurück, einem eingespieltem Ritual folgend.
So ging das für Stunden, bis alle, der Priester und die Gemeinde, einfach nicht mehr konnten. Und dem Saxofonspieler die Luft ausging.
Gott konnte all das ändern. Oder eher der Glaube an Gott. Mit Gottes Wille, seiner unermesslichen Geduld mit uns armseligen Menschen, und dem Glauben an ihn, konnte man etwas aus sich machen, konnte man den Kreis des Teuflischen durchbrechen und seinen Weg zur Erlösung finden. Man musste nur daran glauben und auch danach leben. Ein wenig Geld für die Kollekte könnte auch nicht schaden, sich den Weg ins himmlische Paradies zu verkürzen. Himmlisches Paradies, erkauft durch ein paar Cent in einer ausgedienten und am Hals abgeschnittenen Coca-Cola-Flasche aus Plastik, mit einem Loch, groß genug, um etwas hineinzustecken, aber klein genug, um es nicht wieder herausnehmen zu können. Hatte man als Prediger doch Vertrauen zu Gott, aber nicht so sehr zu seine Schäfchen. Und man wollte sie nicht noch zusätzlich in Versuchung führen, die Schäfchen.
Die Misere für Jonathan Hagman wurde auch durch seinen Glauben an Gott nicht positiv beeinflusst. Wirkliche Erleichterung war nicht zu erwarten, weder für seine missliche Lage, noch für das Wetter, noch für die Zeit, die vor ihm lag. Er hatte längst aufgegeben, darüber nachzudenken, warum das alles so war, warum er immer nur auf der falschen Seite der Straße stand. Dass für ihn die Ampel immer rot war und nur die anderen immer grün hatten und gehen durften. Wenn er dann umschwenkte, um die Grünphase zu erhaschen, war schon wieder rot.
Leise und unruhig wehten die schmutzig gelben, befleckten Baumwollvorhänge, die einmal weiß gewesenen waren, vor den Fenstern. Sie wurden angeweht von der leichten, sanften, stets nach verbrannter Wärme riechenden Luft, einem stechenden Geruch, der einfach nicht zu vermeiden war, man konnte machen, was man wollte.
Die alten Fenster, die man einst nach oben hatte schieben können, standen halb offen, da man sie nicht mehr ganz auf- oder ganz zumachen konnte, weil die Mechanik im Inneren des Rahmens schon vor langer Zeit aufgegeben hatte zu funktionieren. Die Termiten hatten die Führungsbahnen für die Gegengewichte ganz einfach zerfressen, und damit war das Führen nicht mehr gegeben. Es hing auch kein Gegengewicht mehr im Gegenzug, womit man das Fenster hätte leichtgewichtig bewegen können. Im Gegenteil, das Gewicht lag irgendwo eingeklemmt im Rahmen und verhinderte damit auch noch die geringste Bewegung zwischen Fenster und Rahmen. Es klemmte ganz einfach. War unbeweglich festgefahren.
Das alles war Jonathan natürlich nicht bekannt, da er sich für solche Sachen schon überhaupt nicht interessierte, geschweige denn, daran dachte, auch nur einen einzigen Gedanken daran zu verschwenden. Technische Einzelheiten waren nur Belastung für ihn, unangenehm, fremd und für sein Leben total unnötig. Da er so gut wie kein Geld hatte, waren die Fenster eben halb offen oder halb geschlossen, was immer der letzte Stand der Dinge war, bevor die Seile gerissen und die Gewichte mit einem dumpfen Schlag das Ende des Rahmens, und damit auch das Ende ihrer Bestimmung, erreicht hatten. Oder wie man es eben betrachtete.
Das Haus selbst lag am Ende einer der unbefestigten Straßen, wie es die meisten Straßen in Georgia waren und wahrscheinlich auch immer sein würden. Diese Straßen waren meist privat und das hatte auch seinen guten Grund, wollte man sich doch nicht von irgendeiner Gemeinde oder gar irgendeinem Staat reinreden lassen, wie die Straße aussah, wo hin sie führte, wer dort wohnte und was in ihr passierte.
Und es war auch der Begriff der Freiheit – alles oder nichts – wie man die Dinge hier sah und der das Leben bestimmte. Die Freiheit des Südens, anders zu sein als im Norden, auch wenn man den Krieg verloren hatte. Einen Krieg, den man nicht wollte und zu dem man gezwungen worden war. Einen Krieg, in dem es den Nordstaaten nicht um die Sklaverei ging und niemand diesen, von Anfang an zur Verdammnis bestimmten Wesen auch nur einen Tag der Freiheit gönnen wollte, niemand. Selbst Lincoln bekannte sich im Brief an Horace Greeley dazu. Nur die Geschichte wird immer von denen geschrieben, die siegen, nicht von denen, die am Boden liegen. Und diese Erniedrigung hatte man bis heute nicht vergessen und atmete sie ein, jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde. Man würde nie verzeihen, nie. Man würd nie vergessen. Und immer würde die Südstaatenflagge am Mast wehen und mit dem Wind ihre Botschaft in alle Staaten schicken, die hören und sehen können. Die Botschaft, dass man anders war und den Norden nicht mochte.
Südländische Eichen, gewaltige, urwüchsige Bäume, alt, gedrungen und mit korkiger Rinde, und zusätzlich – um die eigene Majestät noch zu unterstreichen – mit spanischem Moos behangen, das fast zu schwer schien für die doch so gewaltigen Äste und doch so federleicht schwang von Ast zu Ast, begrenzten die braunrote Spur aus Lehm, die zum Haus Hagman führte. Große Steine, die ein Riese dahin geschoben zu haben schien, da diese so plötzlich auftauchen, wie aus einem Traum, der nicht ganz zu Ende geträumt war, lagen wild am Rand des Weges. Daneben und dahinter standen südländische Fichten, krumme, große, hohe Fichten, die nur dazu dienten, den Eindruck von Wald zu vervollständigen und sonst als ziemlich wertlos galten. Dennoch gaben sie dem Ganzen eine Vollständigkeit, wie sie nur die Natur hervorbringen kann, ohne die eine Leere wäre, eine Leere, die unsere Sinne nicht verstehen würden.
Die meterhohen Farne, wie aus Urzeiten vergessene Relikte, sowie das immer präsente Kuzu, eine Art Efeu, das alles einzunehmen versucht, verbanden die Bäume und machten das Ganze zu einer Einheit. Es war wie in einem Gemälde, in allen erdenklichen Farben, von Grün und Braun und Gelb und dem so typischen Ocker. Wie ein Zauberwald, eine undurchdringliche Wand, nicht einladend zum Wandern oder Herumstreunen. Mehr ein Zeugnis von der Machtlosigkeit des Menschen, dem etwas entgegen zu setzen, dem Gefühl, ausgeliefert zu sein und aufgeben zu müssen. Man konnte ihn nicht besiegen, diesen Wald, man konnte nur staunen.
Jonathan selbst war kleinwüchsig, ein wenig übergewichtig, mit einer immer roten Nase und einem von kleinen, blauen Adern wild durchsetztem Gesicht. Kleine, abstehende Ohren, dünne, fast strichartige Lippen und schon sehr lichtes Haar gaben ihm nicht gerade ein attraktives Aussehen, mehr das eines sich vergessenen Südländers, der sich ein wenig zu viel des Moonshines gegönnt hatte.
Marlow County war ein sogenanntes trockenes County, was bedeutete, dass man sich entweder den Alkohol aus dem Nachbar-County besorgen oder eben auf im Haus Gebranntes zurückgreifen musste. Selbstgebranntes hatte den Vorteil, billig zu sein, wenn man auch nicht immer wusste, was man bekam, aber das war kein Problem. Es war nicht der schlechteste Tod, den man sich hier vorstellen konnte, waren doch viele schon tot, wenn sie auch noch auf ihren zwei Beinen laufen konnten. Auch tot sein war nicht das schlechteste Los, das einen hier ereilen konnte. Und wenn schon sterben, dann wenigstens betrunken. Oder in den Armen einer Frau. Frauen waren für Jonathan nicht unbedingt in Fülle vorhanden, also blieb nur die Trunkenheit.
Für Jonathan Hagman war nicht mehr viel Hoffnung in all diesen Anfängen und dem Nichtfertigwerden. All diese endlose Eintönigkeit, die sich immer und immer wiederholende Sinnlosigkeit, musste irgendwann einmal ein Ende haben. Wo dieses Ende allerdings sein würde, war allen Beteiligten, einschließlich ihm selbst, noch immer unbekannt und rätselhaft. Die Dusche brachte ein wenig Kühlung. Der Gedanke, die Nacht mal wieder überstanden zu haben, gab ihm letztlich die Kraft, sich für den Tag fertig zu machen. Ein Tag wie jeder andere, dachte er vor sich hin, sinnlos, ereignislos und endlos.
Das Radio spielte Country, wie fast immer, nur unterbrochen von aufregenden Geschichten über die unheimlichen Preisnachlässe bei den neuesten Autos. Und den noch nie dagewesenen Sonderverkäufen aus aufgelösten Möbelfirmen, die nie wieder in diesem Maße kommen würden, und bei denen es gut wäre, gerade deshalb umgehend zuzuschlagen.
Das bisschen Hoffnung, das er früher noch hatte, hat sich mit den Jahren in das aufgelöst, was es immer war, Hoffnungslosigkeit. Er machte sich etwas vor, sah immer etwas, was nicht existierte, und hatte dennoch für lange Jahre die Kraft, an das zu glauben, was nie eintreffen würde. Nur dass es nie eintreffen würde, das wusste er eben nicht, und das war denn auch gut so. Es ist sicher schlimm, immer dort zu sein, wo keiner ist oder sein will, aber umso leichter zu ertragen, wenn man nichts davon wusste.
Jonathan redete sich ein, eines Tages noch den großen Durchbruch zu schaffen, es allen zu zeigen und dann im ganzen Ort der große Mann zu sein, an den man sich auch in einigen Generationen noch erinnerte. Oder zumindest für ein paar Tage. Heute aber war er noch weit entfernt davon, auch nur den Anschein einer gewissen Unsterblichkeit in sich zu bergen, noch dazu in den derzeitigen Umständen. Auch sollte seine Unsterblichkeit andere Gründe haben, als er sich an diesem Tag dachte.
Er hatte schon auch mal ein Mädchen kennengelernt, oder besser gesagt, sie hatte ihn kennengelernt, oder, noch besser gesagt, er hat sich kennenlernen lassen. Auf einer der Schulpartys, die zu Ehren der Heimkommenden jedes Jahr gegeben wurden, hatte sich Mary-Anne Gilmor an ihn erinnert. Sie war gerade aus einer Beziehung ausgebrochen, die sie fast ein Auge gekostet und die sie gerade noch so überstanden hatte. Jonathan saß alleine auf der Bank, oben auf den Bleachern, wie man die Aluminiumbänke nannte, die man wie eine große Treppe übereinander aufgebaut hatte. Er hatte sich eine Cola und Kartoffelchips geholt und sich auf die oberste Stufe gesetzt. Dort oben wollte er nur dem Footballspiel zusehen, als Mary-Anne von unten und von Weitem seinen Namen rief. Er konnte sich noch schwach daran erinnern, dass sie einmal in derselben Klasse gewesen waren, wenn sie auch damals nichts von ihm hatte wissen wollen. Dies jedoch beruhte zu jener Zeit sehr wohl auf Gegenseitigkeit. Noch bevor er antworten konnte, war sie hochgestiegen und neben ihm gesessen, und hat all die Plattitüden von sich gegeben, die man eben so sagt, wenn man sich ein paar Jahre nicht gesehen und sich auch vorher nichts zu sagen gehabt hatte. Einschließlich, wie gut er heute aussah und wie er sich die letzten Jahre zu seinem Vorteil entwickelt hätte.
Jonathan war nicht sehr beeindruckt, hatte er doch nicht sehr viel Übung und Erfahrung, mit Frauen umzugehen. Aber diese Scharade aus Komplimenten und Nettigkeiten kam sogar ihm ein wenig suspekt vor.
Frauen waren ihm sowieso im Grunde suspekt, irgendwie wie fremde Wesen, die eigentlich nur immer dasselbe wollten: Kinder und Familie, ausgesorgt zu haben, in einem Haus wohnen und nachmittags mit den Freundinnen Kaffee trinken. Im Sommer wollten sie am Pool sitzen und darauf warten, dass der Mann nach Hause kam, um die Steaks auf den Grill zu legen. Jonathan wollte diese Art Glück lieber anderen überlassen und sich mehr um sich selbst kümmern. All die Mühe, die sich Mary-Anne gegeben hatte, war sinnlos verpufft, nicht einmal zu einer gemeinsamen Nacht hatte es gereicht, was sich im Nachhinein als Segen herausstellen sollte, da der Nächste, den sich Mary-Anne dann an diesem Abend noch angelte, zwei Wochen später tot war. Der Verflossene, der Mary-Anne eben fast jenes besagte Auge gekostet hatte, war in rasender Eifersucht in das Haus seines Konkurrenten gestürmt und hatte beide, Mary-Anne und Paul Askmit, so hieß der Unglückselige, mit zwei Magazinen und einer 9mm Lugar durchsiebt. Als Jonathan das in der Zeitung las, war ihm umso mehr bewusst, dass Frauen seiner Gesundheit nicht zuträglich und deshalb unter allen Umständen zu vermeiden waren.
Das Radio spielte jetzt auf einmal, zum wer-weiß-wie-vielten Male, dieselben Elvis-Lieder, die man schon als Kind auswendig gekonnt hatte und die doch immer und immer wieder wiederholt wurden.
Dazwischen kam der Verkehrsbericht, die üblichen Staus in Richtung Atlanta, und dann das Wetter, das wie immer unerträglich heiß sein und nur durch ein Gewitter am Nachmittag abgekühlt werden würde. Johnathan dachte sich manchmal, dass man diese Durchsagen wahrscheinlich auf Band hatte und immer wieder abspielte, ohne dass wirklich jemand dort saß und das von irgendwo herunter las. Er wollte einmal dorthin gehen, in diese Radiostation, und sehen, wie dieser Mann denn aussah, der da immer mit seiner sonoren Stimme den ganzen Tag redete und seine langweiligen Späße machte. Späße, die man schon so oft gehört hatte und über die er selbst immer am besten lachen konnte.
2
Trotz der Dusche immer noch endlos müde, machte sich Jonathan nun dennoch auf den Weg zu seinem Büro, das er sich für ganze 200 Dollar im Monat von einem Anwalt angemietet hatte, der so erfolglos war wie er selbst. Das Büro lag im ersten Stock eines alten, nahezu verfallenen und abgestanden riechenden Baus der zwanziger Jahre, mit einst prächtiger Fassade, die sich allerdings im Lauf der Jahre selbst vergessen hatte. Nichts war mehr gerade, alles war etwas aus dem Winkel und die Bohlen am Boden waren teilweise so von Termiten zerfressen, dass man durch die Zwischenräume in das untere Stockwerk sehen konnte.
Bei jedem Schritt wurde ein wenig von dem rotbraunen Holzstaub aufgewirbelt, den die Termiten zurückgelassen hatten, bevor sogar sie eingesehen hatten, dass da nichts mehr zu holen war. Jonathan hatte für sich einen Weg zurecht gemacht, nicht immer gerade und in einer Linie, aber sicher genug, um nicht stecken zu bleiben oder gar in ein Loch zu treten.
'Jonathan Hagman - Kreditvermittlung'
stand an der Tür auf dunklem Holz, in schönen goldfarbenen Buchstaben, gotisch kursiv. Wenn auch manche der Buchstaben sich schon ein wenig abgelöst hatten. Die Tür war nicht verschlossen; warum auch. Gab es doch nichts zu holen, was auch nur annähernd irgendeinen Wert hatte. Sie zu verschließen hätte bei den wenigen, die hier vorbeizukommen gewohnt waren, nur Argwohn geweckt, da sie nichts Derartiges erwarteten. Außerdem war es grundsätzlich nicht möglich, die Tür zu schließen, da der Spalt zwischen Türblatt und Rahmen die Distanz überstieg, die nötig gewesen wäre, den Riegel in das dafür vorgesehene Loch zu schieben. Es passte halt nicht mehr, wie so viel in seinem Leben nicht mehr passte, auch wenn er sich derzeit darüber keine allzu großen Gedanken machte.
Margarete Mary-Joe Simmons, einfachheitshalber Margret oder Marge genannt, seine Assistentin in all den Jahren, kam noch regelmäßig ins Büro, obwohl es schon lange keinen Scheck mehr gegeben hatte, auf dem ihr Name stand und der wieder einmal nicht eingelöst werden konnte. Ihr Mann, der schon seit etwa 15 Jahren verstorben war, hatte bei der Eisenbahn gearbeitet und war fast das ganze Jahr über immer unterwegs gewesen. Eines Tages, als er einen Wagen abkoppeln sollte, war er nicht rechtzeitig zwischen den Wagons herausgekommen und die Puffer hatten ihm in Hüfthöhe seine Eingeweide zerdrückt. Die Eisenbahngesellschaft hatte die Beerdigung bezahlt und seiner Frau eine kleine Rente bewilligt, von der sich einigermaßen leben ließ, wenn auch große Sprünge nicht gestattet oder möglich waren. Sie hat sich nie wieder nach jemand anderem umgesehen, da sie Angst davor hatte, ständig mit ein und derselben Person zusammen zu sein. War doch ihr Verstorbener ein idealer Ehemann gewesen, immer erreichbar, mit monatlicher Überweisung, und doch so gut wie nie zu Hause. Johns Mutter hatte ihr dann eines Tages vorgeschlagen, doch mal anzufragen, ob ihr Sohn jemanden bräuchte. Und anstatt die Zeit zu Hause totzuschlagen, hatte sie sich angeboten, das Telefon abzunehmen, nur für den Fall, dass mal jemand anruft.
Sie saß bereits auf ihrem Stuhl, als Jonathan ins Büro kam, voll konzentriert auf die Rabatthefte und Coupons der Tageszeitung, nach denen sie sich jeweils ihr Abendessen auszuwählen gedachte. Wie jeden Tag.
Wie immer fragte Johnathan, ob es irgendetwas Neues gäbe, als er an ihr vorbeiging, als wäre sie nicht vorhanden. Sie war daran gewöhnt, nicht aufzufallen. Schon immer war sie nur Haut und Knochen gewesen, kein Gramm Fett war an ihr, aber auch keine Figur. Ein kantiges Gesicht mit vorstehendem Kinn, eine verhältnismäßig große Nase und weit auseinander stehende, kleine Zähne machten das Bild einer eher männlichen Margarete komplett. Früher, in der Schule, und besonders in der Highschool, hatte es sie gestört, dass die Jungens immer hinter anderen Mädchen hergelaufen sind, die mehr um die Brust hatten als sie, aber das hatte sich schnell gegeben. Sie fand es sogar schön und bequem, einfacher und attraktiver, je mehr sie darüber nachdachte und sich damit abfand. Manchmal wusste sie nicht, warum, und in stillen Momenten hatte sie sogar das Gefühl, sich eher zum gleichen Geschlecht hingezogen zu fühlen als zu Männern. Da aber der Priester der baptistischen Kirche, in die sie jeden Sonntag ging, dies immer als Sünde von der Plattform herunter predigte, hatte sie den Gedanken daran sehr schnell aufgegeben. Sündigen wollte sie ja nun doch nicht, und Gott würde doch sehr wohl wissen, was recht war und was nicht. Sie konnte sich doch nicht über Gott stellen und das in Zweifel ziehen. Gefügigkeit war das Gebot, Mahnung und gerechte Gesinnung.
Und wie immer sagte Margarete, „Nein, nichts, alles beim Alten.“ Wie jeden Tag, ohne von was immer sie tat auch nur eine Sekunde aufzublicken. Eine kleine Pause zum Luftholen und wieder ein Coupon für zwei Zahnpasten kostenlos, wenn man eine dritte kaufte, ausgeschnitten.
„Ach doch, Ihre Mutter hat angerufen“, fiel ihr gerade ein, als sie sich wieder auf ihre Arbeiten konzentrieren wollte.
„Sie wollte wissen, ob Sie heute zum Essen kommen“, worauf Jonathan sich zu der der Aussage hinreißen ließ, warum er denn nicht kommen sollte. Er käme doch jeden Dienstag, und das schon seit zwei Jahren. In schöner Regelmäßigkeit und Bequemlichkeit.
Dies war eines der Rituale, die Jonathan etwas gaben, woran er sich festklammern konnte. Regelmäßigkeiten, Gewohnheiten, etwas planen, sei es auch nur das Abendessen mit seiner Mutter. Sie lebte am anderen Ende des Ortes, etwas außerhalb, in dem Haus, das noch sein Vater mit eigenen Händen gebaut hatte, wie er nicht lassen konnte, jeden Tag zu erwähnen, als er noch lebte und in guter Südstaatenmanier die Familie terrorisierte. Seine Mutter hatte diesen Part dann übernommen, als der Vater vor ein paar Jahren an einem Herzinfarkt starb. Übergewichtig von zu vielem frittierten Hühnchen, in Schweinefett gekochten Bohnen, endlosem Kettenrauchen mit den Selbstgedrehten, und völliger Bewegungslosigkeit, war es nur eine Frage der Zeit gewesen, wann das Herz nicht mehr mitmachen würde. Es war sehr schnell gegangen und wie man sagte, hatte er nicht einmal etwas davon gemerkt. Er war einfach auf einmal tot. Tot war er eigentlich schon lange, aber in diesem Moment hatte er auch aufgehört zu atmen, einfach so, als wollte er mal kurz irgendwo hingehen und gleich wiederkommen. Nur mit dem Wiederkehren war das so ein Problem. Es gab kein Wiederkehren in diesem Fall.
Johnathan war sich nicht mal mehr sicher, wann das gewesen war, da er damals kein Interesse daran hatte, in die Klinik zu fahren, als sie ihn anriefen, um ihm das Unvermeidliche mitzuteilen. Sie gaben sich Mühe, es ihm schonend beizubringen, obwohl er von dieser Verschonung absolut nichts hielt und es ihnen dann auch gesagt hatte, woraufhin der Arzt es dann auch sehr kurz machte. Johnathan fragte nur, ob es denn schlimm sei und er etwas tun könne, worauf man bedauerte, dass dies wohl nicht möglich sei, worauf er dann wiederum seine Zweifel äußerte und fragte, was er denn dann dort solle.
Das Verhältnis zu seinem Vater war, um es gelinde zu sagen, nicht existent. John war immer im Schatten seiner Gewalt gewesen, seines Forderns, das er nicht erfüllen konnte und wollte, und im Schatten seiner Arroganz, angeblich alles zu wissen.
Sein Vater war aus dem Krieg gekommen, dem Zweiten Weltkrieg, wie man ihn nannte, voller Zuversicht, sowie der Gewissheit das Richtige getan zu haben und nun endlich das Leben anfangen zu können, von dem er all die Zeit geträumt hatte. Wenn er denn, wo immer er gelegen und darauf gewartet hatte erschossen zu werden, Zeit hatte, diesen Träumen nachzuhängen. Es gab viele Versprechungen nach dem großen Krieg, billige Kredite, um sich den Traum vom eigenen Haus erfüllen zu können, Ausbildung, für die man nichts bezahlen musste, und genug Arbeit, um all das herzustellen, was man so die letzten Jahre hatte vermissen müssen. Alles war auf die Produktion von kriegswichtigen Produkten umgestellt worden, für das große Siegen damals, und keiner konnte etwas kaufen wie Autos, Fahrräder oder Fernseher. Die wichtigen Dinge im Leben waren eben nicht zu haben. Alle Produktion war ausgerichtet auf die Zerstörung des Tyrannen, der die Welt in seinen Klauen gehalten hatte, und den man unter allen Umständen hatte vernichten müssen, koste es, was es wolle.
Die ganze Welt wartete damals darauf, dass Amerika das große Schiff der Freiheit in alle Kontinente schickte, vollgeladen mit all den Annehmlichkeiten des zwanzigsten Jahrhunderts.
Gerald Hagman, wie sein Vater hieß, hatte mit all den großen Dingen, die Amerika geplant hatte, nichts am Hut, er wollte ganz einfach Geld verdienen, ein großes Auto fahren und so viele Frauen wie möglich haben. Gleichzeitig oder nacheinander, was immer der Tag so ergab. Die Papierfabrik war dafür genau das Richtige. Kein zu anstrengender oder auslaugender Job, nicht zu weit weg vom Ort und auch vielversprechend. Papier brauchte man immer und Georgia hatte genug schlechtes Holz, das sich gerade dafür am besten eignete. Hatte man doch die größten Fichtenwälder im Südosten der Staaten, endlose Weiten mit noch zu fällenden Bäumen, in einem Land, in dem fast keiner lebte und wenn, dann nur, weil man es sich nicht leisten konnte, woanders zu sein.
Gerald hatte es bis zum Vormann gebracht, wenn er dadurch dann letztlich auch seine Freunde beaufsichtigen musste, was ihm dann doch nicht ganz so recht war. Dies hatte dann dazu beigetragen, dass er sich abends immer mehr um die Flasche kümmerte als um seine Familie. Seine zukünftige Frau, Jonathans Mutter, hatte im selben Betrieb gearbeitet, wie fast jeder, der nicht entweder auf dem elterlichen Hof oder in der großen Stadt etwas fand. Man sah sich mal ab und zu nach der Arbeit, mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger, bis ihm Jannet, so hieß seine Flamme, die spätere Mutter von Jonathan, eröffnete, dass etwas Kleines unterwegs war. Das war natürlich nicht einkalkuliert oder gewollt, aber eben nicht mehr zu ändern und bedeutete in der Welt der Baptisten und Gottgläubigen heiraten.
Das, was zu tun sei, hatte Jannets Vater Gerald in unmissverständlichen Tönen klar gemacht und sieben Monate nach diesem einfühlsamen Gespräch kam Jonathan auf die Welt. Die Hochzeit war kurz und einfach, aber doch schön, wie man sich eben eine Hochzeit auf einem kleinen Dorf in Georgia vorstellte. Jannet hatte sich von ihrer Mutter ein rosarotes Kleid aus feiner Baumwolle nähen lassen, mit feinen roten Rüschen an der Vorderseite und dem Ausschnitt entlang. Man hatte Schuhe mit hohen Absätzen gekauft, die in der großen Stadt Mode waren, und ihr noch einen Kranz aus Blumen in die Haare geflochten. Sie war eine schöne Braut.
Das halbe Dorf war eingeladen, die zweite Hälfte kam auch, ohne dazu extra gebeten zu werden. Es gab selbstgemachten Kuchen, frittiertes Hühnchen, die nicht zu vermissenden Bohnen, Süßkartoffelsalat, Zitronensaft für die Kinder und Selbstgebranntes für die Erwachsenen. In der Kirche hat der Pfarrer noch von der Wichtigkeit des Zölibats vor der Ehe gesprochen, was besonders bei den jungen anwesenden Frauen nur noch ein leises Gelächter auszulösen vermochte. Wusste man doch, was los war und warum so schnell geheiratet wurde.
Nach der Predigt hatte Jannets Schwester Caroline ein Lied für sie gesungen, das von der ewigen Liebe und den Spaziergängen mit dem Liebsten unter südländischen Eichen in blütenübersäten Wiesen handelte. Es war kein Auge trocken geblieben, alle waren gerührt von den Worten der Poesie und der Träume.
Dann gingen alle gesammelt in das Gemeindehaus, in dem ein Tisch aufgestellt war, auf dem all die Sachen zum Essen bereit waren. Und die Geschenke für das glückliche Paar. Man tanzte nach der Musik der fünfziger Jahre, Elvis, Rock und natürlich auch Country.
Bevor es dunkel wurde, ging man nach Hause, einfach so, als wäre es ein Tag wie jeder andere gewesen. Es gab keine Beleuchtung im Ort, also musste man noch bei Tageslicht die Heimreise antreten.
Eine Hochzeitsreise hatte nicht stattgefunden, dazu war kein Geld da und man hielt sie auch nicht für nötig. Hochzeitsreisen waren für die Reichen, die sich nach der Trauung auf einen Dampfer einschifften und die große Reise um die Welt machten. In Geralds und Jannets Kreisen waren keine großen Überraschungen zu erwarten, also warum eine große Geschichte daraus machen?
Jannet war an sich kein unhübsches Mädchen, mittellange, dunkelbraune Haare, mit einem ein wenig rundlichen Gesicht und etwas zu kleiner Nase, zartrosa Haut und lange, schlanke Beine. Man hatte Gerald sehr wohl um seine Frau beneidet. Wenn auch nicht für lange. Es schien das Schicksal vieler Frauen zu sein, dass ihre Figuren regelrecht explodierten, nachdem die Kinder kamen. Obwohl Jonathan das einzige Kind war, das sie bekommen hatte, waren die Folgen in dieser Hinsicht nicht zu übersehen. Die Haut wurde schlaff, die Figur floss auseinander, das Fett um die Hüften wurde mehr und mehr, und mit diesem Zuwachs an Substanz verflossen entgegengesetzt proportional auch die Zuneigung und der Drang, sich näher zu kommen. Die Sehnsucht hielt sich schon von Anfang an in Grenzen und wäre der Unfall mit dem Kind nicht passiert, wäre diese Affäre wohl ausgegangen wie all die anderen Affären auch.
Man hatte sich dann über die Jahre arrangiert, wie man so sagte. Jeder ging mehr oder weniger seiner eigenen Wege und so gut es ging, wahrte man nach außen hin den Anschein, dass alles, was man tat, schön und einträchtig sei. Jannet hatte sich damit abgefunden, Mutter zu sein und für den Mann da zu sein, wenn immer er es brauchte und verlangte. Sie brauchte nicht viel, nicht viel Zuneigung, Liebe oder Eintracht. Sie brauchte Sicherheit, ein Auskommen. Sie brauchte die Gewissheit, dass am nächsten Tag noch Essen auf dem Tisch war und das Dach nicht undicht.
Die Erinnerung an diese vergangenen Tage und Jahre lebte in ihr wie in einem Roman – oder eher einer tragischen Komödie, die kein Ende nehmen wollte. Auch wenn ihr Mann schon lange tot war, sie hatte das nicht oder nur sehr vage realisiert. Manchmal dachte sie sich, dass er plötzlich zur Tür reinkommen würde, so ganz selbstverständlich, als wäre er gerade mal kurz weg gewesen. Er würde ihr den üblichen, flüchtigen Kuss auf die Stirn geben, sich in den großen Sessel setzen und die lokalen Nachrichten im Fernseher einschalten. Sie hätte ihn gefragt, ob er etwas zu essen haben möchte, und er würde nein sagen, und damit wäre die Unterhaltung für den Abend beendet gewesen. Aus nur für ihn verständlichen Gründen entschloss er sich sehr schnell nach der Hochzeit, meist auswärts zu essen, bevor er nach Hause kam.
Der Sohn war für ihn Nebensache gewesen, immer nur Nebensache. Er sah ihn zum Abend essen, manchmal, und sah es als seine Pflicht an, ihn daran zu erinnern, dass man alles, was man auf dem Teller hatte, auch aufessen müsse, ob es denn nun schmeckte oder nicht. Er selbst aß nichts, aber Jonathan musste am Tisch sitzen bleiben, bis auch der letzte Krümel vom Teller weggeputzt war, auch wenn er sich dabei fast übergeben musste. Strenge Erziehung war das Gebot, war seiner Meinung nach der Beweis der Liebe, da man seinen Sohn nur so und nicht anders auf die Wahrhaftigkeit des Lebens vorbereiten konnte. Seine Frau gab sich zu dieser Zeit mehr mit dem zufrieden, was sie noch zu erwarten hatte, wenn der Abend vorbei war. Manchmal, wenn der Abend vor dem Fernseher für ihren Mann nicht zu lange wurde, konnte sie auf ein bisschen Zärtlichkeit hoffen, wenn die Aussichten auch immer sehr gering waren. Wenn er ins Bett kam, legte er sich oft demonstrativ so weit von ihr weg wie möglich, nur um jede Berührung von vornherein zu vermeiden, obwohl sie doch gerade das so sehr gebraucht hätte und so sehr danach verlangte, dass es schon manchmal weh tat, auch nur daran zu denken. Nichtberühren war eine Strafe, die sich ihr Mann für sie ausgedacht hatte. Und Grund für Strafen gab es gerade genug. Entweder war das Essen, wie meist, nicht gut, war zu kalt, das Haus war nicht sauber genug, die Wäsche war nicht gewaschen, der Sohn war frech geworden und so weiter. Es gab immer einen Grund, nicht brav gewesen zu sein und dafür bestraft werden zu müssen.
Wie gerne hätte sie sich nur einmal berühren lassen, wenn er ins Bett kam, nur einmal seine Hand auf ihren Rücken gespürt, nur ein liebes Wort, nichts Aufregendes, nur einmal das Gefühl, dass man gebraucht und geliebt wurde, als Frau, als Mensch, nur für einen kurzen Moment. Es gab nichts, schon seit Jahren, nichts für sie und nichts für ihren Sohn, den er zwar geholfen hatte, mit auf die Welt zu bringen, aber nicht, mit ihr zusammen zu lieben. Es ist nicht einfach, ein Leben ohne Liebe zu leben, aber umso schwerer ist es, ein Leben als Nichts, an der Seite seiner Liebe zu ertragen.
Für ihren Mann da zu sein, war Verpflichtung, komme, was wolle, und die Regeln wurden nicht von ihr erstellt, sondern nur befolgt.
Wenn sie mal nicht gerade in Stimmung war, sich ihrem Mann hinzugeben, wenn er mal wieder von einem seiner Barumzüge nach Hause kam und sturzbetrunken war – was ihm den Mut gab, sich seiner Frau zu nähern – setzte es schon mal was, was am nächsten Morgen dann an der Farbpalette im Bereich der Augen unweigerlich abzulesen war. Sich bei jemandem zu beschweren, war das Letzte, was sie getan hätte. Und sobald Jonathan alt genug war, um zu verstehen, was vor sich ging, erklärte sie ihm, dass das eben so sei, wenn man sich nicht fügte. Und ausreichend Schminke hatte immer den erhofften Effekt. Zumindest nach außen.
Es war daher sicher nicht nur dem Alter seiner Mutter zuzuschreiben, dass dieselbe Geschichte ihrer Ehe nun schon seit Jahren immer und immer wieder am Dienstagabend auf den Tisch kam. Es war dieser Traum, den sie Tag für Tag erlebte und sich von der Seele reden musste. Ein Traum von einem Leben, das so nicht abgelaufen war wie sie sich es wünschte und von dem sie sich weit mehr erhofft hatte, als sie dann letztendlich bekam. Je älter sie wurde, umso mehr verdrängte sie die Realität und versank in ihrer Scheinwelt.
Jonathan musste dann immer wieder erstaunt ihr zum Gefallen seinem Vater Respekt zollen – ein für ihn widerliches Ritual der Verlogenheit, was seine Mutter wiederum immer wieder zu dem Kommentar veranlasste, dass er wohl doch nicht genug von seinem Vater abbekommen habe.
Zu gerne hätte er ihr dann gesagt, dass dies wohl doch der gute Teil seines Daseins wäre und sie doch froh sein könne. Aber in ihrer Einfältigkeit und Selbstverleugnung hätte sie das wohl nicht verstanden.
„Sie wollte wahrscheinlich nur ein bisschen reden, das wissen Sie doch, sie ruft doch jeden Dienstag an und es hat wahrscheinlich keine tiefere Bedeutung”, sagte Margarete nun, mehr zu sich selbst.
Er hörte Margarete etwas sagen, und auch wieder nicht, wenn er so an ihr vorbei ging und mehr so in seinen Gedanken versunken und verloren an die Stunden dachte, die ihm bevorstanden und ihn so absolut nicht in Euphorie geraten ließen. Er wusste nie, was der Tag bringen würde, was er so den ganzen Tag machen sollte, außer eben die Zeitung lesen und hoffen, dass jemand seine Dienste in Anspruch nehmen würde.
„So wie ich jeden verdammten Dienstag dort hin muss, um mir immer wieder dieselbe Geschichte anzuhören”, murmelte er mehr vor sich hin, als würde er etwas sagen, was Margarete mehr oder weniger ignorierte, die nur meinte, dass das bisschen Post, das gestern gekommen war, auf dem Schreibtisch läge.
„Wahrscheinlich sind das nur Reklamesendungen und Rechnungen. Ist auch ein Brief dabei aus Chicago, von irgendeinem Kreditbüro. Zumindest sieht der offiziell aus oder schon fast wichtig.”
„Ich geh erst mal runter frühstücken”, meinte er. Sprach's, ohne auf ihren Kommentar zu achten, und ließ Margarete mit sich und ihren Sonderangeboten allein. Er ging die schiefen Stufen hinunter, die sich bemühten, nicht aus den Fugen zu krachen, und hinaus aus dem Gebäude, auf die noch leere Straße, in Richtung Café. Margarete sah ihm nach, verdrehte nur kurz ihren Kopf, wedelte mit ihren Händen den Staub vor ihren Augen weg, der stets aufwirbelte, wenn jemand an ihr vorbei ging, und widmete sich wieder ihrer Beschäftigung, den Coupons.
3
Im Deli-Café am Hauptplatz, gleich um die Ecke zwischen dem Büromaterialgeschäft mit all den Möbeln aus den fünfziger Jahren auf der rechten und dem Friseur auf der linken Seite, kannte man ihn so gut wie die abgenutzten, grünen Plastikbezüge der Barhocker vor der Theke. Er hatte seinen Platz am Fenster, gleich die zweite Bucht rechts, neben der Tür. Der Kaffee kam bereits, wenn er die Tür aufmachte und noch bevor er 'Guten Morgen' sagen konnte, was im Allgemeinen sowieso niemand zur Kenntnis nahm. Dann setzte er sich auf die durchlöcherte Bank, die unter seinem Gewicht einen guten halben Meter einsank und die Federn so ungleichmäßig verbog, dass es ihm Probleme bereitete, das Gleichgewicht zu halten. An sich sollten sie die Form halten, aber das war schon seit langer Zeit vorbei und nur die richtige Sitzposition und jahrelanges Training verhinderte, dass man entweder nach links, rechts oder vorne abrutschte.
Das Café war seit Generationen im Besitz derselben Familie, immer wieder weitergegeben an die Tochter, obwohl man in dieser Familie seit jeher verzweifelt und immer wieder vergeblich versucht hatte, einen Sohn zu bekommen. Töchter sind auch nicht das Schlechteste, hat man immer wieder betont, kam so doch frisches Blut in die Sippe. Wenn man sich so umblickte in der Runde der Gäste, konnte man leicht auf den Gedanken kommen, dass dies auch anderen Familien ganz gut getan hätte.
Da war 'Stoik', wie sie ihn nannten, mit richtigem Namen Fred Newman, mit weit offenem Mund und klarem Blick, immer in dieselbe Richtung blickend. Und mit Stirnfalten, die sich über seinen grünen Augen und unter dem schütteren Haar zusammenzogen, als würde er angestrengt über etwas nachdenken. In Wirklichkeit war er nur extrem kurzsichtig und versuchte seit Jahren zu entziffern, was denn auf der Tafel stand, an der Wand ihm gegenüber, am Ende des Raumes, direkt über den Kaffeemaschinen, die das Wasser in den Kannen verdampfen ließen, schneller als ein Tümpel in der Wüste sein Wasser in die brennende Sonne entlässt. Das Stoik näher zur Tafel hin hätte gehen können, kam ihm ebenso wenig in den Sinn, wie die Tatsache, das sich der Text, den er so angestrengt zu lesen versuchte, jeden Tag änderte. Man benutzte die Tafel, um die Spezialitäten des Tages darauf festzuhalten, die sich der Koch am Abend vorher hatte einfallen lassen.
Ed, wie man den Koch nannte, und doch nicht wusste, ob dies sein richtiger Name war, war eines Tages im Ort aufgetaucht. Keiner wusste je woher er gekommen war, aber nachdem er das Schild im Fenster gesehen hatte, worauf stand, dass man einen Koch suchte, hatte er sich eben darauf beworben. Schon am ersten Tag stellte man fest, dass Koch wohl nicht sein erlernter Beruf war, aber da die Gäste meinten, er wäre nicht besser oder schlechter als sein Vorgänger – und sein Vorgänger für ein paar Jahre wegen Körperverletzung in Zwangsurlaub gegangen war – hatte man wohl keine andere Wahl.
Dieser hatte einen Gast vor die Tür gesetzt, nicht ohne diesem vorher noch ein paar Zähne einzuschlagen. Der Gast hatte den Mut gehabt, sich über das Essen zu beschweren, bevor er vom Koch ins Krankenhaus geschickt worden war. Da die Auswahl an Köchen in dieser Gegend nicht gerade üppig war, und das, was man kochen können musste, in ein paar Tagen zu erlernen war, wurde Ed umgehend angestellt.
Ed war dürr wie eine Stange Spargel, obwohl er immer in der Küche stand und alles, was ihm unter die Finger kam, probierte.
„Man kann seinen geschätzten Gästen nicht etwas vorsetzen, was man nicht selbst probiert hat“, war sein Spruch auf die Frage, warum er das tat, und über den jeder, der ihn hörte, nicht genug schmunzeln konnte.
Ed rasierte sich nur am Sonntag, und dann nur die untere Hälfte seines Gesichtes, nicht den Bereich unter der Nase. Diese Stelle ließ er wild wachsen und zwangsläufig hingen diese Haare dann auch schon weit über seinem Mund und das meiste, was er dort hineinschieben wollte, an diesen Haaren. Sonntag war der Tag, an dem er frei hatte und in die Kirche ging. An diesem Tag hatte er auch seine einzige gute Hose an, aufgehängt an zwei blau, weiß und rot gestreiften, an amerikanische Flaggen erinnernden Hosenträgern, ein weißes Hemd mit Rüschen an der Knopfleiste und die obligatorischen roten Reitstiefel, die wegen dem über unzählige Jahre eingeriebenem Speck nur so glänzten. Fast konnte man dadurch geblendet werden, wenn man zu lange hinsah. Nach der Kirche ging er in die Bar, wo er sein Mittagessen verzehrte, sich einige Biere einverleibte, bis er kaum noch laufen konnte, um dann gegen frühen Nachmittag seinen Rausch bis zum nächsten Morgen auszuschlafen. Damit war der Sonntag gelaufen, die Woche konnte von neuem beginnen und das Leben war gerichtet. Es hatte einen Sinn, man konnte darauf rechnen, dass es wieder Sonntag wurde, und das war der Sinn für ihn, für sein Leben, für seine Existenz, die ohne dieses Ritual nur Leere gewesen wäre.
Reden war nicht seine Stärke. Stumm und leise die immer gleiche Melodie vor sich hin pfeifend verrichtete er seine Arbeit und wenn man ihn etwas fragte, konnte es sehr lange dauern, bis er eine kurze, unverbindliche Antwort gab. Die, die ihn kannten, wussten das und hatten sich damit abgefunden. Die, die neu waren, fanden ihn arrogant, abweisend und seltsam irritierend. Man hatte das Gefühl, er wisse etwas und wolle es nicht preisgeben. Vielleicht war es auch sein Leben, das er nicht preisgeben wollte, in dem er sich selbst versteckte und keinen hinein ließ. Da man nicht wusste, woher er kam, oder wie er wirklich hieß – man nur wusste, dass Ed mit Sicherheit nicht sein richtiger Name war – war alles um ihn herum ein großes Geheimnis, das man wohl nur allzu gerne gelöst hätte, aber keine Möglichkeit dazu hatte. In seinen Augen sah man nur die endlose Traurigkeit seiner Vergangenheit, die sich nur sonntags ein wenig lichtete, wenn auch nur für ein paar Stunden. Wenn auch nur im Alkohol und der Einsamkeit seines Daseins.
Und dann war da 'Heavy Meggie', die die Blütezeit ihres Daseins schon sehr lange hinter sich hatte. Ihr Traummann Steve, aus den letzten Jahren der Highschool, hatte sich, nicht ohne eine kleine zweibeinige Erinnerung, die sie ihm zu Ehren 'Steve den Zweiten' nannte, zu hinterlassen, sang- und klanglos aus dem Staub gemacht. Manche sagten, er sei im Gefängnis oder gar erschossen worden, manche meinten, er hätte es geschafft, dort an der Ostküste. Warum gerade an der Ostküste, bleibt wahrscheinlich immer ein Rätsel.
Keiner, der Steve kannte, glaubte jedoch, dass er es jemals weiter als vielleicht nach Kentucky geschafft hat. Allerdings wurde jeder, der diesem Ort für immer zu entkam, als besonders begabt und intelligent betrachtet.
Jonathan war auch einmal einer dieser Gegangenen und Zurückgekommenen, einer derer, von denen man nicht genau wusste, warum sie gegangen waren und auf dem Weg ihrer Träume plötzlich wieder hatten umdrehen müssen. Er sprach nicht darüber, nicht einmal zu sich selbst, was schon einiges zu bedeuten hatte, wenn man ihn kannte.
Er war einfach wieder da. Dieselbe Straße auf und ab gehen, immer wieder, und doch nicht von der Stelle kommen, das ist es, was es war. Sich im Kreise drehen, ein Karussell sein auf dem Jahrmarkt des Lebens. Sich immer wieder drehen, immer auf derselben Stelle, immer zu derselben Musik. Wie das Leben nur eine einzige Rolle Musik hat, ein Thema, das sich wiederholt und immer wieder wiederholt. Diese Karussells haben sich der Macht der Schwerkraft entzogen und sich selbstständig gemacht, hören nicht mehr auf sich zu drehen und alle, die mitfahren, werden nur in die Endlosigkeit entlassen.
Was Meggie betraf, hatten sich im Laufe der Jahre noch vier andere Traummänner erfolgreich an ihr versucht und 'den Zweiten' hinterlassen. Dadurch kam sie mit dem ihr gebotenen Salär vom Staat mehr schlecht als recht, aber dennoch aus. Nur dass sie wegen der einseitigen Ernährung, die hauptsächlich aus in altem Fett gebratenem Hackfleischfladen bestand, eben auch immer mehr an Gewicht zunahm und letztendlich eine Form annahm, die einem jungen, aufgeweckten Mädchen mit großen Träumen nicht mehr ganz gerecht wurde. Die Träume waren noch da, ja, aber es waren eben wirklich nur noch Träume. Das einzige, wovon Meggie wirklich etwas verstand, waren die Schmalzopern, die am Mittag auf all den Kanälen im Fernsehen liefen und nie ausgeschaltet wurden. Geschichten, die immer wieder von denselben aufregenden Dingen des wirklichen Lebens erzählten, Liebe, Eifersucht und Tod. Warum man das wissen musste, war niemanden so richtig klar, aber das war ihr Leben. Es gab ihr Hoffnung, dass es vielleicht ja doch einmal noch werden würde mit ihren Träumen, dass ja doch eines Tages jemand käme, der sie rettet, entführt in die Welt der Schönen und Reichen, wie sie es ja so oft gesehen hatte.
Und dann war da Frank Forsyth, der einzige Anwalt des Ortes und damit auch der ganzen Region. Nicht wirklich der einzige Anwalt, aber der einzige, zu dem man gehen konnte und auch sollte, war er doch mit dem Richter eng befreundet, was so manche Gerichtssache etwas einfacher machte. Er hatte seine Position hier im Ort, seinen ihm gebührenden Respekt, war einer, mit dem man gerne mal essen gehen wollte, es aber nicht wagte, ihn darauf anzusprechen.
„Ja, ja”, pflegte Anna zu sagen, „wenn ich mal 'nen Anwalt brauche, werde ich dich daran erinnern, dass du hier seit Jahren umsonst gefrühstückt hast”, worauf Mr. Forsyth wie immer sehr geschockt drein sah, und um sich herum blickte, nur um sicher zu sein, dass das ja niemand mitbekommen habe.
Wie jeden Tag stand Anna früher oder später mit gespitztem Bleistift, den sie aus unerfindlichem Grund immer wieder abzuschlecken pflegte, und ihrem grünen Bestellblock neben Jonathan, nur um ihm mitzuteilen, dass die zwei Spiegeleier schon unterwegs seien. Im gleichen Atemzug rief sie dann durchs Lokal, dass zwei Spiegeleier für Jonathan zu machen seien, wie immer nur auf einer Seite und nicht ganz durch.
Der lauwarme Kaffee, wie immer schon ein bisschen heruntergebrannt und bitter, wurde von Anna in jede Tasse, die auch nur halbwegs leer war, automatisch und ohne Widerrede zu akzeptieren, eingegossen.
Von allen Seiten war Gerufe und Gemurmel zu hören, Stimmen, die etwas zu erzählen hatten, Nachrichten aus dem Ort und der Umgebung, Erzählungen von der großen Stadt, wo doch jeder hin wollte, wenn er nur mal die Gelegenheit dazu hätte. Manches Mal war ein krampfhaftes Lachen dazwischen, manchmal ein Kichern, wobei man dadurch nur die Aufmerksamkeit auf sich lenken wollte, wenn man gleichzeitig so tat, als wäre dies nun das Letzte, was man wolle.
Es roch nach abgestandenem Fett, gebratenem Speck und verbranntem Toast. Wie eigentlich alles in diesem Lokal abgestanden war. Gerüche eingegraben in die Möbel und die Wände, hatten keine Möglichkeit mehr, zu entfliehen. Keiner hatte die Möglichkeit, dieses Etablissement zu verlassen, und wenn, dann nur für eine kurze Zeit, nur um wieder zurückzukehren, genau an den Platz, den man für ein paar Stunden geräumt hatte. Nicht zurückzukommen, hieß gestorben sein, nie mehr irgendwohin zurückzukommen, nicht mal hierher. Selbst die Gerüche konnten nicht mehr entfliehen.
Draußen vor der Tür fing es an, sich zu regen. Geschäfte machten auf, Botengänge wurden erledigt, der Briefträger fing so langsam an, seine Runde zu drehen, die den ganzen langen Tag dauern würde. Nicht unbedingt, weil sein Bezirk so groß war, sondern mehr, weil er ihn richtig einteilen musste, um nicht zu früh wieder zu Hause zu sein. Es war wichtig, nichts zu übereilen, alles seiner Zeit zu überlassen, damit auch nichts schiefging. Die Ordnung musste erhalten bleiben, das Gleichgewicht gewahrt werden. Sollte es einmal aus der Balance kommen, könnte alles kollabieren, in sich zusammenfallen, wie ein langsam und mühselig aufgebautes Kartenhaus, das, für einige Sekunden sich selbst überlassen, ohne Halt und Basis nur noch ein Haufen Abfall wäre. Balance war wichtig, war die Mutter der Existenz in diesem Dorf, das Alles oder Nichts.
Der Barbier nebenan spritzte mit einem Schlauch Wasser auf den Gehweg, um ein wenig Kühlung in seinen Laden zu bringen. In ein paar Minuten würde der Richter auf seinem Weg zum Büro hier vorbeikommen, um sich rasieren zu lassen, wie er das schon seit vielen Jahren jeden Tag zu machen pflegte. Es war immer gut, ein Ohr am gemeinen Volk zu haben, meinte er, konnte man doch immer einiges erfahren.
Die Wahrheiten, die er so jeden Tag im Gericht hörte, waren umso wahrer – oder auch nicht – umso mehr er sich selbst seinen Reim darauf machen konnte, gemessen an den Geschichten, die man im Ort erzählte und die man am besten beim Barbier in Erfahrung bringen konnte. Der Barbier war die Zeitung, die Morgennachrichten, das Magazin, das Radio und überhaupt alle Formen des Journalismus, in einer Person vereint. Er war das Nachrichtenmagazin des Ortes. Und doch war er verschwiegen wie ein Grab, wie er immer betonte, wollte jemand seine Geschichte an ihn loswerden.
Fitzgerald James Partridge der Dritte, war die richterliche Eminenz im Ort. Sein Vater war bereits Richter gewesen, Partridge der Zweite, und als er dafür zu alt wurde und der Posten zur Verfügung stand, hatte man eben seinen Sohn gewählt. Das war schon viele lange Jahre her und man konnte sich auch nicht mehr so genau daran erinnern, wann es gewesen war, aber das war auch Nebensache. Alle Priester der Umgebung hatten ihren Schäfchen nahegelegt, ein Kreuz ganz oben auf der Liste zu machen, konnten doch gerade mal etwa zwanzig Prozent von denen, die zum Wählen gingen, lesen und schreiben.