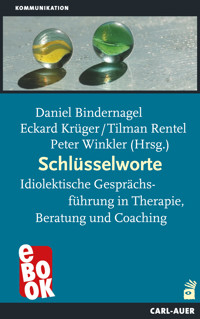
Schlüsselworte E-Book
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Carl-Auer Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Beratung, Coaching, Supervision
- Sprache: Deutsch
"Das Konzept der Idiolektik ist äußerst anregend und es wert, sich mit diesem ganzheitlichen Ansatz intensiv zu beschäftigen. Die Herangehensweise zeichnet sich durch großen Respekt vor der Eigensprache/Eigenart der Patienten aus und ist daher in besonderer Weise resilienzfördernd." Prof. Dr. med. Luise Reddemann "Die aufgenommenen Ideen zur Gesprächsführung lassen sich leicht und Nutzen bringend in die Coaching-Arbeit jedweder theoretischen Herkunft einbringen. – Ein nützliches, lesenswertes Buch!" Coaching-Literatur "Am Ende dieses großartigen Buches hat man zudem viel erfahren über Idiolektik, konditionsfreies Problemlösen, Grundlegendes zur Sprachentwicklung, Ressourcenorientierung und neurowissenschaftliche Aspekte. Dies alles wird in einer so klugen und aufmerksamen Art und Weise präsentiert, dass sich die Leserin reich beschenkt fühlt. Unbedingt lesen!" Systhema "Die Kombination von wissenschaftlichen Ausführungen, Erfahrungsberichten und Gesprächsbeispielen macht das Buch leicht und spannend zu lesen. Es ist allen Fachkräften sehr zu empfehlen, die sich in Forschung, Therapie und Beratung mit Gesprächsführung und der Begleitung von Menschen befassen." Mechthild Herberhold, www.socialnet.de Ich spreche (al)so bin ich Jeder Mensch spricht seine eigene Sprache. Wer genau hinhört, kann z. B. aus der Schilderung eines Problems nicht nur viel über den Umgang mit diesem Problem heraushören, sondern auch über Ressourcen zu seiner Lösung. Idiolektik ist die Kunst eines bewussten, präzisen, sorgfältigen, professionellen und achtsamen Umgangs mit der "Eigensprache" einer Person. Sie sorgt für einen intensiveren Rapport zum Klienten, verbessert die Qualität der Diagnose und der Interventionen und macht Beratungs- und Therapieprozesse insgesamt effizienter. In diesem Buch erklären Ausbilder und Praktiker die Prinzipien der idiolektischen Gesprächsführung und erläutern ihre Wirkungsweise sowie die Integration in verschiedene Therapieverfahren. Fallbeispiele illustrieren die Umsetzung in den unterschiedlichsten Beratungssituationen: Medizin und Psychotherapie, Coaching und Beratung, Sozialarbeit und Seelsorge u. v. m. Mit Beiträgen von: Daniel Bindernagel, Hans Hermann Ehrat, David Jonas, Eckard Krüger, Horst Poimann, Klaus Renfordt, Tilman Rentel, Andreas Speth und Peter Winkler. Über die Herausgeber: Daniel Bindernagel, Dr. med., Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in eigener Praxis. Leitender Arzt an den Kinder- und Jugendpsychiatrischen Diensten St. Gallen 2008 bis 2020; Aufbau einer Säuglings- und Kleinkind-Ambulanz 2004 bis 2020. Forschungstätigkeit in den Bereichen Gruppentherapie, Eltern-Kind-Therapie und tagesklinische kinderpsychiatrische Behandlung. Psychotherapeutische Ausbildungen in Psychodrama auf der Grundlage der jungschen Psychologie, in Systemischer Therapie mit Kindern, Jugendlichen und Familien sowie in idiolektischer Gesprächsführung. 1. Vorsitzender der Gesellschaft für Idiolektik und Gesprächsführung 2015 bis 2020. Publikationen u. a.: Schlüsselworte – Idiolektische Gesprächsführung in Therapie, Beratung und Coaching (zus. mit E. Krüger, T. Rentel u. P. Winkler, 4. Aufl. 2023), Die Eigensprache der Kinder – Idiolektische Gesprächsführung mit Kindern, Jugendlichen und Eltern (2016). Eckard Krüger, M. Sc., Allgemeinmediziner, Heilpraktiker; seit 2000 Ausbilder für die Gesellschaft für Idiolektik und Gesprächsführung; Arbeitsschwerpunkte: Psychosomatik, Naturheilverfahren, Homöopathie, achtsamkeitsbasierte Stressbewältigung, achtsamkeitsbasierte Verhaltenstherapie. Tilman Rentel, Dr. med.; Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie, Facharzt für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie (Tiefenpsychologie und Gestalttherapie); Traumatherapeut (DeGPT und EMDRIA zert., KREST, PITT, Somatic Experiencing).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 419
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Daniel Bindernagel/Eckard Krüger/Tilman Rentel/Peter Winkler (Hrsg.)
Schlüsselworte
Idiolektische Gesprächsführung in Therapie, Beratung und Coaching
Mit einem Geleitwort von Gunther Schmidt
Vierte Auflage, 2023
Mitglieder des wissenschaftlichen Beirats des Carl-Auer Verlags:
Prof. Dr. Rolf Arnold (Kaiserslautern)
Prof. Dr. Dirk Baecker (Witten/Herdecke)
Prof. Dr. Ulrich Clement (Heidelberg)
Prof. Dr. Jörg Fengler (Köln)
Dr. Barbara Heitger (Wien)
Prof. Dr. Johannes Herwig-Lempp (Merseburg)
Prof. Dr. Bruno Hildenbrand (Jena)
Prof. Dr. Karl L. Holtz (Heidelberg)
Prof. Dr. Heiko Kleve (Witten/Herdecke)
Dr. Roswita Königswieser (Wien)
Prof. Dr. Jürgen Kriz (Osnabrück)
Prof. Dr. Friedebert Kröger (Heidelberg)
Tom Levold (Köln)
Dr. Kurt Ludewig (Münster)
Dr. Burkhard Peter (München)
Prof. Dr. Bernhard Pörksen (Tübingen)
Prof. Dr. Kersten Reich (Köln)
Dr. Rüdiger Retzlaff (Heidelberg)
Prof. Dr. Wolf Ritscher (Esslingen)
Dr. Wilhelm Rotthaus (Bergheim bei Köln)
Prof. Dr. Arist von Schlippe (Witten/Herdecke)
Dr. Gunther Schmidt (Heidelberg)
Prof. Dr. Siegfried J. Schmidt (Münster)
Jakob R. Schneider (München)
Prof. Dr. Jochen Schweitzer † (Heidelberg)
Prof. Dr. Fritz B. Simon (Berlin)
Dr. Therese Steiner (Embrach)
Prof. Dr. Dr. Helm Stierlin † (Heidelberg)
Karsten Trebesch (Berlin)
Bernhard Trenkle (Rottweil)
Prof. Dr. Sigrid Tschöpe-Scheffler (Köln)
Prof. Dr. Reinhard Voß (Koblenz)
Dr. Gunthard Weber (Wiesloch)
Prof. Dr. Rudolf Wimmer (Wien)
Prof. Dr. Michael Wirsching (Freiburg)
Prof. Dr. Jan V. Wirth (Meerbusch)
Reihengestaltung: Uwe Göbel
Umschlagfoto: © Julia Marten
Redaktion: Uli Wetz
Satz: Verlagsservice Hegele, Heiligkreuzsteinach
Printed in Germany
Druck und Bindung: CPI books GmbH, Leck
Vierte Auflage, 2023
ISBN 978-3-89670-748-2 (Printausgabe)
ISBN 978-3-8497-8471-3 (ePub)
© 2010, 2023 Carl-Auer-Systeme Verlag
und Verlagsbuchhandlung GmbH, Heidelberg
Alle Rechte vorbehalten
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Informationen zu unserem gesamten Programm, unseren Autoren und zum Verlag finden Sie unter: https://www.carl-auer.de/.
Dort können Sie auch unseren Newsletter abonnieren.
Carl-Auer Verlag GmbH
Vangerowstraße 14 • 69115 Heidelberg
Tel. +49 6221 6438-0 • Fax +49 6221 6438-22
Inhalt
Vorbemerkung der Herausgeber
Geleitwort
Vorwort
Teil I: Grundlagen der Idiolektik
1 Die Eigensprache
David Jonas und Peter Winkler
2 Die Kunst des Fragens
Eckard Krüger
3 Resonanz und Schlüsselworte
Tilman Rentel
4 Bilder und Metaphern
Tilman Rentel
5 Sprachentwicklung und Idiolektik
Daniel Bindernagel
6 Umgang mit Hypothesen – die Vogelperspektive
Peter Winkler
7 Idiolektik und Neurowissenschaften
Daniel Bindernagel und Horst Poimann
8 Ressoucenorientierung in der Idiolektik
Horst Poimann
9 Idiolektische Psychotherapie – ressourcenorientiertes Kurzpsychotherapieverfahren mit neurowissenschaftlichen und evolutionären Grundlagen
Daniel Bindernagel und Peter Winkler
10 Die Eigensprache des Körpers
Peter Winkler
Teil II: Ausgewählte Anwendungsfelder der Idiolektik
11 Allgemeinmedizin
Eckard Krüger
12 Psychosomatik
12.1 Archaische Relikte in der Psychosomatik
Hans Hermann Ehrat
12.2 Interview: Eiserner Ring, organisches Holz und flüssiges Gold
Peter Winkler
13 Traumatherapie
Tilman Rentel
14 Kinder- und Jugendpsychiatrie
Tilman Rentel und Andreas Speth
Ambulanter Praxiskontext
Andreas Speth
Stationärer Praxiskontext
Tilman Rentel
15 Psychoonkologie und Palliative Care
Horst Poimann
16 Seelsorge
Klaus Renfordt
17 Coaching
Thorsten Ellensohn
Aus- und Weiterbildung in Idiolektik
Verzeichnis der Gesprächsbeispiele
Literatur
Über die Autoren
Vorbemerkung der Herausgeber
Das vorliegende Werk ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit von Menschen, die sich seit fast drei Jahrzehnten mit der idiolektischen Methode intensiv beschäftigen. Das Ergebnis entspricht dem aktuellen Stand des Wissens und der Praxis, welches diese Methode betrifft. Insofern kann der Inhalt als ein aktueller Querschnitt des gegenwärtigen Wissens der Idiolektik betrachtet werden. Dieser Querschnitt widmet sich im ersten Teil des Buches den Grundlagen der Idiolektik (was keineswegs immer mit »theoretisch« gleichzusetzen ist). Der zweite Teil des Buches stellt diese Methode im Zusammenhang mit einigen ausgewählten Anwendungsfeldern dar, in denen Idiolektik derzeit praktiziert wird. Dieses gemeinsame theoretische und praktische Wissen wird sich im Laufe der Zeit verändern und weiterentwickeln. Denn es sind die Menschen mit ihren ganz persönlichen und einzigartigen Lebensgeschichten, Wurzeln und Hintergründen, die die Methode anwenden. Im Hinblick auf die Längsschnittperspektive kann das Herausgeberteam als die dritte Generation von »Idiolektikern« betrachtet werden. Die erste Generation stellt A. D. Jonas dar, der die Methode begründete und dem der Platz des einleitenden Artikels »Die Eigensprache« zukommt. Die zweite Generation wird von Horst Poimann und Hans Hermann Ehrat vertreten, die in dem vorliegenden Band maßgebliche Beiträge geleistet haben. Als dritte Generation zeichnet das Herausgeberteam für die Entstehung dieses Werkes verantwortlich. Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass – gemäß der Vorstellung von einer Eigensprache – verschiedene Menschen verschiedene Darstellungsweisen ein und derselben Sache haben. Somit bleibt die letzte Verantwortung für den Inhalt der einzelnen Kapitel natürlich bei den Autoren. Wenn Sie als Leser stellenweise verschiedene Begrifflichkeiten finden, mit denen vermeintlich gleiche Dinge bezeichnet werden, so steht diese Begrifflichkeit wie auch die Ausdrucksweise in einer inneren Beziehung zu den Verfassern der jeweiligen Texte. Gerade wegen der Perspektivenvielfalt ist dieses Buch ein lohnenswerter Einblick in diese Methode. Für das Herausgeberteam war gerade der Diskurs über diese Perspektiven einer der bereicherndsten Aspekte des Prozesses, der zu der vorliegenden Arbeit führte. Dafür bedankt sich das Herausgeberteam bei allen, die sich in irgendeiner Form an diesem Prozess beteiligt haben, und verzichtet darauf, einzelne Namen aufzuführen.
Daniel Bindernagel, Eckard Krüger, Tilman Rentel, Peter Winkler
Mai 2010
Geleitwort
Dieses Buch kommt zur richtigen Zeit. Es ist mir eine Freude, dafür ein kleines Geleitwort schreiben zu dürfen.
Seit vielen Jahren hat es mich immer geschmerzt, dass diese Konzepte der jonasschen Idiolektik eher in relativ kleinen Insiderkreisen diskutiert und genutzt wurden. Wo immer ich die Gelegenheit fand, machte ich in Seminaren, Vorträgen und sonstigen Beiträgen auf sie aufmerksam, um ihre enorm hohe Nützlichkeit zu vermitteln. Oft genug hatte ich aber den Eindruck, dass viele Adressaten meiner Hinweise diese Modelle merkwürdig und exotisch fanden.
Die stürmische Entwicklung der modernen Hirnforschung und damit verwandter Bereiche (z. B. der Embodiment-Forschung, der Priming-Forschung etc.) bringen nun auch wissenschaftlich belegbar ein wichtiges anderes Verständnis von Funktionsweisen des Gehirns. Entscheidend verändern sie das Wissen über den Stellenwert der unbewussten, intuitiven, vieldeutig anmutenden, »irrationalen« Bereiche des Erlebens, die seit der europäischen Aufklärung tendenziell abgewertet, ja oft diffamiert wurden. Und diese Erkenntnisse machen die enorme Bedeutung von Zugängen deutlich, wie sie die Idiolektik bietet.
Heute weiß man, dass gerade die Bereiche des limbischen Systems und anderer (unterhalb der Großhirnrinde angesiedelter) Teilfunktionen des Gehirns von überragender Wichtigkeit sind. Wie G. Roth klar formuliert, kann ohne die Gefühlsfeedbacks des limbischen Systems kein vernünftiges Handeln stattfinden (Roth u. Prinz 1996). Libet (1993) konnte zeigen, dass wichtige Vorentscheidungsprozesse im Zusammenhang mit unbewussten Bereichen unseres Gehirns stattgefunden haben, bevor die bewussten Bereiche davon überhaupt etwas bemerken können. Und A. Damasio bringt es prägnant so auf den Punkt, wenn er sagt, dass jemand, der seine Entscheidungen nach dem Primat der rationalen kognitiven Vernunft im Sinne der europäischen Aufklärung treffen will, eher einem Patienten mit Frontalhirnschädigung gleicht als einem flexibel und kompetent entscheidenden Menschen (Damasio 1997). Der bewusste Verstand wirkt also höchstens als eine Art Berater, der sehr nützlich und wichtig ist. Aber: Der die Entscheidungen fällende »Vorstand« der Entscheidungshierarchie sitzt im limbischen System, eine Willensfreiheit auf bewusster, willkürlicher Ebene haben Menschen nicht (Roth 2004, S. 145).
Es erweist sich also als zentral, die Prozesse im Mittel- und Stammhirn, besonders die des limbischen Systems, sorgfältig zu beachten und zu lernen, wieder intensiv und achtungsvoll mit ihnen zu kooperieren (sie direkt zu vermeiden oder zu verhindern ist ja unmöglich). Solche Kooperation kann aber nur gelingen, wenn man die »Sprache« des Mittel- und Stammhirns verstehen und nutzen kann. Dazu reicht eben die in der kognitiven Welt als »vernünftig« angesehene Zugangsweise nicht aus. Das wird schon dadurch deutlich, dass Mittel- und Stammhirn entwicklungsgeschichtlich wesentlich älter sind als die Großhirnrinde und ungefähr dem Entwicklungsstand der Reptilien (Stammhirn) und dem der frühen Säugetiere (Mittelhirn) entsprechen, worauf schon MacLean, der Begründer der Forschung zum limbischen System, hingewiesen hat. Bei Alligatoren, Kühen und ähnlichen Verwandten von uns (hirngeschichtlich gesehen) wird aber eben nicht geredet, sondern »gebildert«. Und hier erweist sich die besondere Stärke der Idiolektik, denn ich kenne kein anderes Modell in der Psychotherapie, welches so prägnant die »Logik«, Sinnhaftigkeit und Klugheit archaischer Prozesse und damit auch ihre Nutzbarkeit zugänglich macht wie sie.
Zum ersten Mal kam ich mit den Konzepten von David Jonas, der Paläoanthropologie und der Idiolektik, in der Zeit ab 1983 in Berührung. Damals waren sie nur einem sehr kleinen Kreis bekannt. Ich arbeitete zu der Zeit bei Helm Stierlin und hatte das Vergnügen und die Chance, zusammen mit ihm und meinen Kollegen dort (vor allem Gunthard Weber und Fritz B. Simon) an der Entwicklung und Verbreitung systemischer Konzepte im deutschsprachigen Raum quasi Pionierarbeit machen zu können. Ausgelöst durch die Auseinandersetzung mit ihren Wurzeln und ihrer Geschichte, hatte ich dann Ende der 1970er-Jahre noch das große Glück, in Phoenix mit Milton Erickson selbst arbeiten und lernen zu dürfen, dem großen »Vater« der kompetenz- und ressourcenorientierten Hypnotherapie und Psychotherapie. Zusammen mit Stephen Gilligan (einem anderen Schüler von Erickson) konnte ich herausarbeiten, dass man Symptome als Ausdruck von ungewollt induzierten selbsthypnotischen Prozessen verstehen und behandeln kann. Auch sie sind ja Ausdruck unwillkürlicher Prozesse, nur eben ungewünschter, belastender. Wir konnten zeigen, dass sie ausgelöst werden durch ähnliche Prozesse wie die, welche man nutzt, um hilfreiche Trancezustände in der Therapie anzuregen. Dies war eine enorm nützliche Zugangsweise. Zunächst war sie nicht so gut vermittelbar, sowohl bei den Klienten als auch bei Kollegen.
Da fielen mir bei meiner Suche nach hilfreichen Modellen die Arbeiten von David Jonas und Doris Jonas in die Hände. Sofort faszinierten sie mich und zeigten mir hervorragende neue Wege auf, meine Arbeit mit systemischen und hypnotherapeutischen Konzepten (aus denen ich den hypnosystemischen Ansatz entwickelt habe) zu verfeinern und das Spektrum nützlicher Interventionen wesentlich zu erweitern. Manchmal geriet ich fast in ehrfürchtiges Staunen, oft war ich auch emotional sehr berührt davon, wie mit diesen Konzepten ein äußerst achtungsvolles und würdigendes Verständnis von sehr leidvollen Prozessen entwickelt werden kann.
Mit den aus der Paläoanthropolgie abgeleiteten Konzepten der Idiolektik kann schnell verstanden und vermittelt werden, dass leidvolle Prozesse Ausdruck von Kompetenzen und Lösungsstrategien aus unserem archaischen Erbe sind. Sie sind überhaupt erst die Grundlage dafür, dass sich unsere Art so erfolgreich entwickeln konnte. Es wird damit deutlich, dass die Probleme und das Leid nicht von diesen Prozessen selbst kommen, sondern dadurch, dass zwischen kognitiv orientierter bewusster Wahrnehmung (den Großhirnrinden-Prozessen) und den dominierenden Prozessen in Stamm- und Mittelhirn keine kooperative Kommunikation, sondern antagonistische Prozesse vorherrschen. Erst diese mangelnde Kooperation bringt die leidvollen Ergebnisse. Denn das bewusste, kognitiv orientierte »Ich« versucht, die unwillkürlichen Prozesse, die gegen seine Zielvorstellungen wirken, zu bekämpfen und zu beherrschen. Oft unterliegt es den stärkeren und schnelleren Prozessen des Unwillkürlichen, erlebt sich dann als machtloses Opfer und versinkt in Angst, Verzweiflung, Depression oder Selbstentwertung und Selbsthass.
Die Konzepte der Idiolektik sind ideal dafür geeignet, die Dynamik der unwillkürlichen Prozesse zu beschreiben, die gerade in den mehr unbewusst ablaufenden Bereichen des Stamm- und Mittelhirns dominierend wirken. Insofern halfen sie mir optimal, Brücken zu bauen zwischen der Hypnotherapie, die sich ja auch mit Unwillkürlichem beschäftigt, und der systemischen Konzeption. In dieser wird davon ausgegangen, dass jedes Phänomen immer nur verstehbar und auch konstruktiv behandelbar wird, wenn es in Bezug zu seinem relevanten Kontext gesehen wird. Viele Symptome und andere leidvolle Prozesse kann man durch kognitive Zugänge zunächst schwer in einen Kontext einkleiden, der Sinnhaftigkeit nachvollziehbar macht. Die Auseinandersetzung mit Jonas’ Arbeiten zeigte mir schnell:
1)
dass mit idiolektischen Zugängen z. B. so gut wie alle psychosomatischen und auch zunächst noch so bizarr anmutenden psychischen und Verhaltens-»Störungen« (so die in unserem Pathologiesystem üblichen Bezeichnungen) als adäquate und kompetente Lösungsstrategien verstanden und genutzt werden können. Dies wird allerdings erst klar, wenn man sie nicht mit den Maßstäben der kognitiven Konsenslogik misst, sondern mit Bezug auf die archaischen Kontextbedingungen der Arten, von denen wir sie geerbt haben. Denn mit diesem Bezug erweisen sie sich als wichtige und meist erfolgreiche Überlebensstrategien. Wenn wir so die Perspektive erweitern, ergeben sich aber eine große Zahl von hilfreichen Möglichkeiten positiver Umdeutungen, die ja eine besonders wichtige Variante lösungsförderlicher Interventionen darstellen. So entstehen auch viele Chancen, die Symptome konstruktiv zu nutzen als Ausdruck unbewussten Wissens über wichtige Bedürfnisse und damit als kompetente Feedbackschleifen aus dem intuitiven Bereich, die präzise und verlässlich einen Mangel anzeigen, der für gesunde Entwicklung behoben werden sollte. So, wie es ja z. B. lebenswichtig sein kann, dass der Organismus unangenehme Schmerzen produziert, um eine lebensgefährliche Entzündung etc. anzuzeigen und uns zu hilfreichen Handlungen zu bewegen. Und
2)
dass auch Beschwerden, die als rein somatisch eingestuft werden, mit imaginativen Zugängen, die man aus idiolektischen Beschreibungen ableiten kann, durchaus auch über mentale Gestaltungsprozesse sehr günstig beeinflusst werden können, in jedem Fall in ihrer Verarbeitung, oft aber auch direkt in ihrer Entwicklung. So lade ich z. B. seit vielen Jahren in der Therapie von Schmerzzuständen, Allergien, bei Fibromyalgien, aber auch vielen anderen somatisch dominierten Beschwerden die Klienten ein, die körperlichen Prozesse so zu beschreiben, als ob (Interventionsrichtung des »So-tun-als-ob«) sie adäquate Reaktionen des Organismus in einem archaischen Kontext seien.
Wenn z. B. ein Klient dann für seine massiven Pollenallergien Bilder entwickelt, in denen die Pollen wie eine bedrohliche Intervention großer, kugelartiger Geschosse beschrieben werden, die auf seine Augen, Atemwege usw. prallen, kann mit viel Empathie die allergische Reaktion als kompetent bezogen auf dieses archaische Erleben gewürdigt werden. Ich brauche dann nur noch hinzuweisen auf die Erfahrungen mit nächtlichen Albträumen, die jeder Mensch kennt. Dort erleben wir ja ständig, dass die auf unwillkürliche Art (wie eben in Träumen) entwickelten Bilder vom Gehirn jeweils wortwörtlich in körperliche und seelische Reaktionen umgesetzt werden, die exakt diesen Bildern entsprechen. So wird jedem Betroffenen schnell verständlich, dass genau die gleichen quasi albtraumartigen Prozesse bei den leidvollen Beschwerden ablaufen. Auf diese Weise entsteht oft sofort eine deutlich achtungsvollere Beziehung der Menschen zu sich selbst, mit mehr Würde können sie dann gestärkt mit den Beschwerden umgehen. Wenn wir dann noch in diese Bilder hilfreiche Änderungen einführen, z. B. eine imaginierte schützende Umhüllung um die betroffenen Bereiche, sodass die Pollen nicht mehr den Organismus treffen können (immer imaginativ), reagiert der Körper oft schon unmittelbar mit deutlich erlebbarer Besserung. Ich bin immer wieder aufs Neue fasziniert, wie enorm intensiv der Organismus eines Menschen präzise wortwörtlich die hilfreich veränderten Bilder wirksam in gesündere Reaktionen umsetzt. Wenn wir die Erkenntnisse der Hirn- und der Priming-Forschung ernst nehmen, sind solche Abläufe heute keine Überraschung mehr. Gerald Hüther hat z. B. in eindrucksvoller Weise die Macht innerer Bilder beschrieben.
Solche mithilfe der Idiolektik entwickelten imaginativen Zugänge lassen sich auch in Gruppensettings sehr gut nutzen. Sie lassen sich ebenfalls hervorragend mit Zugängen der Körper-, Kunst- und Musiktherapie kombinieren, denn die jeweiligen bildhaften Beschreibungen von Problem- und von Lösungsmustern können noch wirksamer genutzt werden, wenn man alle Sinneskanäle aktiv einbezieht. Die Klienten nutzen sie begeistert, zeigen damit ihre Eigenkompetenz in Selbstorganisation und entwickeln nachweislich schnelle und nachhaltig wirksame Besserungen.
Neben all diesen an sich schon sehr überzeugenden Wirkungen, welche die Konzepte der Idiolektik ermöglichen, erscheint mir ein anderer noch mindestens ebenso wichtig: Menschen sind zumeist sehr mit defizitären, pathologiefokussierten und sich selbst abwertenden Erklärungs- und Bewertungsmodellen identifiziert. Wenn wir das gesicherte Wissen darüber berücksichtigen, dass jedes Erleben immer auch ein Ergebnis der Aufmerksamkeitsfokussierung ist, die gerade praktiziert wird, dann wird sofort ersichtlich, welche verheerende Wirkung das praktisch immer auf kognitive, emotionale, körperliche und auf Verhaltensprozesse hat. Wenn man dann noch sieht, wie intensiv die von uns geforderten traditionellen Diagnosestellungen (z. B. wenn man mit Krankenkassen arbeiten will/muss) in die gleiche Richtung wirken, also die Symptome/Probleme einseitig als Ausdruck von Defizit und Pathologie werten, und dies auch meist noch in unspezifischer, generalisierender Form, dann wird deutlich, dass dieses »Gesundheitssystem« besser als Krankheitssystem bezeichnet werden sollte. Oft genug verstärkt dies nicht nur die Hoffnungslosigkeit und das Inkompetenzerleben der Klienten, sondern verengt auch den Behandlern den Blick.
In unserer Arbeit mit hypnosystemischen Kompetenzfokussierungen können wir jeden Tag erleben, wie schnell befreiend, gesundheitsfördernd und stärkend eine Sicht wirkt, welche den Klienten wieder verstehbar macht, dass ihre Probleme auch als Ausdruck unbewusster Rückmeldekompetenz und intuitiv kluger Lösungsversuche (z. B. in Loyalitätszwickmühlen) verstanden und genutzt werden können. So können kooperative Begegnungen auf ganz gleicher Augenhöhe mit kongruenter Würdigung der Klienten als kompetente Partner gelebt werden. Diese achtungsvolle und nachhaltig hervorragend wirksame Zusammenarbeit ist emotional sehr belohnend für Klienten und Therapeuten. Voraussetzung dafür ist genau die Perspektive, wie sie die differenzierten Konzepte der Idiolektik bieten, die auf ernsthafter und seriöser anthropologischer Forschung gründen. Auch deshalb wünsche ich diesem ausgezeichneten Buch, welches einen profunden Überblick über die aktuellen Entwicklungen der Idiolektik bietet, eine sehr große Resonanz. Ich kann den geneigten Lesern versichern, auch wenn man sie kombiniert mit anderen Konzepten (so wie ich mit den hypnosystemischen) oder in Bewährtes integriert, sind sie ein außerordentlicher Gewinn für alle, die in ihren Genuss kommen können.
Gunther Schmidt
Heidelberg/Siedelsbrunn, April 2010
Vorwort
Medizinisches, psychologisches und pädagogisches Denken und Handeln haben im Zeitenlauf viele und bedeutende Wandlungen bestanden. All diesen Wandlungen ist eines gemeinsam: nämlich das Bestreben, Diagnostik (Erkenntnisse) und Behandlungskonzepte (Verhaltenskonzepte) zu überdenken und, wenn nötig, Korrekturen vorzunehmen und das Gesichtsfeld der Verantwortlichen zu weiten.
Die Intention des vorliegenden Buches ist ganz diesem Grundanliegen verpflichtet. Die zu Wort kommenden Autoren sind alle seit vielen Jahren damit beschäftigt, Wirken und Wirkung einer innovativen, avantgardistischen Methode darzustellen, Erfahrungen mitzuteilen und einen Ausblick in eine neu gestaltete Form in Diagnostik und Behandlungspraxis zu ermöglichen. Sie alle berufen sich auf die Lehre und die Schriften von A. D. Jonas zur idiolektischen (eigensprachlichen) Methode. Der Arzt und Verhaltensforscher lehrte sie im ausgehenden 20. Jahrhundert in Würzburg und Wien und wandte sie in seiner eigenen psychotherapeutischen Praxis an.
Jonas’ Schüler erkannten sehr bald, dass die idiolektische Methode – zunächst eine psychotherapeutisch-psychosomatische Methode im ärztlichen Kontext – auch in anderen Anwendungsfeldern eine große und umwälzende Neuorientierung bewirken kann. So wurde es möglich, dass neben Ärzten auch Psychologen, Lehrer und andere Pädagogen, Pflegende, Seelsorger und in der Beratung Tätige mit der idiolektischen Methode – ausgehend von den jeweiligen Bedürfnissen – ermutigende Resultate erzielten.
Idiolektik – die Lehre von der Eigensprache des Menschen als Hintergrund diagnostischen und therapeutischen Denkens – folgt zwei zentralen Prinzipien: 1) Jedes Lebewesen ist einzigartig, und 2) jedes Lebewesen hat für sein Verhalten Gründe (gute Gründe).
Diese Prinzipien führen zu einer respektvollen Haltung gegenüber unseren Gesprächspartnern, die so zu Experten ihrer eigenen Lebenssituation werden. Durch die so möglichen authentischen Äußerungen kommt in ihrer Eigensprache (Idiolekt) die Gesamtheit ihrer Person zum Ausdruck. In diesen authentischen Äußerungen entdeckt der Sprechende seine Gründe, sich so und nicht anders zu verhalten, sich so und nicht anders zu äußern und in bestimmten Fällen diese und nicht andere Körperreaktionen (Symptome) zu generieren. Dieses jedem Menschen innewohnende selbstorganisierende Prinzip hat A. D. Jonas »innere Weisheit« genannt.
An die Stelle von vermeintlichen Defiziten treten Verstehen und Annehmen der aktuellen körperlich-seelischen Phänomene und der gewählten Lösungen zu bestimmten Lebenssituationen. Sind die seelischen und körperlichen »Aussagen« (Symptome) eines Organismus so »gehört« und »verstanden« worden, müssen sie nicht weiter wiederholt werden. Unter günstigen Umständen kann das dazu führen, dass »Symptome dahinschmelzen wie der Schnee an der Sonne« (mündliche Mitteilung Jonas 1984).
Für die Psychosomatik – eine Disziplin, die sich ganz und gar mit der »Innigkeit von Leib und Seele« befasst – eröffnet sich durch die idiolektische Methode ein neuer Zugang zu Patienten. Sie eröffnet auch eine neue Behandlungsmöglichkeit, deren Wirkung im vorliegenden Buch nachgegangen wird.
Berater, Psychologen und Ärzte, ernüchtert von der Wirkung direktiven Verhaltens, finden und berichten über eine neu gestaltete Möglichkeit, ihre anspruchsvolle Aufgabe sinnvoll und effizient zu lösen und sich aus festgelegten Gewohnheiten ihres Alltages zu befreien. Sie wirken dabei gewissermaßen als Katalysatoren – sie bewirken durch ihre »qualifizierte« Anwesenheit Reaktionen, ohne die Absicht, ihre Geschwindigkeit zu beeinflussen, ohne die neu entstehenden Prozesse in vom Behandler intendierte Bahnen zu lenken. Therapeutisches, beratendes und pädagogisches Denken und Handeln werden so neu geprägt, sind zum Ursprung echter menschlicher Begegnung zurückgekehrt.
Die Lektüre dieses Buches soll allen Lesern dabei behilflich sein, einen neuen Weg beim Umgang mit Klienten oder Patienten zu entdecken. Das Grundanliegen der vorliegenden Beiträge ist ein besseres Verständnis auf allen Ebenen des Denkens und Handelns in Therapie und Beratung.
Eine Kursteilnehmerin drückte dieses Grundanliegen so aus: »Durch den Nebeneingang des Verständnisses gelange ich in einen Raum, und durch das erhabene Portal des Verstanden-worden-Seins gehe ich meinen Weg weiter.«
Hans Hermann Ehrat
Würzburg und Schaffhausen, Mai 2010
Teil I: Grundlagen der Idiolektik
1Die Eigensprache
David Jonas und Peter Winkler1
Der Mensch enthüllt sich in seiner Sprache, verbal, paraverbal und nonverbal. Diese Eigenschaft kommt in jedem Kommunikationsakt zum Ausdruck!
Jeder Mensch hat seine einzigartige Weise, sich auszudrücken, die niemand nachahmen kann. Die Eigensprache ist genauso spezifisch für das Individuum wie seine Fingerabdrücke. Jeder Mensch hat also eine individuelle Eigensprache, er benutzt aber die lexikalischen Wörter, wie sie im Wörterbuch stehen. Er gibt ihnen jedoch seine eigene, besondere Prägung. So erhalten wir, wenn mehrere Menschen dasselbe Wort benutzen und wir fragen, was sie damit meinen, jedes Mal eine unterschiedliche Bedeutung. Die Bedeutung, die von der Person kommt, gibt uns also einen Zugang zur Eigensprache. Das Wort selbst nicht.
Es gehört viel Erfahrung dazu, aus dem Wortgesang, dem Wortbild entnehmen zu können, was der Patient wirklich meint. Es ist viel leichter, einfach nachzufragen: »Ja, was meinen Sie damit?« Da bekommt ihr schon eine Antwort, die unerwartet ist, weil die persönlichen Bedeutungen immer ganz verschieden sind von dem, was man im Wörterbuch findet.
Die spezifischen Wörter, die der Patient benutzt, beziehen sich nicht nur auf die körperlichen Symptome, sondern auch auf die seelischen Probleme, die dahinter sind, und auf seine soziale Situation. Das heißt, er benutzt dasselbe Vokabular, für das eine wie für das andere, sodass man aus der Beschreibung der Symptome die seelischen Probleme herauskristallisieren kann. Und umgekehrt, wenn uns ein Patient die seelischen Probleme erzählt, können wir mit einer ziemlichen Gewissheit die körperlichen Symptome herausdiagnostizieren, bevor er uns noch darüber erzählt.
Organische Symptome haben eine andere Qualität, das hört sich ganz anders an, da wird die Krankheit als etwas Körperfremdes angesehen. Das kann man sehr leicht heraushören, sodass man nach einem einfachen Gespräch einen Hinweis auf eine organische Diagnose bekommen kann.
Wenn wir einfach hinhorchen und uns selbst ausschließen, dann bekommen wir die Sprache. Wenn man in die Sprache einsteigt, unterhält man sich mit der Person auf ihrer Ebene.
Was in dieser Form der Gesprächsführung sehr wichtig ist: Wir müssen uns – und das ist das einzige »muss« – von Werturteilen abschirmen. Ich höre immer wieder: »Es sollte doch möglich sein …«, »Könnte man nicht …« Das sind Konjunktive, die schon eine Zwanghaftigkeit beinhalten, aber der Mensch funktioniert halt nicht so.
Diese Ebene: »Könnte man nicht …«, »Man sollte …«, alle diese Sachen: Weglassen! Nicht, was man könnte, sondern was die Person tut! Wir können nur einen Einstieg in die seelischen Ebenen einer solchen Person erreichen, wenn wir die Sprache des Patienten sprechen. Alles, was wir vorschlagen, ist unsere Sprache und nicht die Sprache des Patienten.
Das technische Wort für die Eigensprache ist »Idiolekt«.
Dieses Wort ist wohl in der Linguistik anerkannt, nicht aber in der Psychologie. Die Bedeutung ist ja, dass jeder Mensch eine ganz bestimmte, auf ihn zugeschnittene oder, um ein Fremdwort zu benutzen, »idiosynkratische« Ausdrucksweise hat, von der er jedoch nicht weiß, dass er sie besitzt.
Im Laufe der Entwicklung dieser Therapie hat sich das Konzept der Eigensprache mehr und mehr verstärkt, zu einem solchen Grad, dass es nahezu ein wissenschaftliches Instrument geworden ist, mit dem man zielgerichtet direkt in die vegetativen Vorgänge des Körpers einsteigen und aufschlussreiche Informationen bekommen kann. Diese Methode ist so verblüffend, wenn ich das sagen darf, dass, wenn man nur darüber spricht, ihr mit Zweifel begegnet wird. Man muss sie tatsächlich erleben, um sie als glaubhaft zu empfinden.
Die Methode hat sich nach und nach herauskristallisiert, und was anfänglich eine intuitive Perzeption der Sprache in ihrer Auswirkung auf die Seele und umgekehrt war, wurde in den letzten zehn Jahren [Aufzeichnung von 1982] durch verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen, vor allem auf dem Gebiet der Neurophysiologie, bestätigt. Die Methode selbst geht ungefähr auf die letzten 15 Jahre [von 1982 ausgehend] zurück. Insofern bestätigt sich, dass jetzt eine wissenschaftliche Grundlage für dieses Konzept da ist.
Wir haben zwei Gehirnhemisphären, eine linke und eine rechte. Die linke ist sprachorientiert in dem Sinne, dass, wenn eine Läsion in der linken Hemisphäre stattfindet, man die Fähigkeit zu sprechen verliert. Lange Zeit hat man gedacht, dass die rechte Hemisphäre stumm sei. Aufgrund von verschiedenen Operationen hat sich jedoch herausgestellt, dass die rechte Hemisphäre gar nicht stumm ist, sondern im Gegenteil sehr viel zu dem, was wir sagen, was wir kommunizieren, beiträgt. Da die rechte Hemisphäre nicht die Fähigkeit hat, sich direkt auszudrücken, hat sich ein Weg ergeben, auf dem die Konzepte, die wir im Kopf haben, von der rechten Hemisphäre beeinflusst werden.
Wenn ich von der rechten und linken Hemisphäre spreche, dann ist das nur eine vorläufige Hypothese, in Wirklichkeit ist es viel komplizierter. Wir haben ein System, das ist das limbische System, das mit den Hemisphären nichts zu tun hat, auf einer tieferen Ebene ist und die Gefühlswelt kontrolliert. [Anmerkung: In der neueren Forschung gibt es mittlerweile Hinweise, dass das limbische System auch einen direkten Beitrag zur Sprachgestaltung leistet (siehe auch Kap. 7). Wir haben einen Frontalkortex, einen Teil des Gehirns, der sehr viel mit Assoziationen zu tun hat. Die Rechts-links-Einteilung ist nur eine provisorische Einteilung, eine Art »Stenografie«, eine Verkürzung, damit man das einfacher versteht. Aber tatsächlich ist das nicht so einfach, dass man sagen kann: Das ist rechts, das ist links, und damit hat sich’s!
Das Interessante ist hier Folgendes: Wenn wir, um ein typisches Beispiel zu nennen, über das Wetter sprechen, ist das eine sachlichdiskursiv logische Besprechung, deren Inhalt objektiv beschreibbar ist. Wir werden aber, ohne dass wir es wissen, etwas über die rechte Hemisphäre hinzufügen, ohne dass sich im logischen Sinne etwas verändert.
Wir können z. B. sagen: »Es regnet«, das übermittelt eine objektive Feststellung. Wir können sagen: »Es ist ein scheußliches Wetter«, das übermittelt auch eine objektive Feststellung. Wir können sagen: »Der Regen fühlt sich gut an«, auch das beinhaltet eine objektive Feststellung.
Aber bei diesen Feststellungen kommt die rechte Hemisphäre hinein, und jetzt können wir aus der Verzerrung der objektiven Feststellung Schlüsse ziehen, die uns direkt zu dem, was bei der Person in der rechten Hemisphäre oder in der Seele stattfindet, hinführen. So können wir uns theoretisch über ein neutrales Gebiet unterhalten – was wir noch zu demonstrieren versuchen werden –, das anscheinend mit der Person überhaupt nichts zu tun hat, und wir bekommen fundamentale Informationen, die dieser Person unbekannt sind. Die Person wird in irgendeiner Weise die Sprache so beeinflussen, dass, wenn ihr das Gehör dafür habt, ihr aus der Beeinflussung oder Verzerrung sehr tief greifende Rückschlüsse ziehen könnt.
Nun, die Problematik liegt darin, dass jemand, der das noch nicht gesehen bzw. gehört hat, sagen würde: »Na ja, das ist halt Ihre Interpretation, wieso wissen Sie, dass es richtig ist?«
Da kommt halt der gewaltige Unterschied dieser Therapie gegenüber anderen Therapien zum Tragen. Es ist nicht, dass der Therapeut die Interpretationen macht, sondern der Patient selbst. Die Weisheit, die sich jetzt hier auftischen wird, kommt von der Person selbst. Die Aufgabe ist einfach, an bestimmten Wendungen der Satzstruktur einzugreifen und nachzufragen und – vor allem das Wichtigste in dieser Therapie – sich belehren zu lassen.
Der Patient ist ständig in der Position, uns zu belehren. Es ist eine ganz charakteristische Stimme, die der Patient hat, wenn er uns belehrt. Nach einer gewissen Zeit, wenn wir ein Gehör dafür haben, hören wir es heraus, und dann müssen wir die Ohren spitzen, denn dann kommen tiefe Weisheiten, »tiefenpsychologische« Konzepte, die man sonst in den Lehrbüchern der Psychologie finden würde, aus dem Munde solcher einfacher Menschen, die keine große Schulvorbildung gehabt haben, die nicht notwendigerweise einen hohen Intelligenzquotienten haben, Jugendliche sein können, sogar Kinder. Eigentlich Kinder noch besser als Erwachsene, sodass dieses Wissen, das nicht dem logischen Wissen entspricht, in dieser Art und Weise einfach zutage gebracht wird.
Nun, eine Frage, die sich immer wieder ergibt: Wenn wir uns ein solches Gespräch anhören, sind wir verblüfft angesichts der Einfachheit dieser Sprache, dieses Austausches. Das hört sich wie ein angenehmes Geplauder an, das kaum irgendwelche toten Stellen hat. Es fließt hin und her wie ein angenehmes Geplauder. Aber wenn wir dann genau hinhören, werden wir überrascht sein, wie viel seelische Fakten da einfach durchdringen. Die Technik ist, wie gesagt, relativ einfach, und gerade, weil sie so einfach ist, ist sie sehr schwer nachzuvollziehen. Was wir hören werden, ist verblüffend einfach, und wenn wir versuchen, es anzuwenden, werden wir sehen, welche Schwierigkeiten auftauchen.
Wir sind gewohnt, logisch zu denken. In dem Moment, wo der Verstand hineinkommt, haben wir den Patienten verloren. Und den Verstand bewusst auszuschalten ist schwierig. Und da liegt die größte Schwierigkeit, z. B. gerade bei den Medizinstudenten, die ja gewohnt sind, alles verstandesgemäß aufzufassen. Die wissen alles, aber haben keinen Zugang zum Patienten. Und Patienten auf einer emotionalen Ebene anzusprechen, die zum Beispiel, wenn wir mit Kindern sprechen, selbstverständlich ist, ist für viele Ärzte sehr schwierig. Die Angst, die da auftaucht bei den Ärzten oder Heilern, ist, dass der Patient sich beleidigt oder nicht ernst genommen fühlen könnte, das sind die Vorstellungen. Stimmt nicht! Gerade, wenn wir so zu ihm sprechen, fühlt er sich verstanden. Und wir etablieren da eine Brücke des Verständnisses, die von Anfang an, in den ersten Minuten, eine Verknüpfung herstellt, die wir mit dem Patienten haben wollen, weil das Verständnis ungeheuer wichtig ist. Die Patient-Therapeut-Beziehung, die sich auf dieser Ebene abspielt, ist ja das Wesen des Heilungsprozesses.
Dieses Wissen stammt nicht von mir, da muss ich in aller Bescheidenheit dem Volksmund den größeren Teil zuschreiben. Im Volksmund, der Jahrtausende an Tradition hinter sich hat, hat sich im Laufe der Zeit dieses Wissen herauskristallisiert, sodass wir im Alltag Redewendungen anwenden, die neurophysiologische Konzepte beinhalten.
Seit Jahrtausenden hat sich diese Form der Eigensprache eingebürgert. Viele dieser Hinweise, wie z. B.: »Ich trage eine Last auf meinen Schultern«, »Ich nehme mir etwas zu Herzen«, »Ich kann es nicht schlucken«, »Das geht mir unter die Haut«, »Ich trage ein Kreuz«, »Ich gehe mit dem Kopf durch die Wand«, das sind unzählige Hinweise, welche Reflexe dafür aktiviert werden, einen seelischen Konflikt auszudrücken.
Und diese Hinweise haben einen ganz bestimmten neurophysiologischen Hintergrund! Nur werden diese Sätze so allgemein gebraucht, dass man sich keine Gedanken darüber macht. Das sind keine leeren Floskeln, sondern wenn jemand sagt: »Ich kann das nicht schlucken« – das sind buchstäblich, man kann’s genau untersuchen, Verkrampfungen im Schlund, und, was noch wichtiger ist, in der Speiseröhre. Erst vor Kurzem hat man in Connecticut in Amerika solche Untersuchungen gemacht, die genau das bestätigen, was ich hier erzähle. Da hat man bei Medizinstudenten eine Sonde in die Speiseröhre eingeführt und gezielte Interviews mit ihnen gemacht. Je nach Material, das besprochen wurde, konnte man auf der Anzeige des Messgerätes Ausschläge sehen, die genau mit den Stress auslösenden Aspekten des Materials übereingestimmt haben, obwohl diese Studenten keine Probleme mit dem Schlucken hatten. So wird klar, dass der ganze Körper auf seelische Probleme reagiert, ohne dass wir es wissen.
Wenn ein Patient eine bestimmte funktionelle Störung hat, die sich beispielsweise auf den Magen bezieht, dann wird man sehen, dass seine Sprache sehr viel von der Physiologie des Magens beinhaltet. Wir haben im Alltagsgebrauch viele solche Redewendungen, wie z. B.: »Ich kann’s nicht schlucken«, »Das liegt mir wie ein Stein im Magen«, »Ich bin sauer auf dich«, dass das schon ein allgemeines Wissen ist. Der Patient wird diese Sprache anwenden, wenn er Probleme mit dem Magen hat.
Der Therapeut wendet dieselbe Sprache an. Er versucht, die Sprache des Patienten zu sprechen. Wir unterhalten uns eigentlich in der rechtshemisphärischen Sprache des Patienten. Diese Art Sprache ist das, was man im Volksmund als »Gequatsche« oder »Geplauder« bezeichnet. Da ist alles rechtshemisphärisch. Wir vermeiden linkshemisphärische Hinweise. Wir versuchen, nicht zu konfrontieren, nicht zu kritisieren, nicht herauszufordern in einer direkten Weise, wenn schon, dann ein bisschen verhüllt. Sodass das Gespräch sich nicht anders anhört als bei zwei Bekannten, die sich gut kennen und sich miteinander unterhalten. Der Unterschied ist natürlich, dass der Therapeut nicht nur mit dem Patienten plaudert, sondern gleichzeitig eine Vogelperspektive hat auf das, was sich da abspielt, und dann durch ein gezieltes Unwissen den Patienten herausfordert, sich zu erklären. Und, wie schon gesagt, in seiner Erklärung ist das Gold der Psychodynamik verhüllt, und das kommt an die Oberfläche.
Wenn ein Patient mir z. B. erzählt, er hat Schuldgefühle, dann frag ich ihn, was er damit meint. Da erstaunt man, wie viele verschiedene Varianten es gibt, wenn man einen Patienten einfach fragt, was er mit Schuldgefühlen meint, da kommt die Eigensprache durch.
Also, die Idee ist, dass man nichts akzeptiert, was sonst offensichtlich ist, sondern sich ständig belehren lässt.
So kann es schon passieren, wenn ich einen Psychologen hier habe, dass er mir schon eine Diagnose anbietet, aber dann frage ich ihn, was er mit dieser Diagnose meint, wie er mir das anders erklären kann.
Oder, was ich gewöhnlich tue, wenn ein Patient hochintelligent ist und sich sehr logisch ausdrückt, dann biete ich ihm eine andere Kommunikationsebene an und sag: »Stellen Sie sich vor, ich bin jetzt sieben oder acht Jahre alt, ich versteh diese abstrakten Konzepte nicht. Erklären Sie mir das so, als ob ich acht Jahre alt wäre und dass ich’s verstehen kann.« Dann wird deutlich, wie mühsam es für diese Leute ist, diese einfache Sprache anzuwenden. Und im Laufe des Gesprächs lernen sie es und sind verblüfft, wie viel sie da kommunizieren können. Aber solche Leute haben Mühe, diese einfache Sprache, die sich zwischen Menschen abspielt, in einem Gespräch, in einem Geplauder anzuwenden, und das sind die Leute, die besonders zwanghaft sind.
In der rechten Hemisphäre ist der ganze Körper vertreten, aber nicht in einer logischen Weise, sondern, wie der Patient das empfindet. Und da ist diese Vorstellung ganz anders als die logische Vorstellung. Wenn der Patient z. B. ein lästiges Symptom hat, ist die Vertretung in der rechten Hemisphäre viel größer, massiver, als es den Tatsachen der funktionellen oder organischen Erkrankung entspricht, sodass die Vertretung in der rechten Hemisphäre den Leidensdruck sehr klar darstellt, was die Symptome für ihn bedeuten. Ein eingewachsener Zehennagel z. B. ist eine triviale Erkrankung, aber für den Patienten, der hinkt und sich behindert fühlt, kann es eine starke Einschränkung sein, und das ergibt sich in der Eigensprache. Das kommt in der Beschreibung durch, diese Wichtigkeit des Symptoms, die ausgedrückt wird.
Die Art, wie wir in dieser Therapie die Dinge auffassen, entspricht der typischen Wahrnehmung eines Künstlers, die ja rechtshemisphärisch ist. Ein Gedicht ist ja, logisch gesehen, ein Unsinn, aber auf der gefühlsmäßigen Basis enthält es in wenigen Zeilen genug Informationen, dass man ein Buch darüber schreiben könnte. Das ist sehr typisch für die rechtshemisphärische Auffassung, die sehr kompakt ist, holistisch.
Und es spielt überhaupt keine Rolle, worüber der Patient spricht. Theoretisch könnten wir über das Wetter sprechen und würden genauso viele Informationen über ihn bekommen, als wenn er über etwas Spezifisches spräche. Die Beschreibung eines Objektes wird unwillkürlich mit der Eigensprache übertüncht, die kommt durch, man kann sie nicht verbergen, das ist das Schöne. Und so könnten wir uns über »triviale Sachen« unterhalten oder über sehr wichtige, das spielt keine Rolle. Nur erwartet der Patient etwas anderes, es würde ihn ja als etwas unangemessen anmuten, wenn wir uns nur über das Wetter unterhalten würden. Aber nichtsdestoweniger können wir das mal machen, über das Wetter sprechen, und da werden wir erstaunt sein, was wir da durchhören können.
Also, das ist unvermeidlich. Es ist ja auch klar, warum:
Der Mensch ist ja hier »das Maß aller Dinge«. Wenn wir etwas »wahr-nehmen«, sehen wir ja nicht das, was draußen ist. Wir nehmen die Gefühle, die wir haben, und legen sie auf das, was draußen ist. Wenn jemand sagt, es ist ein »Sauwetter«, dann kann man sich schon vorstellen, was bei ihm vorgeht. Wenn er sagt, der Regen ist »erfrischend«, dann sieht man eine andere Einstellung. Es ist derselbe Regen. Wenn man genau hinhört, dann kann man aus dem Gespräch über das Wetter viel über den Menschen sagen. Das ist unvermeidlich. Das kann man nicht abschalten. Wenn man offene Ohren hat, hört man das alles durch. Auch so triviale Beschreibungen wie die des Wetters können uns sehr viel über die Person erzählen.
Ein Beispiel: »Saumäßig«
TEILNEHMER: Wie groß ist dann die Gefahr des Hineininterpretierens?
JONAS: Man interpretiert überhaupt nichts hinein. Der Patient erzählt uns.
TEILNEHMER: Ja, aber ich mach ja was damit – oder in dem Fall du.
JONAS: Na ja, schau, wie würdest du das heutige Wetter beschreiben?
TEILNEHMER (lacht): Saumäßig!
JONAS: Dann würd ich dich einfach fragen: Was meinst du mit »saumäßig«? Ich kann mir den Begriff »saumäßig« nicht vorstellen.
TEILNEHMER: Mhm. Wahrscheinlich habe ich das schon immer gesagt, und jetzt sag ich’s auch, so ohne drüber nachzudenken.
JONAS: Ja, aber wenn ich den Begriff nicht kennen würde, wie würdest du mir erklären, was »saumäßig« ist?
TEILNEHMER: Eine negative Vokabel, die ich benutzt habe.
JONAS: Das ist zu gelehrt. Was ist »saumäßig«?
TEILNEHMER: »Saumäßig« ist wahrscheinlich, wie wenn man sich einen Schweinestall vorstellt, dass es stinkt.
JONAS: Ja, da kommen wir schon näher. Es ist kein Zufall, dass im allgemeinen Sprachgebrauch der Begriff »Es stinkt mir« angewendet wird.
Man kann sich das so vorstellen, dass unser Geruchssystem, das olfaktorische System, ja im Laufe der evolutionären Entwicklung zum Sitz der Gefühle geworden ist. Das heutige limbische System war ja, evolutionär gesehen, früher das »Riechhirn«. Das ursprünglich olfaktorische System, das limbische System, verarbeitet also jetzt die Gefühle beim Menschen. Und bei Tieren ist das so, dass da noch eine direkte Verknüpfung vorhanden ist zwischen Geruch und Gefühl. Beim Menschen ist das nicht so direkt, obwohl wir in der Sprache sehr viele Hinweise darauf finden: »Ich kann den nicht riechen« wäre z. B. ein sehr klarer Hinweis, wie man zu dem Gegenüber steht. Und wenn er das jetzt als saumäßig, so wie einen Schweinestall, empfindet, dann kann man sich schon vorstellen, dass ihm viele Sachen »stinken« sozusagen. Dazu könnte man natürlich noch viel sagen, aber wir wollen ja spezifischer sein, das heißt, alles das vom Patienten selber hören. Ich habe jetzt eine Erklärung gegeben, in welche Richtung es geht, aber wenn man geduldig nachfragt, wird er das alles selber erzählen. Dies ist ein typisches Beispiel, dass man dem einfach nicht entgehen kann. Es ist unmöglich! Seine Eigensprache wird alles das prägen, was er sagt.
1 Diese Einführung in das Konzept der Eigensprache besteht aus Auszügen von Transkripten aus Seminarinhalten von A. D. Jonas, die im Rahmen eines Forschungsprojektes von Peter Winkler erstellt wurden (vgl. auch Winkler 2010). Da Jonas Amerikaner war, musste der Text, der aus mehreren Seminaren zusammengesetzt ist, sprachlich und stilistisch etwas überarbeitet werden, damit er gut lesbar ist, wobei die Lebendigkeit der direkten Rede erhalten blieb. Es wurde darauf geachtet, keine inhaltlichen Verfälschungen vorzunehmen.





























