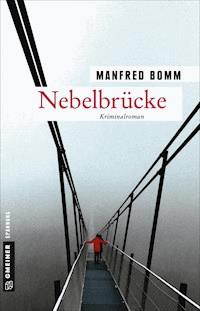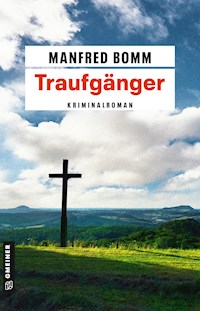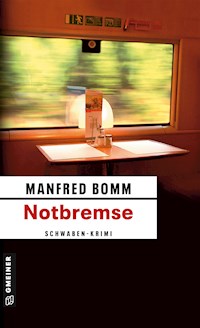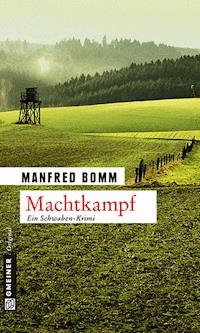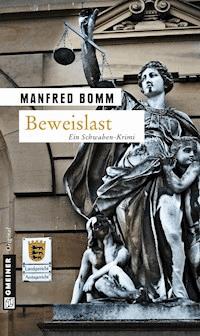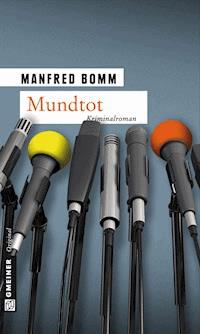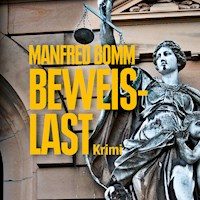Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kommissar August Häberle
- Sprache: Deutsch
Kurz vor dem Ruhestand wird Kommissar August Häberle mit gefälschten Medikamenten und einem Drohnen-Unglück konfrontiert. In beiden Fällen führen die Spuren nach Oberschwaben, wo ein Pharmahändler auf merkwürdige Weise ums Leben kommt und einige Ärzte und Apotheker um ihren guten Ruf bangen. Was Häberle nicht ahnen kann: Es gibt auch einige Frauen, die eine dubiose Rolle zu spielen scheinen. Noch während Häberle seinen 20. Fall klären will, wird bereits seine Abschiedsfeier organisiert …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 640
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Bomm
Schlusswort
Kriminalroman
Impressum
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
1. Auflage 2020
Lektorat: Claudia Senghaas, Kirchardt
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Yury Teploukhov / stock.adobe.com
und © Vista Photo / stock.adobe.com und
© Polizeihistorischer Verein Stuttgart e.V.
Druck: GGP Media GmbH, Pößneck
Printed in Germany
ISBN 978-3-8392-6302-0
Haftungsausschluss
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Vorwort
Gewidmet allen, die nicht der Verlockung des vermeintlich großen Gewinns erliegen, sondern sich durch Ehrlichkeit, Verlässlichkeit und Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft auszeichnen. Wer nur wie ein Besessener nach Macht strebt und auf dem Weg nach oben verbranntes Land hinterlässt, wird eines Tages sehr einsam sein – wenn er kleinlaut und frustriert zurückkehrt und allen wieder begegnet, die er mit Ellbogen beiseitegestoßen hat.
Die Welt ist leider voll von den Rücksichtslosen, den Herrschsüchtigen und Egoisten, die nur fordern und eigenes Unvermögen durch übersteigertes Selbstbewusstsein auszugleichen und von den wahren Problemen abzulenken versuchen.
Gewidmet ist diese Geschichte aber auch jenen, die den Ruhestand genießen können und zu jenen gehören, die das auf immer mehr Druck ausgerichtete Berufsleben satt haben und sich nichts sehnlichster wünschen, als davon befreit zu werden. Wer glaubt, die Menschen immer länger arbeiten lassen zu müssen, der versündigt sich an ihnen und dem Alter. Aber anstatt innovative Ideen zu entwickeln, mit denen die Zukunft lebenswert gestaltet werden kann, wird auf althergebrachte Systeme gepocht, die den Menschen nicht als das sehen, was er ist: nämlich Mensch.
Gewidmet ist das Buch aber auch jenen, die den Mut haben, nicht nur schönzureden, sondern Probleme anzuprangern, ohne Angst davor zu haben, mit dem Hinweis, doch nur »Stammtischgeschwätz« zu verbreiten, diffamiert zu werden.
1
Die Cockpit-Crew des Airbus A 330 war in die Nacht hineingeflogen. Beim Start in Lanzarote hatten die schwarzen Vulkanberge bereits lange Schatten geworfen. Und als die Maschine der British Airways auf Nordkurs schwenkte, lag die afrikanische Westküste schon im Dunkel einer Dezembernacht.
Es war kurz vor 22 Uhr Ortszeit, als der Airliner auf Londons großen Flughafen Gatwick heranschwebte. Der Tower hatte Landerichtung 08 durchgegeben – also in Kompassrichtung 80 Grad, nahezu östlich. Für Maschinen, die sich von Süden näherten, bedeutete dies eine weit ausholende Rechtskurve, sofern keine Warteschleife notwendig wurde.
»Zero, eight, right«, wiederholte der Co-Pilot die Anweisungen des Fluglotsen. Rechte Landebahn. Für die beiden Männer im Cockpit reine Routine. Zwar hatte Gatwick zwei parallel zueinander verlaufende Bahnen, doch konnte jeweils nur eine genutzt werden, weil sie viel zu nahe beieinanderlagen. Außerdem war die »08/links« kürzer und verfügte über kein Instrumentenlandesystem.
Die Landescheinwerfer pflügten durch tief hängende Wolken, als das Fahrwerk mit einem spürbaren Ruck einrastete. Die Instrumente signalisierten den korrekten Gleitweg zu der Landebahn, die nun in einigen Meilen vor ihnen lag – noch von der undurchdringlichen Schwärze dicker Wolken verhüllt.
Die Befeuerung der Landebahn würde erst ab einer Höhe von weniger als tausend Metern über Grund zu sehen sein. Für den Flugkapitän und seinen Ersten Offizier waren dies keine ungewöhnlichen Umstände. Sofern es weder dichten Bodennebel noch orkanartige Stürme oder eine kräftige Gewitterzelle über dem Flughafen gab, konnte man sich auf die moderne Technik verlassen. Jedenfalls würden sie in spätestens dreieinhalb Minuten aufsetzen. Das Dröhnen der Triebwerke, das stundenlang die Maschine erfüllt hatte, war längst einem mäßigeren Sound gewichen, in den sich nun das kräftige Rauschen mischte, das die vorbeistreichende Luft an den ausgefahrenen Landeklappen verursachte.
Im Cockpit machte sich angespanntes Schweigen breit – wie jedes Mal, wenn die Blicke konzentriert auf unzählige beleuchtete Instrumente gerichtet waren. Sie ließen allesamt eine saubere Landung erwarten.
Doch von einer Sekunde auf die andere änderte sich dies: Über ihre Kopfhörer vernahmen die beiden Piloten die Stimme des Fluglotsen – zwar ruhig, sonor und sachlich, völlig unaufgeregt, aber die Anweisung, die er erteilte, war alles andere als beruhigend: Landeanflug sofort abbrechen, nach links drehen und wieder steigen.
Der Kapitän war nur für einen kurzen Moment irritiert und blickte nickend zu seinem Kopiloten, der unterdessen die Anweisung, ohne nachzufragen, wiederholte und damit bestätigte. Beide wussten, was jetzt zu tun war: diverse Tasten und Schalter betätigen und vollen Schub geben, Landeklappen einfahren. Steilkurve links. Die Triebwerke heulten auf.
2
Kurz vor Mitternacht, nur drei Kilometer nordwestlich der Landebahn, unweit des kleinen Orts Charlwood im Bezirk West-Sussex. Das Stanhill Court Hotel schmiegte sich dort wie ein großes Landhaus in eine weitläufige Waldlandschaft. Das Management rühmte sich ob der idyllischen Lage und der verkehrsgünstigen Nähe zum Flughafen – und außerdem sei es ein idealer Ort für Hochzeiten und andere Veranstaltungen, hieß es in den Werbebroschüren.
An diesen Dezembertagen, kurz vor Weihnachten 2018, hatten sich einige gut situierte Herrschaften eingefunden, die aus ganz Europa angereist waren. Offenbar, so hatte die Direktion des Hotels festgestellt, handelte es sich um Vertreter der Pharmaindustrie, aber auch um Ärzte und Apotheker. In einer Branche, die auf Wachstum und Gewinn ausgerichtet war, galt es als durchaus üblich, die wichtigsten Multiplikatoren bisweilen mit einer kleinen Zuwendung und einer bescheidenen Reise bei Laune zu halten. Nun zählte England zwar nicht gerade zu den attraktivsten Reisezielen – zumal schon einmal Japan und Südafrika angeboten worden waren –, doch diesmal, zur Weihnachtszeit, sollte es ein beschauliches, idyllisch gelegenes Hotel sein, von dem aus es nicht weit »zum exklusiven Shoppen« in die Londoner City war. Außerdem lag der Flughafen sozusagen vor der Haustür. Und die Metropole wurde natürlich mit organisierten Taxishuttles angesteuert.
Dass beim opulenten mehrgängigen Abendmenü heute zwei Plätze frei blieben, war nur drei französischen Ärzten aufgefallen, die sich angeregt mit einer jungen Pharmavertreterin aus der Schweiz unterhielten. Bei der anschließenden Show, die einen Querschnitt aus Kabarett, Tanz und Musik bot, hatte sich die Stimmung unter den annähernd hundert Gästen bereits derart gelöst, dass niemand hätte sagen können, ob alle Tagungsteilnehmer anwesend waren. Erst am Morgen danach, als beim Frühstück die beiden Stühle wieder von zwei Männern belegt waren, ließ einer der drei Franzosen mit gedämpfter Stimme eine charmante Bemerkung zum gestrigen Abend fallen: »Sie haben ein vorzügliches Menü verpasst.« Sein französischer Akzent klang sympathisch, worauf einer der beiden jungen Männer lächelnd zurückgab: »Wir haben es schmerzlich vermisst, waren aber leider anderweitig beschäftigt.«
Die Franzosen grinsten und die attraktive Pharmavertreterin, der die Konversation nicht entgangen war, warf den beiden Deutschen einen provokanten Blick zu und meinte auf Schwyzerdeutsch: »Vielleicht kriegen wir ja noch eine kleine Verlängerung.«
Die Deutschen stutzten. »Verlängerung?«, entfuhr es einem von ihnen.
»Haben Sie es nicht in den Nachrichten gehört? Der Flughafen ist seit gestern Abend geschlossen. Man hat unbekannte Flugobjekte gesichtet.«
»U…«, dem Deutschen schien das Wort im Munde stecken geblieben zu sein. »Unbekannte Flugobjekte?«
»Nein, kein Ufo, keine Außerirdischen«, grinste die Frau. »Jemand will Drohnen gesehen haben. Drohnen in der Einflugschneise von Gatwick.«
Die Franzosen richteten ihre Blicke auf sie. »Terroristen?«, entfuhr es einem.
Die junge Dame zuckte mit ihren schmalen Schultern und sah die beiden Deutschen argwöhnisch an.
3
Auch ein halbes Jahr nach diesem Zwischenfall blieb rätselhaft, was den Flugverkehr in Gatwick an jenem Dezemberabend 2018 beeinträchtigt hatte. Die Behörden waren stundenlang in Alarmbereitschaft gewesen, doch noch vor Weihnachten hatte die Polizei in London verlautbart, die Drohnensichtung sei möglicherweise »ein Irrtum« gewesen und es habe demzufolge vermutlich gar kein unbekanntes Flugobjekt in Flughafennähe gegeben. Zwei Verdächtige, denen vorgeworfen worden war, mit einer Drohne den Flugverkehr lahmgelegt zu haben, hatte man wieder freilassen müssen. Jetzt, Anfang Mai 2019, war das Thema »Drohnen« längst aus den Nachrichten verschwunden und vergessen. Doch es sollte anders kommen. Auf der Autobahn A 8. Für den Fahrer eines Wohnwagengespanns.
Die Fahrt war lang und anstrengend. Seit Karlsruhe schon kämpfte er gegen die bleierne Müdigkeit. Die erbarmungslose Sommerhitze und die endlose Kolonne der Lastwagen drohten ihn langsam einzuschläfern. Überholen war meist mühsam, wollte er das generelle Tempolimit von 100 Stundenkilometern, das für sein Wohnwagengespann galt, nicht deutlich überschreiten. Ausscheren wäre ziemlich riskant, weil die nachfolgenden Pkw mit teilweise atemberaubendem Tempo an ihm vorbeirauschten. Ihm aber ging die Sicherheit vor. Schließlich gehörte er einer Generation an, die nicht mit Raserei protzen musste.
Peter Ackermann, erst kürzlich mit 63 Jahren in den lang ersehnten Ruhestand getreten, hatte allerdings einige Zeit gebraucht, um sich an das Fahrverhalten eines Anhängers zu gewöhnen. Immerhin war es die erste Urlaubsfahrt mit diesem Gefährt gewesen. Den luxuriösen Caravan hatten er und seine Frau Cornelia erst vor zwei Monaten gekauft. Für den Start in das Rentnerdasein.
Mehr als zehn Stunden waren sie seit ihrer Abfahrt auf dem Campingplatz im niederländischen Renesse unterwegs, als endlich vor ihnen, nach dem Stuttgarter Flughafen, in der späten Abendsonne jener bläuliche Höhenzug auftauchte, der die Schwäbische Alb markierte. Bis Ulm, ihre Heimatstadt, waren es noch etwa 100 Kilometer.
Das sportliche Ehepaar hatte einen traumhaften Frühjahrsurlaub an der Nordsee verbracht. Zeeland, wie der Landstrich im Mündungsgebiet des Rheins und anderer Flüsse genannt wurde, bot Natur pur, vor allem aber unendlich viele Radwege. Die ganzen Niederlande waren von einem engmaschigen Wegenetz durchzogen, mit dem sich kinderleicht individuelle Routen zusammenstellen ließen. Als Orientierung galten sogenannte Knotenpunkte, von denen aus es sternförmig wieder zu den nächsten ging. Ein geniales System, so hatten die beiden Urlauber dies empfunden und deshalb ihre vor Ort geliehenen Fahrräder fast jeden Tag benutzt. »Sogar ohne Motor«, wie Peter Ackermann oft voller Stolz erklärte, um augenzwinkernd hinzuzufügen, dass die topfebenen Niederlande auch mit Muskelkraft zu bewältigen seien – vorausgesetzt natürlich, es gab keinen kräftigen Gegenwind.
»Sollen wir noch kurz eine Pause einlegen?«, riss ihn Cornelias Stimme aus den Gedanken an die zurückliegenden Urlaubswochen, als bei Stuttgart gerade das große, über die Autobahn gebaute Parkhaus mit der roten Aufschrift »Bosch« einen flüchtigen Schatten warf.
»Nein, es geht schon«, brummte Peter, der die Klimaanlage des VW Touareg kühler drehte. »In spätestens eineinhalb Stunden sind wir daheim.« Kaum hatte er es ausgesprochen, meldete der Südwestrundfunk »fünf Kilometer Stau vor der Ausfahrt Mühlhausen«.
»Wieder dieser Schwachsinn«, wurde Peter munterer. »Nur der Tunnel! Blockabfertigung. Ein Irrsinn.« Wann immer er dort vorbeikam, musste er sich über die Verkehrsbehörde ärgern. Nur weil die Gruibinger einen Lärmschutztunnel bekommen hatten, wurde ein künstlicher Stau verursacht: Sobald sich nämlich dahinter, beim folgenden Albaufstieg, der Verkehr verdichtete, schaltete die Ampel vor dem Tunnelportal auf Rot, um durch Blockabfertigung einen Stau im Tunnel zu verhindern – aus Sicherheitsgründen. Diese künstliche Störung des Verkehrs produzierte aber erst recht einen kilometerlangen Stau. Peter war aber viel zu müde, um seinen Zorn »über diesen Blödsinn«, wie er ansonsten gesagt hätte, in markige Worte zu kleiden.
Schweigend ließ er den PS-starken Volkswagen-SUV auf der Mittelspur an der Lkw-Kolonne vorbeirollen. Rechts der Autobahn war kilometerweit die riesige Geländewunde zu sehen, in der einmal die Schnellbahntrasse zwischen Stuttgart und Ulm verlaufen würde.
Als der SWR die 21-Uhr-Nachrichten ausstrahlte, lag das breite, geschwungene Asphaltband vor ihnen, mit dem die A 8 am Aichelberg die erste Stufe der Schwäbischen Alb erklomm. Wie immer werktags krochen auf der rechten Spur die schweren Lastwagen hinauf, während sich auf der Mittelspur unzählige Kastenwagen gegenseitig nach oben zu drängeln schienen. Links preschten all jene vorbei, die sich um die ausgewiesene 120-Stundenkilometer-Beschränkung einen Dreck scherten, dachte Peter. Immer wieder staunte er darüber, wie leichtfertig und vorsätzlich viele Autofahrer ein Bußgeld oder gar ihren Führerschein riskierten.
Erstaunlich zügig kam das Wohnwagengespann vorwärts, passierte die sogenannte Grünbrücke am Höhenrücken hinterm Aichelberg, wo die Autobahn auf einem kühnen Brückenbauwerk eine tief eingeschnittene bewaldete Schlucht querte, den »Maustobel«, wie es auf einem Hinweisschild zu lesen stand. Der starke Dieselmotor des Touareg zog den Wohnwagen mühelos mit 110 Stundenkilometern bergaufwärts und lässig an den 30-Tonnern vorbei, die rechts hintereinander her krochen.
Cornelia sah auf die Armbanduhr. »Wir schaffen’s noch, bei Tageslicht heimzukommen«, stellte sie fest. An diesen Frühlingstagen wurde es erst gegen 21 Uhr dunkel.
Peter beschleunigte den Touareg, war aber darauf gefasst, bald auf das Stauende zu treffen. Dass die Gefahr von ganz anderswo herkommen würde, konnte er nicht ahnen. Eine Chance, etwas dagegen zu unternehmen, gab es ohnehin nicht. Gerade als das Gespann an einem blauen 40-Tonner vorbeizog, war es da. Blitzartig, dunkel, von oben – und direkt auf die Windschutzscheibe. Ein ohrenbetäubender dumpfer Schlag. Peter war für den Bruchteil einer Schrecksekunde wie betäubt, realisierte aber, dass die Scheibe in tausend kleine Stücke zerborsten war und ihm wie ein dicht gewobenes Spinnennetz die Sicht nahm. Und dass sich irgendetwas Großes darin verklemmt hatte. Zwischen ihm und Cornelia. Er trat abrupt auf die Bremse, versuchte ohne Sicht auf die Straße, die Spur zu halten, doch dann wurde der Touareg von einem großen Rad des daneben fahrenden Sattelzugs erfasst.
Für Peter erlosch das Licht.
Was geschehen war, erfuhr er erst zwei Tage später in der Klinik.
4
Noch bevor Peter Ackermann das ganze Ausmaß dessen, was auf der Maustobelbrücke geschehen war, von einem Notfallseelsorger am Krankenbett mitgeteilt bekam, hatten die Zeitungen der Umgebung bereits groß darüber berichtet. »Drohne tötet Frau«, titelte ein Boulevardblatt aus dem Raum Stuttgart. Im Text hieß es, dass eine »offenbar außer Kontrolle geratene Drohne« die Ursache für einen folgenschweren Verkehrsunfall gewesen sei, bei dem die 59-jährige Beifahrerin eines VW Touareg getötet und ihr 63-jähriger Ehemann als Fahrer schwer verletzt worden seien. Und weiter: »Das Ehepaar war mit dem Wohnwagen auf der Heimreise aus dem Urlaub und befand sich auf dem mittleren Fahrstreifen der am Aichelberg dreispurigen Autobahn. Den Ermittlungen zufolge stürzte ein etwa zehn Kilo schwerer Quadrocopter in die Windschutzscheibe, worauf das Fahrzeug gegen einen rechts fahrenden Sattelzug prallte und von dessen linken Rädern erfasst wurde. An Pkw und Wohnwagen entstand Totalschaden.« Ausgiebig befassten sich die Verfasser der verschiedenen Zeitungsartikel mit der Frage, ob der Eigentümer der Drohne ermittelt werden konnte. Ein Polizeisprecher hatte sich so geäußert: »Wir gehen momentan sogar von zwei Drohnen aus, die offenbar außer Kontrolle geraten und möglicherweise im Flug zusammengestoßen sind. Ein zweites Fluggerät fand sich auf einem Baum unterhalb der Maustobelbrücke. Obwohl für Drohnen dieser Gewichtsklasse eine Kennzeichnungspflicht besteht, also Adresse des Eigentümers, ist auf keiner der beiden Fluggeräte ein solcher Hinweis angebracht.« Als Zeuge wurde der Fahrer des Sattelzuges zitiert, der den Quadrocopter »von rechts oben ziemlich senkrecht herabrasen« gesehen und deshalb scharf abgebremst habe.
In allen Zeitungsartikeln wurde die Bevölkerung aufgerufen, bei der Suche nach den Drohnen-Eigentümern behilflich zu sein. Gesucht seien auch Zeugen, die an diesem Abend im Großraum rund um die Maustobelbrücke Personen gesehen hätten, die mit dem Start einer oder mehrerer Drohnen (»Quadrocopter«) beschäftigt gewesen seien.
Ausführlich wurde wieder in den Zeitungen die Drohnensichtung vom Londoner Flughafen Gatwick vor einem halben Jahr ins Gedächtnis gerufen – als Beweis dafür, wie gefährlich diese Flugobjekte sein konnten. Dass es in London letztlich keine Anhaltspunkte für eine Drohne gegeben hatte, wurde jedoch nur am Rande erwähnt.
Im jüngsten Fall freilich bestand keinerlei Zweifel, was das verheerende Unglück ausgelöst hatte. Die Kriminalpolizei, so hieß es in den Meldungen, habe eine Ermittlungsgruppe zusammengestellt.
In diesem Frühsommer 2019 jedoch fand sich keine Spur zu den Eigentümern. Als Peter Ackermann nach einer Woche Klinik und drei Wochen Reha nach Hause kam, war er ein gebrochener Mann. Doch er schwor Rache. Er würde nicht ruhen, bis er jene Personen ausfindig gemacht hatte, die seine Frau auf dem Gewissen hatten.
5
Eigentlich wär’s ein handfester Skandal gewesen. Aber die Öffentlichkeit in Deutschland hatte vor einem Jahr erstaunlicherweise nur am Rande wahrgenommen, was da aufgedeckt worden war: ein Apotheker sollte angeblich mehrere Ärzte und Kliniken mit falsch dosierten Krebsmedikamenten beliefert haben. Tausende Patienten seien damit nicht ordnungsgemäß behandelt und somit gefährdet worden. Der Pharmazeut soll auf diese Weise die Krankenkassen um 56 Millionen Euro betrogen haben. Im Juli 2018 war dann das Urteil gefallen: zwölf Jahre Gefängnis.
Jetzt aber, ein Jahr danach, in diesem Sommer 2019, schien es, als hätte die Staatsanwaltschaft einen weiteren Skandal dieser Art ins Visier genommen: Über einen »Mittelsmann«, so hieß es jüngst in einer Dokumentation des Fernsehens, seien gepanschte Medikamente »in ganz großem Stil« aus dem Ausland nach Deutschland gebracht und vielen Kliniken und Apothekern angeboten worden. Diese hätten angesichts der relativ günstigen Einkaufspreise zugegriffen, jedoch gegenüber den Krankenkassen die handelsüblichen Kosten abgerechnet. Freilich wollte sich die ermittelnde Staatsanwaltschaft Konstanz öffentlich dazu nicht äußern. Weder zum Umfang der Betrügereien noch zu deren Folgen oder zu den Tatorten. Aus dem Zuständigkeitsbereich der Ermittlungsbehörde hatten die Medien allerdings geschlossen, dass sich der Fall irgendwo im nordwestlichen Bereich des Bodensees oder im Raum Konstanz zugetragen haben musste.
»Wir stehen erst am Anfang der Ermittlungen«, hatte der Pressesprecher in die Mikrofone gesagt.
Ein Reporter hakte nach: »Hat der Fall dieselben Dimensionen wie jener, der in Norddeutschland vor einem Jahr vor Gericht verhandelt wurde?«
Antwort des Juristen: »Keine Angaben, tut mir leid.«
Eine junge Journalistin eines Privatradios wollte wissen: »Sind auch Reha-Kliniken in die Sache involviert?«
Der Jurist ließ sich nichts entlocken: »Kein Kommentar.«
Ein Fernsehjournalist hakte ruhig nach: »Könnte es sein, dass Konstanz dabei eine tragende Rolle spielt?«
Der Sprecher der Staatsanwaltschaft behielt sein Pokerface bei: »Ich kann nur wiederholen, was ich bereits mehrfach gesagt habe: Wir bestätigen, dass es ein Ermittlungsverfahren gibt – aber mehr ist beim jetzigen Stand nicht zu sagen.«
Die Journalisten gaben zähneknirschend auf. Dem Juristen war jedoch klar, dass sich die Angelegenheit bald nicht mehr würde geheim halten lassen.
6
»Nur Fliegen ist schöner«, meinte der sportliche Mittdreißiger, als er an diesem herrlichen Sommerabend aus der zweisitzigen Cessna 152 stieg und mit einem gequälten Lächeln seinem langjährigen Freund mit »Daumen hoch« signalisierte, dass zumindest der Rundflug fantastisch gewesen sei. Ihr Gespräch, das sich ums Geschäftliche gedreht hatte, wohl eher nicht.
Aber wenigstens die Fliegerei verband sie noch. Beide hatten sie ihre Privatpilotenlizenz vor geraumer Zeit erworben. Doch Dr. Markus Kerkhoff, Leiter einer Privatklinik in Bad Waldsee, hatte anschließend gar nicht die Zeit gehabt, die regelmäßigen Flugstunden zu absolvieren, die damals den Hobbyfliegern für den Erhalt der Lizenz zwingend vorgeschrieben waren. Inzwischen hatte man die Bestimmungen durch regelmäßige Befähigungsnachweise zwar etwas gelockert, aber trotzdem schien es angeraten, in steter Übung zu bleiben.
Kerkhoff jedenfalls hatte die aktive Fliegerei deshalb wieder aufgegeben und genoss es, gelegentlich in der Maschine seines Fliegerkameraden Frank Mittelberg die Welt von oben zu sehen. Auch wenn ihr gegenseitiges Verhältnis nicht mehr ganz ungetrübt war, so konnte er doch auf diese Weise jedes Mal den traumhaften Blick auf den Bodensee, die Schwäbische Alb, den Schwarzwald oder die Alpen genießen. Und wenn es etwas zu bereden gab, dann lockerte ein gemeinsamer Flug meist die angespannte Atmosphäre.
Mittelberg war als Pharmaziegroßhändler vermögend genug, um sich dieses kleine Sportflugzeug leisten zu können. Außerdem nutzte er die Maschine auch beruflich – wenn er überall in Deutschland und Österreich Apotheker, Ärzte, Kliniken oder Pharmaunternehmen besuchen musste. Das machte allerdings nur bei stabilem Wetter Sinn, weil er kein »Instrumentenflieger« war und es somit sichergestellt sein musste, dass er auch den Rückflug wie geplant antreten konnte.
Mittelberg verabschiedete sich von seinem Passagier und rollte zur Graspiste zurück. Der kleine Tower von Reute bei Bad Waldsee war zu dieser abendlichen Stunde nicht mehr besetzt, sodass eigentlich keine Starts und Landungen mehr hätten erfolgen dürfen. Aber Mittelberg war abgebrüht genug, um gegen diese Vorschrift zu verstoßen, zumal er sich selbst oft als »Himmelhund« bezeichnete.
Er konnte Start und Landung riskieren, auch wenn hier draußen noch einige Spaziergänger unterwegs waren. Außenstehende kannten sich in den fliegerischen Bestimmungen normalerweise ohnehin nicht aus.
Dr. Kerkhoff blieb noch einen Moment am Rande des Flugfeldes stehen und schaute der startenden Maschine seines Freundes nach. Während sich die blau-weiße Cessna gemächlich von der Wiese löste und anscheinend schwerelos davonschwebte, über Sträucher hinweg, verspürte er wieder das wehmütige Gefühl, nicht mehr selbst fliegen zu dürfen.
Die Faszination des Fliegens hielt ihn noch immer gefangen. Frank hatte ihm deshalb vor geraumer Zeit eine Art Ersatzhobby vorgeschlagen. Für einen Moment musste Kerkhoff daran denken, als er zum Parkplatz hinüberging, wo er erwartet wurde.
Auf dem kurzen Weg dorthin, um den Tower herum, ließ er gedanklich das Gespräch Revue passieren, das er mit Frank geführt hatte. Über etwas, was zwischen ihnen stand und ihre Männerfreundschaft auf eine harte Probe zu stellen schien. Nicht nur einer Frau wegen …
7
Apotheker Rolf Patten hatte seinen alten Freund, den niedergelassenen Arzt Dr. Friedrich Hagebusch, in ein Hinterzimmer seiner Apotheke in Bad Waldsee gebeten und die Tür sanft ins Schloss fallen lassen. Die beiden Helferinnen durften unter keinen Umständen hören, was es zu bereden gab.
Patten, ein großer, stattlicher Mann mit rotem Gesicht und schütterem Haar, saß dem hageren Mediziner gegenüber und kam gleich zur Sache: »Die Marion Schewe ist wieder da. So heißt es in der Klinik.«
Dr. Hagebusch strich nervös über den Oberlippenbart. »Und dieser Pharmafritze? Der Mittelberg?«
»Taucht auch immer wieder hier auf.« Patten lehnte sich tief einatmend zurück und grinste: »Du weißt doch: Immer wenn sie auch da ist.«
Hagebusch spielte mit einem Kugelschreiber und wurde energisch: »Du, ich sag dir, die Sache stinkt. Und ich lass mir nicht ans Bein pinkeln, verstehst du? Mir war von vorneherein klar, dass die Sache nicht hasenrein ist. Erinnerst du dich? Ich hab immer gesagt: So billig kann kein Mensch Medikamente anbieten und dann noch eine tolle Provision zahlen, damit wir Ärzte sie verschreiben.«
Apotheker Patten nickte nachdenklich und runzelte die Stirn: »Wir haben zwei Möglichkeiten«, begann er sachlich. »Wir lassen die Pharma-Jungs von China hochgehen und riskieren es, die Nase selbst noch kräftig reinzukriegen – oder wir müssen alle Spuren beseitigen, um uns selbst aus der Schusslinie zu nehmen.«
»Spuren beseitigen!« Hagebusch warf den Kugelschreiber erschrocken auf den Tisch. »Wie das klingt! Wie bei Kriminellen! Wie stellst du dir das vor, Spuren beseitigen? Das ist doch heutzutage alles irgendwo und irgendwie gespeichert. Im schlimmsten Fall müssen wir mit Hausdurchsuchungen rechnen.«
Apotheker Patten schien sich erst durch diesen Hinweis der Tragweite des Gesagten bewusst zu werden: »Hausdurchsuchungen!«, entfuhr es ihm trotz der zur Schau getragenen Ruhe. »Weißt du eigentlich, was du da sagst?«, zischte er und sah im Geiste bereits Horden von Beamten, die seine Apotheke und sein Büro ausräumten und alles in Kisten packten – so wie man dies vom Fernsehen her kannte.
Hagebusch kämpfte ebenfalls gegen aufkommende innere Unruhe an. »Ja, das weiß ich sehr wohl. Vielleicht sollten wir uns die beiden einfach mal zur Brust nehmen, Rolf. Du hast doch den Kontakt mit diesem Pharmafritzen Mittelberg und dieser Schewe schließlich angeleiert. Oder entsinne ich mich da falsch?«
Patten holte tief Luft und wirkte gereizt: »Nein, du entsinnst dich nicht falsch, Friedrich. Aber ich bin damals davon ausgegangen, dass sie beide seriös sind und für das importierte Zeug aus China neue Absatzmärkte suchen. Auch im Interesse der Krankenkasse und unseres maroden Gesundheitssystems. Du weißt selbst, wie einige skrupellose Pharmahersteller – einer sitzt in Indien – die Preise für lebensrettende Krebsmittel in die Höhe treiben. Und unsere Regierung hat außer markigen Sprüchen dagegen nichts aufzuwenden.«
Der Arzt nickte und spürte den aufkommenden Zorn. »Von wegen seriöse Händler! Das ist doch alles eine einzige Clique. Um nicht zu sagen: mafiose Strukturen.«
Patten winkte verärgert ab und griff das zuvor von Hagebusch Vorgeschlagene auf: »Was heißt da: ›zur Brust nehmen‹, Friedrich? Sollen wir die Schewe anrufen und zu einem Gespräch bitten?«
Der Arzt überlegte kurz und erwiderte: »Quatsch, ich hab da vielleicht eine viel bessere Idee.«
8
Es war einer jener Junimorgen, an denen am Bodensee die sommerliche Frische zu spüren war: In dieser Zeit, in der die Tage sehr lang und die Nächte kurz waren, graute bereits gegen kurz nach halb fünf Uhr der Morgen. Die Luft war feucht-frisch, vom See aus Richtung der Insel Reichenau zogen sanfte Nebelschwaden herüber.
Auf den Straßen erwachte langsam das Leben. Noch fuhr die Fähre, die Konstanz mit dem nördlichen Ufer verband, nur stündlich. Bald würde sich aber auch auf dem Wasser wieder das vielfältige Treiben eines Sommertages einstellen.
Allerdings hatte der kleine Sportflugplatz von Konstanz sehr viel von seinem einstigen Idyll eingebüßt: Das Gewerbegebiet war wie ein Geschwür an ihn herangewachsen und drohte ihn vielleicht bald aufzufressen. Möglicherweise hatten die Kommunalpolitiker wie überall nur die Gewerbesteuer im Auge und die künftige Bedeutung eines Landeplatzes nicht erkennen wollen. Denn einen neuen würde man nie wieder anlegen können.
Der dunkelhäutige Mann, der mit dem Fahrrad herangeradelt kam, hatte diese Probleme bisher nur am Rande mitbekommen. Seine Deutschkenntnisse reichten nicht aus, um die Zeitung zu lesen, obwohl er gleich nach seiner Ankunft am Bodensee begonnen hatte, die Sprache zu erlernen. Auch mit einem Job hatte es für Atila, den jungen, sportlichen Afghanen, bereits geklappt: Er war für die Sauberkeit des »Small Airport« verantwortlich, wie er seine Arbeitsstelle bezeichnete. Jetzt, an Tagen wie diesem, kam er bereits sehr früh angeradelt, weil er dann ungestört von Verkehr und Fliegern das Gelände rundum reinigen konnte. Und außerdem zog er es vor, die Mittagspause für ein Schläfchen zu nutzen.
Von seiner Wohnung in einem dieser Flüchtlingsheime, wie sie vor vier Jahren überall im Lande hektisch errichtet worden waren, brauchte er um diese frühe Zeit nur knapp zehn Minuten bis hierher. Vom Kreisverkehr beim Gewerbegebiet kommend, bog er in die Riedstraße, von der ein geschwungener asphaltierter Fahrweg nach rechts abzweigte – unter dem sogenannten Endteil des Anflugs hindurch –, und fuhr dann parallel zur Graspiste bis zu den Hallen. Der Nebel verdichtete sich, im Morgengrauen erschien alles grau und farblos. Auch die Sportflugzeuge, die hier parkten, weil es für sie keinen Platz in einem der Hangars gab, wirkten glanzlos. Atila konnte zwar die Maschinen nicht nach Typ und Fabrikat unterscheiden, staunte aber jedes Mal beim Anblick der meist schneeweißen Flieger, wie viele hier abgestellt waren.
Der kleine Tower und die Hangars zeichneten sich im nebligen Morgengrau nur schemenhaft ab, als sich Atila in rasanter Fahrt näherte. Dann war da etwas, was im linken Augenwinkel kurz seine Aufmerksamkeit erregte: ein größeres Fahrzeug, vielleicht ein Kombi oder ein bulliger SUV, rückwärts im Zwischenraum zweier Hallen geparkt. Atila drehte sich kurz um, glaubte sogar, hinterm Steuer des offenbar älteren Fahrzeugs die Silhouette einer Person zu erkennen. Aber vielleicht war es auch nur ein Schatten.
Oder ein Pilot, der kurz vor Sonnenaufgang, wenn die Sportflieger frühestens starten durften, loswollte. Dann allerdings wäre zwar der Tower noch nicht besetzt und – das wusste Atila inzwischen – das Starten und Landen eigentlich verboten. Er radelte weiter und dachte, dass ihn dies alles gar nichts anging. Seine Aufgabe war eine andere. Er wollte auch niemanden anschwärzen.
Nach ein paar Sekunden hatte er den Tower erreicht, wo er stoppte und sein Fahrrad abstellte. Während er sich dabei umdrehte, sah er auf dem Asphaltweg, den er gekommen war, die roten Schlusslichter eines Autos im Morgennebel verschwinden. Vielleicht hatte sich der Pilot mit dem großen Wagen doch dazu entschlossen, erst abzufliegen, wenn der Flugleiter im Tower saß und sich der Nebel ganz verflüchtigt hatte.
9
Einige Stunden später, die Morgennebel hatten sich längst verzogen und die Sonne war bereits weit überm Horizont. Frank Mittelberg freute sich auf den kurzen Flug über den Bodensee, mehr noch aber auf das, was dann folgen würde. Er hatte seinen weinroten Audi-SUV unweit des Towers abgestellt, dem Flugleiter zugewinkt, der von seiner Kanzel aus den ganzen Flugplatz überblicken konnte, und war vorbei an einem halben Dutzend abgestellter Flugzeuge zu seiner eigenen Maschine gegangen. Ein flüchtiger Blick bestätigte ihm, dass die kleine, betagte Cessna noch immer so dastand, wie er sie gestern Abend bei Sonnenuntergang abgestellt hatte. Er öffnete die linke Cockpittür, die sich seit Wochen nicht mehr verriegeln ließ, klappte die Lehne nach vorne und verstaute den ziemlich abgegriffenen Aktenkoffer in der kleinen Ablage dahinter.
So wie er es in der Flugschule gelernt hatte, ging er anhand der Checkliste die vorgeschriebene Prozedur durch. Er schwang sich dazu sportlich auf den durchgesessenen Sitz, stellte den Magnetschalter auf »on« , worauf die Elektrik des Fliegers zu summen begann – ein vertrautes Geräusch, das der Kurskreisel verursachte, ein Instrument, dessen Innenleben durch dauerhafte Rotation auf einer Ebene gehalten wurde. Die Tankanzeige versprach genügend Sprit. Dann vergewisserte sich Mittelberg mit Pedalen und Steuerhorn, dass Seiten- und Querruder nicht blockierten, ließ die Landeklappen ausfahren, um beim folgenden Rundgang um die Maschine deren feste Verankerung zu prüfen. Dies stand ebenso auf der Checkliste wie die Kontrolle des Ölstands und das kritische Beäugen des äußeren Zustands der Cessna.
Für ihn, der mit dieser Maschine im Laufe des Jahres mehrere Dutzend Stunden flog, war dies reine Routine. Trotzdem durfte ihm natürlich nichts entgehen, zumal der Flieger in keiner schützenden Halle stand.
Auf seiner Stirn hatten sich durch die vormittägliche Sommersonne bereits Schweißperlen gebildet, als er sich wieder in das Cockpit zwängte, sich anschnallte und die Zündschalter drehte. An so warmen Tagen wie diesem brachte der Motor nach kurzem Ruckeln den Propeller vor der gewölbten Cockpitscheibe sofort auf die nötige Umdrehungszahl, dröhnend und an der ganzen Maschine schüttelnd und rüttelnd. Mittelberg fuhr die Landeklappen ein, vergewisserte sich, ob Türen und Fenster verschlossen waren, und kontrollierte aufmerksam die Triebwerksinstrumente: Drehzahl, Öldruck, Unterdruck, Stromspannung.
Wenn er alleine flog, verzichtete er meist auf Kopfhörer oder Headset und griff zum fest installierten Mikrofon, um sich beim Tower in Konstanz offiziell zu melden. Der Flugleiter, dem er vorhin zugewinkt hatte, wollte das Ziel des Fluges wissen.
Mittelberg teilte ihm mit, er werde ohne Passagier nach Reute bei Bad Waldsee fliegen, und erbat dazu die Rollinformation. Der Tower-Mann wies ihm die Piste »drei-null« zu, also 300 Grad und somit in etwa nordwestliche Startrichtung. Genau so, wie es der sanft aufgeblähte Windsack beim Tower hatte vermuten lassen. Mittelberg erledigte die weiteren Checkprozeduren, stellte den Transponder ein und rollte mit seiner Cessna zum angegebenen Startpunkt, wo eine Querstraße den Flugplatz begrenzte und sich flache Bauten des nahen Gewerbegebiets erhoben.
Der Tower erteilte die Startfreigabe, Mittelberg drückte den Gashebel nach vorne. Der Motor heulte auf und die Cessna beschleunigte auf der Graspiste holpernd und scheppernd. Der mäßige Gegenwind sorgte dafür, dass die Strömung an den Tragflächen schnell anlag und mit Sog und Druck die Maschine schwerelos werden ließ.
Mittelberg zog das Höhenruder zu sich her und riskierte einen Blick auf den Tower, der links an ihm vorbeizog. Die Cessna gewann schnell an Höhe, wurde von einigen Böen geschüttelt und ließ sich in eine sanfte Linkskurve legen – der vorgeschriebenen Platzrunde, die den mit Alleenbäumen gesäumten Straßendamm querte, der zur Insel Reichenau hinüberführte.
Dann meldete sich Mittelberg aus der Platzrunde ab und stellte das Funkgerät bereits auf 118,040 MHz, die Frequenz von »Waldsee Info«, ein. Abseits der Stadt Konstanz ging er auf Nordostkurs, um den Bodensee hinüber Richtung Meersburg zu überfliegen. Unter ihm glitzerte das Wasser, in dem sich das Sonnenlicht millionenfach spiegelte. Einige Segelboote waren unterwegs, dazwischen hinterließen die Fährschiffe ihre weit ausrollenden Bugwellen.
Mittelberg hatte keine Kursberechnungen angestellt, sondern verließ sich bei dieser herrlichen Sicht auf seine topografischen Kenntnisse. Er kannte sich hier bestens aus, achtete darauf, in einem respektablen Abstand zur Kontrollzone des Friedrichshafener Airports zu bleiben, und orientierte sich an der B 33 auf Ravensburg zu. Bei diesen Sichtverhältnissen war die Navigation in vertrautem Gebiet ein Kinderspiel. Den Höhenmesser ließ er bei 3.500 Fuß einpendeln – was etwas mehr als tausend Meter über Normalnull waren. Angesichts des knapp 400 Meter hohen Bodensees und des ins Oberschwäbische ansteigenden Geländes war dies ausreichend, um die Mindestflughöhe einzuhalten.
Bald schon erhoben sich die vielen Türme von Ravensburg, charakteristisch dabei der runde weiße »Mehlsack« und der »Blaserturm«. Nur ein Stück weit dahinter ragten die beiden Türme der Basilika von Weingarten aus der ländlichen Landschaft heraus.
Mittelberg entschied, dem kleinen Tower in Bad Waldsee pflichtgemäß sein Annähern mitzuteilen. Er griff wieder zum Mikrofon, doch während er es zum Mund führte, verspürte er einen seltsamen Geruch und gleichzeitig ein brennendes Gefühl in den Augen. Instinktiv ließ er das Steuerhorn los, um mit einer Hand die Sonnenbrille zu heben und mit dem Rücken der anderen Hand über die Augen zu streichen. Gleichzeitig überkam ihn ein Hustenreiz. Tränen überfluteten schlagartig seine Sicht und ließen alles nur noch milchig erscheinen. Er warf die Sonnenbrille auf den Kopilotensitz und versuchte, gegen den Husten anzukämpfen. Vergeblich. Obwohl er die Augen zusammenkniff, ging die Sehschärfe verloren. Ruhe bewahren, schoss es ihm durch den Kopf. Doch er spürte, wie sich sein Puls beschleunigte. Waren es Auspuffgase, die ins Cockpit drangen? Nein, danach roch es nicht. Oder hatte er sich bereits an den Geruch gewöhnt? Hastig entsicherte er die linke Cockpitscheibe, worauf der Fahrtwind das Klappfenster nach oben riss und eine Böe das Innere erfasste.
Mittelberg konzentrierte sich darauf, die verloren gegangene Sicht wiederzugewinnen. Doch irgendetwas kratzte in seinem Hals, verursachte einen unbändigen Hustenreiz, während ihm der Fahrtwind die Tränenbäche von den Wangen schleuderte.
Landen. Er musste landen. Irgendwie, aber nicht irgendwo, sondern geordnet, auf einem Flugplatz. Es war nicht mehr weit bis Waldsee. Er musste es schaffen.
Ein Notruf zum Tower? »Mayday« müsste er melden. So hatte er es in der Flugschule gelernt. Aber wem würde es nützen? Der Tower würde die Rettungskräfte alarmieren. Das »große Programm« käme in Gang. Feuerwehr, Polizei. Und letztlich geriete er in den Bürokratismus des Luftfahrtbundesamts. Hatte er etwas am Flugzeug übersehen? War er selbst schuld an dem, was da soeben geschehen war?
Die frische Luft hatte ihm wieder ein bisschen Sicht verschafft. Trotzdem brannten seine Augen weiterhin höllisch.
Er musste sich dringend in Waldsee anmelden. Noch einmal hustete er kräftig, um dann mit heiserer Stimme und so ruhig wie möglich »Waldsee Info« zu rufen. Der Flugleiter antwortete sofort und kam der Bitte nach, die Landerichtung mitzuteilen. Drei-drei. Etwa nordwestlich. Er fügte an: »Melden Sie rechten Gegenanflug.«
Der Flugleiter hatte sich von seinem Platz im Tower erhoben, um mit dem Fernglas den Himmel abzusuchen. Wenn kein Verkehr war, wie heute Vormittag, machte er sich einen Spaß daraus, die angemeldeten Flieger direkt zu beobachten. Der Cessna-Pilot hatte die Position mit »querab Weingarten« angegeben, müsste also bei dieser klaren Sicht bald am südwestlichen Himmel auftauchen. Als auch nach zwei Minuten noch keine Maschine im Visier des Fernglases war, überkam den Flugleiter das fahle Gefühl, die seltsam verschnupft geklungene Stimme des Piloten könnte nichts Gutes bedeuten. Außerdem hatte der Mann die Anweisung, den parallelen Gegenanflug zur Landebahn zu melden, nicht bestätigend wiederholt, wie es im Funkverkehr vorgeschrieben war.
Der Flugleiter legte das Fernglas beiseite und nahm das Mikrofon, um die angemeldete Cessna mit deren Kennzeichen anzusprechen.
Doch die Leitung blieb stumm. Auch nach dem dritten Versuch.
10
Dr. Markus Kerkhoff, 38 Jahre alt und in Bad Waldsee ein angesehener und beliebter Mediziner, hatte sich einen Jugendtraum erfüllt. Statt des alten klapprigen VW-Busses, den er größtenteils selbst oder mit Freunden zum Camper umgebaut hatte, wollte er nun weitaus luxuriöser auf Reisen gehen. Seit ihm die Leitung einer privaten Klinik übertragen worden war, hatte er sich immer wieder zu dem großen örtlichen Wohnmobilhersteller hingezogen gefühlt, dessen Ausstellungsräume sich am Stadtrand befanden.
An diesem Sommervormittag konnte er endlich das bestellte Fahrzeug in Empfang nehmen. Schon bald würde er damit auf große Reise gehen. Frei und ungezwungen. Den Job als Leiter der kleinen Klinik hatte er bereits gekündigt. Nun konnte er sich eine einjährige Auszeit leisten. Die Aussicht, dass er dies nicht allein tun würde, beflügelte seine Pläne zusätzlich. Allerdings war seine Stimmung an diesem Vormittag getrübt.
Jetzt saß er in der großzügigen Ausstellungshalle des Wohnmobilherstellers dem Verkäufer gegenüber und mimte den Lässigen, der er heute aber nur äußerlich war: hemdsärmlig, enge Jeans, die schwarzen Haare kurz geschoren. Groß und sportlich-schlank. Kein Typ, dem man auf den ersten Blick den Arzt ansehen würde. Kerkhoff hatte sich gleich nach dem Studium von den etablierten »Herrn Doktoren« abheben und sich betont locker und jugendlich geben wollen. Diese Art kam bei den heutigen Patienten gut an, besonders bei den weiblichen. So jedenfalls war sein Eindruck.
Nachdem die bürokratischen Formalitäten erledigt waren, bat der ebenfalls junge Verkäufer seinen Kunden in das bereitstehende Wohnmobil, das nicht gerade klein dimensioniert war und im Hinblick auf das Interieur keine Wünsche offenließ. Kerkhoff brauchte allerdings keine detaillierte Einweisung, denn er hatte sich in den vergangenen Monaten bereits in die Technik und die Ausstattung eingelesen, im Internet Bewertungen studiert und auch mit anderen Besitzern solcher Wohnmobile gesprochen. Trotzdem folgte er den Erläuterungen des Verkäufers und genoss dabei den wohlriechend-behaglichen Duft, den die Inneneinrichtung verströmte.
»Darf ich fragen, Herr Dr. Kerkhoff, wo die erste Fahrt hingeht?«, drehte sich der Mann nun zu ihm.
»Zuerst zu einem Pharmakongress nach Lausanne«, erwiderte Kerkhoff so schnell, als habe er mit einer solchen Frage gerechnet. Dann wandte er sich dem bequemen Fahrersitz zu, der mit einer einfachen Drehung in den Wohnraum integriert werden konnte. »Aber die kommende Nacht werd ich erst mal auf dem Wohnmobilstellplatz drüben bei der Therme verbringen«, lächelte der Arzt und setzte sich. »Zum Eingewöhnen«, fügte er an. »Ich finde es super, dass diese Stadt so einen tollen Platz für Wohnmobile geschaffen hat.« 39 Stellplätze waren es, das hatte er längst erkundet. Er lächelte anerkennend. »Außerdem werd ich die schöne Stadt verlassen.«
Der Verkäufer sah ihn verwundert an: »Sie geben Ihren Job in Waldsee auf?«
»Ja, erst eine Auszeit, mit diesem schönen Wagen hier – und dann neuer Job in der Schweiz.« Kerkhoff erhob sich wieder, um eines der vielen LED-Lämpchen einzuschalten. »Die Sache mit dem Altwagen geht klar? Auch wenn’s noch ein ›Stinkerdiesel‹ ist?«, vergewisserte er sich und ließ es so klingen, als sei es nur noch eine rhetorische Feststellung. »Sie melden ihn doch ab?«
»Noch heute«, beeilte sich der Verkäufer zu sagen. »Da brauchen Sie keine Angst zu haben. Ich bin mir sogar sicher, dass wir sehr schnell einen Abnehmer finden. Er ist ja noch in einem guten Zustand.«
»Ich hab ihn auch gehegt und gepflegt in diesen zwölf Jahren«, grinste Kerkhoff. »Der hat ziemlich viel erlebt.«
Der Verkäufer überlegte, wie diese Bemerkung zu deuten war, weshalb er ein Schmunzeln unterdrückte und sagte: »Dann wünsche ich Ihnen, dass Sie mit dem neuen Wagen genauso viel Spaß haben.«
Kerkhoff lächelte. »Ich werd’s versuchen, danke.« Mehr konnte er nicht sagen, denn in diesem Moment meldete sich sein kleines Smartphone, das er in der Brusttasche stecken hatte.
11
Heike Mittelberg hatte sich längst mit den langen Geschäftsreisen ihres Mannes abgefunden. Anfangs noch war ihr dies lästig gewesen, doch im Laufe der Jahre hatte sie sich an das häufige Alleinsein gewöhnt. Und seit einigen Monaten genoss sie diesen Zustand sogar. Sie hatten sich auseinandergelebt. Jeder ging seinen eigenen Interessen nach. Frank stürzte sich immer tiefer in seine Geschäfte, weil er wie ein Besessener stets nach noch mehr Geld und Vermögen strebte. Dabei hatten sie doch alles, was sie für ein luxuriöses Leben brauchten. Sogar ein stattliches Sportboot und ein Flugzeug. Aber die Cessna war Frank nicht mehr gut genug. Er träumte von einer viersitzigen Maschine, von einer PS-starken, mit der er größere Entfernungen würde zurücklegen können.
Natürlich empfand auch Heike Boot und Flugzeug als angenehm. Aber was nützte dies alles, wenn sie keine gemeinsame Zeit fanden, es auch zu genießen? Manchmal schien es ihr, als würden ihn die Besitztümer eines Tages auffressen. Es war tatsächlich so: Je mehr man hatte, desto mehr musste man sich um all diese Dinge kümmern. Und umso mehr Geld brauchte man, um alles zu pflegen und zu unterhalten.
Dass sie gestern Abend mit der Cessna ein paar Runden über den See gedreht hatten, war zwar schön gewesen, aber danach hatte Frank behauptet, noch etwas an dem Flugzeug einstellen zu müssen.
Sie freilich hatte dies gerne widerspruchslos zur Kenntnis genommen und war mit ihrem Auto heimgefahren.
Heike beobachtete seit über einem Jahr, dass sich Frank immer mehr aufhalste. Inzwischen war er nicht nur für die altbekannten Pharmaunternehmen als Handelsvertreter unterwegs, sondern versuchte, ein eigenes Vertriebsnetz aufzubauen. So richtig durchschaut hatte sie es bisher nicht – und wenn sie fragte, bekam sie meist nur wachsweiche nebulöse Antworten. Sie hatten sich weder privat noch geschäftlich mehr etwas zu sagen.
Aber damit hatte sie sich abgefunden. Außerdem waren längst Zweifel in ihr aufgekommen, ob sich hinter den Reisen und privaten Flügen nicht ganz andere Interessen verbargen. Deshalb hatte sie beschlossen, sich auf keinen Fall hinters Licht führen zu lassen. Das hatte sie gar nicht nötig, schließlich war sie hübsch und erst 38. Während sie sich mit derlei Gedanken neues Selbstbewusstsein aufbaute, ging sie mit dem schnurlosen Telefon am Ohr in die Diele, um sich im großen Spiegel zu betrachten. Die kurzen Jeans standen ihr gut, die enge Bluse betonte ihre weiblichen Formen und die schulterlangen blonden Haare verliehen ihr ein jugendliches Aussehen. Beflügelt wurde sie vollends, als sich auf der angewählten Nummer endlich die erhoffte Männerstimme mit einem freundlichen »Hallo« meldete.
»Ich bin’s«, hauchte sie in den Hörer. »Was hältst du davon, wenn wir uns am frühen Nachmittag zu einer Tasse Kaffee treffen?« Sie drehte sich zur Seite, um ihre Figur im Spiegel noch besser begutachten zu können – so, als wolle sie dem Angerufenen heute besonders gefallen. »Ja, er ist schon weg«, grinste sie sich selbst an. »Nach Dinkelsbühl, hat er gesagt.« Sie lauschte auf die Antwort und ging in ihr kleines Büro, wo der Monitor ihres Computers angeschaltet war und eine Landkarte mit der nördlichen Umgebung des Bodensees zeigte. »Du willst mir was zeigen?«, erwiderte sie auf das, was ihr die Stimme am Telefon sagte, erstaunt. Doch das Interesse an einer Antwort war plötzlich verschwunden, weil sie den pulsierenden blauen Punkt auf dem Monitor entdeckt hatte. Heike wechselte den Hörer in die linke Hand, um mit der rechten die Maus bedienen und die Landkarte größer ziehen zu können. Der pulsierende Punkt stand bei der Stadt mit den beiden Seen. Bad Waldsee. Heikes Gesicht verlor den Glanz, den ihr das Gespräch mit dem Mann beschert hatte. »Okay«, sagte sie tonlos. »Wie immer. Ich werde in zwei Stunden da sein.«
12
Auch knapp zwei Monate, nachdem seine Frau bei einem tragischen Unfall auf der Autobahn gestorben war, hatte Peter Ackermann das schreckliche Geschehen nicht überwunden. Dass die Polizei schon seit Wochen nichts mehr von sich hören ließ, wertete er als Zeichen nur geringen Interesses. Niemand hatte sich auf die vielen Hinweisbitten hin gemeldet. Ackermann, darüber verbittert, hegte den Verdacht, dass es die unbekannten Besitzer der beiden folgenschwer abgestürzten Drohnen verstanden hatten, mögliche Zeugen zu besänftigen – oder besser gesagt: ihnen das Schweigen finanziell schmackhaft zu machen. Wenn jemand am helllichten Tag abseits der Autobahn, in einem Wander- und Ausflugsgebiet, mit Drohnen spielte, musste dies aufgefallen sein, zumal ohnehin jegliche Art von Modellflugzeugen auf allgemeines Interesse stieß.
Cornelias Tod war das Schlimmste gewesen, was er je hatte durchmachen müssen. Sie hatten sich so auf ihren Ruhestand gefreut – und dann war im Bruchteil einer Sekunde alles zerstört worden. Noch immer wachte er schweißgebadet auf, wenn sich dieser unheimlich dumpfe Schlag gegen die Windschutzscheibe wieder in seine Träume schlich. Ein Schlag, an den er sich nicht mehr bewusst erinnern konnte. Aber er war tief in seinem Unterbewusstsein gespeichert. Die Folgen des schweren Unfalls hatten nicht nur seine Seele verletzt, sondern sie waren allgegenwärtig in seinem Körper zu spüren. Die Ärzte behaupteten zwar, die gebrochenen Rippenknochen würden alle wieder gut verheilen, doch er glaubte inzwischen, Wetterveränderungen Tage im Voraus zu spüren. Seine Tochter, Mutter zweier Kinder und im Elsass verheiratet, kümmerte sich mittlerweile rührend um ihn – was sich allerdings meist nur in regelmäßigen Telefonaten niederschlug. Zu persönlichen Kontakten kam es eher selten. Dazu war die räumliche Entfernung zu groß. Ackermann hatte auch nicht in die Nähe von Tochter, Schwiegersohn und Enkel ziehen wollen, schon gar nicht ins Ausland. Er war viel zu bodenständig, um das heimische Ulm zu verlassen. Hier hatte er soziale Kontakte, Freunde und Bekannte.
Seit Kurzem hatte er eine ältere Dame als Haushaltshilfe engagiert, die ihm sehr viel Arbeit abnahm. Aber zufrieden war er mit seiner Situation nicht, denn er bemerkte selbst, wie er sich zurückzog und immer weniger am öffentlichen Leben teilnahm, obwohl er in seiner einstigen beruflichen Eigenschaft als behördlicher Veterinär viel Publikumsverkehr gewohnt war.
Mit zunehmender zeitlicher Distanz zu dem Unfall wurde nichts besser. Zeit heilte eben doch keine Wunden, redete er sich ein. Im Gegenteil: Sie wurden größer und größer. Vor allem quälte ihn der Gedanke, dass der sinnlose Tod seiner Frau bisher ungesühnt geblieben war. Dass es – wie er oftmals sagte – »hinterhältige Feiglinge« gab, die nicht zu ihrer Tat standen. Natürlich hatten sie den Tod seiner Frau nicht bewusst herbeigeführt – und sie müssten vermutlich nicht befürchten, eingesperrt zu werden. Aber eine ordentliche Aufarbeitung durch ein Gericht wäre ein würdiger Abschluss gewesen.
Eine kleine Hoffnung war aufgekommen, als ihm vor einigen Wochen ein befreundeter Polizist angeraten hatte, sich eines Privatdetektivs zu bedienen. Dieser könne sich »vielleicht intensiver um die Sache kümmern«. Außerdem seien die Kosten gering, zumal es sich um einen pensionierten Polizeibeamten handle, der sich gerade im Ruhestand eine Nebenbeschäftigung aufbaue, um nicht der Langeweile anheimzufallen. Dem Mann gehe es nicht um einen Zusatzverdienst, sondern um eine sinnvolle Tätigkeit, die ihn ausfülle. Ackermann war von diesem Vorschlag angetan gewesen und war sofort telefonisch mit ihm in Kontakt getreten. Der Ex-Polizist, ein Kriminalhauptkommissar, hieß Edgar Bauer, wohnte in Göppingen und war geschieden. Bereits bei einem ersten Gespräch, das sie in einem Biergarten geführt hatten, waren sie sich gegenseitig sympathisch gewesen. Am meisten gefiel Ackermann, dass sie beide der gleiche Jahrgang waren und Bauer noch zur Generation der »Zupacker« zählte – zu jenen also, die nicht durch übermäßiges Theoriegeschwätz auffielen, sondern noch eine Ahnung von praktischer Arbeit hatten. »Ich war jahrelang an der Front«, pflegte Bauer oftmals zu sagen und verwies auf seine Streifenfahrten, die er bis zur Pensionierung mit großer Begeisterung gemacht hatte – auch im Schichtdienst. Schreibtischarbeit schien ihm zuwider gewesen zu sein.
Sofort hatte sich Bauer zu dem, was Ackermann berichtete, Notizen gemacht. Natürlich war dem pensionierten Kommissar der spektakuläre Drohnenunfall auf der Autobahn bestens in Erinnerung, zumal besagtes Autobahnstück zum Landkreis Göppingen gehörte, in dem er nahezu ein ganzes Berufsleben lang tätig gewesen war.
»Wenn es keine konkreten Hinweise gibt, wird der Fall schnell zu den Akten gelegt«, hatte Bauer bedauernd festgestellt.
Bauer, in Ehren ergraut, groß und breitschultrig, sonore Stimme, wirkte wie die Seriosität in Person. Einer, dem man unbesehen einen Gebrauchtwagen abkaufen würde. Kumpelhaft, aber gleichermaßen ernst und nachdenklich, völlig unaufgeregt. Einer, der nicht vorschnell emotionale Äußerungen von sich gab.
Ackermann hatte deshalb schon bei der ersten Begegnung ausführlich berichten können, was ihn bedrückte. »Es kann doch nicht sein, dass jemand so gefährliche Dinger fliegen lässt, ohne dass er zu ermitteln ist«, hatte er vorwurfsvoll bei einem Bier in der Gartenwirtschaft gesagt.
»Na ja«, hatte Bauer entgegnet und einen Schluck Weizenbier genommen. Auf seiner Stirn standen Schweißperlen, weil die Sonne inzwischen ein gutes Stück weitergewandert war und sie nicht mehr im Schatten saßen. »Die Sache mit den Drohnen hat der Gesetzgeber viel zu spät geregelt – und dann auch viel zu lasch. Normalerweise ist in Deutschland in der Luftfahrt alles klitzeklein und penibel vorgeschrieben – aber bei den Drohnen rennen die Behörden der Entwicklung hinterher.«
»Sie meinen also auch, dass wir keine Chance haben«, war Ackermann enttäuscht gewesen.
Bauer hatte ihm bei dieser ersten Begegnung zwar keine Hoffnung machen wollen, zum Schluss aber eine durchaus optimistische Bemerkung gemacht: »Ich werd mich mal in einschlägigen Kreisen umhören. Wenn man so lange wie ich in dieser Gegend Polizist war, dann hat man noch immer gewisse Kontakte.« Ein bisschen frustriert hatte er angefügt: »Aber wissen Sie, Herr Ackermann, die Kenntnis von Personen und ihrem Umfeld zählt heute nicht mehr. Heute werden die Polizisten beliebig hin- und hergeschoben – und hier in der Provinz sind wir für viele nur ein Durchlaufposten auf dem Weg nach oben. Den geduldig zuhörenden ›Schutzmann‹ vom Land gibt es schon lange nicht mehr. Und seit der letzten Polizeireform sitzen die Verantwortlichen ganz weit weg – und haben keinerlei Orts- und Personenkenntnis.« Er grinste. »Fragen Sie doch mal einen im zuständigen Präsidium Ulm, wo das Nassachtal ist oder Oberweckerstell. Die werden zuerst die Koordinaten wissen wollen, damit sie einen Streifenwagen losschicken können.«
Ackermann hatte gefallen, wie Bauer redete.
Als sich jetzt der selbst ernannte Detektiv am Telefon meldete, fühlte sich Ackermann innerlich aufgewühlt. Er ging mit dem schnurlosen Hörer zum Fenster, durch das er von einer Anhöhe Ulms aus zur Donau hinabsehen konnte.
»Ich hab etwas für Sie«, begann Bauer nach der kurzen Begrüßung. »Etwas, was Sie interessieren könnte.«
»Ach?«, entfuhr es Ackermann. »Sie haben etwas rausgefunden?«
»Es könnte sein, dass ich weiß, wo die beiden abgestürzten Drohnen gekauft worden sind«, dröhnte Bauers Stimme durch die Leitung.
»Sie haben das tatsächlich rausgefunden?«
»Ja, und ich glaub auch zu wissen, wer sie gekauft hat.«
Ackermann ging zu einer Couch und setzte sich.
13
Apotheker Rolf Patten hatte sich bei dem lang andauernden Gespräch mit seinem Freund Dr. Friedrich Hagebusch nur kurz unterbrechen lassen, als eine Helferin mit der Bitte, das Rezept eines Kunden zu prüfen, vorsichtig in das Hinterzimmer gekommen war. Danach vergewisserte sich Patten, dass die Tür eingerastet war und sie nicht belauscht werden konnten. »Und du bist sicher, dass die Schewe heute dort wieder auftaucht?«, hakte er nach und knüpfte an einen Vorschlag an, den der Arzt kurz zuvor unterbreitet hatte.
»Ganz sicher. Oft waren sie sogar beide dort, das weißt du. Die Schewe und der Mittelberg. Wie sagt man so schön: Morgens Fango, abends Tango – oder?«
»Die Schewe ist also wieder zur Kur hier, meinst du?« Hagebusch kratzte sich erneut im Oberlippenbart.
»Ja, so hat man’s mir berichtet«, erwiderte Patten mit hochrotem Kopf und fügte an: »Na ja, zur angeblichen Kur. Rein privat.«
»Dann sollten wir was unternehmen. Du hast doch die Kontakte zu diesem Pharmafritzen. Du bist doch sein Geschäftsfreund, wenn ich das mal so sagen darf«, gab sich der Arzt vorwurfsvoll und überlegte, ob er Patten raten sollte, etwas gegen den augenscheinlich hohen Blutdruck zu unternehmen. Aber als Apotheker musste der selbst wissen, was er brauchte. Hagebusch wurde stattdessen energischer: »Frag den Mittelberg dann doch mal beiläufig, wie seine Geschäfte laufen – seit dieser Fernsehsendung vorige Woche.« Weil Patten nicht sofort darauf einging, legte Hagebusch charmant nach: »Nicht zur Rede stellen, Rolf, sondern nur ein bisschen plaudern. Small Talk.«
Der Apotheker holte tief Luft. »Über das, was im Fernsehen gezeigt wurde? Mensch, Friedrich, du weißt genauso gut wie ich, dass das eine ganze Lawine ins Rollen bringen kann.«
»Ja, eine Lawine, vor der auch wir in Deckung gehen sollten, vergiss das nicht.« Hagebusch spielte nervös mit einem Kugelschreiber.
»Mittelberg und Schewe werden den Teufel tun, mit mir darüber zu reden, glaub mir das«, giftete Patten zurück.
Hagebusch winkte ab und meinte süffisant: »Gier frisst Hirn auf, vergiss das nicht, mein lieber Rolf.«
Patten gab sich versöhnlicher und grinste: »Aber manchem rutscht das Hirn gelegentlich in die Hose, oder täusche ich mich da?«
Der Arzt hob eine Augenbraue.
14
Der Flugleiter im Tower des Flugplatzes Reute bei Bad Waldsee hatte aufgeatmet, als die Cessna herangeschwebt war. Erleichtert nahm er zur Kenntnis, dass offenbar alles normal verlief. Schließlich glaubte er zu wissen, dass es sich bei dem Piloten um einen erfahrenen Flieger handelte, der in den vergangenen Monaten schon öfters hier gelandet war. Meist kam er aus Konstanz, hin und wieder auch von anderswoher, um vor dem Heimflug einen Zwischenstopp in Waldsee zu machen. Weshalb er sich aber diesmal am Funk nicht ordnungsgemäß verhalten hatte, erschien dem Flugleiter rätselhaft. Alle Aufforderungen, ihn zu einer Antwort zu bewegen, waren fehlgeschlagen. Merkwürdig war auch, dass sich die Maschine nicht ordnungsgemäß in die Platzrunde – also in den Gegenanflug – einfädelte, sondern direkt auf die Landebahn drei-drei heranschwebte.
Jetzt beobachtete er vom Tower aus, wie die kleine Maschine an die Parkposition rollte. Noch einmal rief er per Funk das Kennzeichen der Cessna – wieder vergeblich. Deshalb nahm er den Flieger, der nur rund 50 Meter entfernt stand, nun ganz groß ins Visier des Fernglases. Der Propeller stand inzwischen still, während der Pilot im Sitzen etwas zu suchen schien. Wegen Reflexionen in der Cockpitscheibe war nicht erkennbar, worum es ging.
Der Flugleiter verfolgte, wie sich der Oberkörper des Piloten zum rechten Sitz hin beugte und in dieser Haltung ein paar Sekunden verharrte. Dann griff der Mann hinter die Lehne, holte umständlich seinen Aktenkoffer hervor, klappte den Deckel auf und schien etwas zu verstauen. Anschließend wischte er sich mit einem Taschentuch über die Augen und setzte eine Sonnenbrille auf.
Dann erst kletterte er aus der Maschine und kam, mit dem Aktenkoffer in der Hand, auf den Tower zu. Wenig später trat er dem irritierten Flugleiter gegenüber und begrüßte ihn mit heiserer Stimme. »Tut mir leid, aber mit dem Funk scheint etwas nicht in Ordnung zu sein.«
»Den Eindruck hab ich auch. Das sollten Sie dringend reparieren lassen«, riet der gestreng dreinschauende Flugplatzchef. »Sonst könnten Sie ganz großen Ärger kriegen. Einfach so landen, geht nicht. Das wissen Sie.«
Der Pilot nickte. »Ich glaub, ich hab den Fehler schon behoben.« Seine Stimme klang, als habe ihn eine Erkältung befallen. »Ich hab einen Direktanflug gemacht. Hab gesehen, dass keine andere Maschine da war.«
»Sonst aber alles okay?«, fragte der Flugleiter misstrauisch zurück und sah in die dunklen Brillengläser seines Gegenübers, der bereits den Geldbeutel gezückt hatte, um die Landegebühr zu bezahlen.
Er legte einen 20-Euro-Schein auf den Tisch und sagte in der Hoffnung, mit reichlich Trinkgeld weiteren Nachfragen zu entgehen: »Stimmt so.«
»Wie lange wollen Sie bleiben?«
»Nur ein paar Stunden.«
Er wünschte dem Flugleiter einen schönen Tag und verließ den Tower, um mit seinem Aktenkoffer in der Hitze des Tages zum angrenzenden Parkplatz zu gehen, wo er sofort sah, was er suchte: ein weißes BMW-Cabrio mit Frankfurter Kennzeichen und offenem Verdeck. Der Wagen war unter schattigen Bäumen rückwärts eingeparkt, sodass er die aufblitzenden Scheinwerfer der Lichthupe sofort wahrnahm. Sie war also da. Marion Schewe, die Frau, die für ihn mehr war als eine Kollegin aus der Pharmabranche. Bereits als er sie das erste Mal getroffen hatte, vor einem Jahr in einer der örtlichen Kliniken, da war er von ihrem selbstbewussten Auftreten fasziniert gewesen. Aber nicht nur davon. Er hatte sie wesentlich jünger geschätzt, als sie war. Erst später hatte sie ihm verraten, dass sie 41 war.
Er winkte ihr zu, öffnete die Beifahrertür und stieg ein. Als er ihr einen Kuss auf die Wange drückte, strichen ihre halblangen schwarzen Haare über sein Gesicht und er roch ihr herbes Parfüm, das er so sehr mochte. »Schön, dass es wieder geklappt hat«, flüsterte sie, während er seinen Aktenkoffer mit der Linksdrehung seines Oberkörpers zwischen den Sitzen nach hinten verfrachtete und dabei mit der rechten Hand über ihren Oberschenkel streichelte.
Dass der Saum ihres geblümten Kleidchens weit nach oben gerutscht war, machte ihn ebenso atemlos wie der tiefe Ausschnitt. Marion wusste, wie sie ihn anmachen konnte. Jetzt aber sagte sie etwas, womit er nicht gerechnet hätte: »Entschuldige, Franky-Boy, aber du riechst ein bisschen seltsam.«
»Ein aggressives Putzmittel im Flugzeug, nichts weiter«, log er schnell und hörte den merkwürdig verschnupften Klang seiner Stimme.
Marion sah ihn entgeistert an: »Ist etwas mit dir? Du klingst so komisch.«
Er rang sich ein gekünsteltes Lächeln ab. »Nichts weiter, mein Schatz, wahrscheinlich hab ich mir eine Erkältung eingefangen.« Um abzulenken, fragte er schnell zurück: »Du bist wieder ambulant in der Klinik im Hofgarten?«
»Na klar, wie immer«, lächelte sie und fuhr ihm übers Haar, um ihm dabei die Sonnenbrille abzunehmen. »Sag mal«, wunderte sie sich. »Du hast total gerötete Augen. Bist du krank?«
Er nahm ihr die Brille aus der Hand und wurde ernst: »Wie ich dir doch sage: Eine Erkältung bahnt sich an.«
»Mitten im Sommer?« Ihre Stimme verriet Misstrauen.
»Vielleicht auch eine Allergie. Bei diesem Wetter fliegen wieder die Pollen wie wild.«
»Willst du nicht lieber einen Arzt aufsuchen?«
»Arzt!«, entfuhr es Mittelberg, als sei dies ein völlig abwegiger Vorschlag. »Du meinst, nur weil es hier von Medizinmännern wimmelt, soll ich gleich wegen einer Erkältung oder einer Pollenallergie zu ihnen rennen? Ich bitte dich, Marion, wir sollten die Zeit nicht mit so etwas vergeuden.«
Marion legte die Stirn in Falten. »Du bist in Eile? Was hast du deiner Frau denn gesagt?«
»Dass ich geschäftlich in Dinkelsbühl zu tun hätte.« Er setzte seine Sonnenbrille wieder auf.
»Und sie wird da nie misstrauisch?«
»Marion, lassen wir das. Du brauchst dir darüber keine Gedanken zu machen. Komm, gehen wir was essen.«
Sie lächelte und startete den Motor. »Dass uns beide mal jemand hier in Waldsee sieht und es deiner Frau zuträgt, das sorgt dich nicht?«
»Um ehrlich zu sein, Marion, das ist mir ziemlich egal.« Er betrachtete sie von oben bis unten und fühlte eine unendliche Zufriedenheit.
Dennoch musste sich bald etwas ändern. Er wusste nur nicht, wie. Und wie er es ihr sagen sollte.
15
Heike Mittelberg hatte nach dem Telefongespräch wie gebannt vor dem großen Bildschirm gesessen und den pulsierenden blauen Punkt verfolgt. Wie in Trance scrollte sie die dargestellte Landkarte weiter nordwärts, über Ulm, Heidenheim, Aalen und Ellwangen hinauf bis Fichtenau – und dann nach rechts auf Dinkelsbühl. Nichts. Außer den Straßen- und Ortsnamen nichts. Kein zweiter pulsierender blauer Punkt. Konnte es natürlich auch nicht geben. Der einzige, der sich auf dieser Landkarte fand, saß bei Bad Waldsee fest. Heike zog das Bild auf dem Monitor größer, um sich den Stadtplan darstellen zu lassen, wo sich der blaue Punkt von Westen her über die Reutestraße der Innenstadt näherte. Heike brauchte noch ein paar Sekunden, um das Gesehene zu verdauen, griff dann nach ihrem Smartphone und rief über eine App dasselbe Bild auf. Augenblicke später hatte sie es in verkleinerter Form auf dem Display und stellte zufrieden fest, dass auch dort der pulsierende Punkt zu empfangen war.
Obwohl sie sich in dem, was sie eigentlich erwartet hatte, bestätigt fühlte, stieg ein unbändiger Zorn in ihr auf. Gleichzeitig befiel sie ein Gefühl der totalen Verunsicherung. Bad Waldsee. Warum ausgerechnet Bad Waldsee? In zwei Stunden hatte sie doch selbst dort sein wollen? Konnte sie das nun trotzdem riskieren? Oder jetzt erst recht?, wurde sie von einer inneren Stimme aufgerüttelt.
Noch während sie auf den Bildschirm starrte, gewannen Zorn und Wut die Überhand: ja, jetzt erst recht!
16
Marion war direkt zur Klinik am Hofgarten gefahren, die sich zwischen der prächtigen Stiftskirche St. Peter und dem Schlosssee befand. Frank Mittelberg hatte sich wieder einigermaßen von seiner Hustenattacke erholt, behielt aber die Sonnenbrille auf. »Sag mal, Marion, das wievielte Mal bist du eigentlich schon hier?«, fragte er, nachdem sie für das Cabrio einen Parkplatz gefunden hatte.
»Das sechste Mal, Franky-Boy. Ich gönn mir diese ambulanten Anwendungen in dieser Klinik rein privat.« Sie setzte wieder jenes Lächeln auf, das er so sehr an ihr schätzte. »Aber ich hab auch sonst einiges in der Gegend zu erledigen.«
»Na ja«, erwiderte Mittelberg und sah sie beim Aussteigen von der Seite an. »Ein Glück, dass niemand so genau weiß, was dich wirklich hierhertreibt.«
Sie ließ das Verdeck des Cabrios nach unten fahren und stöckelte in ihrem kurzen Kleidchen voraus in den Hof der Klinik, in der es eine Cafeteria mit herrlichem Blick auf den angrenzenden Park gab.
»Schön hier«, stellte Mittelberg fest, als sie sich im Schutz eines Sonnenschirms niederließen. Nie zuvor hatte sie ihn hierhergeführt. An diesem späten Vormittag waren nur wenige Tische besetzt.
»Mhm«, machte sie. »Um ehrlich zu sein, Franky-Boy, seit du damals aufgetaucht bist, finde ich es in diesem Städtchen noch viel, viel schöner.« Sie fügte charmant an: »Und dies nicht nur unserer Geschäfte wegen.«
Er nickte und studierte die Getränkekarte.
»Dabei haben wir alles deiner Frau zu verdanken«, strahlte Marion. »Wär sie nicht wegen ihres Knies hier zur Kur gewesen und hättest du sie nicht zufällig an jenem Nachmittag besucht, als ich dort war, wären wir uns nie begegnet, stimmt’s?«
Mittelberg konnte sich natürlich lebhaft daran erinnern. War es doch tatsächlich ein seltsamer Zufall gewesen. Zufall?, hallte es durch seinen Kopf.
Marion hatte ihn damals provokant angelächelt, als sich ihre Wege im wahrsten Sinne des Wortes in einer der Kliniken gekreuzt hatten. Es war zu einem kurzen Small Talk gekommen, bei dem sich schnell herausgestellt hatte, dass sie beide in derselben Branche arbeiteten und sozusagen Kollegen waren. Marion freilich vertrat im Gegensatz zu ihm nicht nur ein einziges Pharmaunternehmen, sondern war, wie sie ihm erklärt hatte, freie Handelsvertreterin. Sie decke ein großes Gebiet ab und sei gerade dabei, »neue Märkte« zu erschließen. Insbesondere mit sogenannten Generika, also Nachahmer-Medikamenten, für Präparate, deren Patentschutz abgelaufen ist. Mittelberg hatte aufgehorcht, denn er wusste, dass der Patentschutz nach 20 Jahren endete und inzwischen mehr als 80 Prozent aller Verordnungen, die über gesetzliche Krankenkassen abgerechnet wurden, über diese Schiene liefen.
Von einem »interessanten Markt« hatte Marion gesprochen – »wenn man’s nur richtig anpackt«. Dass sie mit ihren weiblichen Reizen natürlich bei Apothekern und Ärzten weitaus bessere Karten hatte als er, hatte er sich damals wie heute vorstellen können. Seine Neugier war geweckt, zumal er mit Marions Unterstützung seine Umsätze deutlich zu erhöhen hoffte. Vermutlich noch weitaus mehr als mit seinen bisherigen Geschäften.