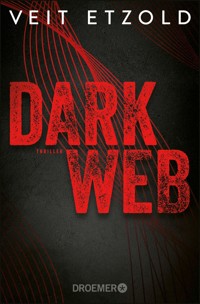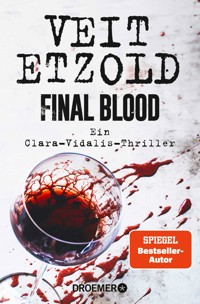9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Clara-Vidalis-Reihe
- Sprache: Deutsch
Hauptkommissarin Clara Vidalis findet sich in einem Albtraum wieder, als mehrere Tötungsdelikte, die als Suizide getarnt sind auftauchen, in denen die DNS von Ingo M. sichergestellt wird – desselben Ingo M., der vor über zwanzig Jahren ihre kleine Schwester missbraucht und ermordet hat. Und dessen sterbliche Überreste in der Berliner Rechtsmedizin seziert wurden. Wie kann es sein, dass ein Toter mordet, wieder und wieder? Und warum hat sich sein Modus Operandi, die Handschrift jedes Mörders, so verändert? Die Wahrheit ist handfester und zugleich entsetzlicher, als Clara es sich in ihren dunkelsten Nächten ausgemalt hat.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Veit Etzold
Schmerzmacher
Ein Clara-Vidalis-Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Hauptkommissarin Clara Vidalis findet sich in einem Albtraum wieder, als mehrere Tötungsdelikte, die als Suizide getarnt sind, auftauchen, in denen die DNS von Ingo M. sichergestellt wird – desselben Ingo M., der vor über zwanzig Jahren Claras kleine Schwester Claudia missbraucht und ermordet hat. Dessen sterbliche Überreste in der Berliner Rechtsmedizin seziert wurden. Wie kann es sein, dass ein Toter mordet, wieder und wieder? Und warum hat sich sein Modus Operandi, die Handschrift jedes Mörders, so verändert? Die Wahrheit ist handfester und zugleich entsetzlicher, als Clara es sich in ihren dunkelsten Nächten ausgemalt hat.
Inhaltsübersicht
Motto
Prolog
BUCH 1
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
BUCH 2
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
BUCH 3
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Epilog
Dankwort
Leseprobe: Staatsfeind
Staatsfeind
Motto
PROLOG
BUCH 1
Das ist nicht tot, was ewig liegt,
bis dass die Zeit den Tod besiegt.
Howard Phillips Lovecraft
Er stürzt sie bei Nacht.
Und sie sind zermalmt.
Hiob
Prolog
Ich bin der Sensenmann, ich bin der Untergang, ich bin der Namenlose.
Ich habe sie alle getötet. Die Männer, um an die Frauen zu kommen.
Es waren nur hübsche Männer, die ich in den Schwulen-Chats gesucht habe. Denn ich benutzte sie, um an die Frauen zu kommen. Um die Frauen zu finden.
Die Frauen zu finden, um sie zu töten.
Die Frauen zu töten, um das Opfer zu bringen.
Das Opfer zu bringen, damit ich nachts wieder schlafen kann.
Denn um den Schlaf zu empfangen, den Bruder des Todes, muss ich selbst töten. Immer und immer wieder.
Mit einem Mord fing es an. Wie bei Kain und Abel.
So war es auch bei mir. Ich war es, der sie getötet hat. Ich habe die einzige Person getötet, die mich jemals geliebt hat.
Vielleicht bringt man nur das um, was man liebt? Weil nur dann der Mord ein wirkliches Opfer ist? Genau so, wie die anderen Opfer wirkliche Opfer waren. Die für sie sterben mussten.
Sie alle waren tot. Sie alle waren lange tot. Ich wusste es. Aber alle anderen dachten, sie würden noch leben. Doch sie lebten nur im Internet weiter. Während ihre Leichen als vertrocknete Kadaver in ihren Zimmern lagen, von Käfern zerfressen, die ihre Flüssigkeit aufgesaugt hatten. Damit sie Mumien wurden. Und weil Mumien nicht riechen, wurden sie nicht entdeckt. Und lebten weiter. Als Tote. Im Internet. In den Chats. In den sogenannten »sozialen« Netzwerken. Ihre digitale Identität lebte viel länger als sie.
Denn heute ist der lebendig, der digital lebendig ist. Selbst wenn er in Wahrheit schon längst tot ist.
Denn es waren gar nicht die Opfer, die dort gechattet haben.
Ich selbst war es. Die enge Vertraute, die mit ihrer besten Freundin Privatnachrichten austauschte. In Wirklichkeit aber sprach sie mit mir. Die Eltern, die gar nicht mit ihrer Tochter mailten, sondern mit mir, dem Killer ihrer Tochter.
Wenn Gott zu euch spricht, werdet ihr sterben. So steht es im Alten Testament. Und alle, die mit mir sprachen, sind gestorben. Wurden zu vertrockneten Mumien, von Käfern zerfressen in ihren Zimmern, während ihr digitales Selbst, wie ein Dämon in der Unterwelt, ohne Körper durch den Cyberspace irrte.
Ich habe die Abgründe des Internets gesehen, die fast noch tiefer waren als meine eigenen. Die Hardcore-Seiten, wo Leute mit Messern zerschnitten werden wollten, die Vore-Seiten, wo sich Menschen gegenseitig aufessen, die Snuff-Movies, wo Menschen vor laufender Kamera zu Tode gefoltert werden. Und die Red Rooms.
Und irgendwann habe ich ihn getroffen.
Ingo M.
Oder besser: wiedergetroffen.
Es gibt kein Erkennen. Es gibt nur ein Wieder-Erkennen.
Denn ich kannte ihn. Kannte ihn, seitdem er mir als Kind seinen dicken, stinkenden Schwanz in meinen Arsch geschoben hatte.
Ich habe ihn wiedergefunden. Mich als Stricher ausgegeben, um an ihn heranzukommen. Und mich gerächt. Ihm das Gesicht zerschlagen und ihn dann angezündet. Zugeschaut, wie er langsam verbrannte. Er konnte sich nur selbst erlösen. Und das hat er getan.
»Verbrenne qualvoll oder richte dich selbst.«
Er hat es getan.
Hat sich mit einem Samuraischwert die Halsschlagader durchgeschnitten. Ich hätte es gern gesehen. Das Blut, das aus der Arterie spritzt und zischend auf das Feuer fällt. Wie auf einem Gemälde.
Ich hätte es gern gesehen. Zu gern. Aber ich bin gegangen. Und habe ihn mit dem Feuer, dem Schwert und dem Tod allein gelassen.
Das Feuer vor dem Höllenfeuer.
Vorher habe ich mir seine Geschichte angehört.
Ich habe ihn dazu gebracht, mir alles zu erzählen.
Ich habe seine Amalgamplomben unter Strom gesetzt, bis er mir wirklich alles erzählt hat.
Die meisten Menschen erzählen nicht alles. Die meisten halten immer etwas zurück.
Er nicht. Irgendwann erzählte er mir alles.
Erzählte mir von Claudia.
Claudia Vidalis. Der Schwester von Clara Vidalis.
Clara Vidalis. Die nur zur Polizei gegangen ist, um den Mörder ihrer Schwester zu jagen. Und die es nicht geschafft hat. Sie hat ihn gejagt.
Aber sie hat ihn nicht gefunden. Ich habe ihn gefunden.
Sie hat ihn nicht getötet. Ich habe ihn getötet.
Sie ist immer nur zur Beichte gegangen an jedem 23. Oktober, dem Todestag ihrer Schwester.
Dir, Clara, ging es wie allen anderen.
Auch das steht in der Bibel: »Auch deine Seele wird ein Schwert durchdringen.«
Du, Clara, warst zu schwach.
Deswegen musste ich die Wahrheit aus Ingo M. herausbrennen.
Er hat es mir gesagt. Ziemlich schnell sogar. Ein Bunsenbrenner, maximal fünfzehn Zentimeter von ihrem Fleisch entfernt, bringt Leute rasch zum Reden.
Zwischen den Schreien, wenn zischendes Fett neben der Flamme auf den Boden tropfte.
Hat mir gesagt, dass er all die Jungen und Mädchen missbraucht und umgebracht hat.
Hat mir gesagt, dass es mit dem Tod noch nicht zu Ende war.
Dass er bei der Beerdigung dabeistand.
Bei den Trauernden.
Und einmal auch neben Clara Vidalis.
Dass er Fotos gemacht hat. Zu denen er zu Hause onaniert hat. Und manchmal nicht nur zu Hause. Manchmal direkt am Grab. Nachts. Und manchmal, wenn er den Kick wollte, auch mitten am Tag.
Das Sperma von Ingo M., das am Grabstein seiner Opfer herunterlief.
Auch das hat er fotografiert.
Hat es sich zu Hause angeschaut.
Und dazu noch einmal onaniert.
Doch das war noch nicht alles.
Er hat mir gesagt, was er außerdem gemacht hat. Was er außerdem mit den Toten gemacht hat.
Dass er … noch einmal zu ihnen kam.
Dass er Dinge festgestellt hat.
Dass man an Leichen neue Öffnungen findet. So nannte er das. Dass man auch jenseits der üblichen … Löcher eindringen kann. Weil die Leichen anders sind. Amorpher. Weicher.
Das hat er mir gesagt.
Aber nicht Clara.
Er hat es nur mir gesagt.
Und ich habe es Clara gesagt.
Und jetzt, wo ich weiß, dass auch mich sehr bald die Schwingen des Todes in eine andere Welt bringen werden, dass ich selbst ein Geist oder ein Dämon werde, der körperlos durch die Leere fliegt, werde ich es ihr noch einmal sagen.
Ein letztes Mal werde ich kommen und Clara eine Botschaft bringen, die sie vielleicht in einen neuen Menschen verwandelt.
Oder sie total zerstört.
Die Zukunft ist ein blinder Spiegel.
Ich werde das Licht sein, das die Nebel durchschneidet.
Das Skalpell, das die Wahrheit freilegt.
Der Hammer, der die Spiegel zerbricht.
Auch wenn ich sterbe, es wird nicht zu Ende sein.
Auch aus dem Grab heraus wird man mich hören.
Auch ohne Körper wird man mich fürchten.
Ich bin der Sensenmann, ich bin der Untergang.
Ich bin der Namenlose.
Ich bin bereits tot. Doch das Chaos geht weiter.
BUCH 1
Driving compulsion morbid thoughts come to mind
Sexual release buried deep inside
Complete control of a prized possession
To touch and fondle with no objection
Lonely souls an emptiness fulfilled
Physical pleasures an addictive thrill
An object of perverted reality
An obsession beyond your wildest dreams.
Slayer, »213«1
Kapitel 1
Clara hörte die Stimme des Priesters, während Sophie und Hermann liebevoll das Kind hielten. Ihr Kind. Ihre Tochter. Ihr Ein und Alles.
Clara und ihr Mann Martin, der im LKA die Leitung für operative Fallanalyse leitete und den alle wegen seiner Faszination für Shakespeare und besonders für den tragischen Helden Macbeth MacDeath nannten, hatten sich dazu entschieden, ihr Kind in der Osternacht taufen zu lassen. Der Priester erzählte die Geschichte aus dem Alten Testament. Von dem Todesengel, der in Ägypten umging, um jeden Erstgeborenen der Ägypter zu erschlagen. Die Israeliten aber, das auserwählte Volk, wussten, wie sie sich schützen mussten. Denn der Engel Gottes hatte sie gewarnt. Sie sollten das Lamm schlachten. Das Fleisch essen. Und das Blut aufbewahren. Das Fleisch und das Blut.
Der Priester hieß Wolfgang und war ein Freund von MacDeath. Er sprach mit ruhiger, sonorer Stimme.
Man nehme etwas von dem Blut und bestreiche damit die Türpfosten und den Türsturz an den Häusern, in denen man das Lamm essen will …
So aber sollt ihr es essen: Eure Hüften gegürtet, Schuhe an den Füßen, den Stab in der Hand. Esst es hastig. Es ist die Paschafeier für den Herrn. Das heißt: Der Vorübergang des Herrn …
Die Paschafeier, das wusste Clara, war der Vorläufer des Osterfestes. MacDeath hatte die Stelle aus dem Alten Testament, Exodus, ausgesucht. Clara fand das zwar nicht unbedingt passend, denn bei einer Taufe ging es schließlich um neues Leben. Und nicht um einen Todesengel, der Kinder erschlug. MacDeath aber hatte sie belehrt, dass das Osterfest das Fest der Taufe war. Dass das Paschafest der Israeliten der Vorgänger des Osterfestes war und dass nur aus dem Tod heraus das Leben möglich ist. Vielleicht hatte er damit recht.
Doch Clara musste, wenn es um Tod und Wiedergeburt ging, vor allem an den Tod denken. Sie dachte vor allem an das Kind, das sie verloren hatte. Das Kind, das ein Killer, der sich Tränenbringer nannte, ihr aus dem Leib getreten hatte und das nun in einem kalten Grab auf einem Friedhof in Bremen lag. In dem Grab, in dem auch schon ihre jüngere Schwester Claudia Vidalis ruhte.
Bis zum Tag der Auferstehung. Oder für immer.
Gott war der Schöpfer des Universums. Und hatte damit das größte Leid geschaffen, was jemals möglich war. Damit war Gott auch der größte Verbrecher des Universums. Selbst seinen Sohn hatte er im Stich gelassen. Mein Gott, warum hast du mich verlassen, hatte Jesus, gefoltert und halbtot am Kreuz festgenagelt, gesagt.
Aber Gott hatte nichts getan.
Der Priester sprach weiter:
In dieser Nacht gehe ich durch Ägypten und erschlage in Ägypten jeden Erstgeborenen bei Mensch und Vieh. Über alle Götter Ägyptens halte ich Gericht, ich, DER HERR.
Das Blut an den Häusern, in denen ihr wohnt, das Blut des Lammes, soll ein Zeichen zu eurem Schutz sein.
Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen.
Und das vernichtende Urteil des Todesengels wird euch nicht treffen, wenn ich in Ägypten dreinschlage.
Claras Blick streifte MacDeath. MacDeath, dem es wieder gut ging, nachdem der wahnsinnige Tränenbringer ihn in den Bauch geschossen und er nur um ein Haar überlebt hatte. Nur weil Clara mit ihrem Finger seine Baucharterie verschlossen hatte, während sie auf dem Boden kniete und das pulsierende Blut an ihrer Fingerkuppe gespürt hatte. Das Blut des Mannes, den sie liebte. Ihr Blick verließ MacDeath und glitt zur Decke der Kirche. Eine riesige Malerei erstreckte sich über das Gewölbe, eine Malerei, die man eher in einer römischen Kirche als in Berlin-Prenzlauer-Berg vermutet hätte. Die Apokalypse mit dem Jüngsten Gericht, mit Christus als Weltenretter und dem Opferlamm. Dem Lamm, das geschlachtet wurde, um den Tod abzuwehren. Damals in Ägypten, dann in der Offenbarung. Und hoffentlich auch in Victorias Leben.
Victoria.
So hieß ihre Tochter.
Sie trug ein weißes Taufkleid und strahlte Clara mit ihren großen, blauen Augen an.
Clara spürte einen Stich im Herzen, voller Freude, doch auch voller Angst. Victoria. Sie war unendlich kostbar. Und unendlich verletzlich. Clara würde tausendmal für sie sterben. Und sie würde tausend Menschen für sie töten, um sie zu beschützen.
Hermann und Sophie traten mit Victoria an das Taufbecken heran.
Das Wasser des Taufbeckens bewegte sich leicht durch einen Luftzug, und das Spiegelbild der Apokalypse an der Decke geriet in Bewegung. Wie der Geist des Herrn, der vor der Erschaffung der Welt über dem Wasser schwebte.
Heute wurde nur der Kopf des Kindes mit Wasser benetzt, aber früher wurden die Täuflinge für einen Augenblick ganz unter Wasser gedrückt. Es sollte den Tod symbolisieren. Dass man sterben musste, um wieder zu leben.
Sterben, um neu geboren zu werden.
Der Priester erhob wieder seine Stimme. »Wisst ihr denn nicht, dass alle, die wir auf Jesus Christus getauft wurden, auf seinen Tod getauft worden sind?« Der Priester wandte sich an Clara und MacDeath, an Sophie und Hermann.
»Welchen Namen haben Sie Ihrem Kind gegeben?«
»Victoria«, antworteten Clara und MacDeath.
Sie schaute auf das Kind. Ihr Kind, das sie mit seinen blauen Augen etwas verwundert, etwas verträumt und vielleicht auch etwas hungrig anblickte.
»Was erbitten Sie von der Kirche Gottes für Victoria?«
»Die Taufe.«
Clara schaute auf das Pult, auf dem das Messbuch lag. Das Pult hatte die Form eines Kreuzes. Der Fuß des Pultes war eine metallene Schlange, die von ebendiesem Kreuz aufgespießt wurde. Es war der Sieg des Engels über den Drachen, der Sieg des Gesetzes über die Schlange, der Sieg Gottes über den Satan.
»Exorcizo te, immunde spiritus, in nomine patris et filii et spiritus sanctus«, murmelte der Priester leise. Es war der kleine Exorzismus, wie er Bestandteil von jeder Taufe war. Die Verbannung des Bösen Geistes, damit er den Täufling in Zukunft niemals vom richtigen Pfad abbrachte.
Der Priester wandte sich wieder an Eltern und Taufpaten, während Victoria in Sophies Armen ein leises Glucksen von sich gab.
Dann hob der Priester die Stimme und schaute alle mit durchdringendem Blick an.
»Widersagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben?«
»Ich widersage«, antworteten alle vier, Eltern und Taufpaten. Stellvertretend für Victoria. Claras Blick huschte über die Bänke. Sie sah Kriminaldirektor Winterfeld, der sichtlich gerührt und stolz der Szene folgte. Neben ihm Lisa, eine IT-Expertin aus dem LKA in der Keithstraße. Und daneben Hauptkommissar Deckhard. Bei ihm und Sophie sollten wohl bald die Hochzeitsglocken läuten.
Der Priester sprach weiter: »Widersagt ihr den Verlockungen des Bösen, damit es keine Macht über euch gewinnt?«
»Ich widersage.«
Der Priester hob zur letzten Frage an: »Widersagt ihr dem Satan, dem Urheber des Bösen?«
»Ich widersage.«
Dem Satan widersagen.
Das Böse erkennen.
Konnte man damit das Böse verhindern?
Clara hatte immer geglaubt, dass sie von dem Bösen verschont bleiben würde, wenn sie alle Winkelzüge und alle Perversionen des Bösen kennen würde. Doch würde es ihr am Ende helfen? Würde es sie am Ende schützen? Vor dem Projektil aus einer versteckten Waffe, einem schnellen Messer, einer Explosion?
Vielleicht war es einfach das Beste, gar nichts zu fürchten und sich am Ende überraschen zu lassen. Denn vielleicht passierte dann gar nichts. Nichts Gutes, aber auch nichts Schlimmes.
Nichts zu wissen, konnte ein Segen sein.
Wissen hingegen war ein Fluch.
Der Baum der Erkenntnis war nicht der Baum des Lebens.
Kapitel 2
Toll«, sagte der Mann im blauen Anzug und schüttelte den Kopf.
Grassoff, der ihm gegenübersaß, musste innerlich lächeln.
Toll sagen und den Kopf schütteln. Das war ironisch gemeint, aber es war dennoch absolut dumm. So etwas passierte den Anfängern, die nicht richtig lügen konnten. Auch dieser Mann war nicht ganz ehrlich. Er lächelte, weil er lächeln musste. Ein echtes Lächeln dagegen baute sich langsam auf, während ein künstliches viel schneller entstand.
Lügen, das wusste Grassoff, war harte Arbeit. Nur wer die Wahrheit ertrug, konnte auch lügen. Doch die meisten verdrängten die Wahrheit. Man musste allerdings erst einmal vom grellen Licht der Wahrheit gegrillt worden sein, um perfekt lügen zu können.
So wie er.
Der perfekte Lügner musste seinen kompletten Körper unter Kontrolle haben. Mimik, Stimmlage, Gesten. Und seine Wortwahl. Er musste sich nicht nur auf das konzentrieren, was er sagte, sondern auch darauf, wie er es sagte. Und er musste eine gute Vorstellungskraft haben. Denn echte Bilder waren im Kopf gespeichert, falsche musste man sich ausdenken. Das machte Arbeit, das kostete Rechenkapazität im Gehirn.
Das menschliche Gehirn hatte, wenn es bewusst Dinge wahrnahm, nur eine Kapazität von 40 Bit pro Sekunde. Nicht gerade viel. Wenn dann noch massiv Daten durch die Leitungen gedrückt wurden, von denen die Hälfte künstliche Bilder waren, die es in der Realität nie gegeben hatte, die man selbst erschaffen musste, weil es sie gar nicht gab; dann merkte ein guter Beobachter irgendwann, dass bei dem anderen etwas nicht stimmte.
So wie hier.
Der Mann hieß Olaf Thomsen und war einer der großen Immobilienhaie in Berlin. Eigentlich, dachte Grassoff, wusste man doch gerade in dieser Branche, wie man richtig log, aber da bestand bei Thomsen offenbar noch Nachholbedarf. Grassoff sollte es recht sein. Je mehr die Menschen von ihm lernen konnten, desto mehr bezahlten sie.
»Ich habe zwei Bauanträge gestellt«, sagte Thomsen und nestelte an seinem Kugelschreiber herum. Sein Haar war schwarzgrau und kurz und schimmerte im Licht der Bürolampe wie eine Stahlbürste. Grassoff hingegen thronte mit seinen hundertzwanzig Kilo auf seinem ledernen Schreibtischsessel, der nicht viel kleiner war als der im Weißen Haus.
»Ich habe beide Male ein Nein erhalten«, fuhr Thomsen fort.
Er hatte die Pläne auf dem Tisch ausgebreitet.
»Ein Nein?«, fragte Grassoff.
»Ja. Ein Nein«, entgegnete Thomsen etwas genervt.
Grassoff lehnte sich zurück. »Schön, dass Sie damit zu mir kommen«, sagte er. »Ich verkaufe nämlich genau das, was Sie brauchen.«
»Was genau verkaufen Sie?«
»Das Gegenteil von Nein.«
»Sie verkaufen …?« Die Kapazität in Thomsens Gehirn schien noch geringer als die üblichen 40 Bits zu sein.
»Ich verkaufe ein Ja«, sagte Grassoff.
Thomsen brütete einen Moment vor sich hin.
»Ein Ja von der Baubehörde?«, fragte er dann.
Grassoff nickte. »Ein Ja von wem immer Sie es brauchen.«
Thomsen kniff die Lippen zusammen.
»Muss ich wissen, wie Sie das machen?«
Grassoff lächelte kurz und ließ gleich danach die Mundwinkel wieder nach unten sacken. »Sie schlafen besser, wenn Sie es nicht wissen. Und manchmal ist auch Nicht-Wissen Macht.« Er schaute auf die Pläne. »Sagen Sie mir, was Sie vorhaben.«
»Das ist das erste Projekt«, erklärte Thomsen. »Ein großer Hotelkomplex auf dem Tempelhofer Feld.«
»… das wegen eines Volksentscheids nicht bebaut werden darf«, ergänzte Grassoff.
»… richtig. Und das ist unser Problem.«
Grassoff wusste, was das wirkliche Problem war. Er hatte schließlich seine Hausaufgaben gemacht, anders als diese Immobilienfuzzis, deren Boss Thomsen war. Noch jedenfalls. Ein großer Staatsfonds aus dem Nahen Osten hatte Thomsens Firma Geld gegeben, damit sie es in Berlin investierten. Dass eine derart große Brache wie das Tempelhofer Feld nicht bebaut werden durfte, verstanden die Herren in den Emiraten nicht. Und einer der Managing Directors von Thomsens Firma hatte sich wohl ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt und gesagt, dass das alles kein Problem sein würde.
Es war aber sehr wohl ein Problem.
Vielleicht hatte sich irgendeiner aus der Firma sogar zu dem Versprechen hinreißen lassen, dass man dort auch noch einen Privatflughafen eröffnen könnte. Schließlich sei das Gelände ja schon einmal ein Flughafen gewesen.
»Die Senatsverwaltung hat uns gefragt, ob wir nicht lesen können«, erklärte Thomsen.
»Nicht ganz unberechtigt«, gab Grassoff zurück. »Aber keine Sorge. Damit werden wir schon fertig. Was haben Sie noch?«
»Dann ist da noch diese Fläche in Grunewald. Sie gehört dem Land Berlin. Wir wollen die Fläche dem Land abkaufen.«
»Wofür?« Grassoff wusste genau, worum es ging. Aber er wollte es aus Thomsens Mund hören.
»Offiziell für günstige Wohnungen. Dummerweise ist durchgesickert, dass wir dort Flüchtlingsheime bauen.«
»Die Sie dem Land teuer vermieten wollen, habe ich recht? Miese, kakerlakenverseuchte Container ohne funktionierende Trinkwasserhygiene zu horrenden Preisen? Mit ethnischer Security, bei der sie einfach einige der Flüchtlinge in schwarze Hemden stecken und ihnen Taschenlampen in die Hand drücken?«
Thomsen wand sich. »Wenn man mit dummen Regierungen zu tun hat, kann man pro Flüchtling viel Geld verdienen. Hat in anderen Bundesländern schon wunderbar geklappt. Und in Berlin, wo alle in der Stadtregierung noch deutlich dümmer als der Bundesdurchschnitt sind, erst recht.«
O ja, das wusste Grassoff. Das konnte man. Und so war es wirklich in Berlin.
»Wie viel?«
»Was meinen Sie?«
»Wie viel Geld kann man machen, verdammt!« Grassoff fragte sich, wie jemand wie Thomsen überhaupt Chef von irgendetwas hatte werden können.
»Das wissen wir noch nicht.«
Typisch, dachte Grassoff. Die meisten wussten nicht, was sie wollen. Wie ein Geiselnehmer, der noch nicht weiß, ob er einen Mercedes oder einen Audi als Fluchtwagen will. Oder doch lieber einen Helikopter.
»Was wollen Sie verdienen?«, fragte Grassoff und blickte Thomsen durchdringend an.
Thomsen zuckte die Schultern. »Wir würden so mit fünftausend Euro pro Flüchtling und Monat rechnen.«
Grassoff hob die Augenbraue. »Würden oder werden?«
Wie viel Geld will er machen?, dachte Grassoff. Das wusste er nicht. Und das wussten die meisten nicht. Die meisten wünschten sich irgendetwas. Doch Wünsche waren Schall und Rauch. Ziele waren das Einzige, was wichtig war. Denn Ziele waren messbar. Wünsche waren Kindergeburtstag.
Thomsen wand sich erneut. »Wahrscheinlich wird das nicht möglich sein.«
Mit Idioten wie dir bestimmt nicht, dachte Grassoff. »So dumm ist die Regierung dann doch nicht?«, fragte er.
»Ein bisschen was davon ist durchgesickert.« Thomsen rückte auf seinem Stuhl hin und her. »Wir haben überlegt, ob wir drohen.«
»Womit?«
»Damit, dass dann der Raum knapp wird. Zu wenig Platz für zu viele Flüchtlinge. Da laut Wahlprogramm der Berliner Regierung niemand ausgewiesen wird, könnte das eng werden. Vielleicht droht Anarchie?«
»Falsche Drohung!« Grassoff schüttelte den Kopf. »Für die Bonzen in ihren gepanzerten Limousinen droht keine Anarchie. Das wird denen egal sein. Wir müssen sie …«, er legte die Hände aneinander, als wollte er eine Nuss knacken. Oder irgendeinem Wesen das Genick brechen, »… wir müssen die Bonzen … persönlich involvieren.«
Thomsen schaute ihn eine Weile an. Dann rückte er ein Stück vom Tisch zurück und blickte auf seine Fünfzehntausend-Euro-Breitling-Uhr.
»Was machen wir nun?«, fragte er. »Können Sie uns helfen?«
»Ja.«
»Und wie?«
»Mit einem Ja.«
»Einem Ja? Von Ihnen?«
»Von ihm.«
Grassoff schob ein Foto über den Tisch und drehte es um, sodass Thomsen es sehen konnte. Thomsen erkannte ihn sofort.
»Wichler«, knurrte er.
»Jochen Wichler«, ergänzte Grassoff. »Senator für Stadtentwicklung und Wohnen. Nah am Bürgermeister. Links, aber nicht blöd.« Grassoff lehnte sich zurück. »Muss einiges unter einen Hut kriegen. Klimaschutz, Smart City, Solar-Hauptstadt, nicht mehr als 30 Prozent vom Einkommen für die Miete von landeseigenen Firmen. Und dann muss er noch ein paar andere Sachen managen.«
»Was denn?« Thomsen war hellhörig geworden.
Doch Grassoff blieb nebulös. »… ein paar seiner Geheimnisse.«
Thomsen blickte ihn an. »Was haben Sie vor?«
Grassoff lächelte. Fast väterlich. »Machen Sie Ihre Deals! Wir … kümmern uns um die Details.«
Thomsen schaute ein paar Sekunden nahezu meditativ auf das Foto. »Ist das alles legal?«, fragte er dann.
»Alles, was legal ist, machen Sie.« Grassoff stand auf. »Alles, was es nicht ist, mache ich.« Er nickte gutmütig, aber es war die Gutmütigkeit eines Kettenhundes, der eine Katze in seinen Zwinger lockt. »Sie bleiben sauber.«
»Hm …«, meinte Thomsen. »Schön wäre, wenn es sich mit legalen Mitteln machen ließe.«
Grassoff schüttelte den Kopf. »Das sind Kompromisse. Kompromisse sind der Tod.«
Die meisten Menschen machten zu viele Kompromisse. Echte Verbrecher waren da anders. Die sagten Ich knalle dich ab. Das war klar. Sie sagten nicht Ich knalle dich nur ein bisschen ab. Das war ein Scheißkompromiss. Ein bisschen abknallen ging nicht, genau so wie ein bisschen schwanger. Er fixierte Thomsen. »Wollen Sie oder wollen Sie nicht?«
»Ja. Ich will.«
»Ein Ja.« Grassoff kniff ein Auge zu. »Genau das werden Sie kriegen!«
Kapitel 3
Einige Monate waren vergangen.
Clara hatte immer noch die Bilder der Taufe im Kopf, als sie an einem trüben Herbsttag das LKA am Tempelhofer Damm betrat. Sie hatte Victoria kurz zuvor in die Kita gebracht. Die Bilder blieben. Und diesmal waren es schöne Bilder. Bilder, die sie gern sah.
Ihre Tochter hatte sie mit einem seltsam weisen Kinderblick angesehen, als sie sie an der Kita abgesetzt hatte. Beinahe schien es ihr, als habe Victoria gewusst, dass sie es mit bösen Menschen aufnahm.
Ja, Mama fängt böse Menschen, hatte Clara in Gedanken geantwortet. Kinder hatten einen klaren Gerechtigkeitssinn. Der Polizist fing böse Menschen. Und ließ sie nicht mehr gehen. Haft auf Bewährung oder soziokulturelle Relativierung und Beschwichtigung war in deren Wertekanon nicht vorgesehen. Verwunderlich, dachte Clara, dass einige Kinder später trotzdem Richter wurden, die auch die schlimmsten Raubmördern und Vergewaltiger mit einem Jahr auf Bewährung gehen ließen.
Kaum hatte sie die Kita verlassen, hatte sie von Hermann einen Anruf erhalten. Sie solle so schnell wie möglich ins LKA kommen, hatte Hermann gesagt. Spezifischer war er nicht geworden.
Im dritten Stock ging Clara zunächst in die Küche und schenkte sich an der polternden und qualmenden Maschine einen schwarzen Kaffee ein. Keine Milch. Kein Zucker. Besser für die Verdauung und besser für die Figur.
Sie wollte gerade in ihr Büro gehen, als sie sah, dass die Tür zum großen Konferenzraum geöffnet war. Sie sah Hermann. Hinter ihm MacDeath, der einen Ordner in den Händen hielt. Auf dem Tisch einige Akten und eine Menge Fotos mit kaum erkennbaren Motiven, irgendein Mischmasch aus Braun und Grau. Auf einem der Konferenztische saß, ebenfalls einen Kaffee in der Hand, Kriminaldirektor Winterfeld.
»Da ist sie ja«, sagte Hermann.
Clara trat einen Schritt näher. Hatte sie irgendetwas verbrochen? Die Szene hatte etwas Tribunalartiges.
»Ja, da bin ich.« Sie sah auf die Uhr. »Bin ich zu spät?«
»Sind Sie nicht«, sagte Winterfeld. »Aber Diven dürfen auch zu spät kommen.«
»Diva? Ich?« Sie legte die Tasche auf einen der Stühle und trank vorsichtig von ihrem Kaffee. War das hier ein Scherz? Ein Dienstjubiläum, das sie vergessen hatte? Ein Spiel mit versteckter Kamera?
Doch Winterfeld blieb ernst. Er nickte nur. »Sie haben einen Fan. Wie sich das für Diven gehört.« Er versuchte, das Tütchen mit dem Zucker, das noch halb voll war, um seinen Finger zu wickeln, und verstreute dabei den gesamten Zucker auf dem Tisch.
Sie haben einen Fan …Clara ahnte schon, dass das sicher nicht so schön war, wie es klang. Vor allem, wenn Winterfeld in diesem irritierenden Ton sprach. Und dann das Wort Diva … Das war immer ambivalent.
»Und was für einen Fan?«, fragte Clara, während Winterfeld den Zucker vom Tisch wischte und das leere Tütchen in den Mülleimer warf.
»Ein junges Mädchen.«
»Und was macht dieses junge Mädchen?«
»Es möchte Sie treffen.«
»Und was macht es sonst so?«
»Es zündet Obdachlose an«, sagte Winterfeld tonlos.
Es zündet Obdachlose an? Clara hatte sich immer schon gewundert, warum ein Mädchen mit dem Pronomen es bezeichnet wurde, das eigentlich irgendwelchen namenlosen Monstern vorbehalten sein sollte. Doch in diesem Fall schien es tatsächlich zu passen.
»Sie zündet Obdachlose an?« Clara hob die Augenbrauen hoch. »Na super. Hatte schon Angst, dass sie gern T-Shirts bedruckt oder Meerschweinchen züchtet.«
»Brandstiftung ist bei Frauen um einiges seltener als bei Männern«, ließ sich jetzt MacDeath zum ersten Mal vernehmen, während er den Ordner auf dem Tisch ablegte. »Meist ist es Rache. Das gemeinsame Wohnzimmer oder der Computer des Mannes wird angezündet. Oder das Innere des Autos. Das Ganze eher auf die leise Art und Weise, nicht mit Molotowcocktails, die durchs geschlossene Wohnzimmerfenster geworfen werden, wie Männer das häufig machen. Bei beiden sind aber oft Drogen oder Alkohol im Spiel.«
»Aber hier sind es ja keine Autos, sondern Menschen?«, fragte Clara.
Winterfeld nickte. »Leider. Feuer als Tatwaffe. Das gibt es bei Frauen noch seltener. Hier schon.«
»Ich fürchte, die Obdachlosen sind noch lebendig, wenn sie angezündet werden?«
Hermann schaute auf einige der Fotos. »Da fürchtest du richtig.«
»Was ist das Motiv?«
»Wissen wir noch nicht«, sagte MacDeath. »Vielleicht Rache? Vielleicht Sadismus? Eine Beziehungstat wohl eher nicht. Die Opfer sind eher ausgewählt worden, weil sie Obdachlose sind. Ihre Spuren musste die Frau dabei nicht verwischen, denn diese Obdachlosen sind wahrscheinlich ohnehin nirgends mehr korrekt gemeldet und werden auch von niemandem vermisst.«
Der Versuch, Spuren zu verwischen, das wusste Clara, war häufig ein Grund, Menschen zu verbrennen. Opfer, die auf andere Art und Weise ermordet worden waren, wurden häufig verbrannt, um die wahre Tat zu verbergen. Wobei die meisten Täter nicht wussten, dass auch nach einem Feuer mit Brandbeschleuniger noch reichlich DNA vorhanden war. Und dass man schon gute zwei Stunden im Krematorium bei 800 Grad Celsius brauchte, bis eine Leiche komplett verbrannt war und alle Spuren vernichtet waren. Inklusive der DNA.
»Hier«, sagte Winterfeld. Er hielt Clara eines der Fotos hin. Das Bild einer Brandleiche.
»Das war ihr Werk. Vor drei Tagen.« Clara schluckte.
Dass es ein Mensch war, war auf dem Foto noch zu erkennen. Arme und Beine waren wie bei einem Fötus angewinkelt, als habe sich das Opfer vor den Flammen schützen wollen. Aber am Ende waren es nur die Muskeln gewesen, die aufgrund der Hitze schrumpften, sich zusammenzogen.
»Von Weinstein sagt, Haut und Unterhautfettgewebe waren so gut wie nicht mehr vorhanden«, ergänzte MacDeath. Clara schaute kurz zu MacDeath und dann wieder auf das Foto, das die verbrannten Reste auf dem Stahltisch in der Rechtsmedizin in Moabit zeigte. Aufgenommen von Dr. von Weinstein, dem stellvertretenden Leiter der Rechtsmedizin, höchstpersönlich. Verkohlte Muskeln hingen an verbrannten Knochen wie die schwarzen Taue eines verbrannten Schiffes. Darmschlingen waren durch die Hitze aus der aufgeplatzten Bauchdecke ausgetreten.
»Wie hat sie das gemacht?« Clara sah nach oben. »Dass sich eine derartige Hitze entwickelt?«
»Mit Ventilatoren. Die haben dem Feuer immer neuen Sauerstoff gegeben. Und es in Richtung dieses armen Kerls gefegt.«
»Hat er dabei noch gelebt?«
Hermann verzog das Gesicht und nickte. »Ja. Die Rechtsmediziner haben Rußablagerungen in den Bronchien gefunden. Der Ruß ist eingeatmet, also aspiriert worden. Das geht nur bei funktionierender Atmung. Er hat noch gelebt.«
Das Böse, dachte sie. Es existierte. Es würde niemals aufhören. Und es würde fast immer gewinnen. Sie dachte an die Worte von der Taufe.
Widersagt ihr dem Bösen, um in der Freiheit der Kinder Gottes zu leben?
Ich widersage.
Widersagt ihr den Verlockungen des Bösen, damit es keine Macht über euch gewinnt?
Ich widersage.
Widersagt ihr dem Satan, dem Urheber des Bösen?
Ich widersage.
Sie schaute noch einmal auf das Foto. Auf die verkohlten und durch die Hitze zusammengeschrumpften Teile des Dünndarms, die aus der aufgeplatzten Bauchdecke hingen. Die leeren Augenhöhlen. Reste des rechten Augapfels waren noch als eine krümelige, schwarze Eiweißmasse vorhanden. Verkohlte Hirnsubstanz quoll aus dem Schädel. Der Mund des Mannes war geöffnet.
Clara legte das Foto auf den Tisch zurück. Dort lagen noch andere Bilder. Detailaufnahmen. Eines von seinem offenen Mund. Selbst die Zähne waren verrußt und die Zungenoberfläche hatte die Beschaffenheit von gekochtem Fleisch.
Das Böse, dachte Clara. Sie dachte wieder an die Taufe. Vielleicht, um das Böse irgendwie zu vertreiben. Vielleicht, um zu verhindern, dass sich dieses Böse jemals irgendwie ihrer Tochter nähern konnte.
Und in dem Moment fragte sie sich wieder das, was sie sich schon immer gefragt hatte: Konnte man in eine solche Welt wirklich ein Kind setzen?
Glaubt ihr an Gott den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde?
Ich glaube.
Glaubt ihr an Jesus Christus …
Ich glaube.
Glaubt ihr an den Heiligen Geist, die heilige, katholische Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das Ewige Leben?
Ich glaube.
»Sie will Sie sehen«, sagte Winterfeld. »Wie gesagt.«
»Warum mich?«
»Sie hat einiges über Ihre Fälle gehört. Es gibt viele Frauen, die Kriminalermittlungen spannend finden.«
»Ja, aber die lesen Krimis oder Thriller.«
»Die hier ist Fan von den echten Ermittlern. Und sie verbrennt leider Menschen.«
»Und jetzt?«
»Müssen wir zu ihr. Sie hat seit heute drei weitere Obdachlose in ihre Gewalt gebracht.« Winterfeld senkte die Stimme. »Einen hat sie schon mit Benzin übergossen. Sie droht damit, sie alle zu verbrennen, wenn Sie nicht zu ihr kommen.«
»Kann sein, wir kommen und sie verbrennt sie trotzdem«, gab Clara zu bedenken. »Wäre nicht das erste Mal.«
»Stimmt«, sagte Winterfeld. »Aber falls wir die armen Kerle retten können, indem wir zu ihr kommen, sollten wir es versuchen.«
»Und das SEK?«
»Ist schon dort.« Hermann schob einen Stapel Papiere zusammen. »Sie hat bisher einen Obdachlosen mit Benzin übergossen und droht, die anderen sofort anzuzünden, wenn sich irgendein Polizist nähert.«
Clara sah Winterfeld an. »Warum haben die keine Scharfschützen, die die Psychotante einfach abknallen?« Seitdem Clara Mutter war, war sie gegenüber Psychopathen noch viel kompromissloser geworden als ohnehin schon.
»Könnten sie auch«, sagte Winterfeld, »dürfen sie aber nicht. Das ginge vielleicht in Frankreich oder den USA. Aber vergessen Sie nicht: Wir leben in Deutschland. Da müssen erst mal mindestens drei Unschuldige sterben, bevor die Einsatztruppen schießen dürfen. Sie wissen ja, wie lange das damals gedauert hat, bis das SEK endlich bei den G20-Krawallen in Hamburg einschreiten durfte.«
»Kann auch sein, dass die die Bewohner der Schanze erst mal eine Weile haben schmoren lassen, nach dem Motto Jetzt seht ihr mal, wie sich eure geliebten Randalierer im eigenen Viertel verhalten.« Das war Hermann.
»Etwas konspirativ, aber wer weiß. In jedem Fall sind in Deutschland Täterleben wichtiger als Opferleben. Und Schuldige höher angesehen als Unschuldige.« Er schaute Clara an.
»Stimmt leider«, sagte die. »Wo ist nun dieses junge Mädchen?«
»In den Ruinen der Beelitz-Heilstätten. Potsdam Mittelmark.«
»Das ist in Brandenburg!«
Winterfeld nickte. »Die Kripo Potsdam weiß eh nicht weiter. Die hat uns den Fall gegeben.«
»Dann fahren wir jetzt dort hin?«
»Richtig. Wir nehmen unser eigenes SEK mit. Die Jungs kennen wir schließlich. Und nehmen die Dame mal hoch. Wird vielleicht einfacher, wenn ihr Idol dabei ist.« Er hob den Kopf und kniff ein Auge Richtung Clara zu.
»Okay«, sagte Clara. »Ich hole meine Glock.«
Winterfeld konnte es nicht lassen: »Und Ihre Autogrammkarten.«
Kapitel 4
Grassoff griff zum Telefon. Durch das Fenster seines großen Büros sah er unten Thomsen in ein Taxi steigen. Direkt gegenüber war das Alexa-Einkaufszentrum, ein klotziges, rotes Gebäude, das jedem Diktatorenpalast in Sierra Leone zur Ehre gereicht hätte. Rechts davon der Fernsehturm, der sich wie eine bizarre Blume in den Himmel erstreckte. Das Gebäude der Landesbank Berlin, die einmal die Bankgesellschaft Berlin gewesen war. Das Park Inn Hotel. Weiter hinten die Leipziger Straße mit den berühmten Hochhäusern.
Grassoffs Büro war am Alexanderplatz. In dem gleichen Gebäude, in dem früher Detlev Rohwedder sein Büro hatte. Der Chef der Treuhand. Die Treuhand sollte damals alle staatseigenen Unternehmen der DDR bewerten und privatisieren. Es war ein Büro mit hoher Symbolkraft. Und genau darum wollte Grassoff es haben.
Treuhand, Bankgesellschaft Berlin, Leipziger Straße, dachte er. Berlin hatte dreihundert bis vierhundert Korruptionsverfahren pro Jahr, da fiel seines auch nicht auf. Vor allem, wenn sie ein derart saftiges Ziel hatten wie Jochen Wichler, Senator für Stadtentwicklung und Wohnen. Ein Mann, der gleichzeitig modern und arbeiternah sein wollte und damit von beidem nur das Schlechteste kombinierte.
Er war der Flaschenhals. Der Thomsens Projekt blockieren oder durchwinken konnte. Grassoff wurde dafür bezahlt, dass genau Letzteres passierte. Er hatte sich alle Informationen über Wichler geholt. Vor seiner Berufung zum Senator hatte Jochen Wichler in einem Architekturbüro gearbeitet. Es war eines der großen Loft-Büros zwischen Mitte und Kreuzberg gewesen, die in allem hip und modern sein wollten und bei dem die Mitarbeiter, wie in Asien, einen RFID-Near Field Communication Chip unter der Haut trugen. Sie wurden den Mitarbeitern von einem Arzt unter die Haut gespritzt. Es hatte Grassoff gewundert, dass die Mitarbeiter das im Datenschutz-hysterischen Deutschland mitmachten, aber offenbar war die dadurch gewonnene Bequemlichkeit einfach zu groß. Denn die Chips eigneten sich zum Türöffnen, Kopierer bedienen und für den Kaffeeautomaten. Keine Schlüssel mehr, die man vergessen haben konnte, keine Karten, die man aufladen musste. Es war alles immer up to date und wurde, im wahrsten Sinne des Wortes, am Mann getragen. In Schweden, wo das Architekturbüro sein Hauptquartier hatte, konnte man damit sogar schon U-Bahn fahren oder bei Starbucks bezahlen.
Wichler schien das genauso praktisch zu finden.
Im Senat wusste freilich niemand, dass Wichler noch diesen Chip trug.
Nur Grassoffs Männer wussten es. Und darauf kam es an.
Sie hatten sich im Gedränge bei einer Opernpremiere, wo Wichler mit seiner Frau war, nahe an der Zielperson platziert und auf diese Weise mit einem Lesegerät die Daten von Wichlers Chip gezogen. Damit hatten sie Zugang zu seinem Mac, der noch in dem Architekturbüro stand, da im Senat Windows der Standard war. Während Wichler in der Oper saß, waren sie an seinem Computer in seinem Büro gewesen.
Wer nach Dreck suchte, fand ihn auch irgendwann. Schließlich waren sie in versteckten Winkeln auf Wichlers privatem Mac gekommen. Chats. Und andere Dinge.
Dort fanden sie einige Dinge über Wichler, die die anderen sicher nicht wussten. Die im Senat schon gar nicht.
Was Wichler mochte. Und was er besonders gern mochte.
Die Dinge, die man besonders gern mochte, waren auch oft die Dinge, die man gern für sich behielt.
Mitunter Dinge, bei denen man alles dafür tat, sie ganz für sich zu behalten.
Und die man besser auch für sich behalten sollte.
Das waren die wertvollen Informationen.
Die Informationen, die so wichtig waren, dass sie anderen ein »Ja« entlockten.
Das war die Währung von Grassoffs Firma.
Kapitel 5
Sie saß gemeinsam mit MacDeath auf der Rückbank von Winterfelds Mercedes. Hermann saß auf dem Beifahrersitz, während Winterfeld den Wagen auf der Avus Richtung Potsdam lenkte. Sie waren gerade auf die Abfahrt Richtung Leipzig und Magdeburg gefahren, und Winterfeld hatte es zum Glück hinbekommen, mal nicht versehentlich auf der Abfahrt Funkturm/Messe abzubiegen und dann umständlich wenden zu müssen. Rechts tauchte kurz die frühere Tribüne für Autorennen auf der Avus auf. Der Polizeifunk knisterte.
Die Ruinen von Beelitz, dachte Clara. In dem Dossier, das die Kollegen aus Potsdam gefaxt hatten, gab es ein paar Presseartikel, in denen es um den Komplex ging.
Bis 1930 war die Heilanstalt eine topmoderne Tuberkulose-Klinik mit tausendzweihundert Betten gewesen, die die damals furchtbar um sich greifende Lungenkrankheit besiegen sollte. Dann kam der Erste Weltkrieg, und die Klinik wurde ein Lazarett. Auch Adolf Hitler war als Gefreiter hier behandelt worden.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen die Sowjets. Dann kam die Wende, und damit kamen Vandalismus, rätselhafte Morde, satanische Rituale. Menschen, die in irgendeinen fünf Meter tiefen Schacht fielen und erst nach Monaten tot und verwest daraus hervorgezogen wurden.
Clara blätterte weiter durch die Ermittlungsunterlagen.
»Nancy heißt die Dame?«, fragte Clara. »Und weiter? Hier steht vermutlich Kersting. Man muss doch wissen, wie die Frau heißt?«
Winterfeld zuckte die Schultern. »Keine Ahnung. Wenn es da nicht steht, weiß ich es auch nicht. Es ist offenbar nicht ganz klar, wer die Eltern waren.«
»Schau mal hier«, MacDeath zeigte auf einen Absatz im Bericht. »Nancy hatte als Baby wohl mehrere Stunden nach der Geburt keinen Kontakt zu Menschen. Imprinting nennt man das, wenn sich Babys die nächste Kontaktperson suchen. Bei Tieren beobachten wir das auch. Gänse sehen zum Beispiel auch leblose Objekte als Eltern an. Kinder machen das indirekt mit den Kuscheltieren.«
»Aber wenn gar keiner da ist …?«, begann Clara.
»Dann ist das hochgefährlich. Solche Kinder werden gefühlskalt und empathielos. Oft können sie die fehlende Nähe und Liebe nur durch Gewalttaten kompensieren. Ähnlich wie bei extremen Masochisten, für die Schmerz die einzige Form von Nähe ist. Es kann aber auch in die andere Richtung ausschlagen. Richtung Sadismus. So wie hier.«
»Können fehlende Nestwärme und Feuer zusammenhängen?« Sie schaute MacDeath an und dachte an die brennenden Obdachlosen.
»Klingt erst einmal seltsam, könnte aber sogar sein«, sagte MacDeath.
»Wie alt ist sie eigentlich?«, fragte Winterfeld.
»Siebzehn«, sagte Hermann, der die Akte vorhin bereits überflogen hatte.
»Mein Gott.«
Es wurden immer mehr Kinder straffällig, das wusste Clara. Terroristen nutzten noch nicht strafmündige Kinder für Terroranschläge. Bei denen sie dann am besten auch noch andere Kinder in die Luft sprengten. Die Kindersoldaten, eigentlich ein Phänomen aus Krisenregionen, kamen langsam nach Deutschland. Und Obdachlose anzuzünden war in Berlin fast schon ein Volkssport geworden, auch wenn diese Tradition eigentlich aus den USA kam, wo es oft die Rich Kids waren, die reichen Kinder, die sich in bester American Psycho-Manier an den Schwächsten vergingen. Mit zwischen dreitausend oder vielleicht sogar zehntausend Obdachlosen in Berlin waren auch genügend Opfer vorhanden. Genau wusste niemand, wie viele es waren, da es keine Meldestelle für Obdachlose gab und die sich dort wohl auch nicht melden würden. Einzig in den USA, wo im Zuge einer umstrittenen Aktion Obdachlose als mobile WLAN-Hotspots unterwegs waren, damit es verbreitet Möglichkeiten gab, ins Internet zu kommen, konnte man ihre Zahl immerhin ein wenig zuordnen. Dafür wurden in Berlin mittlerweile genauso viele angezündet wie beim großen Vorbild jenseits des Atlantiks. Direkt an Heiligabend 2016 hatten sieben junge Männer aus Syrien in der U-Bahn einen Obdachlosen anzünden wollen. Sie hatten die Zeitungen angekokelt, auf denen der siebenunddreißigjährige Obdachlose schlief. War das auch die fehlende Wärme zum Fest der Liebe? Ein U-Bahn-Fahrer hatte dem Mann glücklicherweise mit einem Feuerlöscher das Leben retten können. Die Täter sagten aus, dass sie das Ganze nicht so gemeint hätten, ähnlich wie der Besitzer eines abgerichteten Kampfhundes sagen würde, dass der ja nur spielen wollte. Das Problem an Berlin war, dass die Richter hier so etwas glaubten und die Täter meist laufen ließen oder eine milde Bewährungsstrafe verhängten wie auch in diesem Fall. Überall brannten die Ärmsten der Gesellschaft. In Köln starben sie entweder durch Tritte oder durch Flammen oder beides. Im Vorraum einer Sparkasse wurden sie mit Benzin übergossen und angezündet und die Täter nur erwischt, weil die Überwachungskamera über dem Geldautomaten alles gefilmt hatte. Die Kamera der Sparkasse. Keine öffentliche Kamera. Weil der Staat davon ausging, dass seine Bürger lieber zusammengeschlagen oder angezündet als gefilmt werden wollten.
Clara hatte einiges darüber gelesen. Meist war es Selbsterhöhung, wenn man einen noch Schwächeren demütigen, dominieren oder sogar umbringen konnte. In der rechtsextremen Szene gab es für so etwas sogar einen Namen: Penner klatschen.
Doch hier war es eine Frau. Das war eher selten.
Sie war erst siebzehn.
Im Jahr 2001 geboren.
Damals, als Terroristen das World Trade Center in New York in einem Feuerball aus Flugzeugen und Kerosin und Menschen zum Einsturz gebracht hatten.
Im gleichen Jahr war Nancy geboren worden.
Die heute Obdachlose anzündete.
Sie agierte allein.
Und sie dachte sich Mechanismen aus, wie das Feuer noch brüllender, noch vernichtender, noch grauenvoller wurde. Mit Ventilatoren.
Das Feuer, das vernichtet.
Feuer und Wasser, dachte Clara.
Das Wasser der Taufe.
Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
Das weiße Taufgewand. Sophie und Hermann, die das Kind am Taufbecken hielten.
Clara sortierte ihre Gedanken. Hermann checkte irgendetwas an seinem Smartphone. Sie sah im Rückspiegel, dass sich sein Gesicht kalkweiß färbte.
»Agiert sie wirklich allein?«, fragte Clara.
»Wie man’s nimmt.« Hermann reichte das Smartphone nach hinten. »Hier.«
Clara ergriff das Gerät. YouTube war geöffnet.
»Sie hat gerade den ersten der Männer angezündet«, sagte Hermann. »Und filmt das Ganze. Hat die Live-Schaltung aktiviert.«
Clara konnte nicht hinschauen und musste es doch. Das Knistern, die Schreie, das Zucken und Strampeln des gefesselten Mannes, um den die Flammen gierig herumtanzten. Dies fand jetzt statt. Jetzt, in diesem Moment. Sie spürte einen sauren Kloß in der Speiseröhre.
»Der Traffic ist Wahnsinn«, stöhnte Hermann. Und damit meinte er nicht den stockenden Verkehr auf der Avus, sondern die Klickraten des Videos.
Clara schaute auf die Statistik bei YouTube. Schon zehntausend Klicks. Zwanzigtausend. Es ging fast exponentiell nach oben. Dabei brannte der Mann erst seit einer halben Minute.
Plötzlich wendete sich die Kamera.
Man sah ein Gesicht.
Blass. Halblange Haare. Augenringe. Aufgesprungene Lippen. So als würde das Mädchen schon seit Tagen da draußen leben.
Der Mund öffnete sich.
»Clara!«, rief Nancy. Und es geschah genau in diesem Moment. Sie sagte das, während Clara gerade in dem Mercedes auf der Avus saß und in Beelitz der Obdachlose neben Nancy brannte.
»Clara, ich warte auf dich. Und ich bin nicht allein!«
Sie ließ die Kamera an sich herunterfahren.
Und Clara zuckte zusammen.
Nancy war schwanger.
Kapitel 6
Erst hatte er Tiere gequält.
Dann hatte er sie getötet.
Dann hatte er Menschen gequält.
Und als Nächstes wollte er auch die töten.
Er hatte Frösche aufgeblasen. Mit einem Strohhalm, den er ihnen in den Hintern gestopft hatte. Bis sie platzten.
Dann kamen die größeren Tiere. Und dann die größeren Menschen. Und irgendwann wieder kleinere Menschen.
Kinder waren nicht so kompliziert wie Frauen. Sie fühlten sich nicht so besonders und speziell. Wie die Erwachsenen. Sie waren anders. Sie dachten sich erst einmal nichts dabei. Ließen es geschehen, wenn er sie anfasste. Doch irgendwann mochten sie ihn nicht mehr.
Sie mochten ihn nicht und sie mochten es nicht.
Manche von ihnen hatte er laufen lassen. Doch bei einigen ging das nicht. Bei einigen hatte er Sachen gemacht, von denen auf keinen Fall jemand erfahren durfte. Von denen die Kinder aber erzählen würden. Denn es hatte den Kindern nicht gefallen, was er mit ihnen gemacht hatte. Und er hatte trotzdem weitergemacht. Denn er hatte gemerkt, dass es ihm Spaß machte. Dass es ihm umso mehr Spaß machte, wenn die anderen nicht wollten. Wenn er Macht ausüben konnte gegen den Willen von anderen, dann machte es ihm gleich noch viel mehr Spaß. Wenn die anderen keinen Spaß hatten, dann hatte er Spaß. Es hatte ihn erregt. Und er hatte weitergemacht.
Die Kinder wollten nicht.
Er machte trotzdem weiter.
Die Kinder würden davon erzählen.
Also mussten sie weg.
Für die Spiele hatte er den Bunker.
Die Kinder ließ er verschwinden. Irgendwann würden sie gefunden. Es war egal.
Vor ihrem Tod schaute er in ihre Augen. Trank die Tränen der toten Kinder.
Er versuchte, etwas in ihren Augen zu erkennen. Kurz bevor sie starben. Doch da war nichts. Keine Angst, kein Schrecken, kein Blick in eine andere Welt. Nur Leere. Zwei gallertartige Bälle aus Protein. Mehr nicht.
Leere.
So leer wie der Blick von Ingo M.
Kapitel 7
Winterfelds Mercedes fuhr durch eine Pfütze. Brackiges Wasser spritzte nach oben, bevor der Wagen zum Stehen kam.
Ein Kollege aus Potsdam begrüßte ihn bereits. »Ludwig, Hauptkommissar«, sagte der. »Kommen Sie mit.« Zwei Polizisten standen an seiner Seite. Einer hatte irgendwo einen Pappbecher mit Kaffee auftreiben können. Clara fragte sich, wo. Einen Kaffee könnte sie jetzt auch gut gebrauchen. Hauptkommissar Ludwig war in Zivil, blaues Hemd, Seemannspullover und darüber ein etwas abgerissener Anorak. So sahen fast alle Kommissare in Berlin aus, mit Ausnahme von Bellmann und Winterfeld. Die Ermittler in Zivil, die immer in Anzug und Krawatte unterwegs waren, gab es auch nur in den US-Krimiserien.
Sie betraten das Gelände. Die Gebäude von Beelitz waren verfallen, die bröckelnden Wände voll mit Graffiti, darunter ein Hakenkreuz und mehrere Pentagramme. Die Fenster zugenagelt, zersplittert oder nur noch leere Öffnungen. Pfützen und Schmutz überall.
Wolken waren aufgezogen, und Regen tropfte an den grauen Fassaden herunter und durch die Dächer. Sie sah aufgerissene Stellen, wo Diebe Metall aus den denkmalgeschützten Wänden gerissen haben. Schmutzstarrende Kacheln, Tüten auf dem Boden, Bierdosen, Reste von Lagerfeuern und Spritzbesteck.
In Internetforen gab es viele Postings, die behaupteten, dass es hier spukte, die behaupteten, dass sich Türen von Geisterhand öffneten. Dass es Gespenster gäbe. Und dass man aus dem früheren OP-Bereich Stimmen und Schreie hören würde. Dass die, die bei den OPs gestorben waren, hier als Untote herumspuken würden. Mit aufgeschlitzten Leibern, aus denen die Innereien heraushingen.
»Was müssen wir wissen?«, fragte Clara.
»Sie will Sie sehen«, sagte Ludwig und schlug den Kragen von seinem Anorak gegen den Regen hoch.
»Das wissen wir. Was noch?«
»Sie hat den nächsten Obdachlosen gefesselt und mit Benzin übergossen. Sie hat mehrere Benzinfeuerzeuge griffbereit und droht damit, den armen Kerl auch sofort in Brand zu setzen.« Er schüttelte den Kopf. »Sie hat sogar einen Ventilator angeschlossen. Mit einem benzinbetriebenen Generator.«
Clara blickte sich um. Die Männer vom SEK, die im zweiten Wagen mitgefahren waren, verteilten sich auf dem Gelände.
»Können wir sie erschießen, bevor sie den Mann anzündet?«
»Kommt drauf an, wie schnell wir zum Schuss kommen.« Ludwig kniff die Lippen zusammen. Er wusste, was es, gerade in Berlin, für einen Papierkram gab, wenn ein Polizist im Einsatz einen Menschen erschoss. Auch wenn dieser Mensch gerade einen anderen angezündet hatte. Das wollte sich kein Ermittler antun. »Dann müssten wir noch chemisches Löschzeug holen. Dann vielleicht.« Er blickte in den Regen. »Es kommt noch eine Sache hinzu.«
»Nämlich?«
»Sie hat eine Schusswaffe.«
»Claaaraaaa!«, schrie Nancy.
Sie stand in einem blau gekachelten Raum, der einmal ein OP gewesen war. Die riesige Deckenleuchte hing noch über dem Tisch. Daneben ein Stuhl. Neben dem Tisch der seltsame Ventilator mit dem ratternden Generator. Und auf dem Tisch – ein Mann. Der Kopf von Alkohol gerötet, Kabelbinder an den Händen. Wahrscheinlich hatte sie den armen Mann abgefüllt und dann gefesselt. Schnapsflaschen lagen auf dem Boden. Der Mann gab röchelnde Geräusche von sich.
»Hilfe, Hilfe, Hilfe!«, schrie der Mann, als die Beamten sich näherten. Nancy grinste nur. Geknebelt hatte sie ihn nicht. Warum auch? Hier war es eh egal, wer wie laut herumschrie, die Polizei war schon da, und wahrscheinlich geilte Nancy das Geschrei sogar auf.
Und es würde sie wahrscheinlich noch mehr aufgeilen, falls der Mann anfangen sollte, zu brennen. Feuchtigkeit glitzerte auf der Kleidung des Mannes. Benzin. Clara roch den scharfen Gestank auf vier Meter Entfernung. Der Mann blinzelte, die Augen vom Benzindampf gerötet.
In einer Ecke ein verkohlter Kadaver mit glimmender Asche. Es war der Leichnam des Mannes aus dem YouTube-Video. Das Video, das jetzt bei hundertfünfzigtausend Klicks war.
Schuld und Unschuld.
Leben und Tod.
Clara musste wieder an die Taufe denken.
Der Allmächtige Gott hat dich von der Schuld Adams befreit und euch aus dem Wasser und dem Heiligen Geist neues Leben geschenkt.
In der Taufe bist du eine neue Schöpfung geworden und hast, wie die Schrift sagt, Christus angezogen.