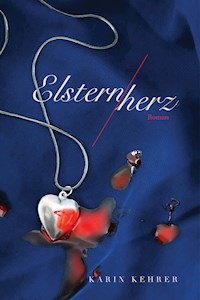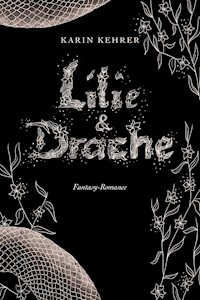Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Dein Schicksal liegt in meinen Händen – so wie meines in deinen. Ich weiß, dass du auf mich wartest … Er tötet jedes Jahr im November und schmückt die Leichen mit Schmetterlingsbroschen. Maureen McPherson war sein erstes Opfer. Ihre Tochter April war Zeugin des Mordes, doch sie kann sich nicht daran erinnern. Aber er hat sie nicht vergessen und sucht noch immer nach ihr. Nach seiner Verbündeten, seiner Seelengefährtin, die ihn damals nicht verraten hat …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 532
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karin Kehrer
Schmetterlingstränen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
01. Highgate Wood, London, 14. November 2012
02. Oban, Schottland, 12. November 2013
03. Portree, Isle of Skye, April 1996
04. Oban, 12. November 2013
05. Glasgow, 15. November 2013
06. Oban, 16. November 2013
07. Oban, 17. November 2013
08. Portree, Clach Ard, Ende Juni 1996
09. Oban, Polizeistation, 17. November 2013, 10.30 Uhr
10. Portree, Clach Ard, August 1996
11. Oban/Glasgow, 18. November 2013
12. Oban, 19. November 2013
13. Glasgow, 19. November 2013
14. Oban, 20. November 2013
15. Glasgow, am gleichen Tag
16. Oban, 21. November 2013
17. Edinburgh, 21. November 2013
18. Edinburgh, North Merchiston Cemetery, 26. November 2013
19. Portree, Mitte November 1996
20. Oban, 13. Dezember 2013
21. Edinburgh, am gleichen Tag
22. Oban, 14. Dezember 2013
23. Oban, 9. Oktober 2014
24. Oban, 13. Oktober 2014
25. Oban, 14. Oktober 2014
26. Oban, 15. Oktober 2014
27. Portree, 15. Oktober 2014
28. Oban/Portree, 15. Oktober 2014
29. Portree, 16. Oktober 2014
30. Portree, 17. Oktober 2014
31. Portree, 13. November 2014
32. Danksagungen
Impressum neobooks
01. Highgate Wood, London, 14. November 2012
At the mid hour of night, when stars are weepingI fly to the lone vale we loved, when life shone warm in thine eye;
Thomas Moore (1779-1852) At the Mid Hour of Night
Der Zeitpunkt war perfekt, von einer zauberhaften Intensität. Er hielt inne und genoss einfach den Moment. Mondlicht überflutete die mächtigen, dicht belaubten Eichen, welche schon die Farbe des Herbstes trugen. Die Bäume am Rand der weiten Rasenfläche waren dem gleißenden Silberlicht ausgesetzt, sodass ihre Blätter wie ziseliert wirkten. Das naturbelassene Gestrüpp junger Hainbuchen und Stechpalmen trennte ihn von der schützenden Dunkelheit.
Er ließ seine Last vorsichtig von den Schultern gleiten. Die schwarze Plastikfolie raschelte. Ein Geräusch, das nicht hierher passte, in diesen Rest urtümlichen Waldes in der britischen Metropole.
Wenn er genau hinhörte, konnte er den Verkehrslärm auf der A1 wahrnehmen, der trotz der mitternächtlichen Stunde ungebrochen rauschte. Aber das brauchte ihn nicht kümmern. Er befand sich in einer anderen Welt.
Er lauschte in die Nacht und spähte auf den von Bäumen umgebenen Sportplatz. Herbstbraunes Gras, von unzähligen Füßen niedergetreten, breitete sich vor ihm aus. Er musste die günstigste Stelle finden, jene, die exakt seinen Vorstellungen entsprach. Am besten einfach dem Gefühl folgen. Das hatte ihn bis jetzt noch nie getrogen.
Er hob das große, fest mit Klebeband umwickelte Bündel wieder auf die Schultern. Mit schwerem Schritt stapfte er über den Platz. Die Plane knisterte rhythmisch bei jeder seiner Bewegungen und das Geräusch störte ihn mit einem Mal doch. Es gab der ganzen Aktion etwas Billiges. Nächstes Mal musste er sich anderes Material besorgen. Eine Decke? Nein – zu gefährlich. Auf Decken blieben Rückstände haften, die ihn verraten konnten. Die Plane war genau richtig.
Er verharrte, hob den Kopf und sah zum Vollmond hoch. Tatsächlich perfekt - eine klare Nacht, kein Regen und für November erstaunlich mild.
Wenn ihn sein Gefühl nicht täuschte, stand er nun genau in der Mitte der Rasenfläche. Sachte ließ er das Bündel von der Schulter gleiten. Jetzt kam der Teil der Mission, den er am meisten nach dem genoss, der die Verwandlung brachte.
Die Verwandlung. Das war gut, bei weitem besser als der Tod. Er durfte stolz auf sich sein, denn mit jedem Mal perfektionierte er seinen Auftrag. Dieses Vorhaben heute kam einem Höhepunkt gleich, auch wenn es noch nicht vollkommen sein würde.
Er holte das Messer aus der Hosentasche, zerschnitt die Klebebänder, mit denen das Bündel umwickelt war und schlug vorsichtig die Plane auseinander, um Cynthias toten Körper zu enthüllen.
Cynthia. So hatte sie sich genannt. Eigentlich spielte ihr Name keine Rolle. Es genügte, zu wissen, dass sie eine von ihnen gewesen war. Eine dieser Frauen, die Schuld in sich trugen und vernichtet werden mussten.
Er zog die Folie unter der Leiche weg, faltete sie sorgfältig und legte sie zur Seite. Er würde sie später mitnehmen und in einen der Abfalleimer des Parks werfen. Es war egal, wenn sie gefunden wurde. Billige Meterware aus dem Baufachhandel, von tausenden Menschen gekauft, die einfachste Möglichkeit, sich unauffällig Verpackungsmaterial zu besorgen.
Er drehte die Leiche auf den Rücken. Sie war nackt und das war wichtig. Denn sonst konnte man die Zeichen nicht sehen. Er hockte sich auf den Boden und strich mit den behandschuhten Fingern das lange Haar aus ihrem Gesicht, fächerte es auf wie einen Schleier. Die Totenstarre war gewichen, also konnte er ihre Beine parallel zueinander legen. Sie mussten geschlossen sein, alles andere hätte obszön gewirkt. Die Arme streckte er seitlich aus, machte sie bereit, den Himmel zu umarmen.
Den Himmel umarmen.
Der Gedanke gefiel ihm und ein Lächeln huschte über sein Gesicht, das unter der Kapuze verborgen war. Vielleicht sollte er ein Buch über seine Arbeit schreiben, über die Poesie, die darin lag. Natürlich so, dass niemand seine Taten ahnen konnte. Eine verschlüsselte Hymne an das Werk der Vergeltung. Ja, das war tatsächlich eine gute Idee!
Er nahm das Messer. Cynthias makellose Haut strahlte hell im Licht des Mondes. So würde die Botschaft gut zur Geltung kommen!
Vorsichtig ritzte er mit der Messerspitze ein Kreuz in die Stirn der Toten. Und noch eines auf das Kinn und eines auf die Brust.
Benedicta tu in mulieribus … Gesegnet bist du unter den Weibern …
Nein, das war sie nicht. Er hatte dafür gesorgt, dass dieser Schoß niemals ein Kind empfangen würde und das war gut so. Der Sünde musste Einhalt geboten werden. Deshalb sollten auch ihre Brüste und ihre Scham bedeckt werden. Er zog das sorgfältig gefaltete weiße Tuch aus der Jackentasche, befreite es von der Plastikhülle und breitete es über die Tote. Ein vollkommenes Bild.
Er runzelte die Stirn. Ganz stimmte das nicht. Ihr Hals wies hässliche Striemen auf, dort, wo der Riemen seines Gürtels ihr die Luft genommen hatte. Das Gefühl, das ihn durchflutet hatte, als sie zusammen vor dem Spiegel standen und zusahen, wie das Leben aus ihr wich! Ihre beiden Gesichter, nah beieinander, ein intimer Augenblick ohnegleichen.
Aber leider einer, der Spuren hinterließ, die seinen Sinn für Schönheit störten. Er musste es hinnehmen, bis jetzt hatte er keine bessere Möglichkeit gefunden, die Verwandlung herbeizuführen.
Mit spitzen Fingern zog er das Tuch hoch bis unter ihr Kinn. Nun konnte man allerdings das Kreuz auf ihrer Brust nicht mehr sehen. Unwillig schüttelte er den Kopf. Jedes Mal wieder das gleiche Dilemma! Er schob das Tuch zurück. Die Botschaft war wichtiger.
Er blieb noch kurz hocken, um sein Werk zu betrachten. Die blauen Augen der Frau, die den Glanz verloren hatten, die wächserne Bleiche des Gesichts. Wie eine Puppe, ein großes Spielzeug, das ausgedient hatte. Nur eine Hülle. Sie hatte nicht gelitten, zumindest nicht sehr. Er hatte inzwischen gelernt, ihre Qualen auf ein Mindestmaß zu reduzieren und sie nicht zu lange zu behalten. Es wäre natürlich besser gewesen, wenn er ihren Körper unbemerkt der Verwesung hätte überlassen können, aber dann wäre seine Mission unbeachtet geblieben. Man musste sie finden. Eine Mahnung sollte sie sein, umzukehren, von der Sünde abzulassen.
Sünde.
Er selbst bemühte sich, in Reinheit zu leben. Aber auch ihn überfielen manchmal Gedanken, die ihn von seiner wahren Bestimmung ablenkten. Er seufzte und schlug sich auf die Brust. Mea culpa, mea culpa.
Nicht jetzt, nicht in diesem Moment. Er schloss die Augen, verharrte still, genoss die angenehme Leere in ihm. So war es immer, wenn er dem Willen des Herrn gefolgt war. Der Ruf, der ihn dazu zwang, die Seelen der Unreinen zu befreien, würde wiederkommen. So lange, bis er endlich sie gefunden hatte. Sein Gegenstück, seine Gefährtin, die ihn verstehen und unterstützen würde im Kampf gegen das Böse. Die er verloren hatte durch die harte Fügung des Schicksals.
Er fröstelte. Kälte drang durch seine Kleidung. Langsam erhob er sich. Es gab nur noch eines zu tun. Er musste Cynthia sein Geschenk geben, sein Wahrzeichen, damit die Welt erkannte, warum sie sterben musste. Seine Hand fuhr in die Jackentasche, holte eine kleine Schachtel heraus. Er befingerte den Deckel. Es war mühsam mit den Handschuhen, es gelang ihm erst nach mehreren Versuchen, ihn abzunehmen. Der filigrane Silberdraht, zu Schmetterlingsflügeln geformt, schimmerte im Mondlicht. Die darin eingearbeiteten Granatsplitter wirkten wie hin gespritzte Blutstropfen.
Er legte das Schmuckstück behutsam zwischen die Brüste der Toten auf das weiße Tuch und schlug das Kreuzzeichen.
Möge deine Seele Frieden finden und frei von jeglicher Schuld dem Schöpfer entgegentreten. Gott verzeihe dir deine Sünden und schenke dir ewige Ruhe.
Ein leichtes Gefühl von Verlust und Trauer berührte ihn am Rand seines Bewusstseins, aber er unterdrückte es sofort. Es erinnerte ihn an eine Vergangenheit, die er vergessen musste.
Er erhob sich, trat einen Schritt zurück und begutachtete noch einmal sein Werk. Für einen Moment wünschte er, es aus der Luft betrachten zu können. Die vom Mondlicht beschienene Rasenfläche, in der Mitte die schöne tote Frau, die Arme weit ausgebreitet.
Nun, vielleicht gelang es ihm beim nächsten Mal. Es würde ein Weg zu finden sein, wenn es so bestimmt war. Er holte das Handy heraus und fotografierte sein Kunstwerk aus verschiedenen Blickwinkeln.
Mit einem leichten Gefühl des Bedauerns wandte er sich ab, hob die gefaltete Folie auf und ging auf das Café zu, das sich als dunkler Klotz gegen das Mondlicht abzeichnete. Er warf das Paket in einen der Müllkörbe, drehte sich noch einmal um. Der Leichnam schimmerte als heller Fleck in der Finsternis. Cynthia würde morgen früh gefunden werden, aber da war er schon wieder im Norden der Insel. Seine Aufgabe war damit zu Ende – für diesmal.
Mit raschen Schritten betrat er den Pfad, der zur Muswell Hill Road führte, wo er sein Auto geparkt hatte. Seine schwarz gekleidete Gestalt wurde vom Dunkel des Waldes verschluckt.
02. Oban, Schottland, 12. November 2013
An undefined, an awful dream,A dream of what had been before;A memory whose blighting beamWas flitting o’er me evermore.
Emily Bronte (1818 – 1848), A Dream
Ich hasse November.
Die Worte hallten im Takt meiner Schritte im Kopf, pulsierten als dumpfes Echo hinter der Stirn. Ich wiederholte sie wie ein Mantra. Ich. Hasse. November.
Die Tablette, die ich gegen den Migräneanfall gleich nach dem Aufwachen geschluckt hatte, begann endlich zu wirken und der stechende Schmerz verwandelte sich in ein Gefühl, als wäre mein Gehirn in Watte gepackt.
Mein Hals und meine Brust taten aber noch immer weh. Ich musste wieder im Traum geschrien haben und wie so oft war ich dankbar für die abgeschiedene Lage von Tante Emilys Häuschen, die nächsten Nachbarn außerhalb meiner Rufweite.
Ich blieb stehen, lauschte in die nebelverhüllte Welt um mich herum.
Stille.
In einer plötzlichen Anwandlung von Orientierungslosigkeit drehte ich mich um die eigene Achse, obwohl ich wusste, dass sich hinter mir der weiß lackierte Zaun und die Gartenpforte des Cottage befanden, das ich gerade verlassen hatte.
Ich hasse Nebel.
Ich wartete auf das altbekannte Ziehen zwischen den Schulterblättern und die Vorstellung, beobachtet zu werden. Langsam ging ich weiter, suchte mit meinem Blick den Dunst zu durchdringen, der wie eine schwere Decke über dem Hügel lag. Normalerweise liebe ich es, mich im Gewirr der Gässchen zu verlieren, die den Laurel Crescent bilden. Aus der Vogelperspektive sieht er aus wie ein Kreuz, das durchgeschüttelt wurde und dessen längere Enden sich an die Laurel Road klammern. Tante Emilys Cottage, das seit zwei Jahren mir gehörte, stand am nördlichen kürzeren Teil dieses Kreuzes gänzlich abgeschieden und war für Uneingeweihte schwierig zu finden. Genau das Richtige für mich.
An Novembertagen war ich jedoch immer froh, zur Kreuzmitte zu kommen und wenigstens noch ein paar Anzeichen mehr von Zivilisation zu sehen, auch wenn die Mietcottages seit dem Sommer schon leer standen. Im Haus der MacAllisters brannte wie immer um diese Zeit Licht und ich genoss den Anblick des tröstenden warmen Scheins.
Als ich das Haus hinter mich ließ, verschluckte mich wieder die weiße Unendlichkeit. Prompt kehrte das Gefühl wieder, beobachtet zu werden. Ich versuchte mit allen Kräften, die aufsteigende Panik zu unterdrücken.
Da ist niemand. Du bildest dir das nur ein.
Ich ging weiter, mit mechanischen Schritten, sah stur geradeaus, bemühte mich, die Büsche zu ignorieren, hinter denen jemand stecken konnte. Die leeren Häuser nicht zu beachten, in denen er womöglich auf mich wartete. Wenn er mir folgte, wusste er, wo er mir am besten auflauern konnte.
Unsinn. Er ist nicht da. Es ist vorbei. Schon lange.
Ich weiß, ich bin seltsam. Aber ich kann nichts dafür. Wem so etwas wie mir widerfahren ist, der hat jedes Recht, seltsam zu sein.
Meine Kindheit endete ein paar Monate nach meinem zehnten Geburtstag an einem Novemberwochenende. Das ist jetzt ziemlich genau siebzehn Jahre her. Ich stürzte in die Finsternis, und als ich am tiefsten Punkt ankam, war alles zu Ende und nichts würde mehr so werden wie früher. Ich hatte alles verloren. Meine Mutter, meine Unschuld und meinen Glauben an das Gute im Menschen.
Meine geschundene Seele wehrte sich, indem sie den Schleier des Vergessens über diese drei Tage legte, in denen ich die Hölle durchlebte. Trotz jeglicher Therapie änderte sich daran nichts. Irgendwann gab ich es auf und akzeptierte, dass ein Teil meiner Erinnerung fehlte. In Anbetracht eines Menschenlebens ist diese Zeitspanne von drei Tagen unerheblich. Doch tief in mir lauert ein furchtbares Wissen, das niemals ruht und das mich unablässig quält. Ich verdränge diese Tatsache mehr oder weniger erfolgreich. Der Lohn sind ständig wiederkehrende Albträume, Migräneattacken und Panikanfälle.
Besonders an Novembertagen wie diesem, wenn der Nebel meine Welt eroberte, sie in dichte, undurchdringliche Schwaden hüllte, die alles um mich herum erstickten, kratzte die eingeschlossene Erinnerung mit scharfen Nägeln in meinem Inneren, versuchte, mit Macht an die Oberfläche zu gelangen und schaffte es doch nicht. Dann wurde jeder Weg zur Tortur, zum Spießrutenlauf.
Ich bog in die Laurel Road ein, das Blut rauschte in meinen Ohren und mein Herzschlag dröhnte. Ich schwitzte, obwohl es so frostig war, dass der Atem weiße Wölkchen bildete. Jetzt kam der schlimmste Teil des Weges. Hier standen keine Häuser, es gab nur dichtes Buschwerk und mit Gras bedeckte Hügel. Unbebautes Niemandsland, das perfekte Verstecke bot. Linkerhand erhob sich der MacCaig’s Tower, das markanteste Wahrzeichen von Oban. Heute konnte ich die Umrisse des mächtigen Runds über mir nur erahnen. Die Straße lag wie ausgestorben vor mir.
Ich beschleunigte meine Schritte. Zwei verschwommene gelbe Lichter tauchten auf. Das erste Auto, das mir an diesem Morgen begegnete. Ich wich zur Seite, starrte auf den Wagen, der langsam an mir vorbeifuhr, hoffte, dass er nicht hielt und der Fahrer mich nicht ansprach. Das Fahrzeug verschwand um die nächste Biegung und ich blieb stehen, lauschte, bis sich das Motorengeräusch verlor und ich mir sicher war, dass er nicht gewendet hatte, um was auch immer zu tun.
Ich stieß den Atem aus, den ich angehalten haben musste, seit ich das Auto bemerkt hatte.
Es ist nichts. Du solltest dich nicht so verrückt machen.
Normalerweise brauche ich zu Elinors Café, meiner Arbeitsstätte, etwa zwanzig Minuten, wenn ich zu Fuß gehe. Mit dem Fahrrad schaffe ich es in nicht einmal der halben Zeit. Aber die Bremsen waren kaputt und ich hatte noch keine Zeit gehabt, sie reparieren zu lassen. Ein Auto konnte ich mir aufgrund meiner knappen Budgetlage nicht leisten.
Meine Beine begannen sich wie von selbst schneller zu bewegen, wie von einem fremden Willen getrieben, lief ich die Straße hinunter Richtung Hafen. Wenig später bog ich in die Craigard Road ein. An ihrem Ende an der Ecke zur Hauptstraße befindet sich Elinor Rockwells kleines Café in einem schlichten, zweistöckigen Haus mit grauer Steinfassade. Keuchend stand ich schließlich vor der Haustür und musste meinen Atem beruhigen.
Die Fenster im ersten Stock waren erleuchtet, was bedeutete, dass Elinor und Sarah bereits beim Frühstück saßen. Alle Anspannung fiel von mir ab. Nun war ich in Sicherheit.
Ich läutete. Gleich darauf polterten Schritte die Treppe herunter und Elinors Tochter öffnete. Seit den zwei Jahren, seit ich sie kannte, hatte sie sich vom etwas pummeligen Grundschulmädchen in einen Teenie mit schlaksigem, ungelenkem Körper verwandelt – mit den üblichen pubertären Anwandlungen, wie Elinor mir manchmal klagte. Jetzt drehte sie sich wortlos um, ohne mein „Hi Sarah, wie geht’s?“, abzuwarten, die Ohren zugestöpselt und zu einer für mich unhörbaren Musik summend.
Ich folgte ihr die schmale, steile Treppe in das Obergeschoss. Würziger Kräuterduft hüllte mich ein. Elinor saß am reichlich gedeckten Frühstückstisch, ein Korb mit frisch gebackenen Scones verströmte diesen köstlichen Geruch. Neben ihr stand der aufgeklappte Laptop.
„Hi, Süße“, nuschelte sie kauend, schluckte hinunter und strahlte mich an. „Setz dich. Du musst unbedingt die Kräuter-Scones probieren.“
Elinor war eine begnadete Bäckerin – einer der Gründe, warum das Café zumindest während der Sommermonate ausgezeichnet lief. Die ruhigen Spätherbst- und Winterwochen nutzte sie, um Rezepte auszuprobieren und ich durfte Versuchskaninchen spielen.
Elinor war vor vier Jahren nach Oban gekommen, nachdem sie sich von ihrem Mann Thomas getrennt hatte. Er war Buchhalter bei der Bank of Scotland, ein durch und durch korrekter und etwas farbloser Typ, der sich aber strikt an die vereinbarte Sorgepflicht hielt und Sarah jedes zweite Wochenende nach Edinburgh holte.
Elinor hatte damals meine Idee, einen kleinen Buchladen mit neuen und gebrauchten Büchern in der anderen Hälfte des Cafés einzurichten, begeistert aufgenommen und nun bildeten wir ein unschlagbares Team.
Ich setzte mich an den Tisch, goss mir eine Tasse Tee ein, nahm mir ein noch ofenwarmes Gebäck, halbierte es und strich gesalzene Butter darauf. „Hmm – köstlich! Vielleicht eine Spur zu viel von … Lavendel?“
„Tatsächlich? Ja, mit dem Zeug muss man aufpassen. Es ist ziemlich intensiv.“ Sie sah auf und ich merkte, dass ich sie aus einer anderen Welt geholt hatte.
„Chattest du schon am Morgen mit einem deiner Verehrer?“
Im Gegensatz zu mir liebte Elinor alle Möglichkeiten der modernen Kommunikation. Ich besaß zwar ein Handy, nutzte es aber nur in Notfällen. Fernsehgerät und Computer waren für mich tabu. Eine Tatsache, über die sie nur den Kopf schüttelte. In ihren Augen war ich eine rückständige Hinterwäldlerin. Aber ich hatte meine guten Gründe dafür.
Sie grinste. „Nö, ich checke gerade die E-Mails.“ Sie warf mir einen vorsichtigen Seitenblick zu, bevor sie weitersprach. „Ich hab hier eins von einem Typen über ein Partnerforum gekriegt. Der schreibt schräge Sachen. Ich glaube, der fällt eher in deinen Bereich, ich kenn mich mit diesem Zeugs nicht aus.“
Sie schob mir den Laptop zu.
Say, wilt thou go with me, sweet maid.Say, maiden, wilt thou go with meThrough the valley depths of shade,Of night and dark obscurity.Where the paths has lost its way,Where the sun forgets the day, -Where there’s nor light nor life to see,Sweet maiden, wilt thou go with me?
… Wo die Sonne den Tag vergisst, wo zu sehen ist kein Licht und Leben … Die Gedichtzeilen waren wie ein Faustschlag ins Gesicht. Eine Gänsehaut lief über meinen Körper. Ich schnappte unbewusst nach Luft, stürzte ab, in mein kaltes, dunkles Loch, aus dem ich gerade heute Morgen geklettert war.
„Hey, was ist? Du siehst aus, als hättest du ein Gespenst gesehen!“ Elinors Griff um mein Handgelenk holte mich aus der Finsternis.
Ich schüttelte den Kopf, kniff die Augen zu. Als ob das gegen die bösen Geister helfen würde!
„Ich kenne das.“ Ich drängte die Dunkelheit in mir zurück in jenen verborgenen Winkel, in dem sie immer lauerte. „Das Gedicht ist von John Clare, einem Dichter des 19. Jahrhunderts, nicht von diesem Typen. Sieht man doch gleich an der Schreibweise.“ Meine Stimme hörte sich in meinen Ohren fremd und gequetscht an. „Du solltest ihm nicht antworten, lass die Finger davon.“
Elinor sah mich verständnislos an. „Jetzt spinnst du aber, oder? Das ist doch harmlos! Okay, ein bisschen makaber vielleicht, aber das ist ja gerade interessant. Wir schreiben uns seit zwei Wochen und es passiert gar nichts.“
„Seit zwei Wochen?“ Ich war perplex. „Du hast mir nichts erzählt …“
Sie senkte den Kopf, mit einem Anflug von Schuldbewusstsein auf ihrem hübschen Gesicht. „Er meinte, ich solle es nicht an die große Glocke hängen.“
Irgendwo in meinem Inneren begann es zu kribbeln. „Du meinst, er hat dir verboten, über ihn zu sprechen?“
„Blödsinn“, sagte sie, ein wenig zu heftig und ich wusste, dass er genau das getan hatte. Sie zog den Laptop mit einer raschen Bewegung zu sich heran. „Ich wollte dir eigentlich nur das Gedicht zeigen, weil ich weiß, dass dir so etwas gefällt. Ich dachte … naja, vielleicht interessierst du dich für ihn. Aber ich wollte nicht, dass du mir Vorhaltungen machst.“
„Vergiss es! Du schreibst einem Kerl, der dich mit düsteren Gedichten beglückt, der dir verbietet, über ihn mit jemandem zu reden, dem du vertraust, und du findest das völlig in Ordnung?“
Es war unfassbar!
In Elinors Augen erschien ein trotziges Funkeln. „Ich bin eine erwachsene Frau und ich kann sehr gut auf mich selbst aufpassen. Und ich habe nicht vor, den Rest meines Lebens irgendeinem langweiligen Typen jeden Abend sein Bier und seine Hausschuhe zu bringen und mit ihm vor dem Fernseher zu versauern. Ich hatte das schon mit Tom und es machte überhaupt keinen Spaß. Ich möchte auch nicht als eine Art Kampfnonne leben, wie eine gewisse Person, die ich kenne, die jedem männlichen Wesen, das in ihre Nähe kommt, am liebsten in die Eier treten würde.“
Ich musste wider Willen lachen. „Du übertreibst maßlos. Ich bin keine Kampfnonne.“
Elinor grinste. „Sorry, das stimmt vielleicht nicht ganz. Aber du musst zugeben, dass du es den Kerlen nicht leichtmachst.“
Sie hatte recht. Ich habe ein problematisches Verhältnis zu Männern. Doch auch dafür gibt es Gründe.
Die Spannung hatte sich gelöst. Für Elinor war der Disput damit erledigt und ich fragte mich selbst, ob ich nicht an Paranoia litt. Sie wandte sich wieder ihrem Laptop zu und las das Gedicht noch einmal halblaut. „Ich könnte mir vorstellen, dass er wie dieser Schauspieler aussieht, der jetzt Sherlock Holmes spielt. Du weißt schon, Benedict Cumberbatch. - Groß, sehr schlank, mit schwarzen Locken und unwahrscheinlich blauen Augen“, sagte sie auf meinen verständnislosen Gesichtsausdruck. „Ach, vergiss es. Du hast ja keine Ahnung, wenn du nicht einmal die Klatschzeitungen beim Friseur liest.“
Ich musste wieder lachen, obwohl das mulmige Gefühl nicht verschwand, als ich die vertrauten Worte noch einmal hörte. Elinor war nicht nur eine ausgezeichnete Bäckerin, sie hatte auch eine überbordende Fantasie. Oft genug zu ihrem Pech, denn sie forderte Enttäuschungen geradezu heraus. Aber vielleicht hatte sie diesmal recht und der Kerl war wirklich nur ein romantischer Spinner. Sie konnte ja nicht wissen, dass diese Gedichtzeilen für einen winzigen Moment eine Tür zu einem Bereich meiner Vergangenheit geöffnet hatten, den ich für immer im Dunklen lassen wollte.
***
Ich schluckte noch zwei Tabletten, bevor ich in den Laden ging, nur um sicher zu gehen, dass mich keine weitere dieser heimtückischen Kopfschmerzattacken außer Gefecht setzte. Sarah hatte die ganze Zeit im Bad verbracht und verließ die Wohnung mit einem flüchtig hingeworfenen Gruß wie immer um acht, um zur Schule zu gehen. Ich half Elinor beim Aufräumen und um halb neun öffneten wir das Café.
Elinor hatte mir erzählt, dass gestern Abend noch eine Kiste mit Büchern aus dem Nachlass der alten Mrs. Tennant gebracht worden war und ich war begierig, sie zu durchforsten. Mrs. Tennant war eine gute Kundin gewesen, die alte Kriminalromane sammelte und ich konnte sicher sein, einige für mich interessante Exemplare zu finden.
Ich ging in den kleinen Lagerraum im rückwärtigen Bereich des Erdgeschosses und knipste die Lampe an. Sofort wurde der fensterlose, mit Regalen vollgestellte Raum in trüb gelbliches Licht getaucht. In dieser wenig ansprechenden Umgebung vertiefte ich mich in meine Arbeit. Es waren etwa hundertfünfzig Bücher, ein Bruchteil von Mrs. Tennants Schätzen. Hauptsächlich Romane von Agatha Christie, darunter sogar eine Erstausgabe von The Murder in the Vicarage aus dem Jahr 1930. Ein paar von Wilkie Collins waren dabei und ein ziemlich zerlesener Sherlock-Holmes-Band. Die Agatha Christies würde ich auf jeden Fall in den Laden stellen, sie waren bei den Touristen immer begehrt.
Elinor erwischte mich beim Schmökern, als sie den Kopf mit einem verschwörerischen Grinsen und einem Blick auf die Uhr an der Wand durch die Tür streckte. Es war fünf Minuten vor elf und ich verstand.
Ich erhob mich, klopfte meine Jeans ab, ging in die Toilette, um mir die Hände zu waschen und band eine der weißen Schürzen um, die an einem Haken neben der Eingangstür zum Lagerraum hingen.
Elinor verschwand in der kleinen Küche des Ladens. Hier bereitete sie die Snacks und Suppen zu, während sie in der größeren, besser ausgestatteten Küche in ihrer Wohnung Kuchen und Kekse fabrizierte.
Pünktlich um elf Uhr klingelte die Glocke der Ladentür und Mr. Hunter betrat das Café. „Hallo Gerald“. Ich lächelte ihn an.
„Guten Morgen, April.“ Sein Blick schweifte suchend durch den Raum.
Wie immer ergriff mich eine leise Ahnung von Mitleid.
„Ist Elinor nicht da?“ Seine hellen blauen Augen – Elinor bezeichnete sie gerne als babyblau – bekamen einen leidenden Ausdruck.
„Ich fürchte, sie hat keine Zeit.“ Ich hoffte, mein Tonfall klang bedauernd genug und warf einen kurzen Blick in Richtung Küche. „Shortbread“, sagte ich aufs Geratewohl. „Sie knetet gerade den Teig und ist komplett voller Mehl. Sorry.“
Er nickte resigniert, griff nach der Zeitung und setzte sich an den hintersten Tisch in der Ecke. Dort saß er immer, in der meist vergeblichen Hoffnung, einen Blick auf Elinor zu erhaschen oder sie womöglich sogar zu sprechen. Er tat mir manchmal wirklich leid, obwohl ich, wie schon erwähnt, mit Männern so meine Probleme hatte.
„Ich könnte Ihnen heute die Zitronentarte empfehlen. Oder den Brombeerkuchen. Beides ganz frisch.“
Er räusperte sich. „Den Brombeerkuchen bitte. Und Tee. Wie üblich.“ Er stellte die mitgebrachte Papiertasche sorgfältig auf den freien Stuhl neben sich und vertiefte sich in seine Lektüre. Immer wieder warf er verstohlene Blicke in Richtung Küche. Ich hörte, wie Elinor darin rumorte, wie um zu betonen, wie beschäftigt sie war. Gerald hätte nie gewagt, die Küche zu betreten, der arme Kerl. Er blieb in der Ecke sitzen, trank Tee, aß den Kuchen, pickte jeden einzelnen Krümel auf. Ein farbloser Mittvierziger in grauer Strickjacke, das glatte, hellbraune Haar sorgfältig gescheitelt. Gerald war Besitzer des Oban Guest House, ein Bed & Breakfast in der Albert Road und er kam jeden Vormittag zur gleichen Zeit. Man konnte die Uhr nach ihm richten. Er war nett. Nicht mehr und nicht weniger. Er würde niemals eine Chance bei Elinor haben, aber er begriff es nicht.
Pünktlich um halb zwölf stand er auf und bezahlte. Diesmal ging er aber nicht gleich, sondern blieb stehen, sah mich flehend an. Aus der Papiertüte – ich hatte mich schon gefragt, wozu er die brauchte – holte er ein Päckchen, eingewickelt in cremefarbenes Papier, das mit rosafarbenen Röschen bedruckt war. Eine hellrosa Schleife zierte das Präsent. Ich hielt unwillkürlich den Atem an. Er tat also den nächsten Schritt. Ein Geschenk.
Er räusperte sich. „Würden – würden Sie das Elinor von mir geben? Ich hätte es ihr gerne selbst … aber sie ist ja leider so beschäftigt… gewissermaßen unabkömmlich … was ich durchaus verstehe …“ Er verstummte abrupt, drückte es mir in die Hand und verschwand so plötzlich, dass ich nicht einmal mehr einen Abschiedsgruß anbringen konnte.
Ich starrte das Ding an. Natürlich musste ich es Elinor geben. Sie würde es hassen, was immer es auch sein mochte, davon war ich überzeugt. Ich legte es auf die Anrichte hinter der Theke und vergaß es.
Der Tag verlief ruhig. Am Nachmittag kamen ein paar Besucher zum Tee. Mrs. Cooper mit ihrer Tochter, drei Arbeiter, die auch noch ein Bier tranken, ein verspätetes Touristenpärchen, das einen Reiseführer und ein Exemplar der Scottish Folk Tales kaufte.
Ich begann, die Bücher aus Mrs. Tennants Kiste zu katalogisieren und in die Regale zu stellen, während Elinor bediente.
Wir hatten das Café gemeinsam gestaltet. Fotos aus Obans Vergangenheit und Nachdrucke von Gemälden von William Turner zierten die Wände, die Möbel hatten wir auf Flohmärkten besorgt, ein Sammelsurium von Stilen, wobei wir darauf achteten, nur dunkle Möbel zu nehmen. Es gab im Gastronomiebereich sechs Tische und im Buchladenbereich ein weiteres Tischchen mit dazugehörigen Stühlen und eine gemütliche, schon ziemlich abgewetzte Ledercouch. Die beiden Bereiche trennte ein mit Büchern vollgestellter Raumteiler, sodass man von zwei Seiten Zugriff auf die Lektüre hatte. Ein offener Durchgang führte vom Café in den Ladenteil und über allem schwebte eine Duftmischung von Tee, Kaffee, frischem Gebäck oder auch würziger Suppe und alten Büchern. Ich mochte meinen Arbeitsplatz, er war gemütlich und überschaubar und oft verbrachte ich Stunden nach Ladenschluss auf der Ledercouch, in irgendeinen Schmöker vertieft, wenn mir vor dem Heimweg und der Einsamkeit zu Hause graute.
„Kommst du auf einen Tee mit hoch? Ich hab auch noch einen Rest Linsensuppe.“ Elinor blieb im Durchgang stehen. Sie hielt Geralds Päckchen in der Hand. „Ist das von ihm?“
Ich nickte. „Sorry, hab vergessen, es dir zu geben.“
Elinor lächelte spitzbübisch. „Er geht also zu Plan B über, der arme Kerl.“ Sie kicherte und drehte sich um. „Weißt du was? Wir streichen den Tee und gönnen uns ein Gläschen Wein. Dann öffnen wir feierlich das Liebespräsent.“
Wenig später saßen wir in ihrer Küche. Die altmodischen, weiß lackierten Möbel im Landhausstil strahlten urige Gemütlichkeit aus, Lampenschirm und Vorhänge aus rotweißem Karo verstärkten den rustikalen Eindruck noch. Besonders stolz war Elinor auf die alten Kuchenformen aus Kupfer, die sie von Zeit zu Zeit polierte. Sie standen in einem eigenen Regal über der Anrichte und verbreiteten vornehmen Glanz.
Die Linsensuppe schmeckte wie immer ausgezeichnet. Elinor schenkte uns ein Glas Chardonnay ein und legte dann Geralds Päckchen auf den Tisch, betrachtete es wie ein Forscher, der ein seltenes Insekt unter dem Mikroskop begutachtet.
„Was könnte da drin sein?“
Der Wein wärmte mein Inneres, ich fühlte mich leicht und mir fiel ein, dass ich den ganzen Tag keine Kopfschmerzen mehr gehabt hatte. „Ich tippe auf ein Schmuckstück. Eine Brosche oder ein Medaillon. Das würde zu ihm passen.“ Eine dunkle Ahnung kratzte an den Rändern meines Bewusstseins, aber ich verdrängte sie sofort wieder. Auch ich war neugierig, welches Präsent Elinors hartnäckiger Verehrer ausgesucht haben mochte.
Sie zupfte an der Schleife und löste sie. „Sieh dir nur diese Verpackung an. Bedrucktes Seidenpapier. War sicher teuer.“ Ich nickte bloß und sah Elinor gespannt zu, wie sie die Umhüllung entfernte. Eine kleine Schachtel kam zum Vorschein. Ich bemerkte das goldfarbene B auf dem Deckel und erstarrte, spürte, wie das Loch sich vor mir auftat, der kalte Hauch der Finsternis mich streifte. Nicht, wollte ich sagen. Mach es nicht auf, aber ich brachte keinen Ton heraus. Elinor achtete nicht auf mich, öffnete den Deckel und stieß einen erstaunten Laut aus. „Das ist ja wunderhübsch! Das hätte ich diesem Langweiler gar nicht zugetraut!“
Sie hielt mir die Schachtel entgegen. Feiner Silberdraht, vollendet geformt zu weit ausgespannten Schmetterlingsflügeln, die eingearbeiteten smaragdgrünen Splitter glitzerten im Schein der Lampe. Ich hörte Brians Stimme aus den Tiefen meiner Erinnerung. Schmuck für meine Prinzessin.
Das silberne Ding verschwamm vor meinen Augen, begann sich flirrend im Kreis zu drehen. Schmerz explodierte in meinem Kopf, Dunkelheit hüllte mich ein, ich erstickte darin und stürzte in bodenlose Tiefe.
03. Portree, Isle of Skye, April 1996
Als ich an diesem Morgen aufwachte, fiel mein Blick zuallererst auf das Buch auf dem Nachtkästchen. Der abgegriffene dunkelrote Ledereinband und die teilweise schon abgeschabte Goldprägung vermittelten mir die Vorstellung von etwas Altem und Kostbarem. Sonnenlicht flirrte durch einen Spalt des Vorhangs und tauchte das Buch in magisches Licht, von Staubkörnchen umtanzt. Ich hielt den Finger in den Lichtstrahl und nun leuchtete auch meine Haut. Ich stellte mir vor, wie es wäre, von diesem Strahl aufgesogen und in das Buch gezogen zu werden. Ich hatte es vor zwei Tagen von meiner Mutter zu meinem zehnten Geburtstag bekommen und es erschien mir wie das kostbarste Geschenk in meinem ganzen Leben.
Ich nahm es in die Hand, fuhr vorsichtig über das narbige Leder, schnupperte daran. Es roch nach Lavendelseife, altem Papier, Abenteuer, nach Herzklopfen und nach heimlichen Tränen. Ein Band mit Gedichten der englischen Romantik.
Unsere Nachbarin, Mrs. Phibbs, rollte mit den Augen, als ich es aus dem hellroten Geschenkpapier schälte, das mit grünen Blättern bedruckt und mit einer ebenfalls grünen Schleife umwickelt war. „Herrje, Maureen“, sagte sie zu meiner Mutter. „Ist die Kleine nicht noch ein wenig zu jung dafür?“
Mum schüttelte den Kopf und lächelte mich an. Wie immer widersetzten sich ihre schwarzen, langen Haare jeglicher Bändigung, vorwitzige Kringel hatten sich aus der silberfarbenen Spange gelöst und fielen ihr in die Stirn. Ich hatte ihre Locken und auch ihre Haarfarbe geerbt, ebenso wie die intensiv blauen Augen. Wenn wir uns manchmal den Spaß gönnten, in ähnlicher Kleidung aufzutreten, kam ich mir immer wie eine Miniatur-Maureen vor und glaubte zu wissen, wie sie selbst als Kind gewesen war.
„Nein, das ist genau richtig für mein Mädchen“, erklärte sie mit sanfter Stimme. Sie wusste um meine liebste Beschäftigung, die darin bestand, auf dem abgewetzten Sofa im Laden zu sitzen und in alten Gedichtbänden zu schmökern. Sie fuhr jeden Morgen mit dem uralten, klapprigen Van von unserem Cottage am Südufer des Loch Fada in die Stadt, um mich bei der Schule abzusetzen und dann zur Arbeit zu gehen. Ihr Laden hieß The Unicorn. Nach dem Unterricht ging ich dorthin und wartete, bis sie fertig war, um mit ihr wieder nach Hause zu fahren. Ich verbrachte Stunden mit dem Geruch von alten Büchern und Schafwolle in der Nase, denn sie verkaufte neben vielerlei Krimskrams für Touristen auch selbstgestrickte Pullover, Schals und Mützen, die sie an den langen Wintertagen, wenn der Laden geschlossen war, anfertigte.
Aus der Küche im Erdgeschoss hörte ich das Klappern von Geschirr und wenig später zu meinem Erstaunen eine männliche Stimme. Wer mochte so früh schon zu Besuch sein?
Ich legte das Buch zur Seite und schlüpfte aus dem Bett, schauderte kurz, als ich die Kühle des Frühlingsmorgens an den bloßen Füßen spürte, angelte nach den Pantoffeln und schlich zur Zimmertür, drückte die Klinke vorsichtig nieder. Die Tür knarrte und ich hielt erschrocken inne, im Glauben, vorzeitig auf mich aufmerksam gemacht zu haben.
Dann hörte ich Mum lachen – nein, es war eher ein Kichern, fast so wie das meiner Freundinnen in der Schule, wenn sie nach den Murphy-Jungs guckten, die von allen angehimmelt wurden – auch von mir.
Ich schlich die Treppe hinunter, schnupperte. Speck und Bohnen zum Frühstück? Es war doch nicht Sonntag!
Leises Flüstern drang an mein Ohr, dann wieder Gelächter. Diesmal eindeutig männliches. Was war da nur los?
Ich schob den Kopf durch die angelehnte Küchentür und erstarrte. Am Herd stand ein Pirat.
Mein Pirat.
Er drehte sich um, wahrscheinlich hatte ich vor Aufregung gekiekst.
„Hi Prinzessin.“ Er winkte mit dem Pfannenwender. Ich starrte ihn mit offenem Mund an. Natürlich war er nicht wirklich ein Pirat. Es war Brian. Ich kannte ihn seit einer Ewigkeit. Mein Blick fiel auf seine nackten, dunkel behaarten Beine und ich konnte nicht mehr wegschauen.
„Wo hast du deine Manieren gelassen, Kind? Steh hier nicht herum und geh dich anziehen.“ Meine Mutter sah mich streng an.
„Guten Morgen, Brian“, sagte ich gehorsam und dann machte ich kehrt, stürmte aus der Küche, die Treppe hinauf, in mein Zimmer und warf mich auf das Bett. Mein Herz klopfte zum Zerspringen und eine heiße Welle raste durch mein Inneres.
Es war – Wahnsinn!
Brian hat bei uns übernachtet!, sang mein Herz. Es musste so sein, ich war ja nicht dumm und kein Baby mehr. Was hätte er sonst in Boxershorts und T-Shirt in unserer Küche gemacht, noch schlaftrunken und mit wuscheligen Haaren. Gut, die hatte er immer. Und auch diesen Dreitagesbart. Darum war er in meinen Träumen ja auch ein Pirat, ein verwegener Held, so wie ich mir meinen Vater vorstellte. Vielleicht hatte schon vor längerer Zeit Brian das Bild meines Vaters ersetzt, den ich nie kannte. Er istauf dem Meer geblieben, wie Mrs. Phibbs immer erklärte, mit einer Mischung aus Mitleid und Respekt. Meine Mutter war gerade einmal eineinhalb Jahre mit ihm verheiratet gewesen und ich ein Baby von fünf Monaten, als sich herausstellen sollte, dass er nicht mehr zurückkam.
„April? Nun komm schon, du musst zur Schule!“ Die Stimme meiner Mutter unterbrach meine Träumerei.
Schule! Als ob das jetzt, in diesem Moment wichtig war! Andererseits – heute hatte ich endlich einmal etwas wirklich Aufregendes zu erzählen!
Ich schlüpfte schnell in den dunkelblauen Rock und die weiße Bluse, die ich jeden Tag, sobald ich nach Hause kam, sorgfältig auf den Kleiderbügel hängen musste, zog die Kniestrümpfe an und hüpfte die Treppe hinunter. Mein Herz sprang wie ein Gummiball mit.
War Brian noch da? Hatte ich es mir am Ende nur eingebildet? Ja, er war es! Er saß jetzt am Tisch, einen Teller vor sich, darauf ein Berg von Speck, Bohnen und Rührei. Mum holte gerade zwei Scheiben Brot aus dem Toaster. Er wartete, bis wir beide uns setzten. Ich beäugte Mum vorsichtig. Ja, sie sah richtig glücklich aus, hatte so ein Strahlen im Gesicht, das von innen kam. So hatte sie schon lange nicht mehr ausgesehen – oder nein, eigentlich noch nie!
Auch Brian strahlte irgendwie. Ich gluckste vergnügt.
„Was ist so lustig, Prinzessin?“ Brian zwinkerte mir zu. Er machte das auf eine richtig coole Art, indem er das linke Auge ganz lange zukniff und erinnerte umso mehr an einen Piraten.
Brian war Künstler und schon deshalb aufregend und interessant. Er war vor einigen Jahren nach Portree gekommen, ich wusste nicht so genau, woher. Ich glaube, er erzählte auch nicht gerne etwas darüber, was er vorher gemacht hatte. Er schmiedete riesige Metallfiguren. Mum und ich waren einmal bei ihm zu Besuch gewesen und ich fand es faszinierend, in der Schmiede zu stehen, die Hitze zu spüren, Brian zu beobachten, wie er unermüdlich auf das glühende Metallstück einschlug, mit nacktem, schweißbedecktem Oberkörper. Irgendwelche reichen Leute bestellten seine Arbeiten, für die er lange brauchte und deshalb auch nicht viele davon verkaufte. Deshalb musste er noch mit etwas anderem Geld verdienen. Er bastelte Schmuck aus Silberdraht und meine Mutter bot ihn in ihrem Laden an. Ich liebte Brians Broschen, Anhänger, Ringe, kunstvoll verschlungen, mit winzigen Steinen darin, in allen Farben. Hauptsächlich Tiere wie Schmetterlinge, Libellen und Käfer, aber auch Vögel. Meiner Mutter hatte er schon einige geschenkt. Sie bewahrte sie in einer kleinen, mit rosa Seidenpapier ausgeschlagenen Schachtel auf, und wenn ich besonders brav war, durfte ich sie manchmal ansehen.
„Trödel nicht, April. Iss deinen Porridge.“ Mum schob mir die Schüssel hin.
„Hmmm.“ Brian schnupperte genießerisch und seine braunen Augen blitzten. „Porridge mit Honig. Den hätte ich auch gerne.“ Er grinste mich frech an.
Ich zog die Schüssel zu mir. „Auf keinen Fall“, platzte ich heraus. „Das ist meiner. Du kannst von mir aus Eier, Speck und Schinken und sogar meine Mutter haben, aber meinen Porridge kriegst du nicht, du Pirat!“
Für einen Moment herrschte Stille. Mir wurde heiß und die Röte schoss mir ins Gesicht. Doch bevor ich ein Wort der Entschuldigung herausbrachte, fing Brian an zu lachen. Er lachte und lachte, bis Tränen über sein Gesicht liefen, steckte meine Mutter an und schließlich auch mich.
So fing unser kurzes Glück an. Es versank ein paar Monate später im November zuerst in einem Meer von Horror, Schmerzen und Tränen und danach in bodenloser, grausiger Finsternis. Einer Finsternis, die mich niemals mehr loslassen sollte. Seit damals wusste ich, dass die Hölle von einer unendlichen Kälte sein musste.
04. Oban, 12. November 2013
Ich bekam kaum mit, wie Elinor mich in ihren Wagen lud und nach Hause brachte. Mein Kopf dröhnte, als würde er platzen. Ich konnte kaum sehen, weil feurige Kreise vor meinen Augen tanzten, wieder verschwanden und dunkle Flecken hinterließen, die mir das Gefühl gaben, plötzlich blind geworden zu sein. Ich hatte einen metallischen Geschmack im Mund und mir war übel.
Elinor sprach mit mir, ich hörte den besorgten Klang ihrer Stimme, konnte den Worten aber keinen Sinn geben. Spürte den warmen Druck ihrer Hände auf meinen Oberarmen, als sie mich ins Schlafzimmer bugsierte, mich niederdrückte und mir die Kleider auszog. Kurz fröstelte ich, als kalte Luft über meine nackten Beine strich, aber gleich darauf deckte sie mich zu. Ich bekam durch das Dröhnen in meinem Schädel vage mit, wie sie mir versprach, am nächsten Morgen nach mir zu sehen und mir befahl, für den Rest der Woche frei zu nehmen.
Dann rollte ich mich zusammen, schloss die Augen und starb einen meiner zahllosen Tode.
Irgendwann wachte ich wieder auf, starrte benommen auf die Leuchtziffern des Weckers. Zwei Uhr. Ich hatte keine Ahnung, ob Tag oder Nacht war. Die Rollläden waren geschlossen und am liebsten wäre ich nie mehr aufgestanden. Die Nachttischlampe brannte, ich musste Elinor gesagt haben, dass ich immer bei Licht schlief. Kalter Schweiß bedeckte meinen Körper und ich fror trotz der Decke. Ich rappelte mich auf und stellte vorsichtig die Beine auf den Boden. Die Kopfschmerzen waren verschwunden, aber ich fühlte mich, als hätte ich den gesamten Loch Fada durchschwommen und wäre gerade noch dem Ertrinken entronnen. Als ich aufstand, zitterten meine Knie und alles drehte sich vor mir. Ich atmete tief ein und aus und der Schwindel verflüchtigte sich.
Barfuß tappte ich zum Fenster, zog den Rollladen hoch. Milchiger Nebel hüllte die Außenwelt in diffuses Licht. Ich konnte kaum die Bäume und Sträucher im Garten hinter dem Haus ausmachen. Der spärlichen Helligkeit nach zu schließen, musste es Nachmittag sein. Ich wusste nicht, wie lange ich geschlafen hatte, es war, als wäre mir ein Teil meines Lebens entglitten.
Ich ging langsam in die Küche. Noch immer traute ich meinem Körper nicht ganz, der mir wieder einmal seine Grenzen aufgezeigt hatte.
Auf dem Tisch lag ein Päckchen in Frischhaltefolie. Es war selbst gebackenes Kräuterbrot. Im Kühlschrank fand ich neben einer Wasserflasche einen Topf mit einem Kärtchen daran. Gute Besserung und alles Liebe, Elinor, stand darauf und mir traten vor Rührung Tränen in die Augen. Ich hob den Deckel und schnupperte. Tomatensuppe. Wie auf Kommando begann mein Magen wild zu knurren. Ich machte den Gasherd an und stellte den Topf auf die Flamme. Dann rief ich Elinor an.
Sie meldete sich gleich nach dem ersten Klingeln. „Hi du Arme, wie geht es dir? Du hattest ja einen richtigen Zusammenbruch wegen dieser blöden Brosche.“
Die Schmetterlingsbrosche.
Ich sah sie wieder vor mir, etwas blitzte in meinem Bewusstsein auf. Eine andere Brosche, nicht mit grünen, sondern mit blutroten Steinen. Nackte Haut. Blut.
Ich verdrängte das Bild sofort und es verschwand.
„Ich wollte dir nur danken, Liebes.“ Meine Stimme gehorchte mir nicht, ich räusperte mich.
„Keine Ursache.“ Elinor klang immer noch besorgt. „Ich war heute Morgen kurz bei dir. Du hast geschlafen wie eine Tote, deshalb wollte ich dich nicht stören.“
Geschlafen wie eine Tote. Ein Schauer rieselte über meinen Rücken. „Ich – das ist diese blöde Migräne. Manchmal bringt sie mich fast um. Doch jetzt geht es wieder.“
„Du ruhst dich aber aus, nicht wahr? Du kannst gerne für den Rest der Woche Urlaub nehmen, ist ja nicht mehr viel los.“
„Aber …“
„Keine Widerrede. Ich komme heute Abend kurz bei dir vorbei, wenn dir das passt. Nur auf einen kleinen Schwatz, damit ich sehe, dass du wieder in Ordnung bist. Ich bringe auch was zu essen mit.“
„Okay, da kann ich ja kaum ablehnen.“ Meine Handflächen wurden feucht und ein Kribbeln überlief mich. Nein – bitte nicht!
„Bist du noch da?“ Ich hörte Elinor wie aus weiter Ferne. Ich musste etwas essen – sofort!
„Alles okay.“ In mir schob sich Panik hoch, ich schluckte den angesammelten Speichel und versuchte mich darauf zu konzentrieren, normal zu sprechen. „Ich muss Schluss machen, das hier riecht so verdammt gut und ich sabbere bereits vor Gier den Küchentisch voll. Danke dir herzlich.“ Ich legte das Handy zur Seite und wischte die feuchten Hände an der Hose ab. Schnappte nach einem Stück Kräuterbrot und biss ab. Das Panikgefühl verschwand augenblicklich und machte schlechtem Gewissen gegenüber Elinor Platz. Ich wusste, dass sie sich um mich Sorgen machte. Manchmal vergaß ich einfach, wie erschreckend meine Zustände auf andere wirken mochten. Zum Glück hatte ich Elinor gerade noch abwimmeln können, bevor sie Zeugin eines weiteren Anfalls wurde. Solche Panikattacken standen mir immer dann bevor, wenn ich nicht regelmäßig aß. Ein psychisches Problem, das ich eigentlich glaubte, längst im Griff zu haben.
Ich löffelte den ganzen Topf leer und aß die Hälfte des Kräuterbrotes. Nach der Mahlzeit fühlte ich mich besser und beschloss, zu duschen.
Im Bad entdeckte ich meine Hausschuhe, die sich aus einem unerfindlichen Grund unter dem Waschbecken befanden. Der winzige Raum bot daneben gerade Platz für ein Schränkchen und eine Duschkabine. Eher eine großzügige Nasszelle war das Badezimmer nachträglich an das ebenerdige Häuschen angebaut worden. Ich fragte mich hin und wieder, wie Tante Emily und Onkel Robert samt ihren manchmal bis zu drei Pflegekindern Raum gefunden hatten, aber es beschwerte sich wohl nie jemand über Platzmangel. Das mochte an der Herzlichkeit und liebevollen Fürsorge der Gallaghers liegen, da vergaß man auf die beengten Verhältnisse.
Ich war ihr letztes Pflegekind gewesen und am längsten geblieben, beinahe neun Jahre, bis kurz vor meiner Volljährigkeit. Sie hatten mich schließlich adoptiert und ich trug von da an den Namen Gallagher. Mir war es nur Recht, ein weiteres Stück meiner Vergangenheit wurde dadurch ausgelöscht. Durch Vermittlung von Onkel Robert bekam ich eine Anstellung als Zimmermädchen im Argyll Guest House in Glasgow. Mein erster Job von vielen.
Onkel Robert starb kurz nach meinem Weggang an einem Herzinfarkt. Tante Emily war vor zwei Jahren eingeschlafen und nicht mehr aufgewacht. Mangels weiterer Verwandtschaft vermachte sie mir das Häuschen und eine kleine Summe Erspartes und ich nahm das Erbe an, froh, endlich nach all den unsteten Jahren eine beständige Unterkunft zu haben.
Ich stellte mich unter die Dusche, ließ das heiße Wasser auf meinen Körper prasseln.
Danach zog ich die bequemste Jogginghose und mein Lieblings-Sweatshirt an und ging zurück in die Küche. Die dunklen Eichenmöbel wiesen mittlerweile starke Gebrauchsspuren auf, ich fand sie aber nach wie vor gemütlich. Der Großteil an Möbeln und Geschirr war aus dem Nachlass von Tante Emily, auch der Wasserkessel aus Edelstahl, den ich nun auf den Herd stellte, um mir eine Kanne Tee aufzubrühen. In einer Schublade entdeckte ich ein Säckchen mit Toffees, die mir Elinor irgendwann einmal geschenkt haben musste.
Ich ging zum Küchenfenster und schob den blau-weiß-karierten Vorhang zur Seite. Tante Emily hatte ihn selbst genäht und am unteren Rand mit einer Reihe Veilchen bestickt. Das diffuse Dämmerlicht draußen nahm mir jede Lust, das Haus zu verlassen.
Ich vertiefte mich in The Moonstone von Wilkie Collins. Das Buch hatte ich zuletzt während meiner Zeit in London gelesen. Der altmodische Krimi beruhigte meine Nerven und ich fragte mich wieder einmal, wie oft ich noch Opfer meiner Hirngespinste wurde.
Das Schrillen der Türglocke holte mich aus dem Tagebuch von Ezra Jennings zurück in die Wirklichkeit. Ich sah auf die Uhr. Halb vier. Hatte Elinor beschlossen, früher zuzusperren? Ehrlich gesagt, wäre es mir lieber gewesen, noch ein wenig Ruhe zu haben. Ich mochte meine Freundin sehr, aber sie konnte ihre Neugier nie lange bezähmen und ich musste auf unangenehme Fragen gefasst sein. Natürlich ahnte sie, dass es für meine Migräneattacke eine tiefere Ursache gab, noch dazu, wo sie so plötzlich beim Anblick der Brosche aufgetreten war. Ich verwünschte meine eigene Schwäche, die mich die Beherrschung verlieren hatte lassen.
Ich hatte Elinor nie etwas über meine Vergangenheit erzählt – auch nicht davon, was ich noch wusste.
Es läutete wieder und ich stand auf. Ignorieren konnte ich sie auf keinen Fall.
Ich öffnete die Tür. „Hi, du bist schon …“ Überrascht verstummte ich. Es war gar nicht Elinor. Ein Fremder stand vor mir.
„Miss April Gallagher? Oder vielmehr McPherson? April McPherson?“
Eine Gänsehaut überlief mich und die Härchen auf meinen Armen richteten sich selbst unter dem dicken Sweatshirt auf.
„Tut mir leid“, sagte ich automatisch. „Da sind Sie hier falsch.“
Er sah mich mit ausdrucksloser Miene an. Seine Augen hatten eine undefinierbare Farbe, eine Mischung aus grau, grün und blau.
„Tut mir leid. Ich wollte Sie nicht erschrecken. Ich weiß, dass Sie jetzt den Namen Gallagher tragen.“ Seine Stimme klang tief und sehr kultiviert. Londoner Upperclass vermutlich.
„Was wollen Sie? Wer sind Sie überhaupt? Falls Sie ein Reporter sind – ich kann Ihnen nichts sagen.“ Ich bemühte mich um einen harschen Ton, versuchte, das Zittern, das mich schlagartig überfiel, zu unterdrücken. Der Kerl war mindestens einen Kopf größer als ich, aber ich war gut darin geworden, mich selbst zu verteidigen. Zur Not konnte ich ihm das Knie in den Bauch rammen und …
„Verzeihen Sie.“ Er neigte den Kopf auf eine Weise, die zu seinem distinguierten Äußeren passte. Ich vergaß meine Verteidigungsmaßnahmen und betrachtete ihn genauer. Sein Alter war schwierig zu schätzen, er mochte vielleicht Anfang Dreißig sein, wirkte aber aufgrund seines Auftretens älter. Er trug einen schwarzen Kaschmirmantel, der nicht zugeknöpft war und darunter Anzug und Krawatte, alles im Wert etwa meines Jahresgehalts. Ich kannte mich mit teurer Kleidung aus, seit ich als Zimmermädchen im Park Lane Hotel in Mayfair gearbeitet hatte.
„Mein Name ist Benedict Holden. Ich bräuchte Ihre Hilfe bei einem heiklen Thema. Es geht um die Umstände des Todes …“
Das Zittern verstärkte sich und mir wurde schwindlig. „Mir egal. Ich will nicht mit Ihnen sprechen. Lassen Sie mich einfach in Ruhe.“ Ich wollte die Tür schließen, doch er stellte blitzschnell den Fuß in den Spalt. Sein Schuh war blank poliert.
„… Ihrer Mutter. Ich komme von Holden, Carmichael & Struthers“, sagte er, als hätte ich ihn nicht unterbrochen.
Ich hielt mich am Türrahmen fest. Hinter meinen Schläfen begann es zu pochen. „Verschwinden Sie oder ich rufe die Polizei.“ Das diffuse Gefühl von Angst, das mich bei der Nennung meines früheren Namens ergriffen hatte, wurde zu wilder Panik. „Gehen Sie, bitte.“ Es hörte sich viel zu flehentlich an.
Zu meiner Verblüffung trat er einen Schritt zurück. Ein bedauerndes Lächeln huschte über sein Gesicht. „Ich habe wohl den falschen Zeitpunkt erwischt, tut mir wirklich leid.“
Hau ab. Lass mich in Ruhe.
Ich hatte das bestimmt nicht laut gesagt, auch wenn es in mir schrie. Er griff in die Brusttasche seines Sakkos und gab mir eine Karte. „Vielleicht überlegen Sie es sich noch einmal. Es könnte sein, dass der Mörder Ihrer Mutter wieder zugeschlagen hat.“
Damit drehte er sich um und ging.
Ich warf die Tür zu, lehnte mich dagegen, konnte mit einem Mal keinen Schritt tun, so sehr zitterten meine Knie. Ich starrte auf die Karte in der Hand, die Schrift verschwamm vor meinen Augen.
Nein, das konnte nicht sein. Das war nur einer dieser sensationslüsternen Journalisten. Irgendjemand wühlte wieder einmal in der Vergangenheit herum, auf der Suche nach Grausigem, Rätselhaftem, um einem gierigen Publikum Unterhaltung zu bieten. Ich schloss die Augen, sah das Blitzlichtgewitter wieder vor mir, das mich unbarmherzig blendete, sodass ich keinen Schritt mehr tun konnte. Hörte die aufgeregten Stimmen, die bohrenden Fragen, die ich nicht beantworten konnte, weil mein Gedächtnis nichts als ein schwarzes Loch war. Spürte die unzähligen Körper, die sich an mich drängen wollten, mir viel zu nahekamen. Der Polizist, der mich mehr schlecht als recht vor der Meute abschirmte, ein Spießrutenlauf zu dem dunklen Wagen auf der anderen Straßenseite, der mich von Portree wegbringen sollte. Für immer.
Wie lange ich da stand, an die Tür gelehnt, in mir haltloses Zittern, hätte ich nicht sagen können. Es war, als würde über mir eine dunkle Wolke hängen, als sei der Abgrund, an den ich längst gewöhnt war, nicht mehr genug.
Das Gedicht. Die Brosche. Und jetzt dieser Kerl, der offensichtlich über mich Bescheid wusste.
Mein erster Impuls war, meine Sachen zu packen und einfach wegzulaufen, wie ich es so oft schon getan hatte. Aber eigentlich wollte ich das nicht mehr. Ich hatte eine Heimat gefunden, besaß ein Haus. Ich hatte endlich eine Freundin.
Das neuerliche Schrillen der Türglocke fuhr mir durch Mark und Bein. Ich hielt mich wieder am Türrahmen fest, um das Zittern unter Kontrolle zu bekommen und atmete ein paar Mal tief ein und aus. Mein Herz pochte so heftig, dass ich glaubte, mein Brustkorb müsste zerspringen. War das wieder dieser Fremde?
Unsinn. Er hatte gesagt, ich solle ihn anrufen. Was ich natürlich nicht tun würde.
Ich fasste mir ein Herz und öffnete die Tür einen Spalt weit. Nebel wallte in weißen Schwaden, schluckte das Licht der Straßenlaternen.
„Hi April! Willst du mich nicht hereinlassen? Es ist saukalt draußen und das Ding hier ist schwer!“ Elinor seufzte dramatisch und ich atmete erleichtert aus. Sie schob sich durch die Tür und brachte den Duft von Zimt und Schokolade mit einem Hauch von Curry mit. Sie ächzte theatralisch und stellte einen Korb von monströsen Ausmaßen auf den Tisch.
Ich stakste mit steifen Schritten von der Tür weg. In der Hand hielt ich immer noch die Karte dieses Mr. Holden. Ich legte sie unauffällig auf die Anrichte.
Elinor war damit beschäftigt, den Inhalt des Korbs auszubreiten. „Ich hab Salat, Curry mit Huhn und Reis und Chocolate Fudge Cake für meine arme kranke Freundin mitgebracht.“
Ich musste angesichts der Mengen lachen und mit einem Mal erfüllte mich Wärme. Wie hatte ich nur daran denken können, wegzugehen und Elinor zu verlassen? „Ich kann das niemals alles essen, ich hoffe, du leistest mir dabei Gesellschaft.“
Elinor grinste. „Das war der Plan.“ Sie zauberte eine Flasche Chardonnay hervor. „Und die passt genau zu unserem Mädelsabend. Fehlt nur noch ein Liebesfilm – ach je, du hast ja kein Fernsehgerät. Egal. Wir kriegen das schon hin. Lesen wir uns eben einige von deinen altmodischen Gedichten vor.“
Sie deckte in Windeseile den Tisch. Ich setzte mich auf einen Stuhl und ließ sie gewähren. Als einsame Kriegerin gegen die Dunkelheit bekam ich selten Gelegenheit, mich verwöhnen zu lassen.
Das Curry schmeckte wie erwartet köstlich und weckte trotz des gerade überstandenen Schreckens meinen Appetit. Zu meinem Leidwesen schaffte ich aber nur mehr eine kleine Portion Kuchen.
Während der Mahlzeit drehte sich unser Gespräch um Belangloses. Um die Schwierigkeiten Sarahs in der Schule, um Elinors Exmann und seine neue Freundin und um ihre eigenen Pläne für das Wochenende. Sarah würde bei Tom übernachten und sie hatte sozusagen sturmfrei. „Ich würde gerne wieder mal nach Glasgow fahren“, meinte sie. „Ein wenig bummeln gehen, vielleicht ins Kino. Hättest du Lust?“
Ich zuckte mit den Schultern. „Nicht wirklich. Ich fühle mich immer noch ein wenig wackelig.“
„Ach komm! Ein Tapetenwechsel würde dir guttun. Wir könnten auch tanzen gehen.“
Dazu war ich im Moment überhaupt nicht in der Stimmung, wollte Elinor aber nicht vor den Kopf stoßen. „Eher ein andermal …“
Sie zog eine Schnute. „Ich sehe schon, du willst dieses Wochenende lieber in deinen vier Wänden verschimmeln, zwischen den alten Schmökern und den komischen Gedichten von – ach, ich weiß gar nicht, wie die alle heißen.“
„Gibt es eigentlich etwas Neues über deine romantische Bekanntschaft?“ Mein Herz flatterte leicht, aber ich versuchte, mir nichts anmerken zu lassen.
„Meinst du butterfly0406?“
„Wie bitte?“ Ich starrte sie verständnislos an.
„Na so nennt er sich. Butterfly0406.“
Mir wurde heiß. Schmetterling. 0406. 6. April? Das war mein Geburtstag. Ein Zufall?
Elinor knuffte mich leicht in die Seite. „Erde an April? Du guckst schon wieder so komisch. Brich mir bloß nicht wieder zusammen! Mir ist das mit deinem Geburtstag auch aufgefallen, aber ich hab vergessen, ihn danach zu fragen. Muss ich unbedingt noch tun. Vielleicht ist es ja auch seiner? Wär doch lustig, oder?“
Ich schüttelte den Kopf, meine Gedanken rasten, ließen sich nicht festhalten.
Das Gedicht von John Grace. Eines meiner Lieblingsgedichte. Früher, in einem anderen Leben. Ich spürte, wie ein unsichtbares Netz mich zu umschließen begann, etwas Gigantisches, das mich in seine klebrige Umarmung ziehen würde.
„April?“ Elinors Hände, die vor meinem Gesicht fuchtelten, holten mich in die Wirklichkeit zurück. Sie nahm mich bei den Schultern, ihr Blick bohrte sich in meinen. „Meine Liebe, ich glaube, du hast wirklich ein ernsthaftes Problem. Denkst du, ich merke nicht, was mit dir los ist? Du trägst irgendeine Scheißgeschichte mit dir rum und glaubst, du musst sie mit dir alleine ausmachen. Falls du das noch nicht weißt – ich bin deine einzige und beste Freundin! Vielleicht wäre es gut, mal alles rauszulassen?“
Ich sah die Besorgnis in ihren Augen und musste schlucken. „Es – es geht nicht. Tut mir leid, aber das ist alles – ziemlich kompliziert …“
Elinor schüttelte den Kopf. „Es hilft wirklich manchmal, einfach drüber zu reden. Auch wenn ich nichts sonst für dich tun könnte, ich würde dir zuhören.“
„Das … das ist lieb von dir. Aber ich kann nicht.“
Sie rückte ein wenig von mir ab und ich spürte ihre Enttäuschung. Ich nahm ihre Hand. „Du bist wirklich meine beste Freundin. Aber glaub mir, es gibt Dinge, über die kann man nicht sprechen, die sollte man einfach nur vergessen. Genau das habe ich getan. Und um nichts in der Welt möchte ich die Erinnerung daran zurückhaben.“
„Wie du meinst.“ Elinor war immer noch verstimmt. „Und das ist wohl auch der Grund, warum du dich einigeln und nicht nach Glasgow mitkommen willst? Aber ist auch egal. Fahre ich eben alleine.“
05. Glasgow, 15. November 2013
The lost breeze kissed her bright blue eye,The bee kissed and went singing by,A sunbeam found a passage there,A gold chain round her neck so fair;As secret as the wild bee’s songShe lay there all the summer long.
(John Clare 1793 – 1864, Secret Love)
Er wartete, sah dabei immer wieder unauffällig auf seine Armbanduhr. Halb zehn. Er war eine halbe Stunde zu früh dran und hatte deshalb noch genügend Auswahl an freien Plätzen gehabt, saß jetzt im Halbdunkel in der Ecke mit freiem Blick zur Eingangstür. Obwohl er durstig war, versagte er es sich, ein Getränk an der Bar zu holen. Niemand sollte sich später an ihn erinnern.
Das One up füllte sich langsam. Einige Paare saßen an den Tischen, auch Männer in Anzügen – Geschäftsleute oder Bankbedienstete – schon sichtlich angeheitert, die ihr Feierabendbier ausdehnten, um gleich das Wochenende entspannt zu beginnen.
Die Eingangstür öffnete sich wieder und spuckte eine weitere Gruppe herein. Ein Frauenquartett, offensichtlich nach einem längeren Einkaufsbummel noch unterwegs. Sie schleppten Unmengen von Plastiktüten mit sich. Er verzog angewidert das Gesicht. Oberflächliche Tussen, die nichts anderes als den neuesten modischen Firlefanz im Kopf hatten. Mit blondierten Haaren, falschen Wimpern und Nägeln, in hochhackigen Pumps und engen Röcken.
Er wandte den Blick von den schnatternden Frauen wieder zur Eingangstür. Jeder, der das Lokal betrat, musste erst über die steile Treppe hochgehen, die beinahe wie ein Nadelöhr wirkte, bevor er diesen Ort des lasterhaften Vergnügens aufsuchen konnte. Mehr denn je fühlte er sich wie ein Fremdkörper.
Noch einmal sah er auf die Uhr. Hoffentlich erschien sie zum richtigen Zeitpunkt. Unpünktlichkeit war eine hässliche Untugend. Es überraschte ihn ein wenig, dass sie so plötzlich ein Treffen vorschlug, vorher hatte sie sich ziemlich zurückhaltend gegeben. Was ihn natürlich noch anstachelte, sich um sie zu bemühen. Aber auf Dauer konnte wohl keine seinen verführerischen Einflüsterungen widerstehen – Gott verzeihe ihm dieses widerwärtige Spiel! Es lag daran, dass sie hungrig waren. Gierig nach Sünde und verbotenen Vergnügungen. Nun – er würde ihnen allen die Augen öffnen!
Auch dieser. Er hatte auf dem Foto, das sie ihm schickte, sofort gesehen, dass sie eine von ihnen war.
Ja, ganz gewiss! Er erkannte solche wie sie auf Anhieb. Die blauen Augen mit diesem frechen Ausdruck, Blicke, die ständig die Umgebung absuchten, das dunkle Haar, das sie offen trugen und es immer wieder mit einer bewusst einstudierten Geste zurückstrichen, die Finger, die damit spielten. So kokett, so gefallsüchtig. Der Gang, wenn sie durch die Straßen liefen, mit wiegenden Hüften und das perlende, helle Lachen. Er würde dafür sorgen, dass sie lernten, sich zu benehmen.
Auch sein neues Opfer würde diese Lektion erfahren. Gleich heute Nacht.
Die Tür öffnete sich erneut, brachte einen Schwall kalter Luft mit und dann sah er sie. Sie ließ ihren Blick schweifen, ein wenig eingeschüchtert von der lärmenden Menschenmenge. Natürlich konnte sie ihn in der dunklen Ecke nicht wahrnehmen und sie wusste nicht, wie er aussah. Damit hatte er Zeit, sie noch ein wenig zu beobachten. Ihr hübsches Gesicht, das nun so gar nicht selbstsicher wirkte, ihr gekünsteltes Lächeln, auffordernd und schüchtern zugleich. Er musste sie einfach noch ein wenig zappeln lassen! Unter dem Mantel trug sie ein rotes, kurzes Kleid. Wie billig! Er hatte rot noch nie leiden können!