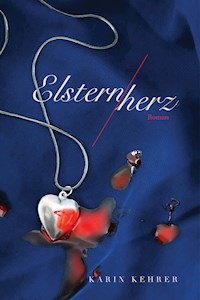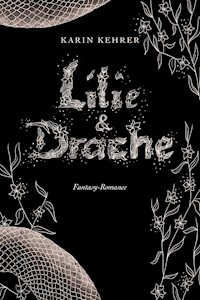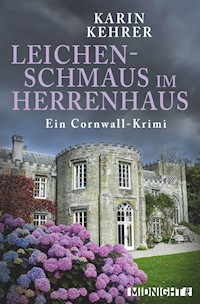Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks Self-Publishing
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Viktorias Begegnung mit Jonathan stellt ihr ganzes Leben auf den Kopf. Denn der einfühlsame Mann hütet ein furchtbares Geheimnis. Sie lässt sich trotzdem auf eine Beziehung mit ihm ein und findet dadurch auch zu sich selbst. Doch ihr Traum von einem harmonischen Familienleben in ihrem neuen idyllischen Haus rückt in weite Ferne, als sie die Wahrheit über Jonathan erfährt – eine Wahrheit, die unglaublicher ist, als alles, was sie sich vorstellen kann …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Karin Kehrer
Wir sind nur Gast auf Erden
Mystery-Romance
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
EPILOG
Impressum neobooks
Kapitel 1
Ich hab die Nacht geträumet
Wohl einen schweren Traum.
Es wuchs in meinem Garten
Ein Rosmarienbaum.
Ein Kirchhof war der Garten,
Das Blumenbeet ein Grab.
Und von dem grünen Baume
Fiel Kron’ und Blüten ab.
Die Blüten tät ich sammeln
In einem großen Krug.
Der fiel mir aus den Händen,
Dass er in Stücke schlug.
Draus sah ich Perlen rinnen
Und Tröpflein rosenrot.
Was mag der Traum bedeuten?
Herzliebster, bist du tot?
(Joachim August Zarnack, 1820)
*****
Jonathan blinzelte. Ein kurzer Schauder überlief ihn und dann öffnete er die Augen ganz. Lag minutenlang einfach bewegungslos da, starrte in das Blau des Himmels, ohne etwas richtig wahrzunehmen. Eine leichte Benommenheit beherrschte ihn, als hätte er zu lange und zu tief geschlafen.
Keine Schmerzen.
Keine Kälte.
Kein Gestank.
Seine Gedanken ließen sich nicht festhalten. Wirre Wortfetzen geisterten durch sein Bewusstsein, verschwanden wieder.
Engelchen. Geh nicht fort. Brauch dich. Wir sind nur Gast …
Langsam setzte er sich auf.
Es bereitete ihm Mühe, die einzelnen Bewegungen zu koordinieren, so, als ob sein Körper vergessen hätte, wie man Muskeln und Gelenke gebraucht.
Er sah sich um.
Vor seinem Blick breitete sich eine grüne Wildnis aus. Brombeersträucher, über und über mit weißen Blütentrauben geschmückt, erstickten fast eine Hainbuchenhecke.
Glockenblumen, Margeriten, Ringelblumen und wilde Kamille wiegten sich in einer leichten Brise. Es roch nach Sommer.
Er drehte seinen Kopf, nahm das Bild auf. Es hatte etwas Vertrautes und zugleich gänzlich Fremdes.
Ein sanft ansteigender Hügel, darauf verstreut niedrige Obstbäume, die von meterhohem Gras umarmt wurden.
Sein Blick wurde am Saum des Waldes aufgehalten, der sich hinter der Wiese erhob. Minutenlang betrachtete er das dunkle Grün der Fichten, dicht gedrängt wie eine Wand, versperrte es ihm die Sicht auf das, was dahinter liegen mochte.
Zu seiner linken Seite lugte das verwaschene Weiß einer Hausmauer durch die Wildnis. Vom Schmutz blinde Glastüren starrten ihn an.
Er war zu Hause.
Ein vages Unbehagen beschlich ihn bei dem Gedanken. Zu Hause – das fühlte sich nicht angenehm an.
Warum?
Er durchsuchte vergeblich seine Erinnerung. Da war nur gähnende Leere.
Das Haus duckte sich unter seinen forschenden Blicken, als hätte es ein schlechtes Gewissen.
Er lehnte sich an die raue Rinde des Kastanienbaums, unter dem er eingeschlafen sein musste und schloss die Augen. Das war besser. Nicht zu sehen, nur zu riechen und zu fühlen. Jetzt konnte er die Sonne auf seinem Gesicht spüren, sie tauchte alles hinter seinen geschlossenen Lidern in freundliches Orange. Der Geruch des Grases und der trockenen Erde hatte etwas Heimeliges.
Nun nahm er auch das Summen der Bienen wahr und das Zwitschern der Vögel. Den Gesang der Amseln, die in der Hainbuchenhecke ihr Nest gebaut hatten und das Flöten der Meisen.
Aber etwas fehlt.
Jonathan öffnete die Augen wieder. Ein Schatten war durch seine Gedanken gehuscht und wieder verschwunden, bevor er ihn festhalten konnte.
Wenn er den Kopf leicht zurücklegte, konnte er das Haus hinter den Sträuchern sehen. Es hatte mit einem Mal etwas Lauerndes. Ein Raubtier, zusammengekauert vor dem tödlichen Sprung.
Unwillkürlich hielt er den Atem an.
Der Schatten war wieder da, nahm Gestalt an.
Mina. Paul. Sebastian.
Mina würde zornig auf ihn sein, wenn er den Tag so vertrödelte. Gleich würde sie ihm mit ungeduldiger Stimme Befehle erteilen.
Welcher Tag war heute? Samstag? Nein, das konnte nicht sein. Er hätte sonst Pauls Hämmern gehört, wenn der wieder einmal dabei war, eine schadhafte Stelle irgendwo auszubessern.
Aber er hätte Sebastians Radio hören müssen, das im Schuppen plärrte, während er mit endlosen Reparaturen an seinem Auto beschäftigt war. Sebastian war immer zu Hause, er ging nicht zur Arbeit.
Doch es blieb still.
Sebastian, Paul und Mina waren nicht da. Er war allein.
Die Erkenntnis breitete sich langsam in ihm aus, ließ ihn frösteln.
Sie sollten hier sein, hier waren sie alle zu Hause. Irgendjemand war immer da, beobachtete ihn, erteilte ihm Aufträge, fügte ihm Schmerzen zu.
Schmerzen.
Eine Wand schob sich vor seine Gedanken als stünde er vor einer verschlossenen Tür. In seinen Erinnerungen klaffte ein schwarzes Loch.
Jonathan betrachtete das Haus mit den verblichenen, grünen Fensterläden und dem abbröckelnden Putz. Die Glastüren, die in den Garten führten und ihn jetzt blind und vorwurfsvoll anstarrten. Zwischen den Pflastersteinen wuchs Unkraut. Den Gemüsegarten überwucherten Brennnesseln.
Mina hätte etwas dagegen getan. Sie hatte immer alles penibel in Ordnung gehalten.
Wie lange habe ich geschlafen?
Wann sind sie gegangen?
Warum haben sie mich zurückgelassen?
Ihm fehlte jegliches Zeitgefühl.
Zögernd stand er auf, starrte noch immer auf das Haus, setzte sich langsam in Bewegung. Er musste bewusst daran denken, den Fuß zu heben, ihn wieder abzusetzen, es mit dem anderen Fuß auch so zu machen.
Aber es fiel ihm leichter, je länger er sich bewegte. Fast so wie in seiner Kindheit, wenn er nach einem langen Winter zum ersten Mal wieder auf sein Rad stieg.
Jonathan blieb stehen und betrachtete das Pflaster zu seinen Füßen.
Radfahren hatte früher zu seinen Lieblingsbeschäftigungen gehört. Über die Zufahrt den Hügel hinunter zu rasen, für einen Moment das Gefühl von Freiheit zu verspüren.
Jetzt bereitete ihm selbst die leichte Steigung hinauf zur Eingangstür Schwierigkeiten. Er begann unkontrolliert zu atmen, holte mehr Luft, als er brauchte. Vor seinen Augen flimmerten grelle Schlangen aus Licht.
Erschöpft blieb er vor der Eingangstür stehen, atmete langsam ein und aus.
Sein Herz flatterte in der Brust wie ein eingesperrter Vogel.
Aber das Erstaunlichste war noch immer, dass die Schmerzen verschwunden waren.
Welche Schmerzen?
Aufmerksam betrachtete er die Fassade des Hauses. Die Farbe blätterte von der Haustür ab, die Oberlichte war verstaubt und voller Spinnweben. Mina musste schon lange fort sein, sie hätte das sicher nicht geduldet.
Jonathan hob die Hand, aber er drückte nicht auf die Klinke.
Verblüfft sah er auf seine Finger, die noch immer unschlüssig in der Luft schwebten. Sie kamen ihm vor, als würden sie nicht zu ihm gehören, als wären sie ein angefügtes Teil seines Körpers, das eigenen Gesetzen unterworfen war.
Sachte legte er die Hand auf die Türklinke.
Ein Abgrund tat sich vor ihm auf, kaltes, schwarzes Grauen. Jonathan schnappte nach Luft, röchelte. Etwas schnürte seine Kehle zu. Er ging in die Knie, hielt sich am Türstock fest. Versuchte zu schlucken, diesen Knoten im Hals loszuwerden, aber es funktionierte nicht.
Vor seinen Augen tanzten feurige Punkte, drehten sich im Kreis.
Langsam sank er auf die Stufen vor der Haustür, stützte sich mit beiden Händen ab. Blind tastete er um sich, fühlte den von der Sonne erhitzten Stein unter seinen Fingern. Er umklammerte eine Stufe, das feste Material gab ihm Halt, denn noch immer hielt ihn diese alles umfassende Angst gefangen wie in einem klebrigen Spinnennetz.
Konzentrieren auf den Atemrhythmus ... alles ist gut … keine Angst … nur eine Panikattacke. Ich werde nicht sterben.
Ausatmen. Einatmen. Ausatmen …
Die Angst wich langsam, machte einer lähmenden Erschöpfung Platz.
Er legte den Kopf auf die Knie. Überließ sich der gähnenden Leere, die sich in seinem Inneren ausbreitete.
Nach einer Weile erhob sich Jonathan, noch ein wenig schwankend.
Kapitel 2
Linz an der Donau, April 2012
Viktoria Sandgruber stand im Toilettenraum des Nobelrestaurants „Zu den drei Mühlen“. Sanfte Violinenklänge und zarter Rosenduft schwebten in der Luft. Der Raum strahlte exquisite Reinlichkeit aus mit den matt glänzenden, beigen Marmorfliesen. Aber sie achtete nicht darauf. Sie starrte in den Spiegel, sah die Wut in ihren Augen und stieß heftig die Luft aus.
Nun mach schon! Vergiss diesen Blödsinn! Du bist doch keine Träumerin!
Das hätte auch ihr Vater sagen können.
Sie schob trotzig ihr Kinn vor. „Ich bin aber nicht mein Vater. Ich bin anders! Ich bin ich!“
Energisch rieb sie ihre Hände unter dem Wasserstrahl. Seifenreste spritzten auf das blank geputzte Waschbecken. „Geschäft ist Geschäft! Ich gehe jetzt da hinaus und bringe das zu einem guten Ende.“
Viktoria trocknete ihre Hände ab und zog ihren Lippenstift nach.
Zur Hölle mit diesem Troger!
Schon als sie ihn zum ersten Mal in der Agentur getroffen hatte, war ihr sein überlegenes Lächeln aufgefallen. Ein typischer Selfmade-Man, der seine Ziele mit Hartnäckigkeit und einer Portion Arroganz erreichte. Er hatte nur auf ihren Ausschnitt gestarrt.
„Sei nett zu Herrn Troger, er ist schließlich ein wichtiger Kunde. Guter finanzieller Hintergrund, viel versprechende Ideen, ein innovatives Produkt. Wenn wir diesen Auftrag bekommen, haben wir gewonnen.“
Die Worte ihres Vaters und zugleich Chefs klangen wie Hohn in ihr nach. Nun – sie war nett genug gewesen und jetzt reichte es.
Nach einer hastig gemurmelten Entschuldigung hatte sie fluchtartig den Speiseraum verlassen, als Otto Trogers Bemerkungen unerträglich wurden.
Prüfend musterte Viktoria sich im Spiegel. Eine richtige Schönheit konnte man sie nicht nennen. Dafür waren ihre Gesichtszüge etwas zu herb, wie sie selbst fand. Normalerweise verstärkten das auch noch die streng zu einem Knoten frisierten und hochgesteckten Haare. Aber dieser Eindruck wurde heute geschickt durch die langen, dunkelblonden Locken gemildert, die auf ihre Schultern fielen.
Das war der erste Fehler, den sie gemacht hatte. Die Hochsteckfrisur verhalf ihr üblicherweise zu einem Gefühl von kühler Distanziertheit. Mit offenen Haaren fühlte sie sich verletzlich und angreifbar. Der zweite Fehler war die Wahl der Kleidung gewesen. Sie hatte durchaus sehr weibliche Rundungen vorzuweisen, die in dem schwarzen Cocktailkleid gut zur Geltung kamen, obwohl es einen dezenten Ausschnitt hatte. Der burgunderrote Lippenstift ließ ihren Mund sinnlich wirken – zu sinnlich.
Valentin würde sie so bestimmt nicht gefallen. Er hasste Make-up. Aber bei ihm hatte sie sowieso nicht die geringste Chance. Er liebte zierliche Dunkelhaarige. So wie Petra. Die beiden passten perfekt zusammen.
Sie verdrängte die aufkommende Bitterkeit. „Zum Teufel mit Valentin! Vergiss ihn endlich! Kehr auf den Boden der Tatsachen zurück! Valentin hat doch keine Ahnung vom richtigen Leben!“
Viktoria stemmte die Hände in die Hüften. „Wenn du Teilhaberin der Agentur werden willst, musst du das bringen! Mach jetzt bloß nichts falsch! Du wirst diesem Troger sagen, was Sache ist! Er muss deine Meinung respektieren!“
Aber er ist nun mal ein arroganter Widerling, flüsterte eine Stimme hartnäckig in ihr. Und warum soll ich ihm nach dem Mund reden, nur damit ich einen Auftrag bekomme, mit dem ich ohnehin nicht glücklich sein werde!
Sie stieß den Atem aus. Andererseits – wie wichtig ist schon, was ich darüber denke? Ein Profi fragt nicht nach, er macht seine Arbeit!
Sie wollte wirklich nach ihrer Arbeit beurteilt werden und nicht nach ihrem Aussehen. Troger schien zu der Sorte Mann zu gehören, die glaubte, dass eine Frau, die einigermaßen gut aussah, einen Intelligenzquotienten wie ein Kuscheltier hatte.
Viktoria streckte ihrem Spiegelbild die Zunge heraus. „Nun mach schon, du blöde Kuh! Zeig es diesem Kerl!“
Sie puderte ihre Nase und strich sich die Haare aus dem Gesicht. Mit einer heftigen Bewegung warf sie den Kopf zurück, presste die Lippen zusammen, straffte die Schultern und ging zurück ins Restaurant.
Gedämpftes Stimmengewirr und diskrete Beleuchtung empfingen sie. Troger hatte das Lokal mit Bedacht gewählt. Teuer und exquisit. Genau richtig für einen aufstrebenden Geschäftsmann, der nur an seinen Profit dachte.
Valentin verabscheute solche Leute. Doch er lebte ja auch in einer ganz anderen Welt. Wieder ein Grund, warum sie sich ihn so schnell wie möglich aus dem Kopf schlagen sollte.
Viktoria schluckte und versuchte, das Gefühl loszuwerden, in einer Falle zu sitzen.
Troger lächelte breit und zeigte zwei blendend weiße Zahnreihen, das Ergebnis intensiver und kostspieliger Zahnarztarbeit. Er war ein großer, schlaksiger Mann Anfang Dreißig mit kurz geschorenem Haar. „Da sind Sie ja wieder. Ich dachte schon, Sie hätten sich aus dem Staub gemacht. Aber ich warte natürlich gerne auf eine schöne Frau.“ Auf ihren protestierenden Laut reagierte er mit einer lässigen Handbewegung. „Doch, Sie sehen gut aus. So gar nicht wie eine dieser Öko-Tussis.“ Seine Augen glitzerten und sie bemerkte die Belustigung über ihr letztes Gesprächsthema darin. „Ich verzeihe Ihnen den kleinen Ausrutscher, wenn Sie versprechen, jetzt vernünftig zu sein.“
„Das bin ich durchaus.“ Viktoria nickte steif. „Ich habe inzwischen keineswegs meine Meinung geändert.“
Sein Lächeln verschwand. „Sie denken also noch immer, ich möchte den Leuten irgendwelches Giftzeug andrehen? Dann sollten Sie sich vielleicht besser informieren. Sämtliche Zusätze in meinem neuen Energy-Drink sind völlig unbedenklich. Aber setzen Sie sich doch erst wieder.“ Er wies auf den Stuhl neben sich.
Viktoria bemerkte, dass sein Weinglas schon wieder voll war. Die Flasche Welschriesling auf dem Tisch wurde beängstigend schnell leer. Doch offensichtlich war er an Alkohol gewöhnt, es war ihm nichts anzumerken.
Sie wich seiner einladend ausgestreckten Hand aus und ließ sich auf dem Stuhl ihm gegenüber nieder.
„Ich habe mir die Zutatenliste Ihres ‚Power of Nature’ angesehen. Wie können Sie glauben, dass ich dieses Gemisch aus künstlichen Farb- und Aromastoffen als frisch aus der Natur anpreisen kann?“, sagte sie fest.
Was rede ich da? Ich bin wohl übergeschnappt! Das kann mir doch alles völlig egal sein!
Trogers Finger schlossen sich um ihr Handgelenk. „Ach lassen Sie das doch, meine Liebe. Darüber sollten Sie sich Ihren hübschen Kopf nicht zerbrechen. Sie sollen nur einen knackigen Slogan und ein Design mit Wiedererkennungswert liefern. Sie enttäuschen mich wirklich fast ein wenig. Ich hätte Sie als erfahrener und realistischer eingeschätzt. Dieses Gerede von moralischer Verpflichtung gegenüber den Kunden und nachhaltiger Produktion irritiert mich. Ihr Vater hat mir versprochen, dass Sie bestens für diesen Job qualifiziert sind.“
Viktoria ballte ihre Finger zur Faust. „Das bin ich auch. Ich muss mich nur mit dem Produkt identifizieren können, für das ich eine Kampagne entwerfe.“
Warum kann es nicht mehr solcher Menschen wie Valentin geben?
Sie schluckte. „Tut mir leid, wenn es wie eine Moralpredigt geklungen haben soll. Das wollte ich nicht. Ich wollte nur eine andere Sichtweise …“ Sie verstummte und dachte wieder an Valentin. Seine Ideen hatten sie fasziniert und die Zusammenarbeit mit ihm hatte wirklich Spaß gemacht und ihr neue Erkenntnisse geschenkt.
Bist du glücklich in deinem Leben? Befriedigt dich das, was du tust?
Seine sanfte Stimme hatte sie aufgeweckt. Nichts war mehr so, wie es einmal gewesen war. Was er wohl machte? Auf ihre letzten beiden SMS hatte er nicht geantwortet. Aber das spielte ohnehin keine Rolle. Er wollte nichts von ihr. Zumindest nicht so, wie sie es gerne gehabt hätte.
„Was sagen Sie dazu?“ Otto Troger fixierte sie neugierig.
„Wie bitte?“ Viktoria schüttelte verwirrt den Kopf und verdrängte mit aller Macht Valentins Gesicht und seine leuchtenden dunklen Augen aus ihren Gedanken. Dieses Strahlen hatte nichts mit ihr zu tun, wie sie schmerzlich feststellen hatte müssen. Er liebte nur seinen Beruf und die Möglichkeiten, die Viktoria ihm geboten hatte.
„Ich sagte, dass ich Ihnen insofern recht gebe, dass der Trend nun mal in Richtung Natürlichkeit geht und ein paar esoterisch angehauchte Sprüchlein auf der Flasche doch gut ankommen würden.“
Viktoria musterte ihn vorsichtig, während sie an ihrem Weinglas nippte.
Sag jetzt nicht so einen abgedroschenen Blödsinn wie „Der Weg ist das Ziel“!
„Wie wäre es mit ‚Der Weg ist das Ziel’?“
Sie verschluckte sich, musste husten.
Troger sprang auf, wollte ihr auf den Rücken klopfen, aber sie wehrte ab. „Es geht schon wieder, lassen Sie nur.“
„Der Spruch gefällt Ihnen wohl nicht?“, feixte Troger. „Dabei dachte ich, Sie hätten einen Draht zur Esoterik. Ging nicht Ihr letzter Auftrag in diese Richtung? Dieser Yoga-Typ, oder?“
Viktoria nickte und versuchte, die Hitze zu ignorieren, die in ihr aufwallte. „Valentin Rainer. Und er ist kein Yoga-Typ, er ist Prana-Healer und leitet ein Meditationszentrum.“
Troger wedelte mit der Hand. „Ist auch egal. Ich kenne mich da nicht wirklich aus. Sind doch alles Spinner.“
„Ja, vielleicht haben Sie recht“, murmelte Viktoria abwesend. Valentin hatte ihr verschwiegen, dass er eine Lebensgefährtin hatte. Aber warum hätte er ihr das auch erzählen sollen? Ihre Beziehung war rein geschäftlicher Natur. Sie hatte sich etwas eingebildet, das nicht existierte.
„Also, was denken Sie?“ Otto Troger sah sie erwartungsvoll an und sie merkte beschämt, dass sie ihm schon wieder nicht zugehört hatte.
„Ich glaube, da sollten wir uns etwas Aussagekräftigeres einfallen lassen“, meinte sie abwesend.
Aber ich habe überhaupt keine Lust dazu.
Sie atmete tief durch. „Wissen Sie was? Ich muss mir das Ganze noch einmal durch den Kopf gehen lassen. Vielleicht bin ich doch nicht die Richtige für diesen Auftrag.“
Was? Was sage ich da? Das ist doch Blödsinn!
Trogers Lächeln erlosch schlagartig. „Wie Sie meinen. Es wird kein Problem sein, eine andere Agentur zu beauftragen, da können Sie sicher sein. Mit Ihnen scheine ich wohl meine Zeit verschwendet zu haben. Schade.“
Sein Blick glitt über ihre Figur, verharrte sekundenlang auf ihrem Dekolleté. „Ich hätte mir eine Zusammenarbeit gut vorstellen können. Ihr Vater wird nicht begeistert sein. Aber das ist bestimmt nicht mein Problem.“
Er winkte dem Kellner und bat ihn um die Rechnung.
„Ich möchte mein Essen selbst bezahlen“, sagte Viktoria.
Troger hob erstaunt die Augenbrauen, protestierte aber nicht.
Der Kellner verschwand mit einem diskreten Nicken.
Viktoria hielt es nicht länger aus. Sie stand auf. „Ich möchte mich verabschieden.“
„Meine Karte haben Sie ja“, meinte er kühl. „Wenn Sie es sich anders überlegen, können Sie mich jederzeit anrufen. Aber zögern Sie nicht zu lange. Und wenn ich Ihnen einen Rat geben darf: Möchten Sie wirklich in Ihrem Job gut werden und Geld verdienen, vergessen Sie dieses Gerede von Ethik und Moral.“
„Danke für den Rat. Wir werden sehen“, sagte sie mühsam beherrscht. Sie drehte sich um und ging, fühlte seine Blicke auf ihrem Rücken.
Der Kellner kam ihr mit einem Tablett entgegen, auf dem die Rechnung lag. Er sah sie fragend an. „Sie wollten getrennt bezahlen?“
„Ja. Wie viel macht es aus?“
Sie kramte mit zitternden Fingern nach ihrer Geldbörse und warf einen flüchtigen Blick auf die Rechnung.
„Den Wein bezahlt der Herr?“
Sie nickte. „Ja, den Wein bezahlt der Herr.“
Viktoria verließ das Restaurant, eilte zum Parkplatz und suchte hektisch in der Dunkelheit nach ihrem Auto.
Dann erst fiel ihr ein, dass sie ja mit dem Bus gefahren war. Daran hatte auch nur Valentins Gerede über den Klimaschutz Schuld.
Sie hastete auf die Bushaltestelle zu. Ihr Herz hämmerte wild gegen die Rippen.
Was ist bloß in mich gefahren? Wie kann ich nur so doof sein!
Sie starrte auf den Fahrplan, fand sich nicht zurecht. Die kleingedruckten Zahlen begannen vor ihren Augen zu flimmern.
Immer wieder warf sie vorsichtige Blicke auf die Tür des Restaurants.
Troger kam nicht.
Nicht auszudenken, wenn sie ihm nach dieser Blamage noch einmal über den Weg lief!
Viktoria verbarg sich im Schatten des Wartehäuschens, stopfte die Faust in ihren Mund, um nicht laut los zu weinen vor Zorn auf sich selbst, auf Valentin und auf diesen eingebildeten Schnösel. Was für eine Blamage!
Erleichtert atmete sie auf, als endlich der Bus auftauchte und anhielt. Hastig sprang sie hinein. Der Busfahrer musterte verwundert seinen hektischen Fahrgast, sagte aber nichts.
Viktoria warf sich auf den Sitz, sah noch einmal zurück zum Restaurant.
Jetzt kam Troger heraus. Sie duckte sich und kauerte sich zusammen.
Der Bus fuhr mit einem Ruck an, verließ die Altstadt.
Sie legte ihre Stirn an die Fensterscheibe und schloss die Augen.
Alles ist schief gelaufen! Jämmerlich versagt habe ich! Und das nur, weil ich mich in Valentin verguckt habe. Ich bin doch wirklich eine blöde Kuh! Es läuft außerdem nun mal nicht so, wie er sich das vorstellt. Geld regiert die Welt und nicht Liebe und Rücksichtnahme!
Ich werde wohl nie das Richtige tun.
Kapitel 3
Noch immer hatte Jonathan das Haus nicht betreten. Er mied es, das Gebäude auch nur anzusehen, so gut es eben ging. Aber es gelang ihm eben nicht gut. Es war einfach da, lauerte, wartete auf ihn wie ein bösartiger Hund in seinem Zwinger.
Am wohlsten fühlte er sich im Garten und im dahinter liegenden Wald. Dann dachte er nicht an die Schrecken und an die Panikattacken, die das Gemäuer in ihm wachriefen. Er konnte diesen Schrecken nicht benennen, obwohl er anscheinend damit gelernt hatte, umzugehen. Jemand musste ihm beigebracht haben, wie er diese Momente purer Angst bewältigen konnte. Aber immer wieder baute sich die dunkle Mauer in seinem Gedächtnis auf, ließ sich nicht überwinden.
Es gab allerdings auch Augenblicke, in denen er darauf vergaß und einfach nur seine Umgebung genoss.
Über dem Haus und dem Garten lag eine angenehme Stille, die sein Körper und sein Geist aufsogen, die seine Leere füllte. Auch konnte er jetzt ein Stück die Straße entlang gehen, ohne von diesem grässlichen Angstgefühl überwältigt zu werden. Das Bedürfnis, Menschen zu treffen, hatte er nicht.
Langsam folgte er dem Verlauf der Straße, den zahlreichen Kehren, die ihn talabwärts führten. Die nächste Biegung gab den Blick auf ein Dach frei, das Rot der Ziegel blitzte durch die Sträucher.
Ob ich auch zur Tankstelle gehen und nach Karl sehen kann?
An den Besitzer der Tankstelle erinnerte er sich seltsamerweise jetzt, obwohl alles andere, was in seinem Leben geschehen war, noch immer im Verborgenen lag.
Gut, er hatte das Haus, den Garten und alles, was sich in unmittelbarer Nähe davon befand, wieder erkannt. Abgesehen von den Panikattacken, die ihn dann überfielen, wenn er das Haus betreten wollte, ging es ihm eigentlich gut.
Er fiel immer noch manchmal in diesen schwebenden Zustand, in dem ihm sein Körper nicht richtig gehorchte, besonders dann, wenn sein Schlaf länger gedauert hatte, aber er überwand ihn immer schneller.
Er wanderte weiter die Straße hinunter. Es war nur ein schmaler Güterweg. Eine Sackgasse, die bei seinem Zuhause endete. Hierher kam nur, wer das Haus auf dem Hügel besuchen wollte. Bei seinen Spaziergängen war ihm bis jetzt nie jemand begegnet.
Die Tankstelle befand sich etwa einen Kilometer von seinem Zuhause entfernt und von da waren es nur mehr ein paar hundert Meter bis ins Dorf. Kirchweg, so hieß es.
Jonathan runzelte die Stirn, als er daran dachte.
Seltsam. Woher wusste er diese Dinge?
Sie waren ihm so geläufig wie die Tatsache, dass der Himmel blau ist.
Der Gedanke an das Dorf löste nichts in ihm aus. Weder Neugier, noch Angst. Nur nach Karl wollte er sehen. Nach seinem einzigen Freund, wie er spürte.
Vor ihm tauchte das niedrige Gebäude der Tankstelle mit dem angebauten Lagerraum auf. Das rote Dach leuchtete in der Sonne. Früher hatte ihn ein Gefühl der Erleichterung bei seinem Anblick durchströmt. Aber er erinnerte sich nicht daran, warum das so war.
Merkwürdig – dieser Zustand. Was war mit ihm geschehen?
Ein Gedächtnisverlust nach einem Schock?
Bevor die dunkle Wand wieder auftauchen konnte, verdrängte er jeden weiteren Gedanken daran. Es brachte nichts. Karl würde es ihm vielleicht erklären können.
Jonathan beschleunigte seine Schritte. Er schlug nun mühelos sein gewohntes Marschtempo an, ohne dass er außer Atem gekommen wäre. Das erfüllte ihn mit Freude. Alles würde wieder in Ordnung kommen.
Auf den ersten Blick schien es, als wäre es tatsächlich so, als er die Tankstelle erreichte. Was immer auch mit ihm geschehen sein mochte, hier hatte sich nichts verändert.
Es gab noch immer den kleinen Laden gegenüber den beiden Zapfsäulen für Diesel und Benzin, die von der Sonne ausgebleichte, rot-weiß gestreifte Markise, die über dem Schaufenster ausgespannt war. Hinter der Glastür baumelte ein Schild.
„Wegen Krankheitsfall bis auf weiteres geschlossen“ stand da in dicken, schwarzen Blockbuchstaben.
Jonathan starrte das Schild an. Eine ganze Weile konnte er an gar nichts denken, doch dann breitete sich Enttäuschung in ihm aus. Das durfte nicht sein! Er musste mit Karl sprechen, dem einzigen Vertrauten, an den er sich erinnern konnte. Sein alter Freund konnte ihm ganz sicher erklären, was geschehen war.
Warum er sein Gedächtnis verloren hatte und warum alle fort waren.
Er ging um das Haus herum.
Stille.
In der Ferne brummte ein Traktor. Das Geräusch entfernte sich, wurde vom Gesang der Vögel verschluckt.
Vielleicht hält sich Karl ja in seiner Wohnung auf? Es kann durchaus sein, dass er einfach krank ist und das Bett hüten muss.
Allerdings konnte er sich nicht erinnern, dass Karl jemals ernsthaft krank war.
Jonathan ging zur Hintertür. Den Ersatzschlüssel fand er unter dem Geranientopf. Auch das war wie immer.
Der Schlüssel lag schwer in seiner Hand und als er ihn in das Schloss steckte, überlegte er, in welche Richtung er ihn drehen musste, um aufschließen zu können.
Der vertraute Geruch nach Tabak und Papier schlug ihm nach dem Öffnen der Tür entgegen. Aber sein Verlangen nach einer Zigarette blieb aus. Trotzdem wusste er plötzlich wieder, dass er früher geraucht hatte.
Jonathan stieg die schmale Treppe hoch, die zu Karls Wohnung führte und öffnete die Tür.
Noch immer Stille.
Die kleine Küche war leer, ebenso das angrenzende Wohnzimmer und das Schlafzimmer. Der vertraute Geruch nach Speck und gerösteten Zwiebeln fehlte. Sein Freund machte die beste Eierspeise von Kirchweg.
Jonathan blickte sich um. Die Wohnung war sauber aufgeräumt und sah aus, als hätte jemand sie für längere Zeit verlassen. Eine feine Staubschicht lag auf den Möbeln und die wenigen Topfpflanzen wirkten vernachlässigt. Durch die staubigen Fensterscheiben drang gedämpft Sonnenlicht.
Sein Blick fiel auf das Telefon. Es stand auf einem kleinen Tisch im Vorzimmer. Daneben lag ein abgegriffenes Schulheft mit fleckigem Umschlag. Karls Telefonbuch.
Jonathan schlug es auf. Alle möglichen Namen und Adressen, in der sauberen, eckigen Handschrift seines Freundes. Sie sagten ihm nichts, obwohl Adressen aus Kirchweg darunter waren, die er kennen musste.
Ein Gefühl von absoluter Einsamkeit überfiel ihn. Es war so allumfassend und endgültig, dass es körperlich schmerzte.
Niemand konnte ihm helfen. Es gab keinen einzigen Freund, nicht einmal eine bekannte Person, an die er sich wenden konnte.
Jonathan rannte aus dem Haus, schlug die Tür hinter sich zu. Stand einfach nur da und versuchte, seinen Atem unter Kontrolle zu bringen. Es half. Das Zittern hörte auf.
Ohne sich noch einmal umzusehen, lief er die Straße zurück zum Haus, die gepflasterte Einfahrt hinauf und in den Garten. Legte sich unter den großen Kastanienbaum und starrte in den Himmel.
Er wollte weinen, doch er hatte keine Tränen.
Dieser seltsame, lähmende Schlaf musste ihn wieder übermannt haben, denn als Nächstes registrierte Jonathan, dass die Sonne nur mehr eine Handbreit über dem Horizont stand.
Er erhob sich und ging auf unsicheren Beinen auf das Haus zu, blieb stehen und betrachtete es. Wieder schien ihm, als würde es ihn belauern. So, als ob es darauf warten würde, dass er sich erinnerte, was darin geschehen war. In seinen Mauern war der Schrecken eingeschlossen, die Angst starrte ihn aus den blinden Scheiben an.
Sein Blick fiel auf das Giebelfenster. Eine winzige Luke, etwa eine Handbreit hoch und drei Handbreit lang.
Eine Welle von heißem Schmerz jagte durch seinen Körper, breitete sich in ihm aus, nahm ihm den Atem. Jonathan stöhnte und ging in die Knie.
Jetzt erinnerte er sich.
Kapitel 4
Linz an der Donau, Oberösterreich - April 1985
Jonathan stocherte ungeduldig in seinem Salat herum. Nur mit halbem Ohr hörte er dem Disput seiner Eltern zu. Aus dem gereizten Tonfall war zu schließen, dass es wie so oft um Onkel Paul ging.
„Er hat also wieder einen deiner Briefe zurückgeschickt? Warum lässt du es nicht endlich? Jahrelang schon versuchst du einzulenken und es nützt überhaupt nichts“, meinte Jonathans Vater ärgerlich. „Dieser unsinnige Familienzwist zehrt viel zu lange schon an unseren Nerven. Und alles wegen dieser mickrigen Erbschaft.“
„Ich weiß.“ Die Stimme seiner Mutter klang leise und sehr müde. „Aber er ist nun einmal mein Bruder. Und nur wegen eines dummen Missverständnisses ist er seit Jahren eingeschnappt. Wie oft habe ich schon versucht, ihn anzurufen? Er wimmelt mich einfach ab. Er gibt mir nicht die geringste Chance, ihm alles zu erklären!“
Jonathan sah, dass seine Mutter mit den Tränen kämpfte. Auch das war nichts Neues. Sie weinte fast immer, wenn sie wegen Onkel Paul stritten.
Jonathan interessierte das alles nicht wirklich. Er legte die Gabel beiseite. „Ich geh jetzt spielen.“
Sein Vater hielt ihn auf. „Hast du die Hausaufgaben schon gemacht?“
Jonathan nickte.
„Du gehst aber nur in den Hof hinunter. Keine Spazierfahrten.“
Wieder nickte Jonathan. „Klar. Kann ich auch gar nicht. Mein Fahrrad ist ja kaputt. – Ähm – könnte ich nicht doch schon jetzt ein neues kriegen?“
Sein Vater hob die Augenbrauen. „Du weißt, was wir besprochen haben. Das neue Fahrrad gibt es erst zu deinem Geburtstag.“
„Aber – das ist doch blöd! Ich will jetzt Radfahren. Nicht erst in tausend Jahren! Außerdem fahren alle aus meiner Klasse schon allein – nur ich darf nicht!“
Jonathan stampfte mit dem Fuß auf. „Das ist so ungerecht! Und alles nur wegen dieses dummen Unfalls. Was kann ich dafür, dass genau an der Stelle, wo ich bremsen musste, noch Streusplitt lag! Mir ist ja gar nichts passiert!“
Sein Vater funkelte ihn an. „Ich habe diese Diskussionen satt! Du warst sehr leichtsinnig und das zeigt mir, dass du noch nicht reif genug für den Straßenverkehr bist. Ich kann dich also nicht alleine zur Schule fahren lassen! Und damit möchte ich jetzt dieses Thema ein für allemal abhaken!“
„Du bist gemein! Ihr seid beide gemein! Ihr behandelt mich, als wäre ich noch ein Baby! Ich bin fast zehn!“
Jonathan rannte aus der Küche und schlug die Tür seines Zimmers hinter sich zu.
Er warf sich auf sein Bett und schlug mit der Faust auf die Matratze.
„Noch einen ganzen langen Monat muss ich auf meinen Geburtstag warten! Als ob das so viel ausmachen würde, wenn ich das Fahrrad jetzt schon bekomme. Papa ist einfach ekelhaft!“
Er setzte sich auf, musterte finster die Tapete an der Wand. Teddybären marschierten in einer Reihe. Jonathan hatte einigen von ihnen mit schwarzem Filzstift Hüte und Schnurrbärte gemalt.
Die anderen werden mich auslachen, wenn ich zu Fuß zur Schule komme. Vor allem Fred, dieser Knallkopf!
Ein leises Klopfen schreckte ihn aus seinen düsteren Gedanken. Seine Mutter streckte den Kopf zur Tür herein. „Möchtest du mitfahren? Wir müssen noch einkaufen.“
„Nein“, fauchte er. „Lass mich einfach in Ruhe!“
Sie zuckte mit den Schultern. „Wie du meinst. Wir kommen in spätestens zwei Stunden wieder.“
„Verschwindet doch und kommt nie wieder“, knurrte Jonathan. Aber erst, als er sicher war, dass seine Mutter es nicht mehr hören konnte.
Die Lust, im Hof zu spielen, war ihm gründlich vergangen. Er verbrachte eine ganze Weile damit, einfach nur trübsinnig aus dem Fenster zu starren.
Das Wetter hatte gewechselt. Jetzt regnete es und dicke Tropfen klatschten an die Fensterscheiben. Jonathan beobachtete wie sie auf das Glas trafen und in dünnen Rinnsalen die Scheibe hinunterliefen. Er fuhr die Spuren mit dem Finger nach. Wenigstens war seine Mutter nicht hier, um mit ihm zu schimpfen, weil er die Fenster beschmutzte.
„Eltern!“, sagte er zu Micky. Die weiße Maus saß in ihrem Käfig und beobachtete ihn aus roten Knopfaugen. „Immer haben sie etwas auszusetzen oder zu kommandieren. Wie einfacher wäre es, wenn sie nicht mehr da wären.“
Die Vorstellung jagte ihm einen kribbelnden Schauder über den Rücken und in seinem Magen breitete sich ein leises Ziehen aus.
Dann könnte ich immer tun, wozu ich gerade Lust habe.
Er stand auf und schlich in die Küche. Das Ticken der Wanduhr klang überlaut in der Stille.
Langsam zog Jonathan die verbotene Lade mit den Süßigkeiten auf. Eine angebrochene Tafel Milchschokolade lag darin. Er brach eine Rippe ab – nur eine. Mama würde das nicht merken. Und er tat das auch nur, weil seine Wut so groß war.
Aber die Schokolade schmeckte ihm nicht. Er legte den Rest zurück in die Lade, stieß sie mit einem Ruck zu und ging zurück in sein Zimmer.
Der Zeiger auf seinem Micky-Maus-Wecker war gerade einmal um fünf Minuten weiter gerückt.
Jonathan nahm eines seiner Fünf-Freunde-Bücher vom Regal über dem Bett und blätterte darin. Die Geschichte war ihm zwar schon bekannt, aber trotzdem vertiefte er sich erneut darin.
Als er das nächste Mal auf seinen Wecker sah, war eine Stunde vergangen.
Zehn vor vier.
Um diese Zeit lief immer die „Sesamstraße“.
Er schlurfte ins Wohnzimmer und schaltete den Fernseher an.
Nach der „Sesamstraße“ kamen der „Rosarote Panther“ und dann „Familie Feuerstein.“
Normalerweise musste danach der Fernseher ausgeschaltet werden. Aber diesmal war niemand hier, der ihm dies befahl.
Er sah sich noch die Hitparade an, obwohl sie ihn überhaupt nicht interessierte.
Sein Magen knurrte laut.
Sechs Uhr. Um diese Zeit gab es immer Abendessen.
Papa und Mama hätten längst zurück sein müssen. Sie verspäteten sich nie wesentlich, besonders dann nicht, wenn Jonathan alleine zu Hause blieb.
Er schaltete den Fernseher ab und starrte beunruhigt auf die Uhr. Was sollte er tun?
Sollte er zu Frau Rotter nebenan gehen und sie fragen, ob sie ihm etwas zu essen machen konnte? Oder lieber doch nicht. Frau Rotter würde es bestimmt seiner Mutter erzählen und das war einfach nur peinlich.
Es klingelte an der Tür.
Jonathan zuckte zusammen. Waren das seine Eltern? Aber sie hätten nicht geläutet sondern den Schlüssel benützt.
Er lief zur Tür, linste durch den Spion.
Mach niemandem auf, wenn du alleine bist. Vergewissere dich, wer vor der Tür steht.
Es waren nicht Mama und Papa, sondern die Nachbarin, Frau Rotter. Und ein Polizist.
„Jonathan? Bist du da?“ Frau Rotters Stimme klang seltsam dünn. Aber vielleicht lag das auch daran, dass sie durch die Tür sprach.
Er öffnete.
Irgendetwas stimmte nicht. Er konnte es an ihren Gesichtern sehen.
Frau Rotter legte die Hand auf seine Schulter. Das hatte sie noch nie gemacht. Jonathan wich ein wenig zurück.
„Dürfen wir hereinkommen?“ Der Polizist musterte ihn ernst.
Jonathan nickte und führte sie in die Küche.
Schon wieder sahen sie ihn so merkwürdig an.
Der Polizist räusperte sich. „Jonathan. Du musst jetzt ganz stark sein. Es – es ist etwas sehr, sehr Schlimmes geschehen.“
„Was?“ Er verstand nicht.
„Deine Eltern sind doch weggefahren, nicht wahr?“
„Ja. Sie – sie sollten eigentlich schon hier sein.“
Werden sie mir jetzt sagen, dass sie nicht mehr wiederkommen?
Nein – das kann nicht sein. Ich habe das doch nicht ernst gemeint.
In Jonathans Hals saß plötzlich ein dicker Kloß. Er schluckte krampfhaft, aber der Kloß verschwand einfach nicht.
„Was ist mit Mama und Papa?“ Seine Stimme hörte sich fremd an.
„Sie hatten einen Unfall mit dem Auto. Die Straße war nass und dein Vater konnte nicht mehr schnell genug bremsen.“
Jonathan schluckte krampfhaft. Der Kloß wanderte in seinen Magen, ballte sich dort zusammen. „Haben – haben sie sich wehgetan?“
Der Polizist und Frau Rotter schüttelten den Kopf. „Nein“, sagte der Polizist. „Es tut mir so leid. Sie – sie sind gestorben. Es ging ganz schnell. Niemand konnte mehr etwas für sie tun.“
Der Kloß explodierte und breitete sich heiß in seinem ganzen Körper aus. „Das – das – glaube – ich – ich nicht“, hörte er sich selbst stammeln.
Frau Rotter legte wieder die Hand auf seine Schulter, aber er spürte es nicht. Sein ganzer Körper war taub und in seinem Kopf herrschte dunkle Leere.
Eine Woche später
Die Scheibenwischer des kleinen Fiats vermochten die strömenden Wassermassen kaum mehr zu bewältigen. Jonathan folgte ihren Bewegungen mit den Augen, bis er schwindlig wurde und die Augen schließen musste. So viel Regen. Vielleicht so viel, dass Frau Papst auch einen Unfall hatte und er dann auch sterben konnte. So wie Mama und Papa.
Die Frau vom Jugendamt, die das Auto lenkte, starrte konzentriert in die regennasse Dämmerung hinaus. Die Stille lastete schwer auf dem Jungen.
Vor einer Ewigkeit waren sie losgefahren. Nach Kirchweg, zu Onkel Paul und Tante Mina.
Seine neue Familie.
„Sie wohnen in einem kleinen Haus mitten im Grünen“, sagte Frau Papst vom Jugendamt. „Sie haben einen Sohn namens Sebastian, der zwölf ist, also zwei Jahre älter als du. Das ist doch schön. Dann hast du einen Spielkameraden und du bist nicht mehr allein. Und jetzt sind Osterferien, du hast also noch Zeit, dich einzugewöhnen, bevor die Schule wieder anfängt.“
Das alles erzählte Frau Papst bestimmt schon zum dritten Mal, während sie ihr Auto durch den Stadtverkehr lenkte und die vertraute Umgebung aus Jonathans Blickfeld verschwand.
„Leider kann dich deine neue Familie nicht abholen“, sprach sie weiter. „Onkel Paul kommt erst sehr spät von der Arbeit nach Hause und Tante Mina kann nicht Auto fahren.“
Er kannte Tante Mina und Onkel Paul nicht, hatte sie nie gesehen. Sie waren nicht einmal zum Begräbnis seiner Eltern gekommen.
Familienzwist, hatte Papa gesagt.
Jonathan wusste nicht, was das bedeutete. Aber es musste etwas Schlimmes sein, so wie er dabei ausgesehen hatte. Und Onkel Paul hatte Mamas Briefe einfach zurückgeschickt, ohne sie zu lesen.
Während der Fahrt warf Frau Papst ihm ab und zu mitleidige Blicke zu. Jonathan tat so, als würde er sie nicht bemerken, starrte einfach auf die Straße und umklammerte den Käfig auf seinem Schoß, in dem sich Micky befand. Das Tier duckte sich furchtsam in eine Ecke.
Er hätte am liebsten mit Micky gezittert, aber er versuchte, sich nichts anmerken zu lassen.
Du musst jetzt tapfer sein.
Alle hatten das gesagt. Immer und immer wieder. Also versuchte er es.
Je weiter sie fuhren, desto mehr wurde ihm bewusst, dass er kein Zuhause mehr
hatte.
Vater und Mutter gibt es nicht mehr. Sie sind tot. Gestorben bei einem Autounfall. Es ist meine Schuld. Schließlich habe ich mir gewünscht, dass sie verschwinden sollen.
Nur wegen dem blöden Fahrrad!
Gott ist bestimmt jetzt böse auf mich. Weil ich meine Eltern weggewünscht habe. Gott weiß alles und er hat mich bestraft.
Er lässt mich nicht sterben. Frau Papst fährt ganz langsam.
Es war schon dunkel, als sie das Haus der Klamms erreichten. Sein neues Zuhause lag ziemlich abgelegen auf einem Hügel und Jonathan kam sich nun gänzlich verloren und verlassen vor.
Er zitterte, nicht nur vor Kälte, als er aus dem Auto stieg. Frau Papst holte seinen Koffer aus dem Wagen und läutete an der Tür.
Tante Mina öffnete. Sie war klein und dünn, trug eine bunte Kleiderschürze. Der Geruch von gekochten Kartoffeln drang aus der Küche. Seine Tante reichte ihm eine feuchte, heiße Hand und musterte ihn mit verbissenem Gesichtsausdruck. „Onkel Paul kommt später“, erklärte sie mit leiser Stimme.
Es klang, als wäre sie froh darüber.
Sebastian tauchte auf und starrte ihn neugierig an. Er war mindestens um einen Kopf größer als Jonathan, aber sehr dünn. Sein blasses Gesicht war mit vielen Sommersprossen übersät. Jonathan betrachtete fasziniert seine abstehenden Ohren. Im Licht, das aus der Küche fiel, wirkten sie durchscheinend.
Sebastians blaue Augen musterten ihn. Jonathan mochte diesen Blick nicht, weil er ihm das Gefühl gab, als sähe der große Junge bis in den letzten Winkel seines Körpers. Aber er versuchte, sich nichts anmerken zu lassen. Sebastian hatte sich bereits abgewandt und begutachtete den Inhalt von Jonathans Käfig.
„Oh, eine Maus!“, sagte er lächelnd. Sein Finger bohrte sich durch das Gitter. Micky drückte sich ängstlich in eine Ecke. Ein kleines, weißes Fellbündel, das vor Angst zitterte.
„Sie mag Fremde nicht“, erklärte Jonathan und presste den Käfig schützend an sich.
Tante Mina sagte nichts und warf ihm nur einen ausdruckslosen Blick zu.
Frau Papst strich Jonathan zum Abschied flüchtig über das Haar und das hätte ihn beinahe zum Weinen gebracht. Aber er schluckte die Tränen tapfer hinunter.
Jetzt bin ich ganz allein.
Nach dem Abendessen, das aus Kartoffeln und Spinat bestand, zeigte Tante Mina ihm sein Zimmer. Eine Kammer im oberen Stockwerk, die auf einer Seite noch durch die Dachschräge verkleinert wurde.
Es gab einen Kasten, ein Messingbett und eine Nachtkommode. Eine nackte Glühbirne erhellte nur spärlich das düstere Zimmer.
Jonathan kroch unter die klammfeuchte Decke und starrte auf die Glühbirne, bis seine Augen schmerzten.
„Licht aus!“, fauchte die Stimme Tante Minas vor der Tür. „Wir müssen sparen, jetzt, wo wir noch ein zusätzliches Maul zu stopfen haben!“
Er knipste mit zitternden Fingern das Licht aus. Die Dunkelheit fiel über ihn her wie ein Tier, das seinen dunklen, gefräßigen Schlund aufsperrte, um ihn zu verschlingen.
Er musste doch eingeschlafen sein, denn später weckten ihn laute Stimmen.
Jonathan riss die Augen auf und fand sich im ersten Moment nicht zurecht. Unter der Tür stahl sich ein dünner Lichtfaden in sein Zimmer.
Die Stimmen kamen aus dem Erdgeschoß. Ein Mann und eine Frau. Aber er konnte nicht verstehen, was gesprochen wurde. Die Frau kreischte. Etwas polterte zu Boden. Jonathans Herz klopfte wild. Er zog die Decke über seinen Kopf und lag mit angehaltenem Atem ganz still.
Schwere Schritte stampften die Treppe herauf, eine Tür wurde geöffnet und wieder zugeworfen.
Jetzt dröhnte die Stimme im Zimmer nebenan weiter. Und nun konnte Jonathan auch verstehen, was der Mann – es musste Onkel Paul sein – sagte.
„Dummes Weibsstück. Was stehst du da herum? Steif wie ein Besenstiel!“
Die Antwort Tante Minas war nicht zu verstehen.
Daraufhin hörte Jonathan einen dumpfen Schlag und das unterdrückte Stöhnen Tante Minas.
Mit weit aufgerissenen Augen lauschte er in die Dunkelheit. Am liebsten hätte er sich so winzig klein wie Micky gemacht, um unbemerkt verschwinden zu können.
Aus dem Nebenraum war unterdrücktes Schluchzen zu vernehmen.
„Was flennst du? Das hast du dir nur selbst zuzuschreiben!“ Onkel Pauls Stimme hallte durch die dünne Wand und Jonathan glaubte zu spüren, wie auch die Mauer zitterte.
Wieder hörte er merkwürdige Geräusche. Dumpfes Poltern, ein Rascheln. Jonathan bemühte sich vergeblich, dem Ganzen eine Bedeutung zu geben.
Er schöpfte tief Luft. In seiner Brust pochte ein stechender Schmerz. Zu lange hatte er schon den Atem angehalten. Seine Hände krampften sich um die Bettdecke.
Schließlich hielt er es nicht mehr aus. Krabbelte aus dem Bett, schlich auf die Tür zu, öffnete sie einen Spalt und warf einen Blick auf den Flur.
Vor der Schlafzimmertür kauerte Sebastian. Sein Cousin bemerkte ihn nicht. Der große Junge starrte wie gebannt durch einen Spalt der Tür auf das, was sich darin abspielte.
„Du musst wieder einmal gehörig durchgefickt werden, damit du weißt, wer der Herr im Haus ist!“
Leises Schluchzen.
„Du könntest ruhig ein wenig entgegenkommender sein! Glotz mich nicht so an!“
Onkel Paul keuchte laut.
Sebastian öffnete die Tür noch ein bisschen weiter, um ja nichts zu verpassen.
Jonathan starrte wie betäubt auf seinen Cousin.
Was macht er da? Warum belauscht er seine Eltern? Was tun sie? Und was heißt ficken?
Eine Gänsehaut überrieselte ihn. Es musste auf jeden Fall etwas Schlimmes sein.
Leise schloss er die Tür und schlüpfte in sein Bett zurück. Zog seine Füße an, die sich mittlerweile in eiskalte Klumpen verwandelt hatten.
Aus dem Nebenzimmer war ein rhythmisches Quietschen zu hören, dann leise, unterdrückte Schmerzensschreie.
Jonathan kniff die Augen zu und legte seine Hände auf die Ohren.
Ich will hier weg! Ich will nur hier weg, bitte, bitte!
*****
Am nächsten Morgen wurde er durch die Strahlen der Sonne geweckt, die durch das Fenster fielen.
Minutenlang lag er im Bett und starrte an die Decke. Genau über seinem Kopf war ein Fleck, der aussah wie ein Drache mit riesigem, weit aufgesperrtem Maul.
Der Drache würde ihn verschlingen!
Schnell hüpfte er aus dem Bett.
Sein erster Blick galt Micky. Die Maus huschte unruhig im Käfig umher. Ihm fiel ein, dass er ihr gestern Abend nichts mehr zu fressen gegeben hatte.
Die Klamms waren schon aufgestanden, denn im Erdgeschoß war das Klappern von Geschirr zu hören. Und Onkel Pauls laute Stimme.
Etwas Heißes überflutete Jonathan.
Angst.
Die Tür wurde aufgerissen und er zuckte zusammen. „Komm, los, zieh dich an! Es gibt Frühstück! Wenn du zu spät kommst, kriegst du nichts mehr!“
Sebastian stand auf der Türschwelle, musterte ihn wieder mit diesem durchdringenden, neugierigen Blick. Es war der gleiche Blick, mit dem er gestern Nacht durch den Türspalt in das Schlafzimmer seiner Eltern gesehen hatte.
Jonathan beeilte sich, seine Kleider anzuziehen. Es war ihm peinlich, dass Sebastian ihm dabei zusah, aber der machte keine Anstalten, ihn alleine zu lassen.
„Du hast ja Jeanshosen“, meinte der ältere Junge bewundernd.
Jonathan hielt den Atem an, als Sebastian mit dem Finger über seinen Oberschenkel fuhr. „Ich krieg keine. Die sind zu teuer, die können wir uns nicht leisten. Mama näht meine Hosen. Schade, dass du kleiner bist als ich, sonst könntest du sie mir borgen.“
Jonathan schüttelte sich innerlich. Was für eine merkwürdige Vorstellung! Er würde doch nicht seine Hosen an jemanden verleihen!
Mit klopfendem Herzen folgte Jonathan seinem Cousin die Treppe hinunter in die Küche.
Onkel Paul saß am Tisch. Jonathan starrte ihn überrascht an. Zuerst hatte er geglaubt, er müsse seiner Mutter ähnlich sehen, da er ja ihr Bruder war. Und nach den nächtlichen Geräuschen hatte er sich Onkel Paul als großen, bösen Riesen vorgestellt.
Aber Onkel Paul war nicht so besonders groß und eher hager. Mit seinen dunklen Haaren und den abstehenden Ohren sah er wie ein erwachsener Sebastian aus.
Als Jonathan hinter seinem Cousin die Küche betrat, hob Onkel Paul den Kopf und musterte ihn mit hartem Blick, ohne ein Wort zu sagen.
Tante Mina ging mit steifen Bewegungen zwischen Anrichte und Herd hin und her, stellte Teller auf den Tisch.
„Setzt euch“, sagte sie mit brüchiger Stimme. „Du dahin.“ Ihr dünner Finger wies auf einen Stuhl. Jonathan setzte sich folgsam.
„Hol dir einen Teller“, knurrte Paul.
Mina zuckte zusammen und stöhnte leise. Jonathan dachte daran, was er letzte Nacht gehört hatte.
Onkel Paul hatte Tante Mina wehgetan.
Jetzt fasste der Mann Minas Handgelenk. „Ich meinte nicht dich, dumme Kuh. Der verwöhnte Bengel kann sich sein Frühstück ruhig selber machen.“
Jonathan schluckte. Er warf Sebastian einen hilflosen Blick zu.
„Ich zeig dir, wo du alles findest“, flüsterte sein Cousin.
Jonathan lächelte ihn dankbar an.
Ohne Appetit würgte er unter den wachsamen Blicken der Familie Klamm schließlich ein Häuflein klebrigen Haferbrei hinunter.
„Wirst dich an eine weniger feine Kost gewöhnen müssen. Wir haben nicht so viel Geld wie die Stadtpinkel“, war der abschließende Kommentar von Onkel Paul.
Jonathan starrte ihn verständnislos an.
„Glotz nicht so blöd. Du weißt bestimmt, worum es geht. Deine Mutter war sich ja immer zu fein für uns. Und jetzt hebt eure faulen Ärsche! Ihr könnt euch im Garten nützlich machen!“
Jonathan fand gerade noch genug Zeit, um ein kleines Stück Brot einzustecken und es seiner Maus zu bringen. Schnell schlüpfte er in die Gummistiefel, die Sebastian ihm hinstellte.
Er hatte noch nie so einen riesigen Garten gesehen. Mit offenem Mund starrte er auf die zahlreichen Obstbäume und die vielen Beete.
Ein derber Stoß in den Rücken riss ihn aus seinem Staunen. „Los, komm! Nimm den Spaten. Wir müssen die Beete umstechen“, flüsterte Sebastian. „Und Mama will, dass wir die Kartoffeln setzen.“
Der Kartoffelacker war eine große Fläche brauner Erde, die sich bis zum Waldrand erstreckte. Jonathan erschien sie unendlich, und je länger er die ungewohnte Arbeit tun musste, desto größer kam sie ihm vor.
Bis Mittag hatten die Jungen zwei Reihen geschafft. Sämtliche Muskeln und Knochen in Jonathans Körper schmerzten.
„Los, ab ins Haus – Hände waschen und zu Tisch“, knurrte Onkel Paul. Es waren die ersten Worte, die er an die Jungen richtete, seit sie nach dem Frühstück den Garten betreten hatten.
Es gab Blutwurst mit Bratkartoffeln. Jonathan starrte misstrauisch auf den Teller und stocherte vorsichtig an der Wurst. Die Haut war hart und ließ sich nicht durchstechen.
„Wenn du das nicht magst, nehme ich es.“ Sebastian zog blitzschnell Jonathans Teller weg und kippte ihn über seinen eigenen.
Unter Pauls starrem Blick machte Jonathan sich ganz klein. „Eines sag ich dir“, schnarrte sein Onkel. „Du wirst mit dem vorlieb nehmen müssen, was bei uns auf den Tisch kommt. Ist es dir nicht gut genug, kriegst du eben nichts.“
Jonathan saß ganz still da. Sein Herz hämmerte wild und in seinem Bauch ballte sich wieder dieser große Klumpen zusammen, den er schon so gut kannte. Er hatte jetzt ohnehin keinen Hunger mehr.
Die Klamms beendeten ihre Mahlzeit schweigend.
Als sie die Küche verließen, steckte Sebastian ihm heimlich ein Stück Brot zu. „Dafür hab ich etwas bei dir gut“, flüsterte sein Cousin. Jonathan nickte mechanisch. Der Klumpen in seinem Bauch hatte sich in einen merkwürdig brennenden Schmerz verwandelt, der Tränen in seine Augen stiegen ließ. Er wischte sie verstohlen ab.
Weinen half bestimmt nicht.
Als Jonathan am Abend den Kasten öffnete, um einen Pyjama herauszuholen, waren alle seine Kleider verschwunden. Stattdessen lagen da die Stoffhosen und Hemden, die auch Sebastian trug.
Minutenlang starrte er auf den sorgfältig geschlichteten Stapel, ohne etwas wirklich wahrzunehmen. Dann weinte er doch.
Die Osterferien verbrachten die Jungen fast ausschließlich im Garten. Bis zum Ende der Ferien waren der Kartoffelacker bestellt und die Gemüsebeete zur Bebauung vorbereitet.
Ein Osternest gab es nicht. „Reine Verschwendung, so ein Blödsinn“, knurrte Onkel Paul und warf Jonathan einen finsteren Blick zu. Auch zur Kirche gingen sie nicht. „Die ziehen einem nur das schwer verdiente Geld aus der Tasche“, war Onkel Pauls Kommentar dazu.
Tante Mina hatte genau zehn Eier gefärbt. Die teilten sie auf. Jonathan bekam nur eines. „Zehn lässt sich nun einmal nicht gut durch vier teilen“, grinste Sebastian und biss in sein drittes Ei. Über Tante Minas Gesicht huschte ein verzerrtes Lächeln.