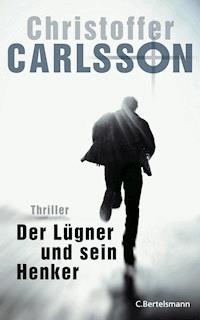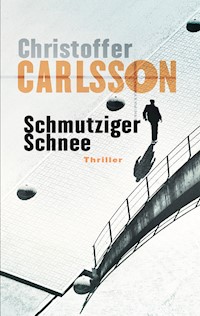
7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Finster, packend und hochaktuell - Leo Junker ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein Soziologe, der über politische Randgruppen geforscht hat, wird ermordet in einem Stockholmer Hinterhof gefunden. Leo Junker entdeckt, dass das Opfer Hinweise auf ein drohendes Attentat erhalten hatte. Kurz darauf wird ihm der Fall grundlos entzogen und dem schwedischen Geheimdienst übergeben. Leos ist alarmiert: Das kann nur bedeuten, dass die Ermittlungen manipuliert werden sollen. Das weckt Leos Ehrgeiz: Er setzt alles in Bewegung um herauszufinden, warum der Soziologe wirklich sterben musste. Und wie man in letzter Sekunde das bevorstehende furchtbare Attentat verhindern kann …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 498
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Christoffer Carlsson
SCHMUTZIGER SCHNEE
Thriller
Aus dem Schwedischen von Susanne Dahmann
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte dieses E-Book Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung dieses E-Books verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2014
unter dem Titel Den fallande Detektiven
bei Piratförlaget, Stockholm
1. AuflageCopyright © 2014 by Christoffer CarlssonCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2016beim C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbHUmschlag: buxdesign | MünchenSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-16345-7
www.cbertelsmann.de
Für Mela,immer
Willard: They told me that you had gone totally insane, and that your methods were unsound.Kurtz: Are my methods unsound?Willard: I don’t see any method at all, sir.
Apocalypse Now
ES WAR DER WINTER, in dem der Sturm tobte.
Ein Wissenschaftler starb, ein Diktafon wanderte von Hand zu Hand durch Stockholm, und wo immer es landete, schien es Probleme zu verursachen. Eine Demonstration lief aus dem Ruder, und zwei, die einmal Freunde waren, trafen sich an den Schaukeln, wo sie als Kinder immer gespielt hatten.
Auf dem Grund des Mälar-Sees ruhte ein Handy, das für die Ereignisse von keinerlei Bedeutung war, wenn man davon absah, dass es von dem Schuldigen ins Wasser geworfen worden war. In einem Krankenhausbett lag ein Mann im Sterben, und seine letzten Worte waren Semosund und Esther. Was immer das bedeutete. Das wurde erst klar, als es zu spät war. Und die ganze Zeit über tickte die Uhr auf den Nullpunkt zu, jenen 21. Dezember.
Es war eine seltsame und komplizierte Geschichte, darüber waren sich hinterher alle einig. Aber war sie das tatsächlich? Vielleicht war sie in Wirklichkeit sehr einfach, geradezu banal, denn dies war auch der Winter, in dem ein Mann einen anderen verriet, und das war wohl der Anfang vom Ende.
Soweit wir wissen, trug sich das Ganze so zu:
IWho comes around on a special night?
12. 12.
NUR EINES IST SICHER: Die Stadt hat Angst. Jetzt hat sie ihr wahres Gesicht gezeigt, davon bin ich überzeugt. Man kann es an ihrem Puls hören, wenn man ganz nah herangeht und es wagt, das Ohr daran zu legen, und wenn man wirklich horcht, wie sie tickt. Angespannt und nervös ist sie, unberechenbar. Eine Glühbirne, die zu flackern begonnen hat, um dann irgendwann ganz zu verlöschen, doch niemand bedenkt das. Niemand sieht es.
Nur eine einsame Kirchenglocke läutet. Es ist Mitternacht, und der Schnee fällt leicht und sacht. Das Licht der kalten Straßenlaternen lässt die Flocken silbern funkeln. Aus einem Club in der Nähe wummert ein schwerer Bass, jemand singt: Oh, I wish it could be Christmas every day, und ein Stück entfernt kreischen Autobremsen. Der Fahrer stemmt sich auf die Hupe.
Eine der Gassen, die von der Döbelnsgatan abgehen, ist klein und eng. Wenn man die Arme ausstreckt, kann man fast auf beiden Seiten die abgestoßenen Ziegelsteinfassaden berühren, so schmal ist sie. Und dunkel. Hier im Stadtzentrum wachsen die Häuser in die Höhe, und es ist lange her, dass der löchrige Asphalt von Sonnenstrahlen erreicht wurde.
Die kleine Gasse führt auf einen größeren Hinterhof. Entlang der Hauswände drängen sich dunkelgrüne, von einer dünnen Schneeschicht bedeckte Plastikcontainer voller Müll.
Wenn man den Blick hebt, kann man oben, eingerahmt von den Häusern, ein Stückchen Himmel erkennen.
Eine Frau in einem hellblauen Overall errichtet sorgfältig ein großes weißes Zeltdach über einem Teil des Hinterhofs. Unter dem Zeltdach liegt ein Mann auf dem Rücken. Er trägt einen aufgeknöpften dicken Mantel, einen Strickschal, dunkelgraue Jeans und schwarze Stiefel. Vier starke weiße Scheinwerfer beleuchten ihn. In der Nähe liegt ein abgenutzter Fjällräven-Rucksack, aus dessen offenem Maul Besitztümer quellen, ein Buch, ein Kreditkartenetui, ein Paar dicker Socken, ein Schlüsselbund, etwas Bargeld. Der Mann hat Handschuhe getragen, sie ragen aus den Manteltaschen.
Er ist zwischen dreißig und vierzig Jahre alt, hat dunkle, ordentlich gekämmte und kurz geschnittene Haare, ein paar Tage alte Bartstoppeln und eckige Gesichtszüge. Seine Augen sind geschlossen, sodass man seine Augenfarbe nicht feststellen kann, aber das ist im Moment wahrscheinlich auch zweitrangig.
Ich warte mit den Händen in den Manteltaschen ein Stück vom Zelt entfernt und stampfe mit den Füßen, als wäre ich ungeduldig. Eigentlich ist mir aber hauptsächlich kalt. Hoch oben in einem der zum Hinterhof weisenden Fenster leuchtet ein roter Weihnachtsstern, groß wie ein Autoreifen. Dahinter ist ein Gesicht zu erkennen. Ein Junge.
»Steht der schon lange da?«
Die Frau in dem blauen Overall, Victoria Mauritzon, hockt vor ihrer Tasche und ist gerade dabei, sie aufzuklappen. Sie dreht sich um.
»Wer?«
Um die Hände warm zu halten, behalte ich sie in den Taschen und deute mit einem Nicken zum Fenster hinauf.
»Der Junge.«
Mauritzon folgt meinem Blick.
»Ah.« Sie sieht mit zusammengekniffenen Augen in das Schneetreiben. »Weiß ich nicht.«
Mauritzon wendet sich wieder ihrer Arbeit zu. Sie hebt eine Kamera hoch, justiert etwas an ihren Reglern und macht dann achtundsechzig Fotos von dem Toten und der Welt um ihn herum.
Blaulicht schlägt stumm gegen die Hauswände, und ganz weit hinten flattert blau-weißes Absperrband. Ein paar Passanten sind stehen geblieben und beobachten die Szenerie in der Hoffnung, etwas zu sehen zu bekommen. Hier und da flammen Blitze von Handykameras auf.
Mauritzon hat den Fotoapparat in die Tasche zurückgelegt und dann vorsichtig ein digitales Thermometer in das Ohr des Toten gesteckt. Nach zwei Minuten zieht sie es wieder heraus, liest es ab und schreibt etwas in das Formular.
»Alles sehr frisch«, sagt sie.
»Wie frisch?«
»Eine Stunde, vielleicht nicht einmal das. Ich bin nicht so sicher wie sonst. Die Messmethode lässt nur eine grobe Schätzung zu, aber ich habe die anderen Instrumente nicht mitnehmen können.«
»Wie ist er gestorben?«
»Keine Ahnung. Aber tot ist er.«
Ich trete vorsichtig unter das Zeltdach und gehe bei dem Rucksack in die Hocke. Mauritzon reicht mir ein paar Latexhandschuhe, und ich nehme widerwillig die Hände aus den Taschen. Die Handschuhe machen meine Hände blasser und lassen die Finger noch knochiger wirken, als sie sind.
Eine Übelkeit wächst in mir an, die Hitze steigt am Rücken hoch und wird zu kaltem Schweiß. Ich hoffe, Mauritzon bemerkt es nicht.
»Er sieht gepflegt aus«, sagt sie mit einem Blick auf den Toten. »Nicht direkt von der Sorte, die man in einem Hinterhof zu finden erwartet.«
»Vielleicht wollte er jemanden treffen.«
Ich nehme das Kartenetui. Es ist schwarz, aus Leder und gefüllt – eine Kreditkarte, ein Ausweis, irgendeine Schlüsselkarte und eine weiße Visitenkarte mit einem schnörkeligen blauen Muster und ebenso blauen Buchstaben: UNIVERSITÄT STOCKHOLM. Ich ziehe den Ausweis heraus und schlucke zweimal, um die Übelkeit zu unterdrücken.
»Thomas Markus Heber.« Ich vergleiche das Foto mit seinem Gesicht. »Das scheint er zu sein. 1978 geboren.«
Mit dem seltsamen Gefühl, dem Toten etwas zu stehlen, notiere ich die Personennummer, ehe ich die Ausweiskarte in das Kartenetui zurückstecke und mich den anderen Gegenständen zuwende, die aus dem Rucksack gefallen sind. Der Schlüsselbund verrät nicht mehr, als dass der Tote offenbar kein Auto besessen hat. Drei Schlüssel, einer zu seiner Wohnung, einer, den ich nicht direkt identifizieren kann, der aber wahrscheinlich zu seinem Arbeitsplatz gehört, und ein Fahrradschlüssel.
Fred Vargas’ Roman Es geht noch ein Zug von der Gare duNord in der englischen Ausgabe ist auch aus dem Rucksack gerutscht. Der Umschlag ist leicht abgenutzt, und in der Mitte des Buches ist ein Eselsohr eingefaltet. Ich schlage die Seite auf, und mein Blick fällt auf den Satz in der ersten Zeile.
Can’t think of anything to think.
ICH ÜBERDENKE DIE AUSSAGE des Satzes, ehe ich das Buch wieder zuklappe, es zurücklege und aufstehe. Es ist mein zwölfter Tag zurück im Dienst, der zweite mit Nachtschicht.
Die Frage ist, was zum Teufel ich hier mache.
Das für die Innenstadt und Norrmalm zuständige Gewaltdezernat wird im Polizeijargon »Die Schlangengrube« genannt. Durchgeknallte Leute, die schlagen, treten, mit Messern stechen und einander erschießen, Drogenabhängige und Dealer, die mit Kugeln im Genick in Kellerräumen gefunden werden, Frauen, die Männer totschlagen, und Männer, die Frauen totschlagen, Waffen- und Drogenlieferungen, die den Besitzer wechseln, Aufläufe, Demonstrationen, illegale Autorennen und in Brand gesetzte Fahrzeuge. Das ist die Schlangengrube. Und jetzt dies hier – ein gut gekleideter Mann mittleren Alters, der in einem Hinterhof stirbt. Niemand ist sicher.
Formell sollte ich noch bis zum Jahreswechsel kaltgestellt sein. Eher schien eine Rückkehr in den aktiven Dienst undenkbar, nach dem, was Ende des Sommers geschehen war. Möglicherweise war es ein Gespräch mit dem Psychologen, das die Situation verändert hat.
Der Psychologe ist einer von der Sorte, die ihre Patienten nach deren Geldbeutel aussuchen, und ich hatte schon lange aufgehört, eine lukrative Investition zu sein. Die stundenlangen Sitzungen waren davon bestimmt, dass ich entweder in Tränen ausbrach oder in tiefes Schweigen versunken dasaß und, obwohl es nicht gestattet war, Zigaretten rauchte. Der Psychologe wirkte meist gelangweilt, betrachtete im Spiegel hinter mir sein sonnengebräuntes Gesicht und fuhr sich mit der Hand durch das gepflegte Haar.
»Wie läuft’s mit dem Sobril?«, fragte er.
»Gut. Ich versuche, weniger zu nehmen.«
Sein Blick hellte sich auf. »Gut, Leo.« Er schrieb etwas auf sein Papier. »Gut, ja, das ist gut. Ein riesiger Fortschritt.«
Kurz darauf war der Psychologe der Ansicht, dass ich seine Hilfe nicht mehr benötigte. Also durchlief ich einige Tage später eine lachhaft oberflächliche Gesundheitsuntersuchung, und derjenige, der mich untersuchte, sah keinen Grund, warum ich nicht wieder dazu übergehen sollte, dem Rechtswesen zu dienen.
Möglicherweise lag das daran, dass ich nichts von den Albträumen erzählt hatte und auch nichts von den sporadischen Halluzinationen. Nichts von dem seltsamen Impuls, manchmal ein Glas an die Wand knallen oder einen Stuhl zerschlagen oder jemanden ins Gesicht prügeln zu wollen. Aus irgendeinem Grund hat auch niemand danach gefragt, und hätte es einer getan, hätte ich auch nicht die Wahrheit gesagt. Wenn ich etwas gelernt habe, dann, dass es nicht schwer ist, sich innerhalb der Polizei frei zu lügen.
Die Abteilung Interne Ermittlungen kam natürlich nicht in Betracht, wenn man bedachte, was geschehen war, doch ich hätte vielleicht wenigstens mit einem Schreibtischjob irgendwo anfangen können, beim Einbruchsdezernat oder bei der Sitte. Irgendwo in der staubigsten Ecke der Bürokratie, wo ich keinen großen Schaden anrichten konnte. Aber nein.
Ich musste natürlich wieder in der Schlangengrube landen, wo ich dereinst von Levin aufgesammelt worden war. Die Landespolizeileitung hat mehr Geld und Leute in den Distrikt gepumpt, und vielleicht bin ich deshalb hier. Die vergrößerten Ressourcen bewirken jedoch, soweit wir es sehen, nicht viel. Man sagt, der Lärm der Großstadt könne die Menschen wahnsinnig machen, und am allerwahnsinnigsten werden diejenigen, die sich an der Quelle des Lärms befinden, im Herzen der Stadt. Das ist kein Geheimnis. Alle, die irgendwann einmal ihre Brötchen in der Schlangengrube verdient haben, wissen das.
ICH ZIEHE DIE LATEXHANDSCHUHE aus. Der Junge steht immer noch dort oben, halb von dem großen leuchtenden Stern verdeckt. Sechs, vielleicht sieben Jahre alt, nicht mehr, mit großen Augen und dunklem, lockigem Haar. Ich hebe die Hand zum Gruß und bin erstaunt, als er es mir ausdruckslos nachtut.
»Jemand sollte mit ihm reden.«
»Mit wem?«, fragte Mauritzon.
»Mit dem Jungen.«
»Die werden schon irgendwann zu ihm kommen.«
Mauritzon hat recht. Es ist spät, und die meisten Fenster, die zum Hinterhof zeigen, sind dunkel, doch nun, da die Leute von meinen Kollegen, die von Tür zu Tür gehen, geweckt werden, leuchten immer mehr Lichter auf.
Ich selbst nehme eine Sobril-Tablette aus der Innentasche des Mantels, die erste seit Beginn der Schicht. Sie ist klein und rund wie das O auf einer Tastatur.
Allein sie zu sehen, zu halten, lässt mir das Wasser im Mund zusammenlaufen, und ich spüre, wie das Schwitzen nachlässt. Ich ahne schon das Gefühl, langsam in Watte gewickelt zu werden und zu spüren, wie die Welt wieder ihre richtigen Proportionen annimmt. Ich halte die Tablette auf der Handfläche, dann lege ich sie diskret wieder in die Innentasche zurück und bereue sogleich, sie nicht in den Mund genommen zu haben.
»Wo ist sein Handy?«, frage ich und merke, dass meine Stimme unnatürlich belegt klingt.
»Das von dem Toten? Keine Ahnung. Vielleicht liegt er drauf. Ich müsste ihn mal umdrehen, will seinen Rücken sehen.«
Sie winkt zwei uniformierte Assistenten zu sich heran. Die beiden sind zehn Jahre jünger als ich und zittern, vielleicht vor Kälte. Sie gibt ihnen Latexhandschuhe, und dann drehen sie die Leiche vorsichtig herum, sodass Mauritzon den Rücken und die Rückseite der Beine betrachten kann.
Unter Thomas Hebers Körper ist der Boden rotbraun. Das Blut hat den Schnee geschmolzen und in einen dunkelroten, bräunlichen Matsch verwandelt.
»Seltsam, dass nur so wenig Blut da ist«, sage ich.
»Das ist die Kälte«, murmelt Mauritzon.
Sie untersucht die nasse Rückseite des Mantels.
»Dadurch ebben die Körperfunktionen schneller ab.«
Sie runzelt die Stirn. »Da haben wir etwas.«
Ein deutlicher Schnitt im Rücken, auf der Höhe des Herzens.
»Von einem Messer?«
»Sieht so aus.« Sie wendet sich an die beiden Assistenten. »Dreht ihn wieder um, aber vorsichtig.«
»Und holt Gabriel Birck«, füge ich hinzu.
»Hat der nicht frei?«, fragt einer der Assistenten.
»Doch, theoretisch schon.«
»Kann es dann nicht bis morgen warten?«
Ich sehe von Thomas Hebers Leiche zu den Assistenten. Meine Übelkeit kehrt zurück, und der Puls steigt. Die Angst kommt angekrochen, Wesen aus der Unterwelt erheben sich und greifen nach mir.
»Was glaubst du denn?«, bringe ich heraus. »Wir brauchen einen Ermittlungsleiter.«
Der Assistent sieht seinen Kollegen an. »Mach du es«, sagt er.
»Er hat aber dich gebeten, es zu tun.«
»Jetzt macht einfach«, keuche ich und merke, wie die Hinterhofwände um uns immer näher kommen, Wände, die im Begriff sind, einzustürzen und mich zu erschlagen.
Die Assistenten gehen mit einem Seufzer davon. Mauritzon wendet sich wieder ihrer Untersuchung zu. Im Klub in der Nähe singt jemand: Oh, what a laugh it would have been if daddy had seen mommy kissing Santa Claus that night, und Mauritzon summt mit.
Vielleicht ist es der Klub und der Gedanke an Alkohol, der bewirkt, dass mich nun ein Schwitzen überfällt, dass der Schweiß sich nur so aus den Poren drängt und es mir den Atem nimmt. Mit eiligen Schritten gehe ich vom Fundort der Leiche weg, hinaus aus der Gasse und auf die Döbelnsgatan, und ich weiß nicht, wie viel andere davon bemerken, aber ich habe das Gefühl zu stolpern, zu schwanken, und bald ringe ich nach Atem. Luft, ich kriege keine Luft mehr.
Mir wird schwarz vor Augen, und irgendwo zwischen dem Toten und der Absperrung stütze ich mich an der Wand ab. Der Ziegelstein ist kalt und hart, aber diese Stütze ist das Einzige, was mich daran hindert zu fallen, und dann stülpt sich mein Magen um, und ich klappe vornüber. Aus dem Hals und dem Mund schießen die Reste eines halb verdauten Würstchens, Brot und Kaffee, alles in einer übel riechenden Mischung, die mit einem platschenden Laut auf den gefrorenen Schnee klatscht.
Die Muskeln geben nach, und ich sinke auf die Knie, spüre die Kälte durch die Jeans bis in die Oberschenkel aufsteigen, doch es ist nur ein vages Gefühl, das vom Schweiß, von dem Zittern, dem Kratzen im Hals und von der Überzeugung überlagert wird, dass das Leben auf diese Weise zu Ende gehen wird.
»Mord kann offensichtlich auch abgebrühte Menschen hart anpacken«, höre ich in einiger Entfernung einen der Assistenten sagen.
Die Blitzlichter der Fotografen flammen auf. Ich schließe die Augen nicht, aber sie tränen vom Würgen. Ich sehe alles verschwommen. Es brennt im Hals, der Magen krampft.
Mit der einen Hand an der Ziegelsteinmauer und der anderen suchend in der Innentasche des Mantels erhebe ich mich. Das ist nicht der erste Anfall dieser Art. Wann habe ich zuletzt eines genommen? Das muss ein oder zwei Tage her sein. Wirklich nicht länger? Ich falle immer noch, immer tiefer, in mich selbst hinein.
Es ist nicht die Stadt, die Angst hat, nicht Stockholm ist eine flackernde Glühbirne. Ich bin es.
DIE TÜR IST SCHWER und kalt, auf dem Briefkasten steht THYRELL. Ich führe einen zitternden Zeigefinger in Richtung Klingelknopf, ehe ich mich entschließe, doch lieber zu klopfen. Kinder haben so etwas Unvorhersagbares, das mich nervös macht.
Mir ist schwindlig, aber das Sobril scheint zu wirken und bettet mich allmählich in einen leichten Nebel. Meine Knie sind immer noch weich, doch der kalte Schweiß trocknet und lässt die Haut spannen. Kaum dass ich den Fingerknöchel auf das Holz gesetzt habe, höre ich schon von drinnen Bewegungen, als hätte dort jemand auf mich gewartet. Das Schloss wird mit einem Klicken geöffnet, und die Tür gleitet vorsichtig auf.
Es ist ein dünner kleiner Junge mit tief liegenden Augen, der so bleich ist, dass mir seine Haut zunächst wie durchsichtig erscheint.
»Ich bin krank«, sagt er.
»Okay. Kein Problem.«
»Lungenentzündung«, erklärt der Junge langsam, als ob das Wort große Anstrengung erfordern würde.
»Wie heißt du?«
»John. Und du?«
»John. Das ist ein guter Name. Ich heiße Leo und bin Polizist. Ist deine Mutter oder dein Vater zu Hause?«
»Papa ist verreist.«
Irgendwo hinter dem Jungen geht eine Tür auf, und eine verschlafene Frau in meinem Alter kommt heraus. Sie trägt ein Nachthemd mit einem ausgewaschenen Bob-Dylan-Porträtaufdruck.
»John, hast du die Tür aufgemacht?«, fragt sie und legt die Hände auf seine Schultern. »Worum geht es?«
»Es ist …« Ich zögere. »Ich bin Polizist. Unten im Hinterhof ist etwas passiert, und es könnte sein, dass John es gesehen hat. Ich würde gern mit ihm sprechen.«
»Darf ich Ihren Ausweis sehen?«
Ich zeige ihn ihr.
»Müssen Sie jetzt mit ihm reden?«
»Am liebsten ja.«
John schürzt die Lippen, als würde er die Vor- und Nachteile, einen unbekannten Mann in seine Wohnung zu lassen, gegeneinander abwägen. Schließlich tritt er zur Seite.
»Du musst die Schuhe ausziehen«, sagt er.
»Na klar. Wie alt bist du, John?«
»Er ist sechs«, sagt die Frau.
Sie stellt sich als Amanda Thyrell vor. Ihre Hand ist warm.
Die kleine Diele ist kurz und schmal, sie führt zu einem größeren Wohnzimmer, und auf dem Weg dorthin komme ich an einer Küche und der halb offen stehenden Tür zum Elternschlafzimmer vorbei. Ich stelle mich neben den großen Weihnachtsstern, der klar und rot auf dem Fensterbrett leuchtet.
»Was hat er denn gesehen?«, fragt sie.
»Als du mich da unten gesehen hast, John, als wir uns zugewunken haben, da hast du doch hier am Fenster gestanden, oder?«
»Ja.«
»Was hat er gesehen?«
Amanda tritt ans Fenster, blickt auf den Hinterhof hinunter, schnappt dann nach Luft und schlägt die Hand vor den Mund.
»Mein Gott.« Sie fragt John, ob es ihm gut gehe. Ob er wirklich mit mir reden könne.
»Ich kann.«
»In Ordnung. Ich werde …« Sie sammelt sich. »Ich denke, ich werde ein wenig Tee machen. Glaube ich. Willst du Tee, John?«
Er zuckt mit den Schultern, und sie geht schwankend aus dem Zimmer.
Ich lege die Hände auf die Oberschenkel und beuge mich vor, um die Welt von weiter unten zu betrachten, so wie er sie gesehen haben muss. Selbst von hier aus hat man einen guten Überblick über den Hinterhof und schräg unter das Zeltdach hinein, in dem Mauritzon gerade dabei ist, dem Toten vorsichtig die Schuhe auszuziehen. Um die Leiche bewegen sich jetzt mehrere Personen, und Mauritzons Körpersprache verrät, dass ihr das nicht gerade gute Laune bereitet.
»Du riechst«, sagt der Junge.
»Ehrlich?«
»Du riechst nach Kotze.«
»Das ist meine Jacke. Als Polizist begegnet man vielen, die kotzen, und manchmal schafft man es nicht schnell genug weg.«
»Aber deine Augen.« Der Junge kneift selbst misstrauisch die Augen zusammen. »Die sind rot.«
»Ich habe lange nicht geschlafen.«
John wägt den Wahrheitsgehalt meiner Aussage ab, ehe er die Sache auf sich beruhen zu lassen scheint.
»Jemand liegt da unten.«
»Ja.« Ich erhebe mich wieder. »Ja, so ist es.«
»Er ist tot, oder?«
»Ja.«
Ich suche nach einer Sitzgelegenheit und entdecke neben einem niedrigen Glastisch einen großen Ledersessel. Als ich mich auf einer der breiten Armlehnen niederlasse, hustet John heftig und heiser. Die Lungen gurgeln wie ein verstopfter Abfluss, und der Junge zieht vor Schmerz eine Grimasse und wird rot im Gesicht.
Amanda scheint vergessen zu haben, weshalb sie in die Küche gegangen ist, oder sie hat es sich auf dem Weg dorthin anders überlegt. Jedenfalls kommt sie mit einem Glas Wasser zurück, stellt es auf den Tisch und setzt sich dann aufs Sofa, wo sie sich eine Decke über die Beine breitet.
»Ich möchte gern dabei sein.«
»Selbstverständlich.« Ich sehe zum Fenster. »Du hast mich da unten gesehen John, oder?«
»Ja.«
»Wie lange hast du hier gestanden?«
Der Junge verschränkt die Arme.
»Eine Weile. Nicht so lang.«
»Kannst du mir erzählen, was du gesehen hast, als du ans Fenster kamst? Was da unten passiert ist?«
»Nichts ist passiert.«
»Es war niemand da?«
Er schüttelt den Kopf.
»Aber dann kam einer«, erklärt er.
»Wann?«
John hustet wieder, diesmal weniger heftig.
»Du willst die Uhrzeit wissen, aber ich kann die Uhr noch nicht lesen.«
»Das stimmt, ich will die Uhrzeit wissen.« Ich zögere. »Aber das ist kein Problem. Wer ist da in den Hinterhof gekommen?«
»Ein Typ. Der jetzt da unten liegt.«
»Woher weißt du, dass er es war?«
»Weil ich es glaube.«
Ich unterdrücke ein Seufzen. Kinder.
»War er allein?«
»Ja.«
»Was ist dann passiert?«, frage ich.
»Ich weiß nicht genau. Ich musste aufs Klo, und als ich zurückkam, lag er da, wo er jetzt liegt.«
»War er da auch allein?«
»Nein. Da stand einer bei ihm und machte was mit seinem Rucksack.«
»Kannst du beschreiben, wie der aussah?«
John denkt nach.
»Schwarze Kleider.«
»War er groß oder klein?«
John betrachtet mich von oben bis unten.
»So wie du ungefähr.«
»Was für eine Haarfarbe hatte er, hast du das gesehen?«
»Nein. Er hatte eine Mütze auf.«
»Hatte er so eine Mütze, die man übers Gesicht zieht?«
Die Frage bringt den Jungen zum Lachen, gluckernd und dunkel, ein angenehmer Laut, der in meinem Magen einen Klumpen Wärme aufgehen lässt. Das Lachen geht in Husten über, und Johns Gesicht wird wieder rot.
»Trink Wasser, mein Herz«, mahnt Amanda.
Ich halte ihm das Glas hin. Er nimmt einen Schluck. Dabei verzieht er das Gesicht, als würde es wehtun.
»Nein«, sagt er. »Solche Mützen hat man doch nicht.«
»Als du zurückkamst, stand also jemand da unten bei dem Typen und hat in seinem Rucksack gewühlt.«
»Ja.«
»Hat er was gefunden?«
»Ich hab nicht gesehen, was es war.«
»Aber er hat was gefunden.«
»Ja. Dann ist er verschwunden.«
»In welche Richtung?« Ich zeige aus dem Fenster und lasse den Jungen meinem Finger mit dem Blick folgen. »In die Richtung oder in die?«
»Die erste.«
In die Innenstadt zurück.
»Und dann«, erzählt der Junge weiter, »ist der andere auch verschwunden.«
»Der andere? Der Typ, der da unten liegt?«
»Nein. Der, der sich versteckt hatte.«
»Da unten war eine Person, die sich versteckt hatte?« Ich recke den Daumen hoch. »Erst war da der, der jetzt im Hof liegt.«
Der Junge nickt. Ich halte den Zeigefinger hoch.
»Dann war da der, der im Rucksack gewühlt hat.«
John nickt wieder. Ich strecke den Mittelfinger aus.
»Und dann war da noch einer.«
»Ja.« John sieht zufrieden aus. Ihm ist die schwierige Aufgabe gelungen, einen Erwachsenen dazu zu bringen, etwas zu kapieren. »Genau.«
»Der Letzte, war das ein Typ oder ein Mädchen?«
»Weiß ich nicht.«
»Wie waren die Haare? Lang oder kurz?«
»Das hab ich nicht gesehen.«
»Und wo hat die Person sich versteckt?«
»Hinter einer der grünen Kisten. Als der, der im Rucksack gewühlt hat, weggegangen ist, ist der andere rausgekommen und dann verschwunden.«
»Wie hat sich die Person bewegt? Schnell oder langsam?«
»Sehr schnell.«
»Geschmeidig? Ich meine, wirkte er linkisch?«, füge ich hinzu, damit mich der Junge versteht. »Ist er gerade oder schräg gegangen, ist er gefallen oder gestolpert oder so?«
John schüttelt den Kopf.
»Er ist einfach gegangen.«
»Aber es war auf jeden Fall ein Mann, oder?«
»Nein, das weiß ich nicht. Das konnte ich nicht sehen. Du sagst immer ›er‹.«
Der Junge hat recht, und ich frage nichts mehr. Stattdessen trete ich ans Fenster. Die starken Scheinwerfer, die den Toten anstrahlen, blenden. Es sieht aus, als würde Mauritzon ihm gerade eine Pediküre verabreichen.
»Hast du die ganze Zeit allein hier gestanden?«
»Ja.«
»Sie sind nicht aufgestanden?«, frage ich Amanda.
»Nein.«
Sie wirkt, als hätte ich sie beleidigt.
»War nicht so gemeint.« Sie antwortet nicht, und ich wende mich erneut dem Jungen zu. »Gut, John. Danke für die Hilfe. Du hast mir wichtige Sachen gesagt, die uns echt weiterbringen können.«
»Er ist tot«, sagt der Junge wieder. »Der da unten liegt.«
»Das stimmt. Das können wir auf jeden Fall schon mal sicher sagen.«
Durch das Licht des Weihnachtssterns verschwimmt der Hintergrund, und der Schnee, der draußen in der Dezembernacht fällt, wird zu einer dunklen, schwarzgrauen Masse.
»Gehst du jetzt?«, fragt der Junge.
»Ich denke ja.«
»Dann gutes Lucia-Fest.« Sein Blick gleitet zur Diele. »Vergiss deine Schuhe nicht.«
UNTEN BEI DEM TOTEN hat sich viel und gar nichts verändert. Er trägt keine Schuhe mehr, und den Mantel hat ihm auch jemand ausgezogen. Aus einiger Entfernung ist die Leiche kaum mehr zu sehen, weil sie von all den Leuten, die sich um sie herumbewegen, verdeckt wird. Hinten an der Absperrung wartet ein Wagen, der eine Zivilstreife sein könnte, aber in Wirklichkeit zum Expressen oder zum Aftonbladet gehört. Von den Assistenten keine Spur. Vielleicht erholen sie sich von ihrem Anruf bei Gabriel Birck.
Es ist noch kälter geworden, zumindest fühlt es sich so an. Doch Veränderungen wie diese sind wahrscheinlich unwesentlich, denn der Tote ist unverändert tot, der Schnee fällt genauso unaufhörlich wie zuvor, und in manchen Nächten ist nichts anderes von Bedeutung als das.
»Von wem kam der Notruf?«, frage ich mit dem Handy in der Hand. Ich traue meinem Gedächtnis nicht mehr und muss das Gespräch mit dem Jungen zusammenfassen, habe aber nichts anderes zum Schreiben dabei als das Handy.
Einer der uniformierten Polizisten hat einen Notizblock in der einen Hand und ein halb gegessenes Käse-Schinken-Brötchen in der anderen. Er heißt Fredrik Markström, ist ein junger Assistent aus Norrland und hat Schultern wie ein Gewichtheber.
»Jau«, erwidert er bedächtig mit vollem Mund und blättert zwei Seiten zurück. »Das war ein anonymer Anruf von einem Handy. Die Person klang seltsam, so als würde er oder sie die Stimme verstellen. Aber das wissen wir nicht. Ich habe um eine Aufnahme von dem Gespräch gebeten, die schicken sie an dich. Der Diensthabende wollte nach dem Namen fragen, aber da hatte der Anrufer offensichtlich schon aufgelegt. Zum Glück waren die Kollegen so schlau, trotzdem jemanden herzuschicken.«
»Und zwar dich, oder?«
»Mich und Hall«, erwidert Markström und nimmt einen neuen Bissen von dem Brötchen.
Åsa Hall stammt aus Göteborg und ist in so ziemlich allem das Gegenteil von Fredrik Markström: gesprächig, untersetzt und fröhlich.
»Wer kam nach euch?«
»Larsson und Leifby.«
»Larsson und Leifby?«
»Jau.«
»Was zum Teufel hatten die in der Innenstadt zu suchen?«
Markström nimmt noch einen Bissen.
»Keine Ahnung. Sagten, sie seien in der Nähe gewesen.«
Larsson und Leifby sind Streifenpolizisten draußen in Huddinge, und zwar welche von der Sorte, die das Dezernat so gut wie niemals bei Informations- und Rekrutierungstagen repräsentieren dürfen. Der eine hat Höhenangst, der andere ist ein miserabler Schütze, Defizite, die für einen Polizisten gelinde gesagt ungünstig sind. Außerdem sind sie sensationslüstern wie Reporter bei einer gewissen Abendgazette.
Als Markström und Hall an den Fundort kamen, gingen sie nach Vorschrift vor. Larsson und Leifby erhielten unterdessen die Aufgabe, mit möglichen Zeugen zu sprechen. Von ihnen ist nun nichts mehr zu sehen, und ich frage mich, ob das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen ist.
Also gehe ich zu den Containern, die vor den Wänden des Hinterhofs aufgereiht stehen. Es riecht säuerlich. Ich knie mich vor ihnen hin und spüre wieder, wie die Kälte vom Boden durch die Jeans und in meine Oberschenkel kriecht. Doch diesmal sind meine Sinne leicht betäubt.
Hinter einem der Container ist die dünne Schneedecke nicht unberührt. Da hat jemand gestanden und ist einige Schritte vor- und zurückgegangen. Die Schuhabdrücke sind verwischt. Stiefel mit kaputten Sohlen, so wie man sie trägt, wenn man kein Geld hat, sich jedes Jahr neue zu kaufen.
»Victoria«, sage ich leise, und Mauritzon blickt von der Leiche auf. »Ich glaube, hier hat jemand gestanden.«
Sie notiert etwas auf dem Block, den sie in der Brusttasche ihres Overalls verwahrt.
Ich gehe auf die Straße hinaus und ein Stück an der Häuserzeile entlang, vorbei an den Absperrungen, und rauche eine Zigarette. Die Klubmusik pulsiert, jetzt ist es ein alter Song, der neu gecovert worden ist, sodass man dazu tanzen kann. Ich erinnere mich aus meinen Jugendjahren an die Melodie, und für einen kurzen Moment wünsche ich mir, fünfzehn Jahre jünger zu sein, noch in der Ausbildung, die Zukunft noch nicht so festgeschrieben.
In der Innentasche des Mantels vibriert mein Handy mit einer Nachricht von Sam.
– Schläfst du?
– Nein. Hab Dienst.
– Hast du einen guten Abend?
Ich denke über eine Antwort nach und nehme einen Zug von der Zigarette.
Entscheide mich für: Ist ok. Mord in Vasastan, fahre ich fort, überlege es mir aber anders, lösche es und schreibe: und selbst?
du fehlst mir, kommt die Antwort zurück, sodass ich mir wünsche, woanders zu sein.
morgen?
ja, morgen ist gut.
Ich frage mich, was das bedeuten mag. Sam sagt fast immer ab oder verschiebt das Treffen, wenn wir verabredet sind.
Ein gut gekleideter Mann mit ebenso ordentlicher Frisur kommt mit flatternden Mantelschößen durch den Schnee auf mich zu. Er hebt stumm die Hand und sieht mit einem Abscheu, die im Takt seiner Schritte zu Gier wird, auf meine Zigarette.
»Gutes Lucia-Fest«, sage ich.
»Krieg ich den letzten?«, fragt er.
Ich gebe Gabriel Birck die halb gerauchte Zigarette, und er saugt das letzte Glimmen aus ihr heraus.
»Ich wusste gar nicht, dass du rauchst.«
»Es gibt viel, was du nicht weißt. Wer ist der Ermittlungsleiter?«
»Du.«
»Ich? Wir brauchen einen Kommissar. Wo ist Morelius?«
»Urlaub.«
Birck verdreht die Augen.
»Dann hol Calander. Der hat keinen Urlaub, und das weiß ich mit Sicherheit, denn vor ein paar Stunden hab ich ihn am Sankt Eriksplan an der Würstchenbude stehen sehen, und da sah er sehr arbeitsfähig aus.«
»Der hat alle Hände voll zu tun mit dem Axtmord von der Tegnérgatan.«
»Mist. Und Bäckström? Besser als nichts.«
Ich schüttele den Kopf.
»An die Reichskripo ausgeliehen.«
»Pfui Teufel, die armen Schweine.«
Birck drückt die letzte Glut an der Hauswand aus und macht Anstalten zu gehen, hält dann aber inne und schnuppert.
»Hast du gekotzt?«
»Nein.«
»Du riechst nach Kotze.«
»Ich habe nicht gekotzt.«
»Dann hat dich jemand angekotzt.«
»Heute mal nicht.«
Das lässt Birck auflachen. Er nimmt ein Paar Handschuhe aus den Manteltaschen.
»Wo liegt er?«
»Drinnen im Hinterhof.«
»Wir haben einen Zeugen«, sage ich und sehe zu dem Fenster hinauf, wo der Weihnachtsstern immer noch leuchtet. »John Thyrell. Er hat den Täter höchstwahrscheinlich gesehen.«
»Woher weißt du das?«
»Ich habe mit ihm gesprochen.«
»Und was hat er gesehen?«
»Ziemlich viel, glaube ich, aber …«
»Was?«
»Seine Mutter sagt, er sei sechs Jahre alt.«
»Sechs Jahre.« Birck zieht eine Grimasse. »Großartig.«
Er hockt sich neben Thomas Hebers stilles, erloschenes Gesicht. Das Kartenetui liegt an seinem Platz beim Rucksack. Birck nimmt es auf und zieht die Ausweiskarte heraus.
»Ein schöner Mann.«
»Auch solche sterben«, erwidert Mauritzon.
Birck schiebt die Karte in das Etui zurück, legt es auf den Boden und erhebt sich, um sich ein paar Minuten am Fundort zu orientieren.
»Heber kommt in den Hof«, beginne ich. »Er stellt sich hier hin. Vielleicht ist die andere Person bereits da, hinter einem der Container. Wahrscheinlich sogar. Noch jemand kommt und ersticht Heber mit dem Messer. Da die Stichverletzung im Rücken ist, kommt derjenige wahrscheinlich von hinten. Heber fällt zu Boden, und der Täter durchwühlt seinen Rucksack, findet, was er gesucht hat, so können wir annehmen, und verlässt dann den Ort, wahrscheinlich mit Hebers Handy, denn wir haben hier keines gefunden. Der Täter bewegt sich Richtung Innenstadt. Danach entfernt sich auch die Person, die hinter dem Container verborgen war, so sagt es jedenfalls der Zeuge. Vielleicht hat der hinter dem Container den Notruf abgesetzt. Die Frage ist, was er hier verloren hat. Entweder hat er mit der Sache zu tun, oder er ist zufällig da. Vielleicht ein Penner oder ein Junkie.«
»Dein Zeuge ist ein sechsjähriger Junge«, betont Birck.
»Aber seine Angaben stimmen mit dem überein, wie es hinter einem der Container aussieht. Da hat jemand gestanden.«
»Hoffen wir mal, dass es noch mehr Zeugen gibt.« Birck sieht sich um. »Es könnte ein Raubüberfall sein. Aber warum hat der Täter dann das Bargeld nicht genommen? Es muss etwas anderes gewesen sein.«
»Ja, die Frage ist nur, was. Vielleicht das Handy?«
»Aber warum sollte Heber das im Rucksack haben? Wer trägt schon sein Handy im Rucksack?«
Markström kommt mit dem Notizblock in der einen und einer Plastiktasse Kaffee in der anderen Hand auf uns zu. Ich frage mich unwillkürlich, ob ich Markström jemals ohne etwas zu essen oder zu trinken in der Hand gesehen habe. Wahrscheinlich nicht, aber ich kenne ihn auch noch nicht so lange.
»Thomas Markus Heber«, sagt er und nimmt schlürfend einen Schluck vom Kaffee. »Geboren 1978. Alleinstehend, keine Kinder. Gemeldet im Vanadisvägen 5, weniger als einen Kilometer von hier entfernt. Vor elf Jahren, also 2002, wegen Körperverletzung verurteilt, im Jahr davor wegen Störung der öffentlichen Ordnung.«
»Körperverletzung und Störung der öffentlichen Ordnung«, echot Birck und wendet sich mir zu. »Übernimmst du das?«
»Ja.« Ich sehe wieder zum Fenster hinauf. »Das mache ich.« John ist verschwunden, wahrscheinlich von seiner Mutter ins Bett gescheucht. Ob das hier den Jungen verstören wird, ob diese Nacht ihn verfolgen wird? Ich hoffe nicht. »Morgen.«
»Ich sehe mir mal seine Wohnung an«, erklärt Birck.
»Hast du einen Schlüssel?«
Birck deutet mit fragendem Blick auf den Schlüsselbund, der auf dem Boden liegt. Ich zögere.
»Wünschst du Gesellschaft?«
»Nein. Aber man kriegt ja nicht immer alles, was man sich wünscht.«
WER NICHT WEISS, DASS mit der Tür irgendetwas nicht stimmt, der wird es nicht bemerken, obwohl Christian einen verdammten, fetten Hammer benutzt hat. Das war das Einzige, was ihm auf die Schnelle einfiel, das Einzige, was er mitgenommen hatte. Die Klinke hängt schlaff herunter, und die Tür ist nicht ganz zu, aber das ist auch alles. In der Dunkelheit kaum erkennbar.
Er steht auf der Straße, gut sichtbar. Abgesehen von einem einsamen Schwibbogen ein paar Etagen höher sind alle Fenster im Haus dunkel. Es ist ein paar Minuten nach halb zehn. In weniger als einer Stunde stirbt Thomas Heber.
Er hat die Plastiktüte mit dem Messer unter die Jacke geschoben und spürt jetzt am Körper, wie sie sich im Takt mit seinen Schritten bewegt. Schnell verlässt er Kungsholmen. Den Hammer wirft er in einen Baucontainer beim Sankt Eriksplan. Niemand sieht ihn. Niemand sieht mehr etwas.
Christian und Michael: Ein halbes Leben haben sie ohne einander gelebt, ein halbes miteinander. Irgendwie gibt es doch eine Symmetrie in den Dingen, die auf etwas hindeuten.
Sie waren fünfzehn Jahre alt, vor fünfzehn Jahren. Beide auf einem Fest in Hagsätra, in einem der Hochhäuser im Zentrum. Es war März, und kein Monat kann so wie der März eine Ewigkeit lang sein. Alles war grau. Sie kannten sich, hatten aber noch nie miteinander gesprochen, sondern sich nur ein paarmal auf dem Platz unten oder auf dem Sportplatz gesehen.
Christian trat auf den Balkon, um eine zu rauchen, und da stand er. Sie fingen an, sich zu unterhalten. Es war etwas Besonderes zwischen ihnen, zumindest empfand er das so, und zu Anfang konnte er nicht so recht einordnen, was es war.
Dann wurde ihm klar, dass sie beide T-Shirts mit einem SKREWDRIVER-Aufdruck anhatten. Sie bemerkten es gleichzeitig, senkten den Blick auf den Brustkorb des anderen. Sie lachten. Das Shirt von Christian war weiß. Er hatte es von seinem Bruder Anton bekommen. Michaels war schwarz.
»Magst du Skrewdriver?«
»Ich hab die erste Platte gehört, aber danach keine mehr«, antwortete Christian. »Die hab ich zusammen mit dem T-Shirt von meinem Bruder bekommen. Aber die Platte mochte ich.«
»Ich auch. Ich mag All skrewed up, aber sonst nichts von denen. Du weißt, dass die dann Nazis geworden sind?«
»Was?«
»Neonazis.«
Christian erstarrte. Der Aufdruck auf dem Hemd veränderte sich, wurde bedrohlich. Er fragte sich, ob Anton davon wusste und ob er ihm deshalb das T-Shirt geschenkt hatte. Um ihn zu ärgern. Damit Christian Prügel bezog.
»Nein, das wusste ich nicht.«
»Voll krank«, meinte Michael, »dass Leute, die erst Punks sind, mit ihrer Band so eine, wie heißt es …«
»Kehrtwendung?«
»Genau. Das ist doch voll krank, oder?«
»Ja.«
Auf der anderen Seite der Scheibe, in der Wohnung, fiel jemand von der Armlehne des Sofas. Christian und Michael schauten ins Zimmer hinein.
»Das ist Petter«, sagte Christian. »Der geht in meine Klasse. Säuft immer zu viel.«
In der Wohnung sang Nirvana: I’m so happy, because today I found my friends. They’re in my head …
So fing es an.
»Wohnst du in Hagsätra?«, fragte Michael.
Christian nickte und zitterte vor Kälte.
»In der Åmmebergsgatan, hinten am Sportplatz. Und du?«
»Glanshammarsgatan.« Er zeigte zwischen die Hochhäuser, wo das Licht in die kleinen Fenster schien. »Siehst du das etwas niedrigere Haus da hinten zwischen den zwei hohen?«
Christian bemühte sich, den Blick zu fixieren, und rückte die Brille zurecht. Er rauchte selten, und wenn er es in Kombination mit Bier tat, dann hatte er das Gefühl, als würde der Alkoholgehalt verdoppelt.
… and just maybe, I’m to blame for all I’ve heard …
»Ja«, sagte er.
»Das zweite Fenster von oben, ganz rechts. Das ist mein Zimmer.«
Das Fenster war dunkel.
Christian hatte starke Akne und einen schweren Augenfehler, dadurch waren die Brillengläser dick, und die Augen wirkten klein wie Stecknadelköpfe. In der Schule gab es einen größeren Jungen namens Patrik, der immer »Hallo, Pickel, wie geht’s?« hinter ihm herrief, sodass die Mädchen lachten. Christian versuchte, das an sich abprallen zu lassen. Er war gut in Sport, Basketball, Bandy und Tischtennis. So machte er sich Freunde, auch wenn er den Verdacht hatte, dass sie hinter seinem Rücken über ihn redeten.
Seinem neuen Freund ging es genauso, das würde er bald merken. In der Hinsicht waren sie sich ähnlich, wenn auch sein neuer Freund weder Akne noch eine Brille hatte.
»Ich brauch noch ’n Bier«, verkündete Michael.
»Ich auch.«
Sie warfen die Zigarettenkippen vom Balkon und sahen sie in die Dunkelheit hinuntersegeln. Dann machten sie die Balkontür auf und gingen hinein. Die Wärme und die Luftfeuchtigkeit in der Wohnung ließen Christians Brille beschlagen. Als Michael die weiße Schicht sah, die Christians Augen verbarg, lachte er.
»Da ist es nicht gerade leicht, einen guten ersten Eindruck zu machen, was?«
Nein, es war nicht leicht. Jetzt muss Christian daran denken. Wenn die Umstände andere gewesen wären, hätte er wahrscheinlich gelacht. Es muss lustig ausgesehen haben.
Zwischen den Hochhäusern türmten sich die Gefühle auf, und es gab nur selten eine Gelegenheit, sie abzuschütteln, also trug man sie mit sich herum. Man trug sie in den Fluren der Schule, hielt sich jene fern, vor denen man Angst hatte, und eignete sich diejenige an, von denen man hoffte, sie würden zu einem passen. Man trug sie, wenn der Spind des besten Freundes aufgebrochen worden war und jemand auf die Innenseite der Schranktür ein Hakenkreuz gemalt hatte. Man trug sie, als man seinen ersten Kuss bekam, mit elf Jahren bei einer Disco, die im Klubraum beim Sportplatz von Hagsätra veranstaltet wurde. Sie hieß Sara und hatte die zarteste Haut, die Christian jemals an seinen Fingern gefühlt hatte. Einen Monat lang waren sie zusammen. Sara hatte, obwohl sie noch nicht älter als zwölf war, angefangen, BH zu tragen, und an dem Tag, bevor sie Schluss machte, durfte er ihre Brust berühren. Vielleicht wollte sie deshalb nicht mehr mit ihm zusammen sein, weil er zu forsch gewesen war.
Man trug sie, als man vierzehn Jahre alt und zum ersten Mal richtig verliebt war, und sie hieß Pernilla und schrieb die können lachen, so viel sie wollen, und uns verhöhnen – wir bewegen uns, die stehen still auf einen Zettel, den sie heimlich durch den kleinen Spalt des Spinds schob. Mit ihr hatte er zum ersten Mal Sex, auf einem Fest, das dem ganz ähnlich war, auf dem er ein Jahr später sein Skrewdriver-T-Shirt anhatte.
Man trug sie, wenn man drei Einwanderer sah, die einen Schweden in den Bauch boxten, zwei hielten fest und einer schlug zu, hinter der Sporthalle, und man trug sie, wenn man tags darauf vier Schweden einen Einwanderer verprügeln sah, hinter dem Kiosk, der dem Vater des einen Schweden gehörte.
Man trug sie, wenn man jemanden zum ersten Mal auf einem Fest traf, der das gleiche T-Shirt hatte wie man selbst, und man erkannte schnell, dass er einem Beschützer und Henker zugleich werden würde.
Es gibt keinen Katalysator, keinen auslösenden Faktor, der die Dinge ins Rollen bringt. Keine Antwort auf das Warum. Es gibt nur Ereignisse, auf die Ereignisse folgen, und wenn man weit genug in die Vergangenheit zurückblickt, wird alles zu einem unüberschaubaren Netz, und vielleicht ist das der Weg, denkt Christian jetzt, wie wir zu dem werden, was wir werden.
Genau wie man es ihm gesagt hat, vermeidet er U-Bahn und Überwachungskameras und nimmt stattdessen den Bus zur Universität. Er fährt Umwege und steigt mehrmals um, damit er nicht zu früh kommt. An den Haltestellen friert er. Die Busse kommen hustend durch die Dunkelheit angefahren, und keiner der Busfahrer ist Schwede. Er fährt an der Vasa-Realschule vorbei, auf die jemand »JUDENSCHWEINE« und dahinter »1488« gesprayt hat. Wer wohl die Dose gehalten hat? Es hat angefangen zu schneien. Am Odenplan grölt ein Lucia-Reigen aus Studenten lachend und torkelnd an ihm vorbei.
Als er aus dem letzten Bus aussteigt, erhebt sich vor ihm in der Dunkelheit der große Blechkomplex der Universität. Im Schatten einer der Ecken wartet er schon, Christian kann es spüren, je näher er dem Gebäude kommt. Und sehr richtig: Da ist er, den Blick auf eines der Fenster hoch oben gerichtet. Das einzige Fenster, in dem Licht brennt.
»Lief es gut?«, fragt er, ohne Christian anzusehen.
»Ja.«
»Du klingst unsicher.«
»Bin ich nicht.«
»Gib es mir.«
Christian zieht den Reißverschluss seiner Jacke auf und holt die Plastiktüte heraus. Michael nimmt sie ihm aus der Hand.
»Was willst du …«
»Geh nur. Wir machen das später.«
»Aber i…«
»Nein. Diesmal nicht. Wir sehen uns morgen.«
Michael hebt den Blick wieder zu dem Fenster. Es ist immer noch erleuchtet. Eine Sekunde des Zögerns dehnt sich unnatürlich lang. Gedanken rauschen wie ein Wasserstrom durch Christian.
»Okay«, sagt er, dreht sich um und geht.
Der Schnee knirscht unter Christians Füßen. Vor ihm leuchtet das große Statoil-Schild orange. Der Verkehr rauscht, aber es ist seltsam still. Ein Abend, an dem alte Gefühle wieder erwachen.
Sie waren fünfzehn Jahre, vor fünfzehn Jahren. Wir bewegen uns, die stehen still.
Christian wendet ein letztes Mal den Kopf, sucht nach dem erleuchteten Fenster, findet es nicht. Das Licht ist aus, und in der Ecke des Gebäudekomplexes steht kein Michael mehr.
13. 12.
ES WIRD VIEL ÜBER Gabriel Birck geredet, und das meiste ist widersprüchlich, wie Beweisfetzen, die auf verschiedene Erzählungen und unterschiedliche Schicksale hinweisen.
Es heißt, er habe keinen Geruchssinn, gleichzeitig behaupten andere, er könne den Geruch von menschlichem Speichel erkennen. Er sei schwul, sei aber mal mit einer Frau aus einem der Hamilton-Clans zusammen gewesen. Dieselbe Person behauptet, Birck hätte während seiner Militärzeit bei den Fallschirmjägern seinen Nachnamen geändert und stamme in Wirklichkeit aus einem reichen Adelshaus. Andere meinen zu wissen, er käme aus ärmlichen Verhältnissen und sei in einem Vorort mit einem einsamen Säufer als Vater aufgewachsen, der ihn jedes Wochenende verprügelt habe. Einmal hätte er eine Frau aus Estland geheiratet, um sie von einer Schleuserbande zu befreien. Schon während seiner Ausbildung sei er von der Sicherheitspolizei Säpo umworben worden, hätte sich aber niemals verlocken lassen. Andere hingegen sind der festen Überzeugung, er hätte eine höchst dubiose Vergangenheit beim Geheimdienst.