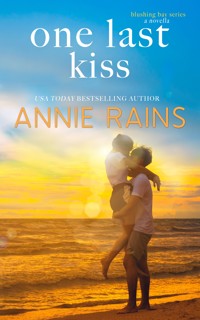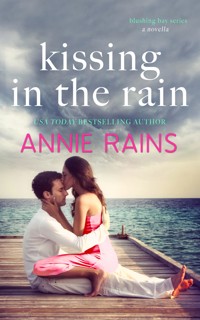9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Diese wunderbare Liebesgeschichte geht ans Herz und ist die ideale Wohlfühllektüre.« Publishers Weekly Festlich beleuchtete Häuser, geschmückte Weihnachtsbäume und duftende Plätzchen. Doch für Diana ist diese Weihnachtszeit keine glückliche: Seit drei Wochen liegt ihr Verlobter Linus durch einen Unfall im Koma. Kurz vor Heiligabend findet sie eine Schneekugel, die Linus ihr schenken wollte. Aber das Einzige, was sie sich wünscht, ist noch einmal einen Tag mit ihm zu verbringen. Dann geschieht etwas Sonderbares: Sie wacht an dem Morgen auf, an dem Linus verunglückt ist. Und während der Tag sich wiederholt, setzt Diana alles daran, Linus vor seinem Schicksal zu bewahren – und hofft aus tiefstem Herzen auf ein Weihnachtswunder …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 439
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Annie Rains
Schneekugelwünsche
Über dieses Buch
Diana ist die Einzige in der Kleinstadt Snow Haven, die nicht in Weihnachtsstimmung ist. Sie streitet sich mit ihrem Verlobten Linus über die Hochzeit. Bevor sie sich mit ihm versöhnen kann, verunglückt er und liegt im Koma. Als Diana sein Weihnachtsgeschenk für sie findet, packt sie es aus. Die Schneekugel ist wunderschön, bringt ihr aber Linus nicht zurück – oder doch? Denn als Diana sie schüttelt, wacht sie am Tag des Unfalls auf, der noch nicht passiert ist. Sie will alles tun, damit dies so bleibt. Vielleicht gelingt es ihr, nicht nur ihr eigenes Weihnachtswunder wahr werden zu lassen, sondern auch die Wünsche von besonderen Menschen in ihrem Umfeld zu erfüllen?
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Annie Rains ist eine USA-Today-Bestsellerautorin. Sie lebt mit ihrem Mann, drei Kindern, einer temperamentvollen Katze und einem verspielten Hund in einer Kleinstadt voller liebenswerter Menschen, malerischen Vierteln und atemberaubender Natur – ähnlich wie die Orte, über die sie ihren Liebesromanen schreibt.
Ira Panic studierte Germanistik, Psychologie und Theaterwissenschaften. Bis zur Jahrtausendwende arbeitete sie als Kulturjournalistin für verschiedene Verlage. Seither ist sie als freie Autorin, Lektorin und Übersetzerin tätig. Ihre Spezialität: Historische Romane, Romances und Fantasy.
Inhalt
Für Sonny, Ralph, [...]
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
Epilog
Danksagung
Für Sonny, Ralph, Doc und Lydia:
Wenn ich eine Schneekugel zum Schütteln und eine zweite Chance hätte,
würde ich nicht die kleinste Kleinigkeit meines Lebens mit euch verändern.
1. Kapitel
In der Nacht vor dem 4. Dezember
»Du findest also auch, dass ich eine Elsa bin?« Diana Merriman lehnte sich zurück, um ihren Verlobten besser anschauen zu können.
Linus hob abwehrend die Hände. Er trug heute seinen lavendelfarbenen, mit winzigen sich jagenden Hunden bedruckten Schlips. Diana hatte ihm das Teil zum Halbjahrestag ihrer Beziehung geschenkt. Es war eher als Witz gedacht gewesen, nicht als künftiger Hauptbestandteil seiner Garderobe, aber der Schlips passte perfekt zu Linus' Persönlichkeit – gleichermaßen lustig und auf unaufdringliche Art attraktiv. »Das habe ich nicht gesagt.«
»Nein, aber du hast auch nicht gesagt, dass ich keine bin.« Die Beleidigung, die ihr heute von ihrer jugendlichen Patientin an den Kopf geworfen worden war, ließ Diana nicht mehr los. Sie hatte zwar nur Teile des berühmten Zeichentrickfilms gesehen, doch immerhin genug, um mitzubekommen, dass die fragliche Disney-Heldin schön und stark war. Dennoch glaubte Diana nicht, dass Addy ihre Bemerkung als Kompliment gemeint hatte. »Elsa ist eine Eiskönigin, stimmt’s?«
Linus lachte leise, was den Stachel der Verletzung nur noch tiefer trieb.
Verärgert kniff sie die Augen zusammen und verschränkte die Arme vor der Brust, um Druck auf ihr schmerzendes Herz auszuüben. »Das ist nicht komisch, Linus.«
Sanft berührte er ihre Schulter. »Hey, sei nicht sauer. Ich wollte dich nicht auslachen. Es sieht dir nur überhaupt nicht ähnlich, derart empfindlich auf so was zu reagieren.«
»Was soll das denn heißen?«, zischte Diana, die spürte, wie sie ihm selbst diese an sich harmlose Erwiderung verübelte. Wahrscheinlich war sie einfach gestresst. Hinter ihr lag ein anstrengender Tag mit vielen Hausbesuchen, und morgen stand das Personalgespräch mit ihrem Chef an. Es ging um die fette Beförderung, der sie seit Monaten entgegenfieberte. Das war alles. Sie war müde und gestresst, und sie wollte, dass Linus in der Elsa-Frage auf ihrer Seite stand. Immerhin war er ihr Verlobter.
»Du bist keine Elsa, okay? Vermutlich wollte deine Patientin dir damit einfach nur zu verstehen geben, dass man nicht so leicht an dich rankommt – emotional. Du kannst manchmal ein bisschen …«, Linus neigte den Kopf zur Seite und verzog leicht die Mundwinkel, »… distanziert sein.«
»Ich bin nicht distanziert«, widersprach sie. »Ich stehe direkt vor dir.«
Linus streifte den Hundeschlips ab. »So wörtlich habe ich das nicht gemeint.«
»Wie hast du es denn gemeint? Nenn mir bitte ein Beispiel, wann ich emotional distanziert war.« Erwartungsvoll schaute sie ihm ins Gesicht. Als sie sah, wie seine humorvolle Miene sich verdüsterte, wurde ihr leicht mulmig.
»Nun ja«, antwortete er in plötzlich sehr ernstem Ton. »Wie wär’s zum Beispiel mit dauernd, seit ich dir im Sommer den Antrag gemacht habe?«
Als Diana an jenen Abend zurückdachte, wurde ihr unwillkürlich die Kehle eng. Sie hatte damals keine Ahnung gehabt, dass er sie bitten würde, ihn zu heiraten. Seine Frage hatte sie dermaßen überrascht, dass sie zum ersten Mal vor ihm in Tränen ausgebrochen war. Es war der glücklichste Moment ihres Lebens gewesen. »Was soll das heißen?«
»Du hast ja zu immer und ewig gesagt, aber seither immer nur Ausflüchte gemacht, wenn es um ein konkretes Datum für die Hochzeit ging.«
Sie schüttelte den Kopf. »Nein, das stimmt nicht. Ich war einfach nur …«
»Zu beschäftigt? Oder …«, Linus faltete die Krawatte zusammen, »… doch eher distanziert? Man kann nämlich durchaus Karriere machen und ein Privatleben haben. Das kriegen andere Leute auch hin.«
Ratlos ließ Diana ihren Blick durchs Schlafzimmer schweifen. Wie waren sie bloß von der beleidigenden Äußerung ihrer jugendlichen Patientin auf ihre und Linus' Hochzeitspläne gekommen – beziehungsweise die Nicht-Existenz besagter Pläne? Und wie sollte sie darauf reagieren? Voller Unmut presste sie die Lippen zusammen, während sie nach einem Vorwand suchte, das Thema zu wechseln. Sie war noch nicht bereit dafür, die Kleiderwahl oder Blumenarrangements zu diskutieren und erst recht nicht die Gästeliste.
»Lass uns Weihnachten heiraten«, schlug er vor und lächelte dieses schiefe Grinsen, mit dem er vor neun Monaten, als sie zum ersten Mal in den Spielzeugladen seines Vaters gekommen war, ihr Herz gestohlen hatte. Mittlerweile war Mr. Grant im Ruhestand, und Linus hatte die Leitung des Toy Peddler übernommen.
»Meinst du dieses Weihnachten?« Plötzlich fühlte ihre Brust sich an, als ob sie von einem unsichtbaren Seil zusammengeschnürt wurde, und ihr Atem kam in schnellen, flachen Stößen. »Also in drei Wochen?«
Linus grinste. »Das wäre der perfekte Zeitpunkt. Meine Verwandtschaft mütterlicherseits fliegt über die Feiertage ein. Und sämtliche Angehörige meines Dads wohnen höchstens eine Autostunde entfernt. Alle könnten dabei sein.«
Seine Wortwahl implizierte, dass der Begriff »alle« noch mehr Personen beinhaltete als die Heerscharen von Grants, die sich an Thanksgiving in Linus' Elternhaus versammelt hatten. Bei dieser Gelegenheit hatte Diana herausgefunden, dass die Menge an Tanten, Onkeln, Cousinen und Cousins, die zu Linus' Familie gehörte, größer war als ihr gesamter Bekanntenkreis.
»Stell dir das doch mal vor. All die Lichter. Die Christbäume. Die Weihnachtssterne.« Begeistert umfasste er ihre Schultern.
Sie legte den Kopf in den Nacken, um Linus ins Gesicht zu schauen, und unwillkürlich schlug ihr Herz einen kleinen Purzelbaum. Sie liebte diesen Mann, ohne jeden Zweifel. Er war der Eine für sie, der Einzige. Ein Teil von ihr wollte so gerne ja sagen. Doch es gab auch diesen anderen Teil, der sich nur allzu gut ausmalen konnte, wie sie auf dem Weg zum Altar kalte Füße bekam. Schließlich war es gemeinhin kein Mangel an Liebe, der Bräute dazu trieb, in letzter Minute das Weite zu suchen. Nein. Diana wusste ganz genau, was Frauen dazu brachte, vor ihrem perfekten Happy End davonzulaufen – Angst.
»Was sagst du? Wenn wir Weihnachten heiraten, brauchen wir fast nichts zu planen, außerdem würde das Ganze erheblich weniger kosten. Wir wären praktisch unter uns.«
Abgesehen von ungefähr fünfzig Mitgliedern der Grant-Familie. Und null Mitgliedern von Dianas Familie. Natürlich hatte sie Freunde, aber längst nicht so viele wie Linus. Die Gästeliste wäre so unausgeglichen, dass die Kirche vermutlich nach einer Seite wegkippen würde.
Sie versuchte zu schlucken, doch ihr Mund fühlte sich staubtrocken an. »Morgen habe ich das Personalgespräch wegen meiner Beförderung«, erwiderte sie schließlich. »Darauf würde ich mich gerne konzentrieren, bevor wir irgendwelche überstürzten Entscheidungen treffen. Danach kümmern wir uns um die Hochzeitsplanung, versprochen.«
»Überstürzt?«, wiederholte Linus leise. Die Enttäuschung, die in seiner Stimme mitschwang, war nicht zu überhören. »Wir sind seit Monaten verlobt, aber du hast so gut wie nie Lust, über die Hochzeitspläne zu reden.« Forschend musterte er sie. »Irgendwie kriege ich langsam das Gefühl, dass du mich überhaupt nicht heiraten willst. Hast du meinen Antrag etwa nur aus Mitleid angenommen?«
»Was? Wie kommst du denn darauf?«
Er hob die Schultern. »Ach, ich weiß auch nicht. Aber so ein Heiratsantrag stellt doch sicher einen gewissen Druck dar. Vielleicht wolltest du einfach meine Gefühle nicht verletzen.«
Schuldgefühle stiegen in Diana auf. Wie furchtbar, dass er auch nur die Möglichkeit in Betracht zog, dass sie nicht aufrichtig gewesen war. »Ich würde niemals ja sagen, wenn ich es nicht so meine, Linus. Es ist nur …« Diana brach ab, weil sie in Wahrheit keine gute Begründung dafür hatte, das Ganze weiter hinauszuzögern. Zumindest keine, die er nachvollziehen könnte. Linus wusste nicht, wie es war, wenn man als Kind von beiden Eltern im Stich gelassen wurde und bei einer Großmutter aufwuchs, die einen auch nicht wirklich haben zu wollen schien. Diana hatte so ihre Probleme, und sie war die Erste, die das zugeben würde. »Warum diese Eile?«, fragte sie schließlich.
Linus presste die Lippen zusammen. »Mein Großvater pflegte zu sagen, dass ›für immer und ewig‹ ein Mythos ist«, sagte er dann. »Alles, was wir haben, ist das Hier und Jetzt.« Eindringlich schaute er ihr in die Augen. »Darum die Eile.«
»Nun, wir haben doch bestimmt noch mindestens ein weiteres Morgen«, konterte sie leichthin, um die Stimmung zu heben. Doch es funktionierte nicht, bei keinem von ihnen. Sie war nervös und abwehrend, und Linus wirkte ernüchtert. Dianas Betroffenheit, weil eine junge Patientin sie als Elsa bezeichnet hatte, war plötzlich nicht mehr wichtig, denn sie hatte Linus verletzt, was nun wirklich das Letzte war, was sie jemals tun wollte. Vielleicht war sie wirklich eine Eiskönigin.
Linus ließ ihre Schultern los und trat einen Schritt zurück. »Manchmal bereue ich, dass ich dich gebeten habe, mich zu heiraten«, murmelte er so leise, dass sie ihn fast nicht verstanden hätte.
»Was?« Entsetzt presste sie eine Hand vor ihre Brust, um sich dazu zu zwingen weiterzuatmen. Das hatte er doch gewiss nicht so gemeint. Oder?
»Nicht, weil ich dich nicht liebe.« Er lachte freudlos. »Die Wahrheit ist, ich liebe dich so sehr, dass es mir den Atem raubt, wenn ich nur daran denke. Du bist alles, was ich mir je gewünscht habe. Und mehr. Ich weiß nicht, womit ich dich verdient habe.«
Tränen brannten in ihren Augen. Sie konnte das »Aber«, das hinter seinen Worten lauerte, förmlich mit Händen greifen. Angespannt wartete sie, wappnete sich für das Schlimmste. »Aber?«, hakte sie nach, als er weiter schwieg.
Verzagt schüttelte Linus den Kopf. »Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich dich überrumpelt. Vielleicht warst du noch nicht bereit. Vielleicht bist du immer noch nicht bereit.«
Diana weinte nicht vor anderen Leuten. Nicht mal vor Linus. Ihre Großmutter Denny hatte ihr beigebracht, ihre Gefühle unter Kontrolle zu halten, bis sie allein war. Dennys Worte waren weit weniger poetisch gewesen als die von Linus' Großvater, aber es hatte doch für ein paar harsche Wahrheiten gereicht, die Diana helfen sollten, in einer Realität zu bestehen, die von Denny als brutal und gnadenlos geschildert wurde. Natürlich hatte Diana ein paar entsprechende Erfahrungen gemacht, doch ihre Welt war sehr viel schöner geworden, seit Linus ein Teil davon war. Er brachte eine Magie in ihr Leben, die sie zuvor nicht gekannt hatte. »Und das alles, weil ich dich gefragt habe, ob ich eine Elsa bin?«, flüsterte sie.
»Das alles, weil ich seit Wochen versuche, mit dir über die Hochzeit zu sprechen, und offenbar nie der richtige Zeitpunkt ist.« Er seufzte erschöpft. »Und auch jetzt ist er es nicht. Wir sollten morgen weiterreden, nach deinem Personalgespräch, wenn wir beide einen klaren Kopf haben.«
Noch immer kämpfte Diana mit den Tränen. »Über was genau reden?«
»Die Hochzeit. Falls Weihnachten eine stattfindet.«
Das Falls ließ sie erstarren, und sie fragte sich, ob er mehr damit meinte als er sagte. Wollte er darüber reden, ob es überhaupt eine Hochzeit geben würde? Vielleicht bereute er wirklich, ihr einen Antrag gemacht zu haben.
Linus bedachte sie mit einem schwachen Lächeln, das seine Augen nicht erreichte, legte den zusammengefalteten Schlips auf die Bettkante und ging hinaus.
Erst jetzt gestattete Diana sich, ihren Gefühlen freien Lauf zu lassen, warf sich auf die Matratze, vergrub ihr Gesicht im Kissen und weinte.
Eine Stunde später lauschte sie Linus' Atemzügen neben sich. Als er ins Schlafzimmer zurückgekommen war, hatte sie sich schlafend gestellt. Sie wusste nicht, was sie zu ihm sagen sollte. Vermutlich wäre eine Entschuldigung angebracht, aber von ihr oder von ihm? Sie hatten beide unbedachte Dinge geäußert. Dieser ganze Abend war ein einziges Desaster gewesen. Der einzige Lichtblick war die Tatsache, dass es morgen nur besser werden konnte.
Sie drehte den mit Diamanten besetzten Verlobungsring an ihrem Finger, während ihre Gedanken sich überschlugen. Was für ein alberner Streit. Wir lieben uns. »Linus?«, flüsterte sie schließlich. »Linus, bist du noch wach?«
Er atmete weiter, langsam und regelmäßig.
Sie drehte sich auf die andere Seite und versuchte, ihn in der Dunkelheit zu sehen. Der Umriss seiner Brust hob und senkte sich im Rhythmus seiner Atemzüge. »Linus?«
Keine Antwort. Er war definitiv nicht mehr wach, und wenn Linus erst mal schlief, war er nicht mehr von dieser Welt. Diana blieb nichts anderes übrig als bis morgen zu warten, um die Wogen zu glätten. Sie wollte nicht, dass er glaubte, sie würde bereuen, seinen Antrag angenommen zu haben. Das Einzige, was sie in diesem Moment bereute, war zornig ins Bett gegangen zu sein. Und dass sie Linus gefragt hatte, ob sie wirklich eine Elsa war, wie Addy ihr vorgeworfen hatte. Das bereute sie ebenfalls.
Schlimmer geht immer
4. Dezember
»Aufwachen, Schlafmütze.«
Diana blinzelte in Linus' Gesicht. »Schon?«
»Ich fürchte ja.« Wie üblich war er in aller Herrgottsfrühe bester Laune. Der Mann war putzmunter, sobald er aus dem Bett sprang, um begeistert in jeden neuen Tag zu starten. Das war eine der Eigenschaften, die sie an ihm liebte, die ihr mitunter aber auch auf die Nerven ging.
Diana legte einen Unterarm über ihre Augen, um das Licht abzuschirmen, und Erinnerungen an den vergangenen Abend stiegen in ihr auf.
»Wie wär’s, wenn wir heute Abend den Baum schmücken?« Obwohl Linus verärgert schlafen gegangen war, schwang in seiner Frage keinerlei Anflug von Frust mit.
»Den Baum?«, wiederholte sie und raffte ihre ganze Willenskraft zusammen, um die Lider offen zu halten. Im Unterschied zu Linus war sie kein Morgenmensch.
»Du weißt schon, dieses große grüne Ding in der Wohnzimmerecke. Das wir vergangenes Wochenende nach Hause geschleppt haben?«
Herzhaft gähnte sie. »Stimmt.«
»Wir könnten mit Champagner auf deine Beförderung anstoßen und Lichter und Lametta anbringen. Wer weiß, vielleicht behänge ich ja auch dich mit ein bisschen Lametta.«
Diana spähte noch gerade rechtzeitig hinter ihrem Arm hervor, um zu sehen, wie Linus erwartungsvoll mit den Brauen wackelte.
»Beförderung?« Sie setzte sich auf und starrte ihn mit großen Augen an. »Stimmt, heute habe ich mein Gespräch.« Sie hatte die Nacht über so lange wach gelegen, im Kopf immer wieder den Streit mit Linus rekapituliert und den bevorstehenden Termin mit Mr. Powell durchgespielt, dass sie total neben der Spur war.
»Sag nicht, dass du das vergessen hast. Seit Wochen redest du über nichts anderes als diese Beförderung.« Er fügte nicht hinzu, dass das bevorstehende Personalgespräch außerdem als Grund dafür herhalten musste, jeglicher Diskussion über die Hochzeitsplanung auszuweichen. Sie war dankbar, dass er das heute Morgen nicht zur Sprache brachte. Das würde nur erneut zu Spannungen zwischen ihnen führen, und der heutige Tag hatte das vielversprechende Potenzial, ihr Leben zu verändern. Eine Beförderung würde ihre finanzielle Situation deutlich verbessern. Womöglich könnten sie sich dann sogar leisten, dieses Apartment aufzugeben und in ein eigenes Haus zu ziehen.
Rasch stand sie auf und eilte in ihren begehbaren Kleiderschrank. Das Gespräch war erst für den Nachmittag angesetzt. Den Vormittag über hatte sie etliche Hausbesuche zu absolvieren. Sie griff zu einem Arztkittel mit glitzerndem Schneeflockenmuster und begann, sich für den Dienst anzuziehen.
»Tut mir leid, dass ich dich gestern Abend als Elsa bezeichnet habe.« Linus stand in der Tür und beobachtete Diana.
»Addy war diejenige, die mich als Elsa bezeichnet hat. Du hast es nur bestätigt.«
»Ich meinte nur, dass du genauso schön bist.«
»Das hast du nicht gemeint, und das weißt du auch ganz genau«, gab sie gut gelaunt zurück und musterte Linus. Obwohl er sich vermutlich bereits gekämmt hatte, stand sein Haar an einer Seite verwegen ab.
Verschämt grinste er sie an. »Nun ja, du bist schön. Viel schöner als jede Eiskönigin. Vergibst du mir?«
Sie schuldete ihm ebenfalls eine Entschuldigung. Denn er hatte ja recht. Sie mied das Thema Hochzeit bewusst. Diana schlüpfte in ihre Hose und machte dann einen Schritt auf Linus zu. »Heute Abend legen wir ein Datum fest«, versprach sie. »Während wir mit Champagner feiern und den festlichsten Weihnachtsbaum erschaffen, den Snow Haven je gesehen hat.«
Linus beugte sich vor und küsste sie. »Darauf freue ich mich.«
»Ich mich auch.« Und das stimmte, obwohl sie die Aussicht, Teil einer Familie zu werden, beängstigend fand. Sie hatte keine Ahnung, wie es war, Verwandte zu haben, denen tatsächlich etwas an ihr lag und die Zeit mit ihr verbringen wollten. Was wäre, wenn sie dieser Situation nicht gewachsen war? Wenn Linus klarwurde, dass er mit seiner Wahl einen Fehler gemacht hatte und sie verließ? Oder, noch schlimmer, wenn er bei ihr blieb und dadurch sein Leben ruinierte?
»Heute Abend also?« Er löste sich von ihr. »Ich muss jetzt in den Laden, ich treffe mich gleich mit einem Lieferanten. Ich liebe dich, für immer und ewig«, rief er ihr im Gehen zu.
Bei seinen letzten Worten geriet Dianas Gehirn ins Stottern. Für immer und ewig ist ein Mythos. Wir haben nur das Hier und Jetzt. Lag Linus' Großvater damit richtig? Nun, wenn dem so sein sollte, dann war sie wild entschlossen, das Allerbeste aus diesem Tag herauszuholen. »Ich liebe dich auch!«, rief sie Linus hinterher. »Bis heute Abend!«
Sobald er weg war, lief sie ins Bad, um ihr Gesicht zu waschen. Kurz darauf hörte sie, wie die Wohnungstür geöffnet wurde. Sie drehte sich um, spähte durch die offene Badezimmertür und sah Linus wieder im Flur stehen.
Er machte ein langes Gesicht. »Mein Wagen hat kein Benzin mehr.«
»Du hast so lange gewartet, dass es nicht mal mehr bis zur Tankstelle reicht?«
»Es reicht nicht mal mehr, um das Auto zu starten.« Er seufzte entnervt, die gute Laune von eben verpuffte zusehends.
»Ich brauche noch ein paar Minuten, um mich fertig zu machen, aber dann kann ich dich fahren«, bot Diana an.
Linus schüttelte den Kopf. »Danke, aber ich nehme das Fahrrad, kein Problem. Ich muss los, will nicht zu spät kommen.«
Umso mehr Grund, sich fahren zu lassen, fand sie. Doch Linus würde nicht mit sich reden lassen. Er fuhr immer mit dem Rad zur Arbeit, wenn das Wetter es zuließ, was heute allerdings eher nicht der Fall war. Die Bewegung tat ihm gut, und bis zum Spielzeugladen war es nur eine Meile die Straße entlang.
»Ich liebe dich!«, rief er, während er sein Rad aus dem Apartment in den kalten Dezembermorgen schob. Sie hatte keine Zeit zu antworten, bevor die Tür hinter ihm ins Schloss fiel und er verschwunden war.
Plötzlich hatte Diana ein mulmiges Gefühl im Magen. Vermutlich eine Nachwirkung der Auseinandersetzung von gestern Abend. Auch wenn jetzt wieder alles in Ordnung zu sein schien, kam ihr der Streit irgendwie größer vor als ihre üblichen Kabbeleien wegen der schmutzigen Wäsche, die er auf dem Boden liegen ließ, oder der Zahnpastatube, die sie nicht zuschraubte. Hatte Linus wirklich gesagt, dass er seinen Antrag bereute? Hatte sie sich von ihrer Hysterie wegen dieser Hochzeit so verrückt machen lassen, dass es einen Keil zwischen sie und Linus trieb?
Einen Augenblick lang starrte sie auf die geschlossene Wohnungstür und widerstand nur mühsam dem Drang, nach draußen zu laufen und Linus zu umarmen. Doch dafür war keine Zeit. Sie hatten beide einen anstrengenden Tag vor sich. Heute Nachmittag würde sie die Beförderung bekommen, die sie verdiente, und am Abend würden sie und Linus den Rest ihres gemeinsamen Lebens zu planen. Und welche Probleme auch immer sie mit Familien und ernsthaften Bindungen hatte – würde sie bis dahin überwinden müssen.
Linus' Großvater lag falsch. Für immer und ewig war kein Mythos.
Die Ewigkeit war zum Greifen nah. Sie würde sie sich nehmen.
2. Kapitel
»Nun kommen Sie schon, Maria. Es ist saukalt hier draußen«, murmelte Diana, bevor sie zum dritten Mal an der Haustür ihrer Patientin klingelte.
Normalerweise öffnete Maria ihr immer sofort. Allerdings lebte die alte Frau allein, vielleicht war sie ja im Bad. Oder sie besuchte Verwandte und hatte vergessen, ihren Physiotherapietermin abzusagen.
Diana wusste nicht mal, ob Maria überhaupt Familie in Snow Haven, North Carolina hatte. Sie pflegte ein professionelles Verhältnis zu ihrer Patientin. Wenn sie mit ihr arbeitete, konzentrierten sie sich auf Marias Übungen, um der alten Dame etwas von der Kraft und Kondition zurückzugeben, über die sie vor ihrem Schlaganfall vergangenen Monat verfügt hatte.
Unter ihrem leichten Mantel zitterte Diana. Die Temperatur war in der Nacht so stark gesunken, dass der Rasen von Raureif überzogen war. Noch einmal läutete sie, bevor sie sich seufzend zum Gehen wandte. Als sie von drinnen Marias Stimme hörte, blieb sie abrupt stehen, drehte sich wieder um und legte ein Ohr an die Tür. »Maria?«
»Hilfe!«
Erschrocken schnappte Diana nach Luft. Sie drehte den Türknauf, doch die Tür war abgeschlossen. »Maria, ich bin hier«, rief sie, in der Hoffnung, dass die Patientin sie hören konnte. »Halten Sie durch!«
Hektisch suchte sie die Veranda nach einem offensichtlichen Schlüsselversteck ab, schaute unter einem Pflanzkübel nach, unter einem Gartenzwerg, hinter dem Windspiel und einem losen Fensterladen. Nichts. Kurz erwog sie, die Tür einzutreten, kam aber zu dem Schluss, dass es professioneller wäre, den Notruf zu wählen.
Diana hastete zu ihrem Auto, wo sie das Handy zurückgelassen hatte, und tippte die Nummer ein.
»Neun-eins-eins, um welchen Notfall geht es?«
Mit zitternder Hand presste Diana das Telefon an ihr Ohr. »Ja, äh, ich sitze gerade vor dem Haus meiner Patientin. Ihr Name ist Maria Harris. Ich bin ihre Physiotherapeutin. Maria hat mir nicht geöffnet, doch ich kann sie von drinnen um Hilfe rufen hören. Ich weiß nicht, was ich tun soll.«
Nach ein paar weiteren bohrenden Fragen versicherte die Telefonistin, dass Hilfe unterwegs war. Diana blieb nichts anderes übrig als zu warten. Dass Maria rufen konnte, war ein gutes Zeichen, dachte sie. Offensichtlich konnte die alte Dame das Telefon nicht aus eigener Kraft erreichen. War sie gestürzt? Hatte sie einen zweiten Schlaganfall erlitten? Die möglichen Szenarien überschlugen sich in Dianas Kopf, bis der erste Streifenwagen mit heulenden Sirenen, dicht gefolgt von einem Rettungswagen, am Bordstein hielt. Das Blaulicht der Einsatzfahrzeuge konkurrierte mit den glitzernden Weihnachtsdekorationen der Nachbarhäuser.
Hilflos verfolgte Diana das Geschehen und fragte sich, wie ihr Morgen bereits so ereignisreich hatte werden können. Die meisten Tage waren das glatte Gegenteil. Ihr Alltag verlief recht gleichförmig. Sie besuchte einen Patienten nach dem anderen, die Abende verbrachte sie mit Linus. Sie mochte ihr Leben so, wie es war, auch wenn sie sich in letzter Zeit nach ein bisschen mehr Abwechslung sehnte. Die Beförderung im Job könnte dabei helfen. Und die Ehe mit Linus. Mit Sicherheit würde ihr Leben sich ändern, wenn sie in die Familie Grant einheiratete, eine Perspektive, die sie gleichermaßen aufregend und beängstigend fand.
An ihr Auto gelehnt, beobachtete Diana, wie ein Mann versuchte, die Haustür zu öffnen. Als ihm das endlich gelang, verschwand ein Team aus Polizisten und Rettungssanitätern im Haus. Kurz darauf brachten zwei Sanitäter Maria auf einer Trage nach draußen. Diana eilte an ihre Seite.
»Maria! Maria, geht es Ihnen gut?«
Maria drehte den Kopf und ließ ihren Blick suchend über die kleine Gruppe von uniformierten Männern und Frauen schweifen, die sich in ihrem Vorgarten versammelt hatte. Als sie Diana entdeckte, lächelte sie ihr herzlich zu. »Oh, Diana. Machen Sie sich keine Sorgen. Mir geht es gut, meine Liebe. Ich bin nur hingefallen. Ich glaube, mein Knöchel ist gebrochen.« Sie versuchte, ihren Fuß zu bewegen, und verzog schmerzerfüllt das Gesicht.
»Gebrochen?« Marias rechtes Bein war nach dem Schlaganfall geschwächt. »Was ist passiert?«
»Es ist mir ziemlich peinlich.« Verschämt schaute Maria zu den beiden Sanitätern, die stehen geblieben waren, damit sie mit Diana reden konnte. »Ich habe versucht, auf den Dachboden zu steigen, um meine Weihnachtsdekoration herunterzuholen.«
Diana starrte sie entsetzt an. »Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie damit warten sollen.«
»Aber worauf denn? Und auf wen? Es musste erledigt werden, und ich fühlte mich heute morgen recht gut, also habe ich beschlossen, mich darum zu kümmern.«
»Das war viel zu riskant«, bemerkte Diana kopfschüttelnd. »Sie haben sich für ein bisschen Festtagsschmuck verletzt?«
Einen kurzen Moment lang wirkte Maria beleidigt. »Weihnachtsstimmung ist wichtig.«
Der Sanitäter auf der rechten Seite der Trage räusperte sich. »Wir bringen sie ins East Medical«, sagte er zu Diana.
East Medical war das örtliche Krankenhaus. Diana kannte es gut. Sie hatte es während Grandma Dennys Krankheit oft besucht, um ihrer Großmutter zur Seite zu stehen, in der Hoffnung, damit wiedergutzumachen, dass sie sie aufgenommen hatte. Zwar konnte Denny ihrer heranwachsenden Enkelin nicht viel emotionale Unterstützung geben, doch ansonsten hatte es Diana an nichts gefehlt. Sie bekam ihr eigenes Zimmer, drei warme Mahlzeiten am Tag und mit sechzehn eine alte Klapperkiste von Auto, mit dem sie erst zu ihren diversen Schülerjobs und später zur Physiotherapieschule gefahren war.
Die Sanitäter machten Anstalten, die Trage weiterzurollen, und Diana trat einen Schritt zurück. »Passen Sie auf sich auf, Maria. Wenn Sie bereit sind, die Physiotherapie wieder aufzunehmen, bin ich für Sie da.« Sie beobachtete, wie Maria in den Rettungswagen geschoben wurde, und ging dann zurück zu ihrem Auto. Noch immer schlug ihr das Herz bis zum Hals nach diesem Schock am Morgen. Warum um alles in der Welt hatte Maria versucht, auf den Dachboden zu steigen? Sie konnte kaum laufen, was einer der Gründe für ihre Physiotherapie war.
Diana ließ sich auf den Fahrersitz fallen und zog die Tür zu, um die eisige Luft auszusperren. Sie griff zu ihrem Handy, in der Hoffnung, eine Nachricht von Linus vorzufinden. Normalerweise schickte er ihr über den Tag verteilt verschiedene Nachrichten, von witzigen GIFs bis hin zu spontanen Überlegungen und Mitteilungen, die sie Linusismen getauft hatte. Doch diesmal wartete nichts auf sie. Er war wohl noch immer in seinem Meeting mit dem Spielzeuglieferanten.
Sie schrieb ihm eine Nachricht.
Diana: Ich hoffe, dein Vormittag verläuft geordneter als meiner.
Als er nicht sofort reagierte, fuhr sie zu ihrer nächsten Patientin.
Addy war sechzehn Jahre alt und litt unter akuter myeloischer Leukämie, momentan in Remission. Vor ihrer Erkrankung hatte sie aktiv im Basketballteam ihrer Highschool gespielt und war bereits auf der Suche nach dem passenden College gewesen. Der Krebs scherte sich jedoch nicht um irgendwelche Zukunftspläne. Oder darum, wie alt jemand war.
Während der Fahrt spielte Diana am Radio herum. Auf sämtlichen Sendern erklangen Weihnachtslieder, was sie jedoch nicht weiter störte. Sie sang bei Mariah Careys All I Want for Christmas Is You mit und dachte ernsthaft über Linus' Idee einer Weihnachtshochzeit nach. Das Lied könnte eine gute Wahl für die Zeremonie sein. Wie sie Linus kannte, würde er ihr den Song beim Hochzeitsempfang vermutlich als Ständchen bringen. Er war der Meinung, singen zu können, und Diana würde ihm niemals sagen, dass das nicht stimmte, auch wenn der Mann absolut keinen Ton traf.
Vielleicht sollte sie ihm vorschlagen, zusammen durchzubrennen. Aber darauf würde Linus sich wohl kaum einlassen. Er wollte ihren großen Moment bestimmt mit seinen Liebsten teilen. Linus war ein Familienmensch. Und, nun ja, Diana war definitiv keiner, auch wenn sie sich oft ausgemalt hatte, wie es wäre, Teil einer großen Familie zu sein.
Sie parkte am Straßenrand vor dem Haus der Pierces, stieg die Stufen zur Veranda hoch und klingelte. Von drinnen näherten sich schlurfende Schritte, dann öffnete Mrs. Pierce die Tür und lächelte Diana strahlend an.
»Ms. Diana!« Sie bedeutete ihr einzutreten.
Diana kam ohne Umschweife zur Sache. »Guten Morgen. Wie geht es Addy heute?«
Cecilia Pierce hob die Schultern, ein wenig ratlos. »Sie ist kaum aus ihrem Zimmer gekommen, um hallo zu sagen. Soweit ich weiß, hört sie Musik.«
»Hat sie Schmerzen?«
»Sie kennen doch Addy. Sie würde sich nie beklagen. Aber ich glaube, sie fühlt sich recht wohl.«
»Gut. Dann schaue ich jetzt nach ihr, wenn das in Ordnung ist.«
»Natürlich. Vielen Dank.«
Addys Zimmer lag am Ende des dämmrigen Flurs. Diana klopfte und wartete auf Antwort, sich innerlich wappnend für das, was sie erwartete.
Jedes Mal, wenn sie Addy sah, war das Mädchen dünner als zuvor. Ihre Leukämie war aggressiv gewesen, doch sie hatte dagegen angekämpft, und sie hatte gewonnen. Nun war ihr Körper durch die Behandlung geschwächt, daher hatte der Arzt ihr eine Physiotherapie verordnet.
»Herein«, rief Addy.
Diana öffnete die Tür und trat ein. Die hellvioletten Wände waren mit Boybandpostern und Basketballfanartikeln geschmückt. Auf dem Nachttisch und in einem Bücherregal verteilt, standen Dutzende Fotos von Angehörigen und Freunden.
Addy entfernte ihre Ohrhörer. »Hi.«
»Hey. Wie geht’s?«, fragte Diana.
Addy war blass, doch ihre blauen Augen blickten klar und heiter. Das war ein gutes Zeichen. »Okay.«
»Deine Mom sagt, dass du dich den ganzen Tag hier verkriechst.«
Addy rollte mit den Augen, wie eine ganz normale Teenagerin. Auch das war ein gutes Zeichen. »Wenn ich diesen Raum verlasse, gluckt meine Mom um mich herum, als wäre ich eine Porzellanpuppe, die jeden Moment in eine Million Stücke zerbrechen kann.«
Diana stellte ihre Tasche auf dem Boden neben dem Nachttisch ab. »Sie liebt dich.«
»Nun ja, sie erdrückt mich aber auch, also …« Addy beendete den Satz nicht. Ihr Blick fiel auf Dianas Diamantring. »Wann heiraten Sie denn nun eigentlich?«
Seufzend zog Diana sich einen Stuhl heran. »Ich stelle hier die Fragen, nicht du.«
Addy schob die Unterlippe vor. Das gehörte zu ihrer Routine. Addy steckte ihre Nase in Dianas persönliche Angelegenheiten, Diana rief sie zur Ordnung, und Addy schmollte. Oder warf Diana wie gestern an den Kopf, sie sei eine Elsa. »Sie sind eine Spielverderberin.«
»Das höre ich öfter. Zum Beispiel jede Woche von dir.« Diana holte den Firmenlaptop aus ihrer Tasche. Sie musste dem Mädchen jede Woche eine Reihe gesundheitsbezogener Fragen stellen. Bevor sie beginnen konnte, leierte Addy schon die Antworten herunter.
»Ich bin eine Fünf auf der Schmerzskala. Ich war heute morgen schon auf der Toilette. Nummer eins, nicht zwei. Zum Frühstück hatte ich Orangensaft und eine Scheibe Toast. Keine Übelkeit, kein Erbrechen.«
Diana lächelte leicht. »Schon klar, Klugscheißerin. Aber du musst mir das alles noch mal sagen, wenn ich meinen Rechner hochgefahren habe.«
Addy grinste stolz, doch die Heiterkeit erreichte ihre Augen nicht ganz.
Diana füllte den Wochenbericht für Addy aus. »Eine Fünf auf der Schmerzskala, sagtest du?«
Addy zuckte beiläufig mit den Schultern. »Oder noch nicht mal das, wenn man das Herz nicht mitzählt.«
Besorgt schaute Diana von ihrem Keyboard auf. »Du hast Brustschmerzen?«
Addy rollte mit den Augen. »Nein. Mein Herz-Herz. Sie wissen schon, das, wo all die Gefühle wohnen.«
»Ach.« Diana zögerte. Wollte sie wirklich in das Wespennest stechen, die Emotionen einer Teenagerin aufzudröseln? Das war eher der Bereich ihrer besten Freundin Rochelle, die Kinderpsychologin war. Rochelle diskutierte liebend gern über Gefühle. Während Diana es vorzog, sich mit physischen Problemen und körperlichen Schmerzen zu beschäftigen. »Los, wir gehen jetzt mal zusammen ins Badezimmer, okay?«
Addy stieß einen tiefen Seufzer aus. »Es ist so seltsam, dass ein Gang zum Waschbecken plötzlich Bewegungstraining für mich ist. Ich bin früher eine Stunde am Stück übers Spielfeld geflitzt.«
»Und das wirst du auch wieder tun«, versprach Diana. »Aber im Moment müssen wir kleine Schritte machen, um zum Ziel zu gelangen. Dein Körper muss erst wieder aufbauen, was er während der Chemotherapie verloren hat. Komm, lass uns loslegen.« Diana gab sich Mühe, so auffordernd in die Hände zu klatschen wie ein Basketballtrainer.
Es funktionierte. Langsam setzte Addy sich auf. Als sie ihre Beine über die Bettkante schob, zuckte sie zusammen und sah aus, als ob sie mehr als eine Fünf auf der Schmerzskala empfand. Dann erhob sie sich, atmete tief durch, und ging Richtung Badezimmer. Diana blieb dicht hinter ihr, für den Fall, dass Addys Beine nachgaben.
Vor dem Waschbecken blieb Addy stehen und starrte ihr Spiegelbild an, als hätte sie sich seit Tagen nicht mehr angeschaut. Unwillkürlich fragte Diana sich, was das Mädchen dachte.
»Bin ich immer noch hübsch?«, wollte Addy schließlich wissen.
»Natürlich bist du das, Addy. Es sind nur Haare. Sie wachsen nach.«
Im Spiegel suchte Addy ihren Blick. Ihre Augen funkelten zornig. »Das kann nur jemand sagen, der so viele Haare hat, wie er sich nur wünschen kann. Würden Sie auch jemanden, der eine Amputation hatte, so trösten, nach dem Motto: Es ist ja nur ein Bein?«
Konsterniert hob Diana die Brauen. »Ein Bein kann nicht nachwachsen. Dein Haar schon.«
Plötzlich schwammen Addys Augen in Tränen. Nein, nein, nein. Bitte nicht weinen. »Dann finden Sie wohl auch, dass es keine große Sache ist, meinen Freund und meine beste Freundin zu verlieren? Schließlich kann ich mir ja neue suchen, nicht wahr?«
Verzweifelt suchte Diana nach den richtigen Worten, in der sicheren Gewissheit, dass ihr bei der falschen Antwort diese Therapiesitzung um die Ohren fliegen würde. »Ich wusste nicht, dass du einen Freund hast«, erwiderte sie.
»Nun, ich habe ja auch keinen. Nicht mehr.« Wütend wischte sich Addy eine Träne aus dem Gesicht.
»Hör zu, was immer ich gesagt habe, um dich so aufzuwühlen, tut mir leid. Ich wollte deine Gefühle nicht verletzen, Addy.«
»Es sind nicht nur Haare«, stieß Addy zwischen zusammengebissenen Zähnen hervor. Sie lehnte am Waschbecken, die dünnen Arme um den Oberkörper geschlungen. »Es ist nicht mal nur Krebs. Es ist mein Leben, verstehen Sie das nicht? Und es fühlt sich für mich gerade so an, als ob es vorbei ist. Meine größte Leistung heute wird sein, dass ich zum Waschbecken gelaufen bin und fünf Minuten davor gestanden habe. Das ist einfach nur Scheiße!« Ihre Stimme zitterte, ihre erhitzten Wangen waren tränenüberströmt. »Niemand versteht, wie es mir geht, deshalb fühle ich mich umso mehr allein. Abgesehen davon, dass ich hier in diesem Moment in der Tat vollkommen allein bin.«
»Das stimmt nicht«, sagte Diana. »Ich bin auch hier.«
Wieder trafen sich ihre Blicke im Spiegel. »Ich kenne Sie ja nicht mal richtig. Sie sind nur eine Fremde mit einem vertrauten Gesicht.«
Diana wand sich innerlich. Gestern hatte Addy sie als Elsa beschimpft, heute erklärte sie sie zur vertraut aussehenden Fremden. Teenager konnten wirklich grausam sein. »Addy, ich …«
»Egal.« Addy drehte sich vom Becken weg und machte einen wackeligen Schritt auf Diana zu. »Entschuldigen Sie bitte. Ich will einfach nur ins Bett zurück. Ich muss mit meinen Kräften haushalten. Das ist es doch, worauf Sie immer herumreiten, oder? Dass ich mich nicht verausgaben darf.«
»Ja.« Müde seufzend trat Diana zur Seite, um das Mädchen vorbeizulassen. Zurück ins Bett zu gehen, klang auch für sie gerade nach einer sehr verlockenden Idee.
3. Kapitel
Geistesabwesend drehte Diana ihren Perlohrring und versuchte, sich auf ihr Gespräch mit Mr. Powell zu konzentrieren, statt daran zu denken, wie Maria heute Morgen mit einem Rettungswagen abtransportiert worden war und Addy sie in hohem Bogen aus ihrem Zimmer geworfen hatte. Auch die Tatsache, dass Linus immer noch nicht auf ihre Textnachricht geantwortet hatte, obwohl es inzwischen vierzehn Uhr war, beschäftigte sie. Bei seinem Aufbruch schien er guter Dinge gewesen zu sein, aber vielleicht hatte ihm der Streit von gestern Abend doch mehr zugesetzt, als er durchblicken ließ.
Nun, sie würde heute Abend alles in Ordnung bringen. Wenn dieses Gespräch hinter ihr lag. Vorigen Monat hatte Diana sich beim Powell Rehabilitation Center um eine Beförderung beworben, und sie ging davon aus, dass ihr Chef sie deshalb heute zu sich gebeten hatte. Diana arbeitete seit sieben Jahren für das Rehazentrum, hatte kaum Fehlzeiten, und es gab keine einzige Beschwerde gegen sie. Es war höchste Zeit für etwas Neues, und die ausgeschriebene Position schien ihr genau das Richtige zu sein.
»Sie müssen heute Morgen einen ganz schönen Schreck bekommen haben«, bemerkte Mr. Powell.
Diana rang sich ein souveränes Lächeln ab. Ihr Tag hatte nicht gerade optimal begonnen, trotzdem war sie bezüglich dieses Gesprächs zuversichtlich. Von jetzt an würde sich alles zum Besseren wenden, das spürte sie in ihren Knochen.
»Ich musste bislang noch nie den Notruf wählen. Das war definitiv eine neue Erfahrung.« Sie schüttelte seufzend den Kopf. »Und keine, die ich so schnell wiederholen möchte.« Sie saß sehr aufrecht auf ihrem Stuhl, mit gestrafften Schultern, genau wie der Mann ihr gegenüber. Von Natur aus war Diana nicht unbedingt der selbstsichere Typ, konnte sich bei Bedarf aber so präsentieren.
Mr. Powell nickte. »Zum Glück hatten Sie Ihren Termin mit Ms. Harris. Wer weiß, wie lange sie sonst da gelegen und um Hilfe gerufen hätte.«
Das wollte Diana sich nicht mal vorstellen. »Maria ist eine sehr willensstarke Frau. Als sie erwähnte, dass sie ihren Weihnachtsschmuck vom Dachboden holen muss, sagte ich ihr, dass sie das auf keinen Fall allein tun sollte. Schließlich macht sie nicht ohne Grund diese Physiotherapie. Aber ich habe wohl ihren Dickschädel unterschätzt.«
»Sturheit ist eine gute Eigenschaft bei Patienten. Meiner Erfahrung nach arbeiten diese Leute bei einer Therapie am besten mit.« Mr. Powell lachte leise. »Und für Weihnachtsfans ist Dekoration sehr wichtig. Meine Mutter hat das Zeug immer schon am Tag nach Thanksgiving hervorgeholt.«
Diana war zwar nicht sicher, was Maria und der Weihnachtsschmuck mit ihrer Beförderung zu tun hatten, lächelte aber tapfer weiter, auch wenn ihre Handflächen langsam feucht wurden. Sie schlug die Beine übereinander und lehnte sich im Stuhl zurück. »Jedenfalls hat der Rettungswagen Ms. Harris ins East Medical gebracht. Ich bin sicher, dass es ihr schon viel besser geht. Zumindest hoffe ich das.«
»Sie haben nicht nachgefragt?« Hinter seiner Brille runzelte Mr. Powell die Stirn.
Der vorwurfsvolle Ton erwischte Diana kalt. »Nein, noch nicht. Ich hatte gleich danach eine andere Patientin.« Es wäre doch gewiss nicht in Mr. Powells Sinn gewesen, wenn Diana den nächsten Termin abgesagt hätte. »Ich rufe sie gleich nach diesem Gespräch auf ihrem Handy an, vielleicht schaue ich auch direkt im Krankenhaus vorbei.«
Das brachte ihr ein Lächeln ein. »Gute Idee. Und wenn Sie das tun, sagen Sie Ms. Harris doch, dass es uns ein Vergnügen wäre, ihre Weihnachtsdekoration anzubringen. Wir machen das gern für sie, schließlich wollen wir ja nicht, dass sie sich noch mal verletzt.«
Verblüfft starrte Diana ihn an. »Wir?«
»Das Personal hier bei Powell Rehabilitation. Wie Sie wissen, sind wir ein familiengeführtes Unternehmen, und unsere Patienten sind für uns wie Familienmitglieder. Wenn Ms. Harris ein festlich geschmücktes Haus möchte, dann ist es ein Klacks für uns, ihr das zu ermöglichen. Tatsächlich hat William bereits seine Hilfe angeboten.«
»William«, wiederholte Diana. William Davis war einer ihrer Kollegen. Er war jung, Single und energiegeladen. Und er behandelte alle Leute, als wären sie beste Freunde, was Diana aus irgendeinem Grund auf die Nerven ging. Beste Freunde musste man sich erarbeiten, man bekam sie nicht einfach so binnen dreißig Minuten auf dem Silbertablett serviert. Ihre beste Freundin Rochelle kannte Diana seit zwei Jahrzehnten. Sie waren sich in der Mittelstufe über den Weg gelaufen und hatten nach einer Phase heftiger gegenseitiger Abneigung etliche Gemeinsamkeiten entdeckt, aus denen sich im Laufe der Zeit eine Freundschaft entwickelt hatte. »Das ist … nett von ihm.«
»Das stimmt. William schmeißt sich für seine Patienten wirklich ins Zeug, nicht wahr?«
Er sagte das so, als wäre es eine gute Sache, eine Einschätzung, die Diana nicht zwingend teilte. »Aber Maria ist nicht seine Patientin.« Sie lächelte zittrig, um zu überspielen, dass sie sich plötzlich in einer Verteidigungsposition wahrnahm. Diana konnte förmlich spüren, wie ihr Selbstvertrauen dahinschmolz, zusammen mit ihrem komplett nutzlosen Deodorant.
Mr. Powell breitete die Arme aus, als wolle er die Welt umarmen. »Wie gesagt, wir sind hier bei Powell Rehabilitation eine große Familie. Eine große glückliche Familie.«
»Natürlich.« Diana hatte zwar nicht viel Ahnung von Familien, glaubte aber nicht, dass ihr Arbeitsplatz unter den Begriff fiel. Arbeit zählte zum professionellen Teil des Lebens, Familie und Freunde waren etwas Persönliches. Man sollte diese beiden Dinge nicht vermischen.
»Deshalb habe ich Sie heute hergebeten, Diana«, fuhr Mr. Powell fort.
Diese Bemerkung war das erste Warnsignal für sie. Diana hatte ganz selbstverständlich angenommen, dass ihr Chef bei diesem Treffen über die Beförderung sprechen wollte, für die sie sich beworben hatte. Und sie war hundertprozentig davon ausgegangen, dass sie sie auch bekommen würde. Doch die neue Position hatte nichts mit William oder Maria zu tun.
Mr. Powell musterte sie über den Rand seiner Brille hinweg. »Ich bin gern offen mit meinen Angestellten. Sie sind eine der besten Therapeutinnen, die ich habe, Diana, ich hoffe, das wissen Sie.«
»Vielen Dank, Sir.« Ihr Selbstvertrauen erholte sich wieder. Womöglich ging es ja doch um die Beförderung. Vielleicht würden sie und Linus in ein paar Stunden auf ihre neue Rolle in der Firma anstoßen.
»Aber …« Mr. Powell zögerte.
Und das war das zweite Warnsignal.
»… ich sehe Sie momentan nicht in einer Führungsposition.« Er klang beinahe entschuldigend.
Diana schluckte, während seine Worte langsam in ihren Verstand sickerten. Ein Wirbel aus Emotionen kochte in ihr hoch. Enttäuschung. Verwirrung. Demütigung. Sie wusste nicht, was sie sagen sollte, also sagte sie nichts, saß einfach nur wie betäubt da und starrte ihren Chef an. Sie hob eine Hand, um an ihrem Perlohrring zu spielen, eine nervöse Angewohnheit, die ihr dabei half weiterzuatmen. Drehen – einatmen. Drehen – ausatmen. Drehen. Drehen. Fang bloß nicht an, in Mr. Powells Büro zu hyperventilieren.
»Eine Führungskraft benötigt eine komplexe Kombination aus Können, Erfahrung und Herz«, fügte Mr. Powell hinzu. »Daher habe ich vor, William zu befördern. Ich bin sicher, Sie verstehen das und gratulieren ihm zu seiner neuen Position.« Er lächelte freundlich, als wäre diese Information keine große Sache.
»William?« Ihre Stimme klang schrill, und sie drehte ihren Ohrring in Rekordgeschwindigkeit. »Aber William arbeitet noch nicht so lange hier wie ich.« Sie war dienstälter. Diese Beförderung stand nach Fug und Recht ihr zu.
»Zeit ist relativ. William mit seiner Leidenschaft für Patientenversorgung und seinem guten Verhältnis zum Personal wird einen exzellenten Vorgesetzten abgeben.«
Wie konnte das passieren? Träumte sie? Hatte sie einen Albtraum? William würde ihr Vorgesetzter sein? Sie war diejenige, die ihn eingearbeitet hatte. Lag es daran, dass er ein Mann war? Diana hatte Mr. Powell nie für sexistisch gehalten, aber welchen anderen Grund konnte er haben, sie zu übergehen, um William zu befördern?
»Praktisch jeder Patient, mit dem William arbeitet, reicht eine begeisterte Glow Card ein«, fuhr Mr. Powell fort, ohne auf ihre aufgewühlten Gefühle zu achten.
Diese sogenannten Glow Cards, mit denen Patienten ihren jeweiligen Therapeuten bewerten konnten, lagen der Informationsbroschüre bei, die jeder Patient vor Beginn seiner Behandlung erhielt. Man konnte sie direkt oder online ausfüllen. Nach Dianas Erfahrung verzichteten die meisten Patienten darauf, es war optional und machte Extramühe. Vermutlich drängte William seine Patienten dazu, diese Karten auszufüllen. Womöglich bestach er sie sogar oder schrieb sich selbst glühende Glow Cards.
»Ein guter Vorgesetzter muss mehr können als Papierkram erledigen«, bemerkte Mr. Powell beiläufig.
»Wie bitte?« Entgeistert starrte Diana ihn an. »Ich pflege ein gutes Verhältnis zu meinen Kollegen und meinen Patienten.«
»Selbstverständlich tun Sie das. Ich wollte damit nur sagen, dass Management nicht einfach ist.« Er nickte ihr zu. »Tatsächlich habe ich in den vergangenen zwei Wochen eine Glow Card für Sie erhalten.«
Obwohl Diana drauf und dran war, entweder in Tränen auszubrechen oder mit irgendwas um sich zu werfen, zum Beispiel mit dem Kristallbilderrahmen auf Mr. Powells Schreibtisch, hellte diese Neuigkeit ihre Stimmung etwas auf. Noch nie hatte sie eine Glow Card erhalten, während ihre Kollegen jedes Jahr mehrere bekamen. Was machten die bloß anders als sie?
»Einer meiner Patienten hat eine Karte eingereicht?«
Mr. Powell lächelte nicht, wirkte stattdessen zum ersten Mal während ihres Gesprächs leicht nervös, als er zu einem Blatt Papier griff, das vor ihm auf dem Tisch lag. Er blinzelte ein paarmal, bevor er begann, die Bewertung vorzulesen. »Diana Merriman ist eine qualifizierte Physiotherapeutin. Sie schien zu wissen, was sie tat, auch wenn ich ihren Umgang oft reichlich kurz angebunden fand.«
»Kurz angebunden?« Und das soll ein Kompliment sein? »Wer hat das geschrieben?«, wollte sie wissen.
Mr. Powell schüttelte den Kopf. »Das spielt keine Rolle. Allein die Tatsache, dass sich ein Patient die Zeit genommen hat, Sie zu bewerten, ist ein Fortschritt.« Er legte das Blatt Papier wieder auf den Tisch. »Und Fortschritt ist immer willkommen. Das wird sich in ein paar Monaten gut auf Ihrem Jahresbericht machen«, fügte er hinzu, als ob ihr das jetzt ein Trost sein könnte. »Diana, ich möchte, dass Sie wissen, wie sehr man Sie hier respektiert. Wie ich vorhin bereits sagte, kann Powell Rehabilitation sich glücklich schätzen, Sie an Bord zu haben. Ich kann mich immer darauf verlassen, dass Sie neue Kollegen bestens einarbeiten.«
»Was im Grunde zur Rolle einer Führungskraft gehört«, merkte Diana an. Ihr gezwungenes Lächeln fühlte sich inzwischen mehr wie ein unbehagliches Zucken an. »Ich bin nicht kurz angebunden. Ich bin professionell«, betonte sie matt.
»Dem widerspreche ich nicht. Seien Sie versichert, dass William sehr viel von Ihnen hält. Bei ihm als Vorgesetzten sind Sie in guten Händen. Und er kann Ihnen gewiss ein paar Tipps geben, was den Umgang mit Patienten betrifft.«
»Mein Umgang mit Patienten ist völlig in Ordnung«, gab Diana zurück. »Ich weiß nicht, wer diese Bewertung geschrieben hat, aber meine Patienten wirken immer sehr zufrieden mit mir, Sir. Vielleicht stecke ich meine Nase nicht in ihre Privatangelegenheiten, aber ich bin bestimmt nicht kurz angebunden.«
»Gewiss nicht.« Mr. Powell stand auf und streckte ihr die rechte Hand hin. Das Meeting war offensichtlich vorbei. Es war gar kein echtes Personalgespräch gewesen. Mr. Powell hatte sich nur nach Marias Unfall erkundigt und ihr netterweise direkt mitgeteilt, dass sie sich die Beförderung abschminken konnte. Und dass sie eine Glow Card bekommen hatte, in der sie als »kurz angebunden« beschrieben wurde.
Auf zitternden Beinen erhob sich Diana, um ihrem Chef über den Schreibtisch hinweg die Hand zu schütteln. Dabei stieß ihr Arm gegen eben jenen Bilderrahmen aus Kristallglas, den sie vorhin erwogen hatte, an die Wand zu werfen. Noch immer halb erstarrt vor Ungläubigkeit und Enttäuschung schaute sie zu, wie er erst langsam hin und her wackelte und dann vor ihren Füßen auf den Boden fiel, wo er in winzige Stücke zerbrach, die wie Eissplitter glitzerten.
Vielleicht bin ich ja tatsächlich Elsa, die Eiskönigin.
Entsetzt schnappte Diana nach Luft. »Es tut mir so leid.«
Mr. Powell senkte den Arm, und sein Lächeln erstarb. Dann räusperte er sich. »Machen Sie sich keinen Kopf, Diana. Ich rufe jemanden, der das saubermacht. Bilderrahmen kann man ersetzen, gute Mitarbeitende nicht. Wir wissen Ihren unermüdlichen Einsatz für diese Firma wirklich sehr zu schätzen.«
Aber offenbar nicht genug. Sie war eine gute Mitarbeiterin, während William ihre Beförderung abstaubte. Die Anzahl seiner Patienten würde um ein Viertel reduziert werden, damit er sich darauf konzentrieren konnte, das Personal einzuteilen, neue Kollegen anzuheuern und innerbetriebliche Angelegenheiten zu managen. Das alles konnte Diana genauso gut leisten. Sie tat es bereits.
Wie benommen trat sie aus dem Gebäude auf den Fußweg. Sie atmete zittrig durch, und die kalte Luft prickelte in ihrer Lunge.
Nicht weinen.
Sie hastete über den Parkplatz. Wenn sie doch bloß einen Mantel angezogen hätte. Es war wirklich eisig. Snow Haven lag mitten in den Blue Ridge Mountains. Im Winter wurde es oft so kalt, dass es in den Bergen schneite, allerdings erreichten die weißen Flocken nur selten das Tal, in dem die Stadt lag. Als hier das letzte Mal Schnee gelegen hatte, war Diana achtzehn gewesen. Ihre Großmutter war gerade gestorben, und auf ihrer Beerdigung hatte Diana dicke Fellstiefel zum langen schwarzen Kleid getragen. Grandma Denny hätte das gebilligt. Sie war eine sehr praktisch veranlagte alte Dame gewesen. Manche Leute hätte sie womöglich als »kurz angebunden« bezeichnet. Vermutlich sogar die meisten.
Als Diana ihr Auto aufschloss, zog sich ihr Magen schmerzlich zusammen. Hatte sie sich womöglich ohne es zu wollen in ihre Großmutter verwandelt?
Mühsam die Tränen zurückhaltend, ließ sie sich auf den Fahrersitz fallen, zog die Tür zu und drehte den Schlüssel im Zündschloss. Während der Motor summend zum Leben erwachte, überschlugen sich ihre Gedanken. Seit einem Monat hatte sie sich mental auf das Personalgespräch vorbereitet, hatte extra viel Einsatz mit Patienten und neuen Kollegen gezeigt, um zu beweisen, dass sie das Zeug zur Managerin hatte. Sie war die erfahrenste Mitarbeiterin, verantwortungsbewusst und verfügte, ihrer bescheidenen Meinung nach, über alle Qualitäten, die ein Chef sich für eine Führungsposition nur wünschen konnte.
Doch offenbar hatte sie sich geirrt.
Diana umklammerte das Lenkrad und fragte sich verzweifelt, ob sie während des Gesprächs irgendetwas hätte besser machen können, um Mr. Powell davon zu überzeugen, dass sie die richtige Kandidatin für den Job war. Aber spielte das überhaupt noch eine Rolle? Es war zu spät. Mr. Powell hatte seine Entscheidung bereits getroffen, bevor sie in sein Büro gekommen war, und das Leben gewährte keine zweiten Chancen.
Nach ein paar tiefen, beruhigenden Atemzügen fuhr sie vom Parkplatz des Rehazentrums. Sie hatte sich bereits vorab den Rest des Nachmittags frei genommen, für den Fall, dass Mr. Powell ihr gleich das neue Büro zeigen wollte, in das nun der Kaugummi schmatzende, dröhnend lachende William einziehen würde.
Diana wusste nicht, was sie jetzt mit sich anfangen sollte. Sie könnte im Toy Peddler vorbeischauen, um Linus zu treffen, aber der war bei der Arbeit und hatte immer wieder erwähnt, dass der Dezember ein anstrengender Monat für ihn war. Vielleicht sollte sie ihn einfach in Ruhe lassen und direkt in die Wohnung fahren. Sie könnte ein Glas Wein trinken, ein heißes Bad nehmen und online ein paar Geschenke für die Leute auf ihrer Weihnachtsliste shoppen. Und so tun, als hätte dieser Tag nie stattgefunden. O ja, das klang nach einem super Plan.
In diesem Moment piepte ihr Handy, das auf der Mittelkonsole lag. Sie tippte auf die Taste der Freisprechanlage am Lenkrad, um den Anruf anzunehmen.
»Treffen wir uns gleich?«, fragte Rochelle.
O Mist. Heute war Rochelles dreißigster Geburtstag, und Diana war mit ihr im Sparky’s auf den traditionellen Glückwunschdrink verabredet.
»Ich, äh, fühle mich nicht so gut«, erwiderte Diana. Das war nicht mal komplett gelogen. Sie fühlte sich tatsächlich ziemlich furchtbar nach den Ereignissen des heutigen Tages, der den gestrigen mittlerweile sogar noch an Schrecklichkeit überholt hatte.
»Was? Du sagst ab? Was ist los?« Rochelle klang besorgt. Als Psychologin wollte sie immer wissen, was im Argen lag, und sie reagierte genauso frustriert wie Linus, wenn Diana beteuerte, das absolut überhaupt nichts im Argen lag.
»Alles ist gut«, erwiderte sie.
»G-Wort-Alarm.« Rochelle hatte Diana vorgeworfen, in letzter Zeit allzu oft zu betonen, wie »gut« alles war. »Und wenn alles gut ist, gibt es keinen Grund, warum du dich nicht mit mir auf einen Drink treffen kannst. Nun komm schon, Diana. Ich bin Single und brauche jemanden, der mit mir auf die nächsten Jahrzehnte Geburtstagseinsamkeit anstößt.«
»Du wirst nicht mehr jahrzehntelang einsam bleiben«, versicherte Diana Augen rollend. Sie rollte vor einem Stoppschild aus, schaute nach rechts und links, um sich zu vergewissern, dass alles frei war, und fuhr dann weiter. »Tut mir leid, Rochelle. Nächstes Mal wieder.«
Am anderen Ende der Leitung herrschte Stille. Diana hasste es, die Menschen in ihrem Leben zu enttäuschen. Gestern Abend Linus und jetzt Rochelle. Frohnatur William hatte dieses Problem vermutlich nicht. Der brauchte wahrscheinlich niemals einen Moment für sich allein mit einem Glas Wein.
»Na schön«, sagte Rochelle schließlich leise. »Gute Besserung.«
»Danke. Alles Gute zum Geburtstag, Ro.«
»Keine Ahnung, wie gut der wird, da ich allein an der Bar sitzen und trinken werde. Wir reden Morgen weiter, Di.« Ohne auf eine Antwort zu warten, beendete Rochelle das Gespräch.
Tief durchatmend bog Diana in den Oakwood Drive ein und hielt vor einer roten Ampel an. Gedanken an Linus, Rochelle, Mr. Powell und ihre Patienten, von denen eine sie als Elsa bezeichnete und ein anderer als kurz angebunden, wirbelten durch ihren Kopf, während sie stumpf vor sich hinstarrte. Offenbar musste sie einigen Problemzonen in ihrem Leben zu Leibe rücken, angefangen bei ihrer Beziehung zu Linus. Sie waren verlobt, was bedeutete, dass sie einen Hochzeitstermin festsetzen mussten. Vielleicht konnte sie das Ganze bis nächstes Jahr Weihnachten hinausschieben, um länger Zeit zu haben, sich mental darauf einzustellen. Immerhin war dies hier erst ihr erstes gemeinsames Weihnachtsfest, und auch wenn sie alle bisherigen Schritte ihrer Beziehung im Rekordtempo hinter sich gebracht hatten, hieß das ja nicht, dass das auch beim Heiraten so sein musste. Sie könnten es langsam angehen lassen, damit Diana sich an Linus' Welt gewöhnen konnte, die so ganz anders war als ihre eigene.