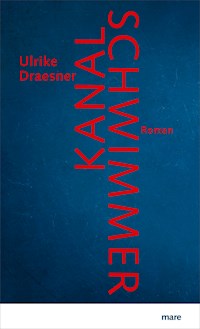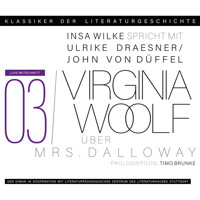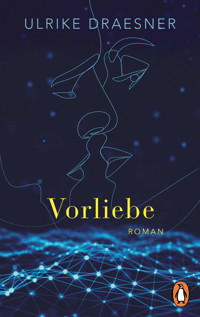3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Eine mitreißende weibliche Literaturgeschichte in neun klugen Essays
Das Lesen: ein Glück, soviel ist sicher. Aber was geschieht eigentlich, wenn wir uns in die Romane von Virginia Woolf und Antonia S. Byatt, in die Gedichte von Droste-Hülshoff und Friederike Mayröcker, in die Erzählungen von Ingeborg Bachmann hineinbegeben? Wie bahnt sich das Lesen seinen Weg, auf welche Weise berühren uns die erschriebenen, neuartigen Welten? Und welche Stimme ist es, die wir auf einmal immer deutlicher zu hören vermeinen?
Ulrike Draesners Band versammelt hinreißend intensive, spielerisch kluge und immer überraschende Porträts von neun Autorinnen – eine Liebeserklärung ans Leseglück. Über Ingeborg Bachmann, Antonia S. Byatt, Annette von Droste-Hülshoff, Gustave Flaubert, Friederike Mayröcker, Michèle Métail, Marcelle Sauvageot, Gertrude Stein, Virginia Woolf.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 235
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ulrike Draesner, 1962 in München geboren, wurde für ihre Romane, Gedichte und Essays vielfach ausgezeichnet, zuletzt mit dem Preis der LiteraTour Nord, dem Bayerischen Buchpreis, dem Deutschen Preis für Nature Writing sowie dem Großen Preis des Deutschen Literaturfonds. Draesner, seit 2018 Professorin am Deutschen Literaturinstitut Leipzig, lebt in Berlin. Sie ist Mitglied der Akademie der Künste Berlin und der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung.
Schöne Frauen lesen in der Presse:
»Wer Essays schreibt, sollte nicht nur schreiben, sondern auch denken können. Und beides mit Eleganz. Wie so etwas aussehen kann, zeigt die Lyrikerin und Prosaautorin Ulrike Draesner in ihrem Essayband.« Deutschlandradio
»Es gibt eben eine existentielle Qualität dieser vielleicht seltsamsten menschlichen Tätigkeit. Ulrike Draesners Buch führt sie vor und erforscht sie zugleich.« Die Zeit
Außerdem von Ulrike Draesner lieferbar:
Die Verwandelten
doggerland
Schwitters
Kanalschwimmer
Eine Frau wird älter
Mein Hiddensee
subsong
Heimliche Helden
Sieben Sprünge vom Rand der Welt
berührte orte
gedächtnisschleifen
Ulrike Draesner
Schöne Frauen lesen
Über Ingeborg Bachmann, Annette von Droste-Hülshoff, Friederike Mayröcker, Virginia Woolf u.v.a.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2007 by Luchterhand Literaturverlag München Copyright © 2023 dieser aktualisierten Taschenbuchausgabe by Penguin Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Umschlaggestaltung: Sabine Kwauka nach einem Entwurf und unter Verwendung einer Illustration von Roland Eschlbeck Gesamtherstellung: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN 978-3-641-29792-3V001www.penguin-verlag.de
SCHÖNE
(Def.)
Abk.
Foto von Monroe, im Ulysses von Joyce lesend
anatom.
alles oder nichts
biol.
bekannt als »Handicap«, etwa Pfauenschwanz. Sieht für uns »schön« aus, wird von Pfauenhennen aber geschätzt, weil sich zeigt: dieser Mann kann, anders als wir, die Weibchen, nicht fliegen, überlebt aber doch.
chirurg.
das unmittelbar der Schwerkraft unterworfene Dasein insbesondere der weiblichen Menschheit
christl. (NT)
die (schöne) Bescherung
etymol.
nach Grimm: vermutet Zsh. zu »skone«, heute »schonen«, der angeblich in Kontexten wie »verschon’ mich bloß damit« (woher soll ich denn wissen, was du anziehen sollst), weiterlebt. Volksetymolog. verwandt mit »schon« im Sinne von »rasch, vorzeitig« bzw. mit »stöhnen«.
nach Grimm, verbesserte Fassung, genannt Märchen: ein nie lügender Spiegel zerstört das Verhältnis zwischen Müttern und Töchtern. Am Ende sind zwei Frauen viele Jahre älter, und der Spiegel lügt noch immer nicht. Längst ist deutlich: eine muss gehen. Aber warum sitzen sie weiterhin zusammen?
euphem.
»Du bist die Schönste!«
exklam.
Mach mal schön Bitte!
film.
Die Schöne und das Biest dicht gefolgt von Black Beauty (dem Pferd)
gramm.
überdeterminiert, da mit den Artikeln der, die, das kombinierbar. Ideales Werbemittel für »Wir lernen deutsch«.
griech.
bekannt als »Birne Helene«. Frucht schälen, vierteln, entkernen, mit Schokosauce übergießen. Alternativer Name für das Endprodukt: »Trojanisches Pferd«. Vgl. auch »lit. allgem.« und »Abk.«.
hortic.
die Kirschen in Nachbars Garten
kulin.
»Süppchen« – »jetzt essen wir mal schön das …« Hauptverw.: Kitas, Seniorenresidenzen
literar. allgemein:
»die schöne Literatur«: Redewendung des 19. Jahrhunderts. Alles, was nicht wissenschaftlich, also nützlich ist, sondern beim Lesen Spaß macht. Verbunden mit Sofa, Genießen, Schokolade. Also nützlich, wenn auch auf eigene Art.
spezif: Goethe: »mehr Vulpius«
mathem.
a verhält sich zu b, wie a + b zu c. Es fällt auf: auch hier werden drei Einheiten benutzt, die partiell und wechselhaft verschmelzen. Siehe auch: Stoff für »literar.«, wobei a, b und c zu Personen werden.
meteorol.
was es früher nicht oft genug gab, während es nun zu häufig zu werden droht
meteorol. -nostalg.
Überleben des Wetterfrosches in seinem Glas
mil.
»freundliche Übernahme«
mythol.
Marie Curie begegnet Clark Gable. Er sagt: »Stellen Sie sich vor, wenn wir ein Kind hätten. Ihre Intelligenz und meine Schönheit.« Sie sagt: »Und was machen wir, wenn es andersherum kommt?«
philosoph.
bei Kant: Gefühl der Beförderung des Lebens. Bei Wittgenstein: Wortgebrauchsweise, u. a. zur Beförderung des Lebens im männlichen Cambridge
poet.
Tod durch Musen
verb.
lesen
FRAUEN
(Portale)
Annette von Droste-Hülshoff (1797–1848)
© ullstein – ullstein bild
Anna Elisabeth Franziska Maria Adolphina Wilhelmina Ludowica, aufgewachsen in einer Wasserburg nahe Münster, ledig, unternahm 1841 eine Wasserreise besonderer Art: Sie besuchte ihre Schwester, die mit Familie im Meersburger Schloss lebte, am Bodensee. Kaum war »Nettchen« angekommen, traf auch Lewin Schücking ein, muntere 17 Jahre jünger als die Dichterin, ehrgeizig, westfälischer Neu-Schriftsteller. Manche reden von »mütterlicher Liebe« – Drostes Gedichte aus der Zeit erzählen etwas anderes. Im April ’42 reiste Schücking wieder ab. Die Dichterin, klein, blond, stark kurzsichtig, die Augen wölbten sich vor wie bei einem Frosch, ging wieder allein spazieren.
Weibliche Welten? Ja, Annette war witzig, bissig, satirisch. Musste Nichten und Neffen hüten. Das Schloss in Meersburg besuchte sie noch zweimal; dort wohnte sie in der »Spiegelei« – freier Blick auf das spiegelnde Wasser des Sees. 1844 erschien auch Schücking wieder, mit frisch angetrauter Gattin. Droste ersteigerte ein Meersburger Haus samt Weinberg. Blicke auf Himmel und See. Schücking und Frau blieben drei Wochen, man kann sich ausmalen, was sich abspielte, er und Droste sahen sich danach nie wieder. Sie versuchte ihr Traubenglück: auspressen, keltern, trinken. Und schrieb Gedichte über Gruben, Pflichten, über Glauben und darüber, was man nicht glauben kann. Sie lachte gern. Krank war sie schon als Kind, blieb es ein Leben lang. Nervosität? Schwächlichkeit? Aus dem Rebenkeltern wurde nichts. Im Alter von 51 Jahren starb sie in Meersburg, wohl an einer Lungenembolie, die einzig wirklich eigenständige Dichterin deutscher Zunge des ganzen 19. Jahrhunderts. Ist das traurig? Ja.
Erwähnte Werke: das Gedicht Das Spiegelbild
Weiter-Lesen: Emily Dickinson, Gedichte
Gustave Flaubert (1821–1880)
© ullstein bild – KPA/Topf
Achet Chufu, Horizont de Cheops – im Dezember 1849 stehen Flaubert und sein Freund Maxime du Camp vor der 140 Meter hohen Pyramide bei Gizeh. Flaubert befindet sich im »besten Mannesalter«, viele Badehäuser werden besucht, zahlreiche Mädchen und Knaben aus der Nähe angesehen. Gustave steckt sich mit Syphilis an, alles andere hingegen läuft wie vorgesehen: Maxime und Gustave schlafen am Fuß der Pyramide in einem Zelt, um am nächsten Morgen vor der Hitze des Tages die Besteigung zu wagen. Gustave, »bestes Mannesalter«, leider etwas dick, beginnende Glatze, keinerlei Kondition, braucht Hilfe: zwei Ägypter schieben, zwei andere ziehen ihn hinauf. Oben wartet bereits Freund Maxime, Flaubert findet eine Visitenkarte, ausgelegt wie ein Osterei: Humbert, Frotteur – Rouen. Das also ist ihr Humor: natürlich hat Maxime die Karte platziert. Doch, besser noch: Flaubert selbst brachte sie nach Ägypten, hatte sich bereits zu Hause den Pyramideneffekt ausgedacht.
Effekte, unwahrscheinliche Übereinstimmungen, Zufälle und Zusammenhang. Auf die Bourgeoisie spottete Flaubert gern, doch als Madame Bovary Erfolg hatte, ließ er sich das Pariser Gesellschaftsleben durchaus gefallen – seiner Emma gar nicht so unähnlich. Sogar das Kreuz der Ehrenlegion trug er auf dem Busen, ganz wie der lächerliche Bovary-Apotheker Homais. Aber die Räume selbstironischer Spiegelung sind unendlich – mise en abîme nennen die Franzosen das, »an den Abgrund setzen«. Beine baumeln lassen, Horizont genießen.
Zu Hause lebte Gustave mit Mutter und Nichte, aus jeder Generation war in der einst großen Familie nur einer übrig geblieben. Später, als er allein war, kaufte er sich einen Windhund und träumte von Prosa um nichts. Er starb plötzlich, erst 58 Jahre alt; als man ihn fand, war seine Faust so verkrampft, dass man keinen Handabdruck nehmen konnte. Auch dies – ein Horizont. Im Übrigen war Flaubert stark kurzsichtig; er verstand es, Poren zu sehen.
Erwähnte Werke: Madame Bovary, Un Cœur simple, Briefwechsel mit Louise Colet; Julian Barnes, Flaubert’s Parrot
Weiter-Lesen: Gustave Flaubert, L’Education sentimentale
Virginia Woolf (1882–1941)
© ullstein bild
Gordon Square, London-Bloomsbury: lautstark warb eine kleine Kommune für freie Liebe, die Bibliothek des British Museum lag um die Ecke, die Zeitungsredaktionen der Fleet Street waren nah. In das helle alte Haus Nr. 46 zogen im Sommer 1904 Vanessa, Adrian und Thoby Stephen; die Vierte im Bunde, Virginia, war krank und wurde in Cambridge behandelt. Nach dem Tod des Vaters im Februar des Jahres hatten die Geschwister eine Europareise unternommen, am Ende hörte Virginia Stimmen, litt an Kopfschmerzen, Herzbeschwerden und warf sich aus einem Fenster. Erst im Winter kam sie nach London, das Leben sollte nun anders werden: die Geschwister, die schon 1895 die Mutter verloren hatten, waren endlich unter sich, Thobys Studienfreunde kamen zu Besuch, einer von ihnen hieß Leonard Woolf. Sieben Jahre später sah er, der inzwischen im englischen Kolonialwesen in Indien arbeitete, Virginia wieder. Zur Hochzeit im August 1912 quittierte er den Dienst und schloss mit seiner Frau einen doppelten Pakt. Sie wollte keinen Sex, er wollte, dass sie jeden Morgen schrieb. Nun lebten die Woolfs in London sowie auf dem Land; immer wieder erkrankte Virginia, wurde in Kliniken behandelt. War sie gesund, hielt sie Vorträge, schrieb Rezensionen, scharfsinnige Essays zur (englischen) Literatur und ein erstes fiktives Buch. Es wurde 1919 gedruckt. Die (natürlich kinderlose) Ehe schien der Autorin gutzutun, in rascher Folge publiziert sie in den 20er-Jahren ihre wichtigsten Romane. Auf einem Gartenfoto kann sie, unter breitkrempigem Hut mit großer weißer Feder, in Spitzenbluse, Rüschenrock, Zigarette im Mund, den Hals durchgedrückt, sodass man den Kehlkopf sieht, scharf schauen wie ein Mann. Im Vergleich zu einem Jugendfoto von 1903 wirkt sie kaum gealtert. Um sich zwischen den Romanen auszuruhen, schreibt sie 1933 ein kleines Buch über den Hund des Dichterpaares Browning, Flush – und sitzt, ein paar Jahre später, mit seidenhaarigem Setter im Garten ihres Landhauses, an eine Blumenurne gelehnt. Schauen kann sie nun wie eine Hagestölzin, ihr Körper ist lang und dünn, Augen gesenkt, schlichtes Kleid – sie wirkt anwesend, doch fort. Im Januar 1939 besuchen die Woolfs Dr. Freud in Hampstead. Der zweite weltweite Krieg bricht aus. Virginia Woolf schreibt, mit Mühen, ihren letzten Roman, Between the Acts.
Erwähnte Werke: Mrs. Dalloway, The Waves, Tagebücher
Weiter-Lesen: Michael Cunningham, The Hours
Marcelle Sauvageot (1900–1934)
© Apic/Getty Images
Tuberkulose, eine Bakterieninfektion, die zumeist die Lunge betrifft, war noch zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch in Europa die endemische Krankheit schlechthin. Erst 1946 wurde mit der Entwicklung eines Antibiotikums ein wirksames Heilverfahren gefunden. Marcelle Sauvageot, Französischlehrerin an einer Pariser Knabenschule, braune Haare, schmales Gesicht, erkrankte 1926. Drei Jahre später verschlechterte eine Lungenentzündung ihren Zustand dramatisch. Ein Sanatoriumsaufenthalt Ende 1930 folgte, im Frühjahr wurde sie als geheilt entlassen, doch der Winter 1933 sah sie, schwer krank, in Davos. Dort starb sie Anfang ’34.
Charles du Bos, ein damals bekannter Kritiker, nahm sich, durchaus selbstwichtig, der Briefe der Kranken aus dem Winter 1930 an. Ein literarischer Text? Ein Briefroman? Ein Lebenszeugnis, enthusiastisch und analytisch, bildarm, doch beschwörend, fiktiv und »real«. In seinem Zentrum das alte Problem: der eben noch geliebte Mann ist plötzlich nur mehr von hinten zu sehen. Rasant passieren die Gründe dafür Revue. Krankheit und Liebesbruch nehmen Sauvageot mit. Dennoch spricht sie witzig, gefühlvoll und mit Selbstironie. Das Werk, von Sauvageot Commentaire genannt, erschien in kleiner Auflage, wurde bald wieder vergessen. Was wohl aus dem verlorenen Liebhaber wurde?
Sauvageot: »In Korsika bin ich einmal nach einem langen Ausritt durch die Macchia auf einen offenen Weg hinausgetreten. Ich führte mein Pferd am Zügel; sein Kopf war über dem meinen, und ich verschwand fast zwischen zwei Erdbeerbäumen; vor meiner Brust hielt ich rosa Pfingstrosen. Ich hätte gewünscht, Sie wären da und könnten den Duft der Macchia-Pflanzen riechen; dann hätten Sie verstanden, was mich manchmal zum Wilden hinzieht; Sie wären einfach und wild gewesen wie ich, und wir hätten uns geliebt. Ich habe mein Pferd fest umarmt und dabei die Pfingstrosen zerdrückt. Es war niemand da, der lieben konnte, was ich liebte.«
Erwähnte Werke: Sauvageots einziges: Fast ganz die Deine
Weiter-Lesen: Franz Kafka, Briefe an Frauen
Gertrude Stein (1874–1946)
© ullstein – Camera Press Ltd.
Abgebrochenes Medizinstudium in den USA, vermögende amerikanische Familie, ab 1903 als Kunstsammlerin in Paris. Picasso, Matisse, Cézanne. 1907 lernt sie Alice B. Toklas kennen, ebenfalls Amerikanerin, die ihre Lebensgefährtin wird. Die ersten literarischen Werke erscheinen. Stein schreibt Gedichte, Theaterstücke, eine a rose is a rose is a rose unverkennbare Prosa, die aus den Rhythmen von Satzperioden besteht: durch wiederholende Variation bewegt sich Sprache über die Figuren, die sie erzeugt. Erfolg bringt ihr das Buch Autobiographie von AliceB. Toklas – es erzählt, geschrieben von Stein, aus Alices Sicht über Stein und ihre Pariser Salons; Maler und Schriftsteller gehen ein und aus. Alice, so das erzählperspektivisch verrückte Buch, kocht, näht, pflegt Gertrudes Texte und ihre notorischen Hunde. Gertrude selbst schreibt, versteht sich auf die Kunst des Handlesens, ihre Linien zeigen, dass sie mit 72 Jahren sterben wird. So kommt es. Lange davor aber sagt Gertrude als Alice über sich: »Gertrude Stein war, in ihrem Werk, immer schon besessen gewesen von der intellektuellen Leidenschaft für Genauigkeit bei der Schilderung der inneren und äußeren Realität. Sie hat eine Vereinfachung bewirkt durch diese Konzentration und als Resultat die Zersetzung der assoziierenden Emotion in Prosa und Poesie. Sie weiß, dass Schönheit, Musik, Dekoration, das Resultat von Emotion, nie deren Ursache sein sollten, sogar Ereignisse sollten nicht die Ursache von Emotion sein, noch sollten sie der Stoff sein für Poesie und Prosa. Noch sollte Emotion an sich die Ursache von Poesie oder Prosa sein. Sie sollten in einer genauen Reproduktion entweder einer äußeren oder einer inneren Realität bestehen.«
Erwähnte Werke: The First Reader
Weiter-Lesen: Romane von Henry James, etwa The Portrait of a Lady. Short Stories von Ernest Hemingway (besuchte über Jahre hinweg Steins Pariser Salon)
Ingeborg Bachmann (1926–1973)
© DER SPIEGEL 34/1954
Von ihrem Ende haben alle gehört. Eine brennende Zigarette im Bett, Mitte September 1973. Tod in einem römischen Krankenhaus fast einen Monat später, aufgrund der Brandwunden. So die verbreitetste Version. Die andere: Bachmann war tablettensüchtig. Im Krankenhaus habe man dies aus Scham verschwiegen, sodass es aufgrund einer Nichtbehandlung der Abhängigkeit zu einem toxischen Schock kam, der Bachmann das Leben kostete. Die Erben kontrollieren, was bekannt wird; zahlreiche Briefe der Autorin an Kollegen, Liebschaften, Freunde sind gesperrt. Insgesamt: traurige Geschichten und viele Gerüchte, Effekte auch einer (unserer) mediatisierten Gesellschaft und der darin zu führenden Autorenexistenz. In den 80er-Jahren wurde Bachmann von den feministischen Literaturwissenschaften entdeckt, weitere Stilisierungen von Leben und Werk folgten. Es ist bemerkenswert, wie der Autorin anhängt, was sie gern selbst betrieb, eine gewisse Schwarz-Weiß-Malerei. »Du Opfer« gilt heute als Schimpfwort; das hätte Bachmann sich wohl nie träumen lassen. Ihre Biographie und ihr Schreiben drücken ein seltsames Schwanken aus: wer kann ich sein? Umzüge, Reisen, rasch wechselnde oder komplizierte Beziehungen (u. a. zu Max Frisch). Als wäre da etwas Inneres leer. Sie dockt an Moden, Zeitströmungen, kulturelle Deutungsmuster an, scheidet bis heute die Geister. Auf den späteren Fotos ein sehr weiches (aufgeschwemmtes?) Gesicht. Dazu die tippelnde Stimme. Und immer das Moment »was ist echt, was nicht?«. Im Übrigen: Frau Dr. Bachmann. Sehr ehrgeizig, was sie aber zu verbergen suchte.
Erwähnte Werke: Erzählungen aus den Bänden Das dreißigste Jahr und Simultan
Weiter-Lesen: Max Frisch, Montauk (Erzählung)
Friederike Mayröcker (1924–2021)
© Marco Lipus/Picture Alliance
Ihre Wohnung in Wien ist Legende. Ihr Schreiben ebenso: eine Verzettelung, ein Seitensturm, eine Verschmelzung, die Leben und Schreiben ununterscheidbar macht. Lange ist sie nicht umgezogen. Lange, von 1954 bis zu seinem Tod 2000, lebte sie mit dem Dichter Ernst Jandl. Mayröcker ist eine Früharbeiterin: um vier Uhr morgens geht es los. Lebensschriften: Mayröcker ver-schreibt, was sie sieht, empfindet, lebt. Gedichte, Prosa, Mischformen, Hörspiele – das umfangreichste Werk aller Schriftsteller:innen in diesem Buch. Auch im Alter entwickelt sie sich weiter, verändert, erfindet, sucht. Lange Zeit stand sie im Schatten Jandls, zudem quer zu ihrer Zeit. Auch dies scheint sich erst ab den 90er-Jahren zu ändern. Oder sollte es damit zu tun haben, dass wir uns weiterhin (s. die Bachmann-Rezeption) schwertun, mit den Werken weiblicher Dichter umzugehen: wer dürfen sie sein? Wo hören wir ihre Stimme und wie? Mayröckers Prosa stürmt leichthin, mit großen Sprüngen, voran. Dazu gehören Selbstwitz, Ironie und eine große Freundlichkeit im Umgang mit anderen. Sie schreibt an den Konzepten Person, Identität, Erinnerung. Die Augen versteckt sie gern unter einem langen schwarzen Pony. International ist sie im Verhältnis dazu, wie wichtig ihr Werk auch für jüngere Generationen von Schreibenden ist, zu wenig bekannt.
Erwähnte Werke: Magische Blätter I–IV, Das Licht in der Landschaft, Lection, Abschiede, Und ich schüttelte einen Liebling, Im Hintergrund: Gedichte aus den Bänden Das besessene Alter, Notizen auf einem Kamel, Mein Arbeitstirol
Weiter-Lesen: Jacques Derrida, Friedrich Hölderlin, das Tagebuch von Gerard Manley Hopkins, dazu Musik, etwa von Schubert, von Bach.
Michèle Métail (*1950)
© gezett.de
Kommt als 22-Jährige nach Wien, um über den Zusammenhang von Text und Musik in Alban Bergs »Lulu« zu schreiben, und hört, in einem kleinen Salon der Stadt, ihre erste Lesung mit einer zeitgenössischen Dichterin: Friederike Mayröcker. Daneben fließen die Donau, die deutschen und französischen Grammatiken, die »Bedeutungen« der Sprachen und ihre Melodien. Métail entdeckt ihr eigenes Leseinstrument, das Mikrofon. Wie es den Atem einfängt, das Timbre der Stimme, ihre Nuancen, ihren Fluss.
Im März 1982, nach der Beerdigung des Schriftstellers Georges Perec, Mitglied der literarischen Gruppe OULIPO (L’Ouvroir de Littérature Potentielle, Werkstatt für potentielle Literatur) in Frankreich, der auch Métail lange angehörte, stand die Dichterin vor ihrem Bücherregal auf der Suche nach Trost. Zufällig griff sie ein Buch über die Poesie Chinas heraus. Sie verstand es als Fingerzeig: 13 Jahre lernte sie chinesisch, bis zum Doktortitel. Dass diese systematisch-bewegliche, mit Bild und Text arbeitende, erfinderische Autorin Gärten liebt, nimmt am Ende wenig wunder, sind doch auch sie hervorragende Areale von Anordnungskunst, die Formales und Lebendiges verbinden und, wie Sternchen, Tausende von Namen in verschiedensten Sprachen darüberstreuen.
Erwähnte Werke: 2888 Donauverse
Weiter-Lesen: Michèle Métail, Gehen und schreiben. Gedächtnis-Inventar; Georges Perec, träume von räumen
Antonia S. Byatt (*1936)
© Barbara Zanon/Getty images
Dame Commander of the British Empire. In England lange bekannt als die ältere Schwester der erfolgreichen Romanautorin Margaret Drabble. Das ärgerte vermutlich – beide. Intellektuell, ehrgeizig, klug. Liebt Gedichte, schreibt aber selbst nur welche, um sie in einen Roman zu integrieren. Ein erzählerischer Geist. Die Einzige unter den Autorinnen dieses Bandes, die Kinder hat (drei Töchter, der Sohn starb als Kind bei einem Unfall). Lebt in London, stammt aber aus Nordengland, wo sie auch aufwuchs. Lernte schon als Schülerin Deutsch, trotz des 2. Weltkrieges und seiner Folgen. Wissenschaften, auch jene der Natur, ziehen Byatt an; Literatur ist für sie ein Erkenntnisinstrument, kulturelle, historische, soziologische Fragen erscheinen im Spiegel der erzählten Leben.
Das erste Byattbuch auf Deutsch wurde gedruckt, als die Autorin 1990 den Booker Prize erhalten hatte. Ihre Romane, große Gewebe, funkeln vor allem dort, wo etwas beschrieben wird: Tier, Baum oder Ding. Vielleicht nicht im realen Leben, gewiss aber als Schriftstellerin liebt Byatt Schnecken. »Ihre Häuser waren verschiedenartig und entzückend, manche von zartem Zitronengelb, manche von dunklem Rosa, manche von grünstichigem Rußschwarz, manche mit dunklen Spiralen auf Ledergelb keck gestreift, manche mit cremeweißen Spiralen auf Rosa, manche mit einem einzigen dunklen Streifen auf goldenem Grund, manche wie Gespenster mit grauweißlichen Windungen auf Kalkweiß. […] Ihre taubengrauen durchsichtigen Körper schimmerten von ihren eigenen Ausscheidungen, ihre zierlichen Fühler zitterten vor ihren Köpfen, kosteten die Luft, hielten bedächtig Ausschau.«
Erwähnte Werke: das Romanquartett Die Jungfrau im Garten, Stillleben, Der Turm von Babel und Frauen, die pfeifen
Weiter-Lesen: George Eliot, alle Romane.
Charles Darwin, The Voyage of the Beagle
LESEN
(Essays)
»Was den Mund umspielt, so lind«
Annette von Droste-Hülshoff und das Schleichen der Spione
Wer in einen Spiegel schaut, sieht sein Spiegelbild. Nicht sich selbst. Er sieht sich, wie er sich im Spiegel sieht, nie aber, wie andere ihn sehen. Die Seiten sind vertauscht. Aus dem Spiegel blickt ihm ein zweites Selbst entgegen, eines, das allein für ihn gemacht ist, wenn und wie er da steht und mustert und schaut, bis er sich selbst als Muster vorkommen muss. Natürlich kann man auch zu zweit in einen Spiegel sehen, aber wie oft tut man es – im Vergleich zum Solo-Blick ins Glas, um jenem Bild von sich zu begegnen, das kein anderer, kein einziger Mensch auf der Welt kennt als man selbst.
Wie selten hat man auf diese Weise etwas für sich.
Es ist schön und brutal.
Beängstigend und versichernd.
Auf einem Foto sind die Seiten zurückgetauscht. Dort sehen wir uns, wie andere uns sähen, blickten sie durch eine Kamera, und das Objekt, die Fotografie selbst, kann weitergegeben werden. Ganz anders die intime – und flüchtige – Spiegelimago, gebildet aus unserer Materie, die übersetzt, nämlich hin- und hergeworfen wird durch Licht. Das dann als Mensch im Glas steht, lacht oder weint, ohne doch etwas anderes zu sein als Licht und sein Weg.
Kein Wunder, dass kleine Kinder lernen müssen, was ein Spiegelbild ist; kein Wunder, dass kaum eines der sogenannt anderen Tiere auf Spiegelung reagiert wie wir; kein Wunder, dass Sprache mit diesem Erkennen im Spiegel verbunden ist. Wir tragen Spiegel im Kopf – »Spiegelneuronen« nennen die Hirnforscher dieser Tage jene hochspezialisierten Nerven-Cluster, die uns befähigen, das, was an und mit anderen oder durch sie geschieht, so zu erleben, als täten wir es selbst oder geschähe es an uns.
Und so lesen wir.
Texte sind Spiegel. In ihnen zeigen wir uns uns selbst so, wie kein anderer uns sieht oder von uns weiß, und begegnen uns nicht selten in Gestalten, von denen wir bislang nichts ahnten. Wir spiegeln uns nicht nur in dem, was wir lesen, sondern vor allem darin, wie wir es tun, denn das Muster oder Bild, das im Lesen entsteht, zeichnet zugleich jene Strukturen auf, in denen wir uns und unsere Welt erfahren.
Schaust du mich an aus dem Kristall
Mit deiner Augen Nebelball,
Kometen gleich, die im Verbleichen;
Mit Zügen, worin wunderlich
Zwei Seelen wie Spione sich
Umschleichen, ja, dann flüstre ich:
Phantom, du bist nicht meinesgleichen!
Wer sein Spiegelbild betrachtet, betrachtet das Bild seines Ich als das jenes anderen, den jeder braucht, um überhaupt Ich sagen zu können – um jene Spaltung in Einheit zu vollziehen, die das Ich zu Subjekt und Objekt zugleich macht, eben zu einem Ich, das sich selbst zu denken vermag. Hölderlin nannte diesen Vorgang das Urteil – die Urteilung des Subjektes in Ich und Du, um Ich zu sein.
Vor dem Spiegel kommt dieses Du, gebrochen, doch leuchtend, als Bild auf den Schauenden zurück. Eben dies zeichnet Annette von Droste-Hülshoff in der ersten Strophe ihres Gedichtes Das Spiegelbild in die sich umschlingenden Wörter Verbleichen/Umschleichen, die sich zu einem Zusatzreim jenseits des bereits umarmenden Versschemas verbinden. Er wandert vom Ende der dritten Zeile zum Anfang der vorletzten, und tatsächlich umkreisen sich wie Spione die einander ähnlichen, angeblich Welt spiegelnden Laute. Es entsteht ein Phantom. Wörter spiegeln Welt nicht, sondern sind sie; ununterscheidbar werden Phantom und »ich« – es entsteht »wunderlich«.
Wer, wie Droste, stets am Wasser lebte, in Meersburg am Bodensee, in der westfälischen Wasserburg der Eltern, in Orten mit wellenzeichnenden Konsonantendoppelungen, ss und ee, wer, wie Droste, ein Leben lang vom Wasser nicht loskam, kommt auch von Augen nicht fort. Da umkreisen sich zwei, stumm, spähen sich aus, und aus dem Schauen folgt, wie bei einem Kind vorm Spiegel, das Sprechen, als Flüstern, an der Grenze zwischen Stimme und Schweigen, als Anrede an ein Wesen, seinerseits Grenze, genannt Phantom.
Bist nur entschlüpft der Träume Hut,
Zu eisen mir das warme Blut,
Die dunkle Locke mir zu blassen;
Und dennoch, dämmerndes Gesicht,
Drin seltsam spielt ein Doppellicht,
Trätest du vor, ich weiß es nicht,
Würd’ ich dich lieben oder hassen?
Traum oder Albtraum: das sich vom Ich lösende Spiegelbild.
Traum oder Albtraum oder Metapher des Schreibens.
Gedichte eignen sich im Besonderen, Spiegelbilder in dem hier gemeinten Sinn zu sein, weil sie die Spiegelung mitzeigen – sichtbar machen, dass sie Wellen werfen, dass sie Medium sind. Im Reim etwa, aber auch in jedem anderen sprachlichen Zug, der (Wiederholungs-)Muster baut, mit Lauten spielt. Sie übersetzen uns jene spiegelnden Neuronen-Cluster, mit denen wir auf Bildsuche durch unsere Welten laufen, auf Fühlens-Suche, um Verstehen bemüht, nicht der Sache wegen, sondern für uns, um zu überleben, und sie zeigen uns, wie wir uns bewegen und da-sind, mit anderen verbunden, doch allein: ein dämmriges Gesicht, seltsam bespielt von Doppellicht.
Gedichte sind Spiegelbilder in Buchstaben und im Satzspiegel. Sie zeigen, und sprechen davon, wie sie es tun. So werden sie jene Spiegelbilder, die vom Spiegel handeln, von Sprache. Hut/Blut, blassen/hassen, Gesicht/Doppellicht/nicht – ein Spiegel, der Wellen wirft, fast flüssig, und in Bewegung setzt, uns. Etwas, dämmrig, verschwindet und tritt doch hervor. Gedichte, wässrig, nämlich medial, also etwas, das wi(e)dergibt, also verzerrt, auf den Kopf stellt, neu gliedert, werfen Wortwellen aus, in denen sie uns einfangen – erscheinen lassen. Sie machen dem Bild Platz.
Zu deiner Stirne Herrscherthron,
Wo die Gedanken leisten Fron
Wie Knechte, würd’ ich schüchtern blicken;
Doch von des Auges kaltem Glast,
Voll toten Lichts, gebrochen fast,
Gespenstig, würd’, ein scheuer Gast,
Weit, weit ich meinen Schemel rücken.
Als ich ins Gymnasium kam, gab es plötzlich ein Fach, das »Kunst« hieß. Da stand einer mit breitem schwarzem Bart und einem unaussprechbaren Namen, ein Lehrer, der aus Verzweiflung unterrichtete und etwas anderes hatte werden wollen, wie man an den Aufgaben merkte, die er stellte. Wir waren zehn Jahre und bekamen den Auftrag, auf das erste Blatt des ganz neuen Zeichenblockes einen – Fleck zu machen. Irgendwohin. Blau. Dann mussten wir aus dem Fleck einen Bagger malen, dazu einen Bauzaun etc. Ich hatte noch nie einen Bagger gemalt. Bagger interessierten mich nicht. Mein Bagger sah sehr komisch aus. Ich lernte etwas. Über Sehen und Erinnern, und war froh, als die Aufgabe erledigt war. Jetzt würde es besser werden, doch es wurde schlimmer. Ein Spiegel kam ins Spiel.
Und wie schön die deutsche Sprache ist, wenn sie »Spiegel« sagt und das Wort enthält »Spiel«, und jedes Gedicht, wenn ich es als Spiegel betrachte, spricht mit vom Spielen und fragt danach. Doch das nur nebenbei, als Fleck.
Wir sollten uns selbst malen, am Morgen, vor dem Spiegel, beim Zähneputzen. Wir sollten unser Spiegelbild malen, in einem Augenblick, den wir anderen nicht zeigten. Wie sieht man aus, mit Schaum vorm Mund, frisch aus dem Bett? Und ich träumte davon, Prinzessin zu sein! Zumindest war das in der Volksschule so gewesen; nun fingen meine Brüste zu wachsen an, und ich träumte davon, schön zu sein. Und dann das: ein Spiegelbild, morgens. Mit Schaum.
Immer mehr Schaum.
Jeder von uns malte sich so, dass kein anderer ihn erkannte. Das war keine Absicht, es passierte, denn so trug sich der Spiegel ins Bild. Ihn konnten wir nicht malen, mit den Kinderkünsten, aber dass wir an ihn dachten und wiedergaben, wie wir, die Kurzen, die doch erst halb in die elterlichen Spiegel ragten, seitenverkehrt aussahen, zeigte sich in unseren Bildern an uns. Der Schaum wurde immer größer, der Mund und das halbe Kinn verschwanden darin, und Schaum tropfte herab, fettes Deckweiß, und wucherte über den Rest.
Und was den Mund umspielt so lind,
So weich und hülflos wie ein Kind,
Das möcht’ in treue Hut ich bergen;
Und wieder, wenn er höhnend spielt,
Wie von gespanntem Bogen zielt,
Wenn leis’ es durch die Züge wühlt,
dann möcht’ ich fliehen wie vor Schergen.
Es ist gewiss, du bist nicht Ich,
ein fremdes Dasein, dem ich mich
Wie Moses nahe, unbeschuhet,
Voll Kräfte, die mir nicht bewusst,
Voll fremden Leides, fremder Lust;
Gnade mir Gott, wenn in der Brust
Mir schlummernd deine Seele ruhet!
Wir sehen mit dem Gehirn, nicht mit den Augen, und nehmen uns selbst nur in Verschiebungen unserer Sinne wahr. Der eigene Geruch: verborgen. Berührt werden oder sich selbst berühren: welch Unterschied. Die eigene Stimme: wie anders sie klingt, wenn man sie vom Band hört, also von außen, ohne das Mitschwingen der inneren Resonanz. Und: das seitenverkehrte Spiegelbild.
So schleicht man an sich selbst heran. »Unbeschuhet«. Auf leisen Sohlen. Am Anfang steht eine Definition: Du bist nicht Ich. Auf dieser Basis kann man es wagen, sich dem Spiegelbild zu nähern, sich selbst ein Spion. Doch schon schlägt das Phantom zurück, wirft einem etwas Unsichtbares, Immaterielles in die Brust: Lust. Und Seele. Und Kraft.