
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tyrolia
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Literarische Perlen zu Literatur, Kunst und Religion Er ist renommierter Radiomann der ersten Stunde und begehrter Vortragender in Fragen von Kunst, Literatur und Religion: Hubert Gaisbauer kann mit seinen nunmehr 80 Jahren aus einer Fülle an lesenswerten, vielschichtigen Texten schöpfen, die zum Teil für seine Radioserien "Gedanken für den Tag" und "Menschenbilder" oder auch für seine immer wieder gern gehörten, aber bisher nicht veröffentlichten Vorträge entstanden sind. Aus diesem reichen Gedankenschatz ist nun ein sorgfältig gestalteter Sammelband entstanden – ein "Best-of" an literarischen Lichtblicken – allesamt in gekürzter, gut lesbarer, ja manchmal sogar literarisch überraschender Form. Dabei beschäftigen ihn Persönlichkeiten aus Geschichte und Gegenwart ebenso wie biblische Figuren oder mythische Begebenheiten: Außerordentlich kenntnisreich und präzise in seiner Betrachtung nähert er sich ihnen an, und ist dabei "schonungslos zärtlich" auf der Suche nach Authentizität und einer umfassenden Wahrheit, aber nicht ohne auf das zutiefst Menschliche, die innewohnenden Würde zu vergessen. Die Lebensbilder spannen einen Bogen von Schriftstellerinnen wie Ilse Aichinger, Christine Busta, Else Lasker-Schüler oder Christine Lavant über bildende Künstler wie Alberto Giacometti, Georges Rouault, Marie-Louise Motesiczky oder Ernst Barlach bis zu historischen Figuren wie Johannes von Gott, den Begründer der Barmherzigen Brüder oder den biblischen Tobit und die hl. Anna. Dazu kommen wunderbare Betrachtungen etwa über die Poesie, Religion, Arbeit, Erinnerung, das Gebet - oder das Riesentor von St. Stephan.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 295
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
2019
© Verlagsanstalt Tyrolia, Innsbruck
Umschlaggestaltung: Nele Steinborn
Satz- und Layoutgestaltung: Nele Steinborn, Wien
Schriften: Bunday sans, DTL Albertina
Druck und Bindung: Finidr, Tschechien
ISBN 978-3-7022-3735-6 (gedrucktes Buch)
ISBN 978-3-7022-3749-3 (E-Book)
E-Mail: [email protected]
Internet: www.tyrolia-verlag.at
schonungslos
zärtlich
Menschen|Bilder|Gedanken
Inhalt
Vorwort
IEin Tor zum Frieden
Das Riesentor von Sankt Stephan in Wien
Meine Kindheit ist jetzt
Über den Bildhauer und Maler Alberto Giacometti
IIMenschen statt Masken
Über den Komödienschreiber Carlo Goldoni
Die Heiligsprechung des Clowns
Über den Maler Georges Rouault
Barfuß nach Gottosten
Über die Dichterin Else Lasker-Schüler
IIIPapst Franziskus und die Zärtlichkeit
Über die Proklamation einer verschwundenen Tugend
Mach mich weinen
Gedanken zum Stabat Mater
Abenteurer der Barmherzigkeit
San Juan de Dios, der heilige Johannes von Gott
IVSchonungslos zärtlich
Über die Malerin Marie-Louise von Motesiczky
Den Himmel auf der Zung’, im Mund die Sonne
Die Liebesmystik der Catharina Regina von Greiffenberg
VLieben und arbeiten
Gedanken für den „Tag der Arbeit“
Irdische Träume von himmlischen Gärten
Kleine spirituelle Gartenkunde
VIDie Süße der Schrift
Gedanken über Poesie und Religion
Für die Kunst zu altern brauchen wir die Kunst
Eine Anregung
VIIDer Kuss unter der Goldenen Pforte
Betrachtungen über die heilige Anna und ihre Tochter Maria
Und ich in großer Angst
Der Maler Pontormo und die Angst eines Jahrhunderts
Ich brauche einen Menschen, bis ich Gott habe
Über die Schriftstellerin Christine Lavant
VIIIAuf der Suche nach der verlorenen Seele Europas
Eine Betrachtung
Zerreißt den Mantel der Gleichgültigkeit
Über die Flugblätter der Weißen Rose
IXDie Rede des toten Charles Péguy vor dem Thron Gottes
Der Engel weiß den richtigen Weg
Gedanken zum Buch Tobit – eine Nacherzählung
XEin Mittel gegen die Traurigkeit
Geduld – das Geheimnis von Johannes XXIII.
Gott ist nicht zu haben
Über den Bildhauer und Dichter Ernst Barlach
XIMeine Wärme geht ihre eigenen Wege
Über die Malerin Paula Modersohn-Becker
Wer ist fremd, ihr oder ich?
Über die Schriftstellerin Ilse Aichinger
XIIDer Sprache im Wort geblieben
Über die Dichterin Christine Busta
Erzähl mir …
Vier Skizzen vom Sinn des Erinnern
In der Finsternis flüchtet das Licht der Welt
„Die Flucht nach Ägypten“ von Adam Elsheimer
Bildnachweis
Vorwort
Ja, ich bin ein Moralist – und zwar im Sinne meines geliebten alten philosophischen Wörterbuchs, das unter einem Moralisten jeden versteht, der sich durch eine „leidenschaftliche Stellungnahme zu Mensch und Gesellschaft auszeichnet“. Und zur Religion, füge ich hinzu.
Ich hatte das Glück, ein Berufsleben lang für ein Kulturmedium ersten Ranges arbeiten zu dürfen, für das Radioprogramm Österreich 1. Ich war und bin noch immer ein von meinem Naturell und von großartigen Menschen entflammter Streiter für eine Kultur, die nicht sich selber, sondern der Entfaltung des Menschlichen dient.
Deshalb gefällt mir auch der Titel dieses Buches. Ich habe ihn vor Jahren für einen Vortrag über eine Malerin gewählt, die den Alterungsprozess ihrer Mutter zum Thema ihrer Malerei gemacht hat. In den Bildern, die daraus entstanden sind, werden die Liebe zur Mutter und die Liebe zur Wahrheit eins. Schonungslos zärtlich.
Nach meinem Abschied vom Radio, der ja nicht ganz radikal war, habe ich mich meinen Vorlieben ergeben: der Liebe zur bildenden Kunst und zur Dichtung, der Spurensuche in Leben und Werk von Dichterinnen und Malern, vielen Fragen der Religion und des Glaubens, die mich von Jugend an begleiten. Von all dem kann man in diesem Buch lesen.
Wenn man mich fragt, was alle die unterschiedlichen Beiträge gemeinsam haben, dann sage ich: Vielleicht die Suche nach dem Einklang von Liebe und Wahrheit.
Hubert Gaisbauer
Blick in die nördliche Portallaibung des Riesentors von Sankt Stephan
Ein Tor zum Frieden
Das Riesentor von Sankt Stephan in Wien
erst wenn
die Bilder aus Stein
einmal
können warten
Augen
bis wir sie
Hände
erhören
und Mund
ganz nah
im Staunen und
im Erbarmen
zu Wunden und Wundern
geführt werden
dann erst
begreifen wir
redest
(vielleicht)
DU
Oft war es mir vergönnt, durch das Riesentor in den Dom von Sankt Stephan zu gehen – oder soll ich besser sagen: zu schreiten? Nein, im Gedränge, das heute meist in der Vorhalle herrscht, kann man nicht schreiten. Aber einen Schritt lang innehalten, das geht immer. Einen Gedanken lang aufblicken, über das Getümmel des Kämpferfrieses und über die Wucherungen der Kapitelle hinweg zu den vertrauten Apostelköpfen mit der zeitlos ruhigen Gewissheit im Blick – hin auf den Segensgestus des Christus in der Mandorla.
Ich weiß nicht, wie viel hundertmal ich durch das Riesentor in den Dom gegangen bin. Immer versuchte ich zu verstehen, was das Tor sagen will. Versuchte ich, meinen Kindern, meinen Enkelkindern und unzähligen mir nicht näher Bekannten nachzuerzählen, was ich glaube, verstanden zu haben. Wovon wollten die Bauleute und die Erfinder der Bilder dieses Tores erzählen? Von Irrwegen in der Welt vielleicht, und dann von der Vollendung im Reiche Gottes.
Ein Tor der Barmherzigkeit
Bei mir stellte sich im Laufe der vielen Jahre eine große Vertrautheit ein. Sie lässt mich heute das Riesentor von Sankt Stephan auch als eine große Friedenserzählung verstehen. Als Papst Franziskus am 8. Dezember 2015 zu St. Peter in Rom ein „Heiliges Jahr der Barmherzigkeit“ ausrief, wurde auch in Wien das Riesentor als „Heilige Pforte im Jahr der Barmherzigkeit“ geöffnet. Damit weitete sich der Blick von Wien über Rom bis zum „Goldenen Tor“ in Jerusalem, das auch „Tor des Erbarmens“ heißt, auf Hebräisch Scha'ar ha Rachamim und auf Arabisch Bāb ar-Rahma, „Tor der Barmherzigkeit“.
Papst Franziskus sagte damals bei der Öffnung der Heiligen Pforte am Petersdom: „Möge das Durchschreiten der Heiligen Pforte uns das Gefühl vermitteln, Anteil zu haben an dem Geheimnis der Liebe, der zärtlichen Zuwendung. Lassen wir jede Form von Angst und Furcht hinter uns, denn das passt nicht zu dem, der geliebt wird!“
Die Portale romanischer und gotischer Kathedralen führen aus der irdischen Welt des Alltags und der Geschäftigkeit in die geistige Welt des Himmlischen Jerusalem. Jedes mittelalterliche Gotteshaus ist ein Sinnbild dafür. Der Mensch, der hier eintreten will, wird in der Symbol- und Bildsprache der Zeit seiner Entstehung empfangen. Ornament und Figuren verweisen auf die Heiligkeit der Stätte, sie begleiten einen kurzen, aber ausdrucksstarken Reinigungsweg.
Allerdings war das Betreten der Kirche durch das Riesentor für das Volk in der Vergangenheit keine Selbstverständlichkeit. Schon der Eingang in die Vorhalle der Kirche war mit einem eisernen Gitter verschlossen und wurde nur bei bedeutenden Anlässen und hohen Festlichkeiten geöffnet.
Die Reinigung der Apostel
Einmal hatte ich das Glück, den Aposteln, den Engeln und der Majestät Christi in der Mandorla ganz nahe zu kommen: Während der Reinigungsarbeiten am Riesentor 1996/97 konnte ich in geradezu zärtlicher Nähe zu den Gesichtern auch behutsam die Gewänder der Heiligen und die Flügel der Engel berühren.
Neben den ehrwürdigen Figuren standen ganz profan Dosen, Fläschchen und Tiegel mit Pinseln und anderen Reinigungsgeräten. Mir ist ein Vers aus der Offenbarung des Johannes eingefallen: „Selig, wer sein Gewand wäscht, er hat Anteil am Baum des Lebens und er wird durch die Tore in die Stadt eintreten können.“ Selig auch diese Figuren, dachte ich, denen der Staub von Jahrhunderten aus den faltigen Gewändern gelöst wird.
Wie viel Überheblichkeit und Erniedrigung hätten diese Apostel sehen können – im Laufe der fast acht Jahrhunderte, die sie hier oben hocken –, wenn sie der irdischen Dinge geachtet hätten! Siegreiche Feldherren hätten sie gesehen, hohlwangige Prediger an der Spitze düsterer Bußprozessionen und herrschaftliche Hochzeitsgesellschaften, die an Bettlern vorbei in den Dom gezogen waren. Bei Meister Eckhart ist zu lesen: „Für Gott ist nichts fern noch lang. Willst du, dass dir nichts fern und lange sei, so füge dich zu Gott, denn da sind tausend Jahre wie der Tag, der heute ist.“ So hörte ich auch die Apostel reden, mit denen ich für eine Stunde auf gleicher Augenhöhe war.
Die Restaurierung war ein aufwändiges Projekt, bei dem die stark verschmutzten Reliefs in den vielfältigen Details mit Laser gereinigt und die verschiedenen Schichten der ehemaligen farbigen Fassungen dokumentiert wurden. Das Riesentor war ja bis ins 18. Jahrhundert farbig gefasst, erst 1792 wurden die Bemalungen entfernt und die Steinoberfläche weitgehend freigelegt.
Im Zwielicht
In der Architektur wird die Öffnung in einer abgrenzenden oder schützenden Mauer Tor genannt. Das Wort allein schon hört sich groß an, es kann zu einer Stadtmauer, einem Schloss, einer Burg oder einer Kirche gehören. Tore können auch für sich alleine stehen oder sich mit Brücken verbinden. Ein offenes Tor bedeutet Willkommen und Geborgenheit, erlaubt Freiheit, Ein- und Ausgehen, verheißt den Wechsel von blendendem Licht in dunkle Kühlung. Ein offenes Tor lädt ein zur Begegnung mit Neuem, zum Wagnis in ungewisse Veränderung.
Wie eine befestigte Burg erscheint die Fassade des Vorbaus des Riesentors zu Sankt Stephan. Wer durch den schmucklosen Eingang in die Vorhalle tritt, befindet sich noch nicht in der Kirche, aber auch nicht mehr in der alltäglichen Selbstverständlichkeit der Dinge. Das eigentliche Portal dämmert im Schatten. Noch herrscht ein Zwielicht des Fragens. Wer bist du eigentlich, Mensch, der hier herein will? Was ist gut, was ist böse? Weißt du, was hinter der Tür auf dich wartet? Sieben Schritte ist das Tor tief, von der spitzbogigen Öffnung des Vorbaus bis zur Tür unter dem Tympanon, durch die man die Kirche betritt. Sieben Säulenpaare mit geometrischen Bandornamenten begleiten links und rechts diese Schritte. Aus diesen Säulen wachsen in den Kapitellen quellende Blattkronen, manche sogar mit Gesichtern. Darauf liegt der Kämpferfries, auf dem die Torbogenrippen aufruhen. Diese Zone ist beherrscht von Zweideutigkeit, Zwiespalt und Zerrüttung. Ein Zerrspiegel des gottvergessenen Spiels der Mächtigen, gleich ob Kleriker oder Laien. Hier hausen Sirenen, Vögel mit Frauenköpfen, der listige Fuchs wartet auf sein argloses Opfer und der Teufel schleicht in Löwengestalt umher und „sucht, wen er verschlingen könnte“. Ein Mensch stellt mit erhobenem Beil einem flüchtenden Mönch nach, während ihm selber ein Unhold auf den Fersen ist. Als ein Pandämonium der Bosheit nährt dieser anschauliche Lasterkatalog die Angstlust des Mittelalters. Es ist natürlich die Wachsamkeit, zu der dieser motivisch recht bunt zusammengewürfelte Fries ermahnen will. Allgegenwärtig war ja die berühmte Achtlasterlehre des Johannes Cassianus aus dem 5. Jahrhundert – wenigstens im Kopf der für Bildinhalte in Kirchen tonangebenden Kleriker. Darin heißt es: „Wir müssen also alle die Windungen unseres Herzens und alle Geheimnisse erforschen, um zu sehen, ob der Feind unserer Seele, der Löwe oder der teuflische Drache dort eingetreten ist und Spuren hinterlassen hat, die ähnliche Tiere dahin gelockt hätten, wenn wir die Wache über unseren Gedanken vernachlässigen.“ Gemeint sind die sogenannten Wurzelsünden wie Aberglaube, Wollust, Zorn, Stolz, Betrug, Maßlosigkeit.
Recht und Unrecht
Das Tor der Hauptkirche einer Stadt, und das war Sankt Stephan schon sehr früh, stand symbolisch für das Stadttor. Deshalb wurde unter oder vor dem Tor auch Gericht gehalten. In antiken Texten ist davon schon die Rede, ebenso in der jüdischen Bibel des Ersten Testaments, so heißt es beispielsweise beim Propheten Sacharja: „Übt ein heilsames Gericht in euren Toren! Sinnt nicht Böses wider einander in euren Herzen und habt nicht Gefallen an falschem Eid.“ Oder bei Amos: „Haltet aufrecht im Tore das Recht, vielleicht erbarmt sich dann Jahwe.“ Löwen an Kirchentoren – beim Riesentor links und rechts an den Vorbaukanten – verweisen auf den Thron des weisen Richters Salomon. An der Wand über dem linken Eckstein erinnern zwei in Brusthöhe eingelassene Eisenstäbe, die Große und die Kleine Elle, dass vor dem Riesentor einst eben auch ein Ort des Handels und der Rechtsprechung war.
Mitten im Kämpferfries, über der vierten Säule der linken Seite, neben dem Hinterteil eines Löwen, ist ein Kopf mit einem spitz zulaufenden Hut zu sehen. Diese Kopfbedeckung, den „Judenspitz“, mussten offenbar zur Zeit der Entstehung des Riesentors männliche jüdische Mitbürger tragen – so wurde es im Jahr 1267 erneut bekräftigt, und zwar auf dem sogenannten Wiener Konzil, einem Provinzialkonzil von sechzehn Bischöfen aus den umliegenden Diözesen unter Aufsicht eines päpstlichen Legaten. Dabei wurde der Verkehr mit Juden einmal mehr erheblich eingeschränkt. Christen durften sich beispielsweise nicht von jüdischen Ärzten behandeln lassen, Juden durften keine christlichen Dienstboten beschäftigen oder gar mit Christen gemeinsam essen. Die Errichtung neuer Synagogen wurde strikte verboten.
Nachdem die erste Stephanskirche 1258 bei einem verheerenden Brand vernichtet worden war, wurde alsbald mit dem Wiederaufbau begonnen. Das Riesentor wurde, auf der älteren Portalanlage aufbauend, im Verlauf der folgenden zweihundert Jahre mehrmals deutlich bearbeitet, ergänzt und umgeformt. Der Wiederaufbau fällt in die Zeit der Regentschaft von König Ottokar von Böhmen, der in Stadtrichter Paltram, dem Anführer der Wiener Bürger, einen treuen und finanzkräftigen Gefolgsmann hatte, was vielleicht auch der Stephanskirche zugutegekommen war. Ottokar selbst war letztlich ein skrupelloser und somit unglücklicher Herrscher, der sich unrechtmäßig Ländereien angeeignet hatte; ein Friedensschluss mit Kaiser Rudolf von Habsburg, der sogenannte „Wiener Friede“, war von ihm gebrochen worden. 1278 wurde er in der Schlacht auf dem Marchfeld besiegt und getötet. Franz Grillparzer legte ihm im Drama „König Ottokars Glück und Ende“ eine späte Erkenntnis in den Mund, die man Machthabern und Kriegsherren aller Zeiten dringend wünscht: „Kein Königsschloss mag sich vergleichen mit dem Menschenleib! Ich aber hab sie hin zu Tausenden geworfen […] wie man den Kehricht schüttet vor die Tür.“ Drei Tage nach der Schlacht zog Rudolf von Habsburg als erster Habsburger zum Dankgottesdienst in die Stephanskirche ein. Eine Chronik berichtet: „Rudolf ward feyerlich eingeführt nach Sanct Stephan und dankte dort dem Himmel.“
Eine franziskanische Friedenspredigt
Die Zeit der Entstehung des Riesentors war auch die Zeit franziskanischer Wanderprediger. Kern der Predigten des noch jungen, aber bereits südlich und nördlich der Alpen weit verbreiteten Ordens war der Friedensgedanke, die Verwirklichung des inneren Friedens in einer vielfach zerrissenen Gesellschaft. Man weiß, dass einer der berühmtesten franziskanischen Prediger, Berthold von Regensburg, auch in Wien vor tausenden von Zuhörern gepredigt hat. In einer der überlieferten Predigten sprach er über den Zugang zum „Himmelreich“, der nur möglich ist, wenn „Ihr nur das Eine haltet, das uns Gott geboten hat“. Dieses Eine „begehrt der Vogel in den Lüften“, ebenso wie „der Wolf im Walde, der Fisch im Wasser, der Wurm in der Erde und die wilden Tiere.“ Ausnahmslos alle Kreatur und alle Menschen begehren dieses Eine: „Mann und Frau, Arm und Reich, Gebildet und Ungebildet […], Dieb und Räuber, sogar der Teufel wird es nach dem Jüngsten Tag begehren, die Verdammten in der Hölle begehren es, die im Fegefeuer und überhaupt alles, was auf der Erde lebt […] Seht, jetzt will ich es euch nennen, es heißt Friede, Friede, Friede. Denn das begehrt alle Welt und alle Kreatur. Was man tut, tut man alles um des Friedens willen.“
Versuchen wir in diesem Sinn einmal eine andere Deutung des dämonischen Kämpferfrieses im Riesentor. Dann könnten wir nämlich hinter den abstoßenden Phantasie- und Fabelwesen auch verwunschene Seelen sehen. So wie in Fabeln, Märchen und Mythen Menschen in abstoßende Wesen verwandelt sind, die nur des Augenblicks harren, dass der Fluch in Vergebung umgewandelt wird, der Bann in Erlösung. „Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes. Wir wissen doch, dass die gesamte Schöpfung bis zum heutigen Tag seufzt und in Geburtswehen liegt.“
In einem wunderbar ruhigen Kontrapunkt zum chaotischen Treiben am Kämpferfries setzt darüber das Bogenfeld mit den Halbfiguren der Apostel an, zur Proklamation der alles ordnenden Wiederkunft Christi. Gewichen sind die dunklen Ängste der Welt und ihrer Dämonen. Ein ursprünglich vielfarbiger versöhnender Himmelsbogen wölbt sich in der reich ornamentierten Laibung des Portals darüber und bekräftigt die Verheißung, dass einmal alle Tränen abgewischt werden und es keinen Tod mehr geben wird. Nicht zufällig sitzen diese Halbfiguren als fortgedachte Säulen an der Basis der himmeltragenden Archivolten. Denn wer dem Bösen widersteht, „den werde ich zu einer Säule im Haus meines Gottes machen“, sagt in der Offenbarung des Johannes „der Heilige, der den Schlüssel Davids hat“. Im 9. Jahrhundert hat der Kirchenlehrer Beda Venerabilis in den Aposteln den „Blütenstand im Weinberge“ des Geliebten gesehen und ein andermal „die Pforten der Kirche“. Jesus hat den Zwölfen ja zugesagt, dass sie bei der Welterneuerung, wenn der Menschensohn auf dem Thron seiner Herrlichkeit sitzen wird, ebenfalls auf zwölf Thronen sitzen und die zwölf Stämme Israels richten werden. Am Riesentor von Sankt Stephan sind es allerdings vierzehn – vielleicht hat man die Evangelisten Lukas und Markus oder andere Heilige kooptiert. Alle tragen Bücher oder Schriftrollen in Händen. Den Steinmetzen war nicht wichtig, sie einzeln zu kennzeichnen, nur Petrus identifiziert man am Schlüssel, Paulus vielleicht noch am schütteren Kopfhaar und den einzigen bartlosen Apostel als den Jüngling Johannes. Der Friede in allen ihren Gesichtern ist der Widerschein jenes Friedens, der bei ihrem Hören, Horchen und Schauen auf Christus auf sie übergeht, eines Friedens, den „die Welt“ so nicht geben kann.
Das entblößte Knie
Sieben Schritte sind es vom Eintritt in die Vorhalle des Tores bis zur Türschwelle unter dem Tympanon, dem optischen und geistigen Brennpunkt des Riesentors. In der Mandorla, von zwei mächtigen Engeln gehalten, thront in erhabenem Relief Christus. Das ist der Herrschaftssitz Christi. Ihm sind die Engel geschickt, „sie sollen auf den Händen dich tragen […] du wirst gehen über Löwen und Schlangen, wirst niedertreten junge Löwen und Drachen“. Mit entblößtem linken Knie sitzt Christus auf dem Regenbogen, dem versöhnenden Zeichen des Bundes zwischen Himmel und Erde. Die rechte Hand ist segnend erhoben, in der linken hält er ein geschlossenes Buch. Manche Deutung sieht darin das „Buch des Lebens“, von dem die Sequenz Dies irae spricht: „Und ein Buch wird aufgeschlagen / treu darin ist eingetragen / jede Schuld aus Erdentagen.“ Christus als Buchhalter? Auf vielen anderen Darstellungen der Majestas Domini ist das Buch offen und ein „Ich bin“-Wort Jesu ist lesbar aufgeschlagen: Ich bin die Tür. Ich bin der Weg. Ich bin der Gute Hirt. Ich bin der Anfang und das Ende.
Das entblößte Knie gibt noch immer Anlass zu unterschiedlichen Erklärungsversuchen. So sieht man darin ein profanes mittelalterliches Herrschafts- und Gerichtssymbol, ähnlich einem Siegel des Stauferkaisers Friedrich II., auf dem sich das Motiv in verblüffender Ähnlichkeit findet. Die Sitzhaltung des Kaisers auf diesem Siegel scheint wiederum der römischen Kopie – aus dem 2. oder 3. Jahrhundert n. Chr. – jener weltberühmten Skulptur des Zeus von Olympia nachgebildet zu sein. Manche Kunsthistoriker behaupten, dass die Nacktheit des Beins überhaupt erst viel später aus dem Untergewand Christi herausgemeißelt worden ist.
Man könnte aber auch alle Vermutungen über das nackte Knie – etwa als Zeichen der Aufforderung zur Unterwerfung oder als Symbol für eine Instanz der Gerichtsbarkeit oder als Ritual der Freimaurer – außer Acht lassen und sich nur dem hingeben, was man selbst empfindet. Vielleicht spürt man es dann so, dass sich dieser Christus doch gewissermaßen eine Blöße gibt. Er ist nicht der Unberührbare, der nur Erhabene. Da enthüllt er sein Bein, als möchte er zeigen, dass unter dem Mantel von Recht und Gerechtigkeit Fleisch und Blut eines Menschen pulsiert, des Mensch gewordenen Gottessohnes. Des Rabbi Jesus, der sich nicht scheut, seinen Schülern die Füße zu waschen, der sich aber auch selbst und vor aller Augen die Füße waschen lässt, und zwar mit den Tränen einer Frau, die einen schlechten Ruf hatte in der besseren Gesellschaft. Bernhard von Clairvaux empfiehlt, es dieser Frau gleichzutun: „Umfasse die Füße des Herrn, benetze sie mit Tränen, so waschest du nicht ihn, sondern dich selbst.“
Die Mandorla
Zwei mächtige Engel halten den ovalen Rahmen der Mandorla, in der sich der Himmel öffnet und Christus segnend auf dem Regenbogen sitzt. Einige der Apostel am Riesentor schauen recht sprachlos hinauf, so, wie in der Apostelgeschichte von der Himmelfahrt Jesu die Rede ist, als „zwei Männer in weißen Gewändern“ plötzlich bei ihnen stehen und sie in den Alltag zurückholen: „Ihr Männer von Galiläa, was steht ihr da und schaut zum Himmel hinauf?“ Woraufhin die zwei Männer – oder Engel – den Verblüfften zusichern, dass dieser Jesus wiederkommen wird, so wie sie ihn zum Himmel auffahren gesehen haben. Er, der sich ihnen nach seinem Leiden ja als lebendig erwiesen und ihnen Kraft dafür versprochen hatte, dass sie seine Zeugen sein können „bis ans Ende der Welt“.
Als ich während der Restaurierungsarbeiten auch der Mandorla physisch ganz nahekommen durfte, sah ich ein Bild von biblischer Wucht. Vom Kreuznimbus des Christus über dessen rechten Arm fährt ein heller Blitz durch die ganze Mandorla. Offenbar war bei den Reinigungsarbeiten ein Riss entdeckt worden, der zuerst einmal fachkundig mit einer hellen Masse gekittet werden musste. Ich habe den Riss als Blitz gesehen, als biblisches Zeichen der Präsenz Gottes: „Von dem Thron gehen Blitze aus …“
Als Symbol gedeutet ist die Gestalt der Mandorla ein großes Versöhnungszeichen: Da sind zwei gleich große Kreise, der eine repräsentiert die Erde, der andere den Himmel. Sie schieben sich so ineinander, dass der gemeinsame Teil in der Mitte eine Mandelform bildet. Wie der mütterliche Schoß ist die Mandorla geöffnet für das Leben in himmlischer Vollendung.
Dies ist also der Ort unter der Mandorla des Riesentors. Hier legen sich Welt und Gott übereinander. Hier ist die Schwelle, wie viel Welt nehmen wir mit, wie viel Gott lassen wir ein.
Hinweise
• Friedrich Dahm (Hg.): Das Riesentor. Archäologie – Bau- und Kunstgeschichte – Naturwissenschaften – Restaurierung, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2008.
• Dem Riesentor sind auch einzelne Nummern des Mitteilungsblattes DER DOM des Wiener Domerhaltungsvereins gewidmet (z. B. Folge 4/1995 und Folge 2/1996).
• Annemarie Fenzel/Lene Mayer-Skumanz/Annett Stolarski: Ein Haus voller Zeichen & Wunder. Wien-Innsbruck: Tyrolia 2014 – Das Kinderbuch zum Dom.
Alberto Giacometti
1957
Meine Kindheit ist jetzt
Über den Bildhauer und Maler Alberto Giacometti (1901–1966)
Selbstzweifel war die Triebfeder von Giacomettis Schaffen: „Ich muss wissen, warum ich versage.“ Seine unverwechselbaren Plastiken sind überlange, bis auf den Wesenskern ausgebrannte Körpergerüste. In allen Sammlungen moderner Kunst sind sie zu finden. Manche sehen darin den ausgelieferten Menschen des 20. Jahrhunderts, beziehungslos, von Sinnlosigkeit ermattet. Andere erkennen ein Echo auf Kultfiguren frühzeitlicher Religionen.
Seltener verbindet man mit dem Namen Alberto Giacometti den bedeutenden Maler und Grafiker. Dabei nahm das Porträt einen gewichtigen Teil der künstlerischen Potenz des Schweizer Künstlers in Anspruch. Familienmitglieder und Freunde mussten ihm oft viele Stunden, ja Tage, Modell sitzen. Die Ergebnisse, wenn er sie nicht schon vorher als ungenügend oder misslungen vernichtet hat, lassen „in die Tiefe schauen“, lassen den Schmerz spüren, der in ihnen ist. Ähnliches empfindet man bei den nahezu körperlosen Skulpturen, gleich ob es sich um einen „schreitenden Mann“ oder um eine „stehende Frau“ handelt – oder um einen Hund, der ausgemergelt und mit gesenktem Kopf eine Spur wittert.
Très gentil, très très gentil
Wochenlang hatte ich täglich das Gesicht Alberto Giacomettis vor Augen. Fotografiert von Franz Hubmann. Ich hatte mir das Porträt als Hintergrundbild auf der Startseite meines Notebooks eingerichtet. Zuvor hatte ich den Film Les heures chaudes de Montparnasse gesehen, der drei Jahre vor dem Tod des weltberühmten Bildhauers und Malers gedreht worden ist. Giacometti beim Skizzieren, beim Modellieren und beim Nachdenken. Freundinnen, Freunde und anonyme Passanten sprechen darüber, was es für sie bedeutet hat, diesem Menschen in den Gassen des 14. Arrondissements zu begegnen. Täglich hatte man ihn leicht hinkend und mit gesenktem Kopf in sein Stammcafé gehen sehen oder irgendwann spät in der Nacht zurück in sein Atelier. Die meist jungen Leute in diesem Film erzählen von einer großen Wärme, die zu spüren war, wenn er vorüberging. Liebenswürdig war er, auch fremden Menschen gegenüber. Très gentil, très très gentil. Wie er einen anschaute, wenn er für einen Gruß dankte, wie er sich noch einmal umdrehte, mit einem breiten Wohlwollen im Gesicht.
So blickte er mich an, wenn ich in der Früh mein Notebook öffnete: Mit gefurchter Stirn unter dem kräftigen graumelierten Wuschelhaar, tiefen Kerben um den breit-sinnlichen Mund und mit dem Blick, der sich nicht recht entscheiden kann zwischen Empathie und Selbstzweifel. Ungefähr ein Jahr vor seinem Tod antwortete er auf die Frage, ob er gern an seine Kindheit denke: „Nein. Meine Kindheit ist jetzt. Denn jetzt erst lerne ich, wie ich das machen muss, was ich machen will.“
Mit zwanzig Jahren entdeckte Alberto in Florenz und später im Louvre die alte ägyptische Kunst für sich. Diese ins Zeit- und Raumlose blickenden Stand- und Schreitfiguren. Ähnliche Haltungen fand er in den etruskischen Skulpturen, die man damals vor 2300 Jahren den Toten ins Grab mitgegeben hatte. Der wohl berühmtesten darunter, dem sogenannten „Schatten des Abends“, einer unendlich langgestreckten Figur – gleichermaßen Jüngling und Mädchen – begegnete Giacometti erstmals in den sechziger Jahren. Die Ähnlichkeit zu seinen eigenen Skulpturen überraschte ihn. Das Todesthema liegt nahe. Giacometti drückte sich nie davor. „Alles ist bedroht!“ Seit er aber das Sterben eines Freundes mitansehen musste, konnte er im Dunkeln nicht mehr schlafen. Lebenslang. Einmal meinte er sogar, dass Kunst wohl die beste Vorbereitung auf den Tod sei.
Raum für den Raum
Was wollte Giacometti mit seiner Kunst? Mit seinen „stehenden Frauen“, die gefroren in Hoheit, Verlangen und sublimiertem Schmerz im Raum stehen. Mit den „schreitenden Männern“, die begegnungsfern aufeinander zumarschieren und doch großen Schrittes das Weite suchen. Mit seinen Köpfen, Büsten, Halbfiguren. Mit den grauschwarzen Porträtbildern, für die er vornehmlich seine Frau Annette, den Bruder Diego, eine langjährige Geliebte und einige ausgewählte Freunde zwang, stundenlang still zu sitzen, tagelang. Beim Zeichnen oder Malen hatte Giacometti den Arm mit dem Pinsel oder dem Bleistift immer völlig gestreckt – ähnlich der Haltung eines Menschen, der sich blicklos „seinen Weg in der Finsternis ertastet“. Die Gespräche, die auf Filmdokumenten von solchen Sitzungen existieren, sind eigentlich Monologe. Wenn er zu erklären versucht, dass er im Besonderen eines Gesichts das Allgemeine sichtbar machen möchte; alles, was an Kraft in einem Kopf wohnt. Den ganzen Menschen, gebildet aus allen Menschen, der „so viel wert ist wie sie alle, und so viel wert wie jedermann“. So steht es bei Jean-Paul Sartre im letzten Satz seiner „Wörter“. Vielleicht eine Quintessenz aus den vielen Gesprächen des Philosophen mit Giacometti, noch zu Zeiten ihrer Freundschaft.
Gelegentlich äußerte sich Giacometti über die zuerst winzigen, später in eine faszinierend schmale Länge gezogenen Skulpturen. Er betonte, dass es ihm vor allem um den Raum gehe, der um eine Skulptur herum entstehe. Je geringer das Volumen einer Figur wäre, umso mehr Raum könne sie dem Raum schaffen. Während der Urtrieb des Bildhauers die gestaltgebende Ausdehnung sei, war Giacomettis Prinzip das Zusammenziehen, ähnlich dem Zimzum in der Kabbala: Gott ist Schöpfer, indem er sich zusammenzieht, damit um ihn herum alles entstehen könne, was ist. Giacomettis Figuren, geschaffen nach 1945, stehen nicht im Raum, vielmehr laden sie den Raum ein, sich zu „entfalten“. Entäußerung. Demut. Kenosis. Wer das einmal gespürt und begriffen hat, weiß sich wirklich von Giacometti ergriffen.
Katze und Hund
Giacomettis Hund. Er hatte natürlich keinen lebendigen. Giacomettis Wohnort war ja das Atelier, das mit seinem Chaos voller Gipsstaub und penetrantem Terpentingeruch keinem anderen Lebewesen zugemutet werden konnte, nicht einmal einem Hund. Sein Bruder Diego, der nebenan die Werkstätte hatte, fütterte zugelaufene Katzen. Sie besuchten Giacometti manchmal am Morgen, stiegen über sein Bett, sodass er ihren runden Kopf über seinem Gesicht spürte. Aus dieser Erfahrung modellierte Giacometti seine Katze, 80 Zentimeter lang, dünn wie eine Zündschnur, ovaler Kopf, heutiger Schätzwert 16 bis 22 Millionen Dollar oder noch mehr.
Eine zweite Tierskulptur, die er schuf, war der berühmte Hund. Giacomettis Hund. Trottend mit gesenkter Schnauze sucht er eine Spur, abgemagert zum Skelett, einsam und herrenlos. Kinder, so wird erzählt, haben oft Mitleid mit ihm im Museum und versuchen, ihn an der bronzenen Schnauze zu streicheln. Der Hund, sagte Giacometti einmal, das bin ich. Man assoziierte diesen Hund auch mit den schroffen und zerklüfteten Felsen des Graubündner Alpentals und mit der Treue des Künstlers zu seinem Heimatdorf Stampa, wo bis zwei Jahre vor seinem Tod die Mutter lebte. Er besuchte sie regelmäßig.
Die Katze war der andere Lebensmittelpunkt: Paris. Zwielichtige Modelle liefen ihm zu wie dem Bruder Diego die hungrigen Katzen. Der Giacometti von Paris war ein Nachtgeschöpf. Apropos Katze: Wenn er sich entscheiden müsste, entweder einen Rembrandt oder eine Katze aus einem brennenden Haus zu retten, dann, meinte er einmal, würde er die Katze retten.
In der Geburtshöhle
Giacomettis Atelier ist zum Mythos geworden, man nannte es „Geburtshöhle und Grabkammer in einem“ und „jeder Hoffnung und jeden Komforts beraubt“. Selbst als er schon sehr viel Geld hatte, verließ er sein Atelier nicht. Es lag in der Rue Hippolyte-Maindron 46, Halbstock, fünfundzwanzig Quadratmeter, Wasser und Klo außen im Hof. Das Atelier war seine zweite Haut. Und der einzige Ort, an dem er sich wirklich geborgen fühlte. Rundum warteten die mit feuchten Tüchern umhüllten Gespenster unfertiger Skulpturen auf ihre Erweckung zum Leben. Beleuchtet war alles von nackten Hundert-Watt-Glühbirnen. Der Fußboden war übersät mit unzähligen Brandspuren ausgetretener Zigarettenstummel. Die Wände, über und über bedeckt mit graffitiähnlich hingeworfenen Kritzeleien, Bleistiftzeichnungen und Malskizzen, den Zeugen von vierzig Jahren kreativer Unrast. Als in den 1970er Jahren das Atelier geräumt wurde, nahm man den Verputz der Wände ab wie bei alten Fresken und übertrug sie in die Sammlung der Giacometti-Stiftung.
Wie viele andere Künstler empfing auch er Kollegen, Gäste und Händler gerne in seinem Atelier. Die chaotische Unordnung des Schauplatzes der Kämpfe zwischen Idee und Materie wurde zur mystischen Aura. Alle waren sie zu ihm gepilgert: Michel Leiris, Picasso, Sartre, Genet, Artaud, Cartier-Bresson und Marlene Dietrich. Für Samuel Beckett schuf er hier in langen Gesprächen den berühmten kahlen Baum für ein Szenenbild von „Warten auf Godot“.
Geld hatte er genug. Auch an Freunden und Frauen mangelte es nicht. Wichtige Begegnungen konnten sehr flüchtig sein. „Der Gang und das Profil einer Frau im Vorübergehen, zum Beispiel, nur Sekunden. Einen Augenblick. Und doch wirklich Begegnung. Ich glaube, dass sich jede Begegnung, die mich ergriffen hat, genau an dem Tag und in dem Augenblick ereignet hat, in dem sie für mich notwendig war.“
Einzig der Blick, das Auge
Eines Tages erkannte Giacometti, dass das Einzige, was Leben besitzt, der Blick ist. „Selbst einem Blinden schaue ich in die Augen“, sagte er einmal, „alles andere an einem Menschen ist unscharf.“ Die primitiven Künstler Ozeaniens hätten gewusst, wie sie ihren Skulpturen Leben einhauchten: durch das Auge. Selbst den von ihm so bewunderten ägyptischen und griechischen Statuen fehle dieser lebendige Blick, auch dann, wenn man in versuchter Nachahmung der Natur den Köpfen Augen aus Edelstein oder kostbarem Email eingesetzt habe. Giacomettis Suche nach der Wahrheit des Menschen in seinen Porträts beginnt und endet am Auge. So setzte er den Stift oder den Pinsel immer genau am Mittelpunkt zwischen der Nasenwurzel und den beiden mittleren Augenwinkeln an. Dann zeichnete er sofort ein Auge. Meist das linke. „Wenn ich einmal ein Auge habe – und es stimmt! – habe ich den Kopf, und wenn ich den Kopf habe, den Menschen.“ Giacometti litt immer an den Porträts, die er malte. Und seine Modelle mit ihm. Sie hatten die ständigen Zwischenbemerkungen Giacomettis zu ertragen, mit denen er seinem angeblichen Unvermögen oft auch derb und lautstark Ausdruck verlieh. Nach unzähligen Übermalungen schließlich ein Ergebnis: auf dem meist mit groben Strichen skizzierten Rumpf versinkt der Kopf in ein dunkles Grau. Erst bei längerem Hinsehen taucht das Gesicht auf – wie aus einer unwirklichen Tiefe und manchmal von erschreckender Wahrhaftigkeit. Zu retten, den Blick vor der Verwesung zu retten, das sei die Aufgabe des Künstlers. Und er meinte, in manchen Mumienporträts aus der Nekropole von Fayum wäre dies vielleicht gelungen. So etwas wie ewiges Leben sei in der Vitalität dieser Blicke zu sehen.
Ich gehe jetzt rückwärts
Etwa ein Jahr vor seinem Tod malte Giacometti seinen Freund und späteren Biographen James Lord. Giacometti war damals dreiundsechzig Jahre alt. Eine Krebsoperation lag hinter ihm, man hatte ihm vier Fünftel des Magens entfernt. „Lass dich anschauen, junger Mann“, sagte er zu Lord, der ihm Modell saß. „Ich bin kein junger Mann mehr“, sagte dieser, „sondern ein Mann, der junggeblieben ist.“ Giacometti zuckte die Achseln. „Ach Gott, Jugend bedeutet nicht viel. Ich bin sehr jung, während alle meine Altersgenossen in meinem Heimatdorf Stampa alte Männer sind, weil sie sich mit dem Alter abgefunden haben. Ihre Leben gehören schon der Vergangenheit an. Aber meins liegt noch in der Zukunft. Jeden Tag kann ich neu mit meinem Lebenswerk beginnen.“
Als er einmal bei einem Interview gefragt wurde, ob er gerne reise, antwortete Giacometti: „Eigentlich nicht. Warum sollte ich? Denn das Abenteuer, das große Abenteuer, besteht doch darin, in ein und demselben Gesicht jeden Tag wieder etwas Unbekanntes hervortreten zu sehen, das ist doch großartiger als alle Reisen rund um die Welt.“
Giacomettis Tugend war die Beharrlichkeit. Seine Arbeit betrachtete er als fortgesetztes Scheitern. Der empfundenen Vergeblichkeit war es kein Trost, dass Zeitungen in aller Welt über ihn schrieben, dass die bedeutendsten Museen seine Arbeiten ausstellten und Bankenkonsortien seine Skulpturen kauften. Er brauchte keinen Trost. Anfang Jänner 1966 zog er eine seltsame Bilanz: „Ich habe große Fortschritte gemacht, denn jetzt gehe ich rückwärts, dem Ziel entgegen. Ich schaffte nur, indem ich zugleich zerstöre.“ Ein Paradox, wenn man gerade in seinem Werk den eindrucksvollen Versuch der Rettung des Noch-Unzerstörten im Menschen sehen muss.
Unmittelbar bevor Alberto Giacometti am 11. Jänner 1966 im Krankenhaus von Chur an einer Herzmuskelentzündung starb, soll er zu den Angehörigen gesagt haben: „Also dann bis morgen!“
Hinweise
• James Lord, Alberto Giacometti: Die Biographie, Taschenbuch, Frankfurt a. M. 2013.
• L. Palmer/F. Chaussende (Hg.): Alberto Giacometti: Gestern, Flugsand. Schriften. Zürich 1999.
• Der im Text erwähnte Film „Les heures chaudes de Montparnasse“ aus dem Jahr 1963 (franz. OF /U) ist auf You Tube zu finden.
Menschen statt Masken
Über den Komödienschreiber Carlo Goldoni (1707–1793)
„Lieber Goldoni, Euch kann man nicht vorwerfen, ein ‚Frömmler‘ zu sein, Ihr habt nur selten von Gott gesprochen und sogar gewisse Vertreter mit einer Prise Ironie bedacht.“ So schreibt der Patriarch von Venedig Albino Luciani, der als „der lächelnde Papst“ Johannes Paul I. in die Kirchengeschichte eingegangen ist. In seinen humorvollen und geistreichen Briefen an literarische und historische Persönlichkeiten schrieb Luciani auch an Carlo Goldoni. Darin zeigt sich der Papst – der 1978 nach nur dreiunddreißig Tagen seines Pontifikats starb – als profunder Kenner von Werk und Leben des venezianischen Komödiendichters. Er verglich ihn mit Shakespeare und verlieh Goldoni taxfrei den Titel eines Feministen, beurteilte aber Shakespeares Umgang mit Frauenrollen – vor allem in „Der Widerspenstigen Zähmung“ – recht kritisch. Obwohl Luciani die eher kirchenferne und religionskritische Haltung Goldonis wahrnahm, attestierte er ihm hohe Moralität, ausgedrückt im Respekt, den Goldoni in allen seinen Stücken den Frauen, der Liebe, der ehelichen Treue und der Familie zollt. Goldoni machte ja aus seinem Anliegen kein Hehl, das menschliche Zusammenleben durch die Komödie verbessern zu wollen. Durchaus im Sinne der auch in Italien anbrechenden Aufklärung.
Ein friedfertiger Charakter
„Ich bin im Jahre 1707 zu Venedig geboren, in einem großen und schönen Haus, das zwischen der Brücke de Nomboli und Donna Onesta an der Ecke der Strada Ca Cent’Anni gelegen war und zu dem Sprengel San Tommaso gehörte.“
So beginnen Goldonis Memoiren „Mein Leben und mein Theater“. In besagtem Haus gab es – laut Goldoni – einen Großvater, ebenfalls Carlo mit Namen, der nach venezianischer Art das Vergnügen liebte und sein Geld großzügig für luxuriöse Komödien- und Opernaufführungen verwendete; ferner eine schöne brünette Mammà, die allerdings ein klein wenig hinkte; dann einen Vater, der nicht die Erziehung erhalten hatte, die er seiner Meinung nach verdient hätte; ja und alsbald den kleinen Carlo, der fast achtzig Jahre später feststellte: „Meine Mutter hatte mich fast ohne Schmerzen geboren. Und davon, dass ich nicht geweint hatte, als ich das Licht der Welt erblickte, scheint auch die Sanftmut herzurühren, die sich in meinem friedfertigen Charakter kundgab.“
Ereignet hat sich diese sanfte Geburt am 25. Februar des genannten Jahres. Als Erinnerungsglanz der Kindheit blieb nur das Marionettentheater, das ihm der Vater einst bauen ließ.
Mit dreizehn Jahren sollte Goldoni ein Abbate
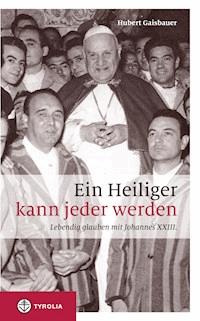














![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)













