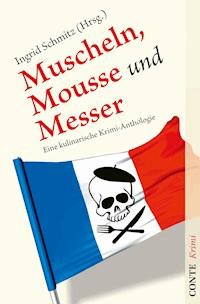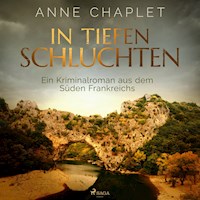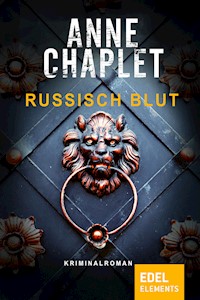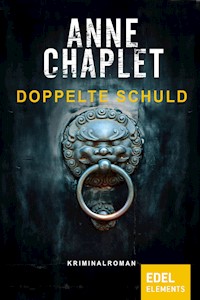4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Edel Elements - ein Verlag der Edel Verlagsgruppe
- Kategorie: Krimi
- Serie: Stark & Bremer
- Sprache: Deutsch
Sophie Winter konnte ihr dunkles Geheimnis vierzig Jahre bewahren. Plötzlich wird ihre wilde Vergangenheit wieder lebendig. Nicht nur die Polizei interessiert sich für das rätselhafte Verschwinden einer jungen Frau aus der Hippiebewegung...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 396
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Kurzbeschreibung: Sophie Winter konnte ihr dunkles Geheimnis vierzig Jahre bewahren. Plötzlich wird ihre wilde Vergangenheit wieder lebendig. Nicht nur die Polizei interessiert sich für das rätselhafte Verschwinden einer jungen Frau aus der Hippiebewegung. Ein spannender Kriminalroman um den mörderischen Sommer der Liebe.
Anne Chaplet
Schrei nach Stille
Der siebte Fall für Stark & Bremer
Edel Elements
Edel Elements
Ein Verlag der Edel Germany GmbH
© 2021 Edel Germany GmbH Neumühlen 17, 22763 Hamburg
www.edel.com
Copyright © 2008 by Anne Chaplet
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München.
Covergestaltung: Anke Koopmann, Designomicon.
Konvertierung: Datagrafix
Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des jeweiligen Rechteinhabers wiedergegeben werden.
ISBN: 978-3-96215-386-1
www.instagram.com
www.facebook.com
www.edelelements.de
Inhalt
Nach dem Sturm
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Nach der Liebe
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Vor dem Schnee
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Vor der Stille
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 17
When the truth is found to be lies
Jefferson Airplane, 1966
Vergessen ist Gefahr und Gnade zugleich
Theodor Heuss
Nach dem Sturm
Das Haus. Es lebt. Es verändert sich von Tag zu Tag. Es beherbergt Hausgeister. Kobolde. Rebellische Heinzelmännchen, die nicht Ordnung machen über Nacht, sondern alles auf den Kopf stellen. Die Möbel verrücken und Gegenstände verstecken: die Brille, das Portemonnaie, den Haustürschlüssel. Die den Schreibtisch in Unordnung bringen, Bücher wegräumen, Bleistifte verschwinden lassen, die Speisekammer plündern, das Kleingeld aus dem Zuckertopf stehlen, den Zettel für die Reinigung verstecken.
Das Haus ist alt und böse geworden. Die Bäume haben ihm das Licht geraubt und die Luft genommen. Sie sind zu groß geworden. Sie ragen über die Traufe. Sie haben alles, was unter ihnen gedeihen wollte, erstickt.
Die Haustür schließt nicht mehr richtig. Es zieht durch die Fenster im Wintergarten. Die Türen des Kleiderschranks öffnen sich von allein. Als ob das Haus sich neigte.
Es duckt sich. Es krümmt sich zusammen. Es beginnt, sich selbst zu verschlingen.
1
Es dauerte eine Weile, bis der erste Wassertropfen beschloß, sich vom Strom der anderen zu entfernen, die das Dach Richtung Regenrinne verließen, und durch einen Spalt zwischen zwei Ziegeln zu sickern. Dort hing er eine Weile an der Lippe eines der mürben Biberschwänze und löste sich erst, als ein zweiter Tropfen auf ihn stieß. Beide fielen nicht tief und landeten weich; auf dem Fell einer Ratte, das sich von ihrem aufgedunsenen Körper abgelöst hatte und wie ein Sprungtuch auf der schlierigen Wasseroberfläche des Zubers aus grauem Zink lag. Nur manchmal, im Sommer, wenn es lange nicht geregnet hatte, war der Zuber leer. Jetzt war er fast voll.
Den ersten Tropfen folgten weitere, erst langsam, dann immer zügiger, nun, da der Weg gebahnt war. Ihr Aufprall ließ das Rattenfell erschauern, und es begann, träge durch die Zinkwanne zu treiben. Die Wanne füllte sich, bis die Wasseroberfläche sich wölbte und ein weiterer Pionier unter den Wassertropfen den Sprung ins Unbekannte wagte, vom Rand des Zubers hinunter auf die staubigen Holzplanken des Dachbodens. Der Staub sog ihn gierig auf, auch den nächsten und übernächsten und alle weiteren, bis er gesättigt war und den Tropfen erlaubte, sich einen Weg an einen anderen Ort zu suchen. Erst sammelten sie sich in einem Astloch, dann strömten sie weiter, nach unten, an einem mächtigen Schiffskoffer vorbei, der mit geöffnetem Deckel im Weg stand und in dem es glitzerte und glänzte.
Sie umschifften einen verstaubten Sessel und einen mit Schwalbenkot bekleckerten Tisch und näherten sich schließlich einer Ritze zwischen den Planken. Sie weichten den Staub zwischen den Planken auf und sickerten tiefer, durch Holzspäne und Staub, durch Lehm und Mörtel, durch von Mäusen angelegte Gänge und Nester aus Heu und Federn und Plastikfetzen, drangen hindurch, fielen wieder auf Holz, glatter diesmal und weiß lackiert. Sie folgten einer sanften Neigung, schneller jetzt, da sie auf keinen Widerstand mehr trafen. Und schon tat sich die nächste Ritze zwischen zwei Brettern auf.
Die Tropfen hielten Ordnung. Der erste fiel ins Ungewisse. Zögernd folgte der nächste. Ihm folgten die anderen, immer schneller, wie die Lemminge, die dem Abgrund zuströmen. Sie sprangen, sie fielen, sie prallten unten auf, sie vereinten sich zu einer schillernden Pfütze und durchbrachen dann in einem entschlossenen Strom die letzte Barriere.
Im Keller wurden sie zu einem schmalen Rinnsal und nahmen Kurs auf die nicht mehr ganz weißen Kappen eines Paars hellblauer Chucks.
2
Tock.
Sie fuhr hoch. Es war dunkel im Zimmer, nur auf der gegen-überliegenden Seite des Raums sah man das hellere Rechteck des Fensters durch die Gardinen schimmern.
Tock.
Sie schloß die Augen und versuchte das Geräusch zu orten.
Tock.
Für eine Schrecksekunde bildete sie sich ein, es entstehe in ihrem Kopf, dehne sich aus, dränge heraus, sprenge ihren Schädel.
Tocktock.
Schneller jetzt. Gefolgt von einer Art feuchtem Schmatzen.
Sophie Winter ließ sich ins Kissen zurücksinken. Wassertropfen, über ihr. Über ihrem Kopf, über der hellgrau gestrichenen Holzdecke, auf dem Dachboden. Darüber das Dach. Und darüber ein atlantisches Tief.
Der Sturm, der still gelauert zu haben schien, jagte mit einem tiefen Orgelton eine Bö vorbei, rüttelte am Fenster, fegte durch ächzende Baumkronen im Garten.
Die Bäume, dachte sie. Sie werden aufs Dach stürzen. Die Dachziegel hinwegfegen. Ein Loch reißen in meine Höhle und die Elemente hineinlassen. Balken und Ziegel und Mörtel und Steine und Wasser.
Über ihr trommelten die Tropfen auf die Holzdecke.
Sophie versuchte sich dahin zu träumen, wo Stille war: Pferdeställe, Bibliotheken, Gartenhütten, der Pazifische Ozean, Heuschober. Doch heute gelang ihr das Abtauchen in das schützende innere Reich nicht, die Geräusche des Sturms übertönten alles. Nur nicht die Laute, die das Haus machte, bei jedem Windstoß.
Du hättest nicht kommen dürfen, flüsterte es.
Inzwischen tropfte es nicht nur über ihr, sondern auch neben ihr. Das Wasser war durch die Schlafzimmerdecke gedrungen, immer schneller klatschten die Tropfen auf den Holzfußboden neben ihrem Bett. Wenn du nichts unter das Leck stellst, stehst du morgen im Nassen, dachte sie und ging in Gedanken die Treppe hinunter, um einen Putzeimer zu holen.
Sie hörte die Tropfen auf den Boden klopfen, schneller, immer schneller. Sie hörte ihren Atem, seltsam gepreßt. Sie hörte den Pulsschlag in ihrem Ohr. Sie hörte es wispern.
Einen Eimer. Sofort.
Einen Eimer gegen die Sintflut? Sie zog sich die Bettdecke hoch bis über die Ohren und drehte sich auf die Seite.
Die Katze sprang aufs Bett und kuschelte sich schnurrend an sie. Der Sturm verebbte. Die Tropfen wurden weniger. Endlich schlief sie ein.
Sie wachte erst auf, als es schon hell war. Einen Moment lang wußte sie nicht, wo sie war und woher das Geräusch kam, das sie aufgeweckt hatte. Schließlich setzte sie sich auf, schwang die Beine aus dem Bett und schrie leise auf, als sie in kalte Nässe trat. Eine Pfütze. Warum war es naß in ihrem Schlafzimmer? Ein Schatten sprang vom Bett und bewegte sich zur Tür. Was war das?
Sophie schüttelte benommen den Kopf. Vor der Schlafzimmertür wartete die Katze und lief leise maunzend voraus, die Treppe hinunter. Sie folgte dem Tier.
Und dann hörte sie es wieder, das Geräusch. Ein energisches Klopfen, als ob jemand hereinwollte. Aber der Laut kam nicht von unten, von der Haustür. Er kam von oben. Vom Speicher.
Nein: vom Dach. Sophie lief auf bloßen Füßen wieder hoch, fand Jeans und T-Shirt auf einem Stuhl im Schlafzimmer, zog sich an und lief wieder hinunter.
Die Haustür war zu, verschlossen. Und der Schlüssel? Sie blickte sich suchend um. Der Schlüssel. Wo war der verdammte Schlüssel? Die Katze gab einen fragenden Laut von sich, sie stand mit erhobenem Schwanz im Flur, vor einer geschlossenen Tür, und sah Sophie auffordernd an. Sophie machte lockende Laute, während sie hinüberging und die Tür zur Küche öffnete. Die Katze. So weiß wie Schnee.
Mit einem Satz landete das Tier auf dem Küchentisch und hockte sich vor ein Schüsselehen mit Trockenfutter. Sophie horchte auf das leise Krachen, mit dem es die dunklen Brocken zerbiß. Plötzlich spürte sie ihren eigenen Hunger. Und Durst. Durst nach Kaffee.
Sie füllte Wasser in die Maschine und häufte ein paar Löffel Kaffeemehl in den Filter. Dann drehte sie sich um und öffnete den Brotkasten. Krümel. Eine leere Papiertüte. Das war alles. Und im Kühlschrank? Auf dem Weg dahin blieb sie stehen. Sie hatte gestern Brot gekauft. Ganz sicher. Vollkornbrot mit Dinkel, ein halbes Stück. »Wie immer?« hatte Nicole in Jürgen’s Lädchen gefragt, das Brot schon in der Hand, und es, ohne auf ihr Nicken zu warten, in die Tüte gesteckt.
Wenn kein Brot da ist, dann hast du auch keins eingekauft, schalt sie sich und schrieb »Brot!!« auf einen der Zettel auf dem Küchentisch, auf dem bereits »Frischhaltefolie!!!« stand.
Draußen erhob sich der Wind und orgelte durch die Bäume. Da war es wieder, das Geräusch – kein Klopfen mehr, eher ein dumpfes Hämmern und Schaben. Bei jedem Schlag schien das Haus zu zittern, als ob es sich fürchtete.
Nein, dachte Sophie. Als ob es sie hereinlassen will, die Naturgewalten. Als ob es nachgibt.
Sie eilte aus der Küche in den Flur. Der Haustürschlüssel lag da, wo er immer lag, seit fast einem Jahr, seit sie hier wohnte, in einer Schale auf der Anrichte. Wo sollte er auch sonst sein? Sie schloß auf, öffnete die Tür und trat nach draußen. Die Tannen im Vorgarten schwankten und stöhnten, wenn eine Bö sie packte.
»Wollen Sie nicht wenigstens ein paar der Bäume fällen lassen? Es ist so düster bei Ihnen«, hatte die Nachbarin im Sommer gesagt, kurze Zeit nachdem Sophie eingezogen war. Sie hatte nur den Kopf geschüttelt. Was hätte sie auch sagen sollen? Die Bäume sind tabu?
Die Kletterrose neben dem Haus hatte sich vom Spalier gelöst, ihre langen Triebe fuhren wie Peitschen durch die Luft, einer streifte ihr Haar und hätte sich fast darin festgekrallt. Sophie trat einen Schritt zurück und blinzelte hoch zu den blauen Flecken zwischen den schwankenden Wipfeln, über die weiße Schäfchenwolken jagten. Hier vorne sah alles aus wie immer, nur ein paar kahle Äste lagen auf dem Boden. Und der Lorbeerbusch in dem großen Topf mit den Löwenköpfen, der neben dem Gartentor stand, war umgefallen. Macht nichts, dachte sie. Ist ja nur Plastik.
Noch vor ein paar Jahren hätte sie einen auf Terrakotta getrimmten Kunststofftopf für einen unverzeihlichen Stilbruch gehalten. Aber damals hatte sie auch noch ein stabiles Kreuz. Sie ließ den Topf liegen, er würde ja doch wieder umfallen, wenn der Wind nicht nachließ. Dann ging sie nach hinten, in den Garten hinter dem Haus.
Eine Bö erfaßte sie, als sie um die Ecke bog. Im gleichen Moment bohrte sich etwas Spitzes in ihren Fuß, mit einem bissigen, bösen Schmerz. Sie sah an sich herab. Ihre Füße waren nackt. Sie hatte keine Schuhe angezogen.
Es ist nichts, flüsterte die Stimme in ihr. Du konzentrierst dich nicht, denkst immer an mindestens drei Sachen zugleich. Bist eben nicht mehr die Jüngste.
Sie balancierte auf einem Bein, während sie den Glassplitter aus ihrem Fußballen zog. Und dann hob sie den Blick.
Zwei Tannen mit geborstenen Stämmen waren auf den rückwärtigen Zaun gefallen, wahrscheinlich versperrten sie den Gemeindeweg. Sie mußte jemanden anrufen – aber wen? Die freiwillige Feuerwehr? Den Ortsvorsteher?
Sophie strich sich das feuchte Haar aus der Stirn. Sie hatte heute noch nicht in den Spiegel gesehen, die Haare waren nicht gekämmt und die Zähne ungeputzt. Hoffentlich sah sie niemand so. Und dann wanderte ihr Blick von den umgestürzten Tannen aufwärts, zur Rückseite des Hauses. Die Birke. Auch die war mal ein kleines Bäumchen gewesen. Aber mittlerweile reichte sie dem Haus bis zur Dachtraufe. Und jetzt hatte sie sich über das Haus geneigt, drückte auf das Dach, rieb sich an der Dachrinne.
»Wir fällen auch Bäume«, hatte der Mann gesagt, bei dem sie das Holz für den Winter bestellt hatte, der alte Otto, der ein paar Straßen weiter wohnte und ihr die sauber geschnittenen Buchenscheite mit dem Bulldog anlieferte. Er hätte sie ihr auch gestapelt, wenn sie ihn gelassen hätte. »Ist doch keine Arbeit für eine junge Frau!« Altherrencharme. Aber er hatte einen wunden Punkt getroffen. Manchmal fehlte ihr – ein Mann.
Einer wie Conrad, der das Holz hackte für den Kamin. Mit dem man Wein trinken und sich lieben konnte. Manchmal wußte sie nicht mehr genau, warum sie sich eigentlich getrennt hatten. Es war gut gewesen mit ihm, die paar Jahre. Sie sah sein Profil vor sich, die schmale, etwas windschiefe Nase, im Dämmer des Schneideraums, in dem sie tage- und nächtelang nebeneinandergesessen hatten. Es war immer ein magischer Moment gewesen, wenn das Filmmaterial zum ersten Mal angelegt wurde, Spule um Spule. Sie hatten daraus ein Ritual gemacht, einen guten Wein geöffnet, auf sich und das Werk angestoßen, während die ersten Bilder über den Bildschirm liefen, und Conrad hatte sich ein Zigarillo angesteckt.
Vorbei. Und besser so. Kein Mann, auch er nicht, hätte jemals hier einziehen dürfen. Nicht in dieses Haus. Außerdem konnte man einen guten Wein auch allein trinken.
Sophie schüttelte benommen den Kopf. Träum nicht. Vor allem nicht von der Vergangenheit.
Wieder bewegte sich die Birke unter einem Windstoß. Sie trat ein paar Schritte näher. Nicht die Birke war umgeknickt, sondern eine der Tannen, die gegen die Birke gekippt war. Daraufhin hatte sich der Baum geneigt, wie ein Teller hatte sich das flache Wurzelwerk aus der Erde gehoben, während die Krone über dem Dach lag. Wieder hörte sie es schaben und klopfen. Und wie in Trance ging sie hinüber, faßte an den Baumstamm, wollte ihn bewegen. Ein lächerlicher Versuch. Hilflos ließ sie die Arme sinken.
Der Wind schien die Luft anzuhalten. Sie hörte ein Pfeifen, das sich langsam steigerte. Und dann wurde der Ton tiefer. Sie lauschte dem Klang hinterher, er berührte etwas in ihr, sie spürte Weite und Einsamkeit. Der Ton kam näher. Die Luft vibrierte. Endlich begriff sie. Lauf, dachte sie noch. Aber schon war die Windbö bei ihr und preßte sie gegen den Birkenstamm. Sie versuchte Luft zu holen und sich dem gewaltigen Druck entgegenzustemmen. Ihr T-Shirt blähte sich knatternd auf. Über ihr ächzten Äste, splitterten Zweige. In diesem Moment bewegte sich der Birkenstamm. Die Tanne folgte. Sie hörte es krachen und bersten. Sophie fiel. Und dann senkte sich eine Wolke aus nassen Tannenzweigen über sie und hüllte sie ein.
Als sie zu sich kam und die Augen aufriß, sah sie nichts. Aber es roch nach Harz und feuchter Erde. Sie schmeckte Blut und tastete mit der Zunge nach ihrer Unterlippe, die sich taub anfühlte und anzuschwellen begann. Über ihr rauschte und wisperte es, etwas näherte sich, ein Tier? Sie versuchte zu rufen, versuchte sich zu bewegen, die Beine, die Arme, den Kopf. Der Baum hatte sie unter sich begraben. Sie würde erfrieren.
Etwas flüsterte. Etwas wollte zu ihr. Drang durch die Zweige. Nicht, dachte sie noch. Dann dämmerte sie weg.
So weiß wie Schnee, so rot wie Blut. Was für ein schöner Vogel. Unter dem Machandelbaum.
3
»Hast du das gehört?« Ulla Abel stellte das Bügeleisen ab, ging zum Fenster und spähte hinaus.
»Was soll ich gehört haben?« Peter Abel zog mit einem kräftigen Ruck die Zeitung auseinander und nach hinten und faltete sie wieder zusammen. Sie haßte das Geräusch, mit dem er umblätterte. Sie haßte es seit Jahren.
»Drüben. Bei der Winter. Ich hab es klirren gehört.«
»Na und?«
»Und vorhin – es muß einen der Bäume erwischt haben.«
»Gut so. Immer weg damit. Und heller wird’s dann auch.« Peter wiederum haßte es, wenn er morgens beim Zeitunglesen gestört wurde. Sie waren ein wunderbares Paar. Seit Jahren.
»Soll ich mal rübergehen?«
Peter knurrte. »Die kann schon für sich selbst sorgen. Sieh lieber zu, daß du mit meinen Hemden fertig wirst.« Er nahm einen Schluck Kaffee, schlürfend, wie immer.
Ulla legte das gebügelte Hemd zusammen und beiseite und breitete das nächste über das Bügelbrett. So einen Sturm hatte sie lange nicht erlebt. Sie hatte die halbe Nacht wach gelegen. Nur Peter hatte geschnarcht. Wie immer.
»Und wenn ihr was passiert ist?«
»Kümmert es dich?«
Ja, dachte Ulla. Nein. Aber die Frau war allein. Und wenn wirklich etwas passiert war ...
»Sie ist unsere Nachbarin, Peter.«
»Ja. Leider.« Ihr Mann raschelte mit der Zeitung. Gleich würde es wieder kommen, das Geräusch.
»Soll ich nicht vielleicht doch lieber ...« Ulla Abel biß sich auf die Lippen. Sie erwartete keine Antwort. Wenn es nach ihm ginge, konnte Sophie Winter bleiben, wo der Pfeffer wächst. Und wenn es nach ihr ginge, wäre er aus dem Haus oder täte was Nützliches. Schlimmer als ein schlechtgelaunter Ehemann ist ein schlechtgelaunter Ehemann, der arbeitslos ist.
Und der noch nicht einmal daran denkt, die Gass’ zu fegen oder Holz zu hacken oder einzukaufen.
Noch drei Hemden. Peter Abel brummte irgend etwas Unverständliches. Sie hatte sich abgewöhnt, ihm zuzuhören, wenn er die Weltlage erörterte. Die da oben. Wir da unten. Sie kannte die Leier.
Noch zwei Hemden. Noch eins. Fertig.
Sie schaltete das Bügeleisen aus, sah kurz zu ihm hinüber – er schien den Anzeigenteil der Zeitung zu studieren, vielleicht war es ja sogar der Stellenmarkt – und ging hinaus in den Flur zum Telefon.
4
Paul Bremer stand vor seinem Haus und blinzelte in die Morgensonne. Der Tag nach dem Sturm begrüßte ihn mit einem leergeräumten Himmel und einer Horde aufgekratzter Meisen im sauber gekämmten Apfelbaum. Der Wind, der die verblühenden Schneeglöckchen striegelte, war noch kühl, aber es roch schon nach aufbrechender Erde und strotzenden Knospen. Nemax und Birdie strichen mit vibrierenden Schwänzen um seine Beine, sie schienen sich nicht sicher zu sein, ob dies ein Tag auf dem Sofa oder der Heizung werden würde oder ob man einen Ausflug in die Flußaue wagen konnte, in der Hoffnung auf frühlingsbesoffene Mäuse.
Aus dem Fenster im Nachbarhaus hingen Bettvorleger und Plumeaus zum Lüften. Gottfrieds Hähne verkündeten mit einer Inbrunst den Tagesanbruch, als ob sie ihn gerade erst erfunden hätten, und aus dem Stall auf der anderen Straßenseite drangen markerschütternde Schreie. Arme Schweine, Kohldampf schiebend. Oder, wie Bremer manchmal fürchtete, muskelbepackte Eber voller Freiheitsdurst und Rachsucht. Der schwarze Kater von nebenan trabte vorbei und maunzte klagend. Nemax zu Bremers Füßen gab ein tiefes Grollen von sich und machte einen Buckel.
Vom Friedhofsweg her hörte man das Nörgeln einer Kreissäge. Um diese Jahreszeit zerkleinerte immer jemand Holz. Ein paar Wochen später schon erweiterte sich das Programm: Dann würden auf jedem Grasfleckchen die Rasenmäher quengeln. Und im Sommer, beim Einsatz des schweren Erntegeräts, spielte alles zusammen in der großen Sinfonie des Landlebens.
Bremer reckte sich den kräftiger werdenden Sonnenstrahlen entgegen. Klein-Roda war laut, Klein-Roda stank, Klein-Roda war von mittelmäßigem Klima, Klein-Roda hatte nichts Exotisches und bot auch sonst keine Überraschungen. Aber er war froh, wieder hierzusein. Verdammt froh.
Karen Stark zum Trotz. Seine beste, seine älteste Freundin – »solange ich nicht deine dickste sein muß« –, ach was, seine einzige Freundin wollte ihn seit Jahren nach Frankfurt locken. »Du brauchst Menschen, Abwechslung, Anregung.« Aber er wollte nicht. Zumal Karen immer dann, wenn man sie brauchte, Liebeskummer hatte oder auf Dienstreise war.
Ein neues Geräusch mischte sich unter die vertrauten Laute. Es gehörte nicht dazu – besser gesagt: noch nicht. Es kam von der denkmalwürdigen Fernsehantenne auf dem Haus von Gottfried und Marie. Er blinzelte hinüber. Dort oben saß ein kleiner schwarzer Kerl und schnalzte und schmalzte vor sich hin, klang mal wie ein Paar Gummisohlen auf glattem Parkett, mal wie ein zufriedenes Weidepferd. Das war keine Amsel, die waren keine Seltenheit. Es war ein Star. Der erste Star.
Bremer ließ sich auf die Gartenbank neben der Haustür sinken, obwohl sie moosig schimmerte, legte den Kopf in den Nacken und schloß die Augen. Der Frühling war nirgendwo auf der Welt so wie hier. Er schlich sich heran, fast verlegen, trat von einem Fuß auf den anderen, als ob er nicht aufdringlich sein wollte, ließ sich unendlich viel Zeit, überraschte mit zartem Flaum und jungfräulichen Farben und Düften, preschte vor, zuckte zurück und spielte das Spiel von Verlockung und Zurückweisung, bis sich der aufdringliche Sommer mit seinen fetten Farben durchgesetzt hatte.
Kein Vergleich mit dem gleichförmig freundlichen Wetter anderswo. Langweilwetter für Rentner und Kleinkinder. Er hingegen war gestern wie elektrisiert gewesen, als sich der Sturm ankündigte. Alles in ihm hatte nach Luft und Raum geschrien, die Lunge, die Haut, das Zwerchfell, die Augen. Er war so unruhig gewesen wie die Katzen, hatte aufgeräumt, staubgesaugt, feucht gewischt, ja sogar die Fenster geputzt, weil er nicht stillsitzen konnte. Die Fenster hätte er sich sparen können. Der Sturm hatte den Regen über die Straße gepeitscht, hatte ihn Erde und Stallmist vom Asphalt lecken lassen, dann die braune Suppe wieder hochgewirbelt und gegen die Fenster geklatscht. Streifenfrei.
Ich trinke auf dich
Hier ist erst morgens
War ein heißer Tag
Hier ist erst Frühling
Vermisse dich
I.d.a.
»Und? Alles in Ordnung?«
Bremer sah von seinem Mobiltelefon auf. Marianne stand nebenan im Fenster und räumte die Bettvorleger weg.
»Alles bestens.«
»Hast du Sehnsucht?« Marianne sah hinunter auf seine Hände, die das kleine Gerät umklammerten.
Er hob die Schultern. Ja und nein. Anne war in Los Angeles, und er war hier. Das sagte alles.
»Und? Den Sturm gut überlebt?«
»Keine besonderen Vorkommnisse.« Dreckige Fenster waren nicht der Rede wert, das waren sie bei ihm meistens. »Und wie steht’s bei euch?«
»Zwei Weidezäune, der alte Kirschbaum und ein paar Dachziegel.« Marianne legte die Arme auf den Fenstersims, das tat sie immer, wenn ihr nach einem Plausch war, und das Sturmtief Kyra und die Folgen waren Stoff genug. »Zwei Tote in Bayern, haben sie eben in den Nachrichten gesagt. Beim Spazierengehen vom Baum erschlagen.« Sie fuhr sich durch die blonden Locken und machte ein Gesicht, als ob sie »Geschieht ihnen recht, den Bayern« sagen wollte. Wer ging schon bei Sturm spazieren?
Paul grinste hoch zu ihr. Wenn er ihr erzählte, daß er gestern nacht aufgestanden war, weil er sich seit Stunden schlaflos im Bett wälzte, daß er sich angezogen hatte und hinausgelaufen war in den Sturm, würde sie auch ihn für verrückt erklären. Er war den Friedhofsweg hochgegangen, es hatte ihm bei jeder Windbö den Atem verschlagen, er hatte auf das Orgeln des Windes in den Stromleitungen gehorcht, auf das Ächzen der Weide am Friedhofsrand, auf das Rauschen des Sturms in den Pappeln am Bach. Noch nicht einmal Nemax war ihm gefolgt, der es normalerweise liebte, abends noch einen Rundgang zu machen. Die Vielstimmigkeit des Sturms hatte Bremer euphorisch singen und rufen lassen. Verrückt. Würde Marianne sagen.
»Luca ist verschwunden«, sagte sie beiläufig und tätschelte ein geblümtes Kopfkissen.
Luca. Das Sorgenkind von Klein-Roda. Und das sagte sie erst jetzt. »Seit wann? Mitten im Sturm?«
»Wird schon nichts passiert sein.« Marianne schüttelte das Kopfkissen aus und legte es beiseite. »Der hat sich irgendwo verkrochen. Unkraut vergeht nicht.«
»Du hast vielleicht Nerven!«
»Wer einmal lügt ...« Sie wiegte den Kopf.
Dem glaubt man nicht, und wenn er auch die Wahrheit spricht. Bremer kannte diesen und ähnliche Sprüche, nicht nur von Marianne. Sie hielt, wie die meisten im Dorf, Lucas Mutter für eine Fehlbesetzung und Luca selbst ... Na ja. Der Knabe war nicht das erste Mal verschwunden.
»Seit wann ist er weg?«
»Seit Donnerstag.« Marianne nahm die hellblaue Bettdecke vom Fenstersims. »Nicole hat drei Tage gewartet, bevor sie die Polizei angerufen hat.«
Drei Tage Warten. Wie hält man das aus? Andererseits – Bremer erinnerte sich noch gut an das erste Mal, als das ganze Dorf auf der Suche nach Luca war und man schon das Schlimmste befürchtete. Der zwölfjährige Knabe war schön wie aus dem Bilderbuch, mit blondem Prinz-Eisenherz-Haarschnitt und großen blauen Augen – der Phantasie waren keine Grenzen gesetzt, was so einem Kind geschehen konnte. Aber spätestens seit dem dritten Alarm waren alle abgestumpft, auch die Polizei. Man hatte sich daran gewöhnt, daß er verschwand und wieder auftauchte, meistens schon einen Tag später. Aber drei, nein: vier Tage?
»So lange war er noch nie weg.« Selbst Marianne schien beunruhigt zu sein. Und das wollte etwas heißen.
Luca war ein seltsamer Junge. Die Eltern hatten sich schon vor Jahren getrennt, die Mutter lebte seit einiger Zeit mit einem Freund, die Klatschbasen berichteten von lautem Streit, aber Genaues wußte man nicht. Der Junge selbst sagte nichts, er hatte bloß den unstillbaren Drang zu verschwinden.
Einmal kreuzte er bei Bremer auf, setzte sich auf die Garten-bank und sah ihm beim Rosenschneiden zu. Erst nach zwei Stunden sagte er etwas. Er wollte wissen, wie man die Farbe der »Rose de Resht« nennt, einer stark duftenden Damaszenerrose mit dicht gefüllten Blütenrosetten.
Purpur.
Vor dem weißblauen Himmel über ihm zogen zwei Krähen ihre Runden und krahten. Bremer sah Lucas Gesicht vor sich, ernst und ein bißchen verträumt. Vielleicht hätte er sich mehr um den Jungen kümmern sollen?
»Dein Telefon«, sagte Marianne.
Endlich hörte Bremer es auch.
Der alte Wilhelm war dran, wie üblich heiser und kurzatmig. Er war noch immer Ortsvorsteher, auch wenn er jedes Jahr ein bißchen steifer und ein bißchen müder wurde, aber es fand sich niemand, der ihn hätte ersetzen können.
»Paul, kannst du schnell rüber in die Siedlung fahren? Ulla hat angerufen. Bei ihrer Nachbarin stimmt was nicht. Die Frau wohnt allein, du weißt schon, es ist das Haus im Auenweg mit den vielen Bäumen im Garten.«
»Hat Ulla mal nachgesehen?« Gute Nachbarn taten das.
»Nein.« Wilhelm klang verlegen. »Alte Geschichten. Ich erzähl’s dir, wenn du zurück bist.«
»Ich fahr gleich los«, sagte Bremer. Er war Wilhelms Hilfs-sheriff, seit jenem Sommer vor einigen Jahren, als Wilhelm ins Krankenhaus mußte und ausgerechnet ihn, den zugewanderten Städter, um seine Vertretung gebeten hatte. Seitdem gehörte er dazu. Na ja: fast. Auch in Klein-Roda galt der Spruch: Wir haben nichts gegen Fremde, aber sie sollten schon von hier sein.
»Und – Paul? Halt bitte auch sonst die Augen auf. Luca ist wieder verschwunden.«
»Schon seit vier Tagen, hat Marianne gesagt.«
»Viel zu lange. Das macht mir Sorgen.«
Mir auch, dachte Bremer, lief nach oben und zog die Fahrradhose an, dazu ein warmes Hemd und eine winddichte Jacke, lief wieder hinunter und holte das Rad aus dem Schuppen. Alles, was Kinder betraf, weckte Urinstinkte, und Bremer, der es noch nicht einmal zum Onkel gebracht hatte, reagierte wie alle anderen auch. Man hatte hier in der Vergangenheit seine Erfahrungen gemacht mit verschwundenen Kindern. Der kleine Martin war tot gewesen, als ein Suchtrupp ihn entdeckte. Wenigstens Tamara lebte noch, als man sie fand. Das alles grub sich ein ins Gedächtnis und tat immer wieder aufs neue weh.
Gute Nacht
Ich schlafe schon
Luca ist weg
Nicht schon wieder
Ich mach mir Sorgen
Unkraut vergeht nicht
5
»Bringst du mir ein Autogramm mit?«
Nein, Caro. Und nun iß bitte dein Knäcke.
»Wie süß! Ein Autogramm!«
Flo! Hör auf, deine Schwester zu quälen.
»Vielleicht auch noch von der Lohberg, der alten Schachtel?«
Ist schon über 30, also kurz vor der Rente. Oh, Jugend ist grausam.
»Du bist gemein.«
Na ja – nicht, wenn Jugend Caro heißt und erst dreizehn ist.
»Und Papa sagt ...«
Papa sagt gar nichts. Der hält sich raus. Vergiß das Pausenobst nicht, Flo.
»Aber ich möchte gern mit.«
Nein, Caro, kommt nicht in die Tüte. Und jetzt beeil dich.
»Kinder haben da nichts zu suchen. Papa hat doch gesagt ...«
Daß eine Fernsehproduktion harte Arbeit ist und daß man sich als fachlicher Berater von der Polizei am Filmset möglichst unsichtbar macht. Ab in die Schule.
»Ich bin kein Kind! Kann ich nicht wenigstens nach der Schule ...?«
Ich sagte doch: Nein.
»Hast du dich wegen Hannah Lohberg so feingemacht?«
Fein? Ich? Jetzt werd mal nicht frech, Flo. Und nun ab mit euch, Kinderchen.
Kuß rechts, Kuß links, Tschüs, Papa. Tschüs, ihr Süßen. Du hast das Obst vergessen, Flo. Und ich denk noch mal über das Autogramm nach, Caro.
Ein Luftzug. Der Duft nach Pfusichshampoo.
Kriminalhauptkommissar Giorgio DeLange sah den beiden hinterher und wartete auf das vertraute und beängstigende Geräusch, mit dem die Wohnungstür zuknallte. Dann räumte er den Frühstückstisch ab, verstaute das Geschirr in der Spülmaschine und die Milch im Kühlschrank und schaltete das Radio ein.
»... zwölf Jahre alt. Der Junge hat blonde Haare, blaue Augen, ist schlank und circa ein Meter fünfundsechzig groß, trägt blaue Jeans und eine rote Windjacke ...«
Sachdienliche Hinweise. An die örtliche Polizeidienststelle. DeLange atmete tief ein und wieder aus. Immer wenn es solche Nachrichten gab, wurde er unruhig. Da war ein Zwölfjähriger verschwunden, irgendwo im Hessischen. Sein Verstand sagte ihm, daß der Knabe wahrscheinlich die Schule geschwänzt hatte und sich nun aus Angst vor Strafe nicht blicken ließ. Aber es half nichts. Immer wenn er so etwas hörte, machte er sich Sorgen.
Um Caro und Flo. Um wen sonst.
Beruhige dich, Alter. Der Bengel ist zwölf. Flo und Caro sind vernünftige Mädchen und schon fast erwachsen. Es wird ihnen nichts passieren. Sie werden ihre Partys feiern und die falschen Freunde kennenlernen und viel zu früh irgendeinen Langweiler mit nach Hause bringen, den sie heiraten wollen. Also reg dich ab, DeLange. Alles im grünen Bereich.
Er richtete sich auf, wischte noch einmal mit dem Küchenpapier über die Arbeitsplatte und ging ins Bad. Diesmal sah er sich ins Gesicht beim Rasieren, was er normalerweise vermied, weil es kein schöner Anblick war. Dabei war an jeder scharfen Linie in seinem Gesicht hart gearbeitet worden. Dank an Feli. Dank an den Mann mit dem Messer. Und danke an Flo, fünfzehn, und Caro, dreizehn. Mein Stolz, mein Elend. Beide schön wie die Verheißung. Und jung und unschuldig und unverletzt, und das hoffentlich noch lange.
Er massierte sich einen Klecks Post Shave Healer in die Haut, nutzlose Kosmetik, hatte er mal gedacht, aber seine Haut vertrat eine andere Meinung. Dann bürstete er sich das Haar, das er länger trug als früher, was sogar den Kollegen aufgefallen war, die ihn seither mit launigen Kommentaren begrüßten. »Und? Wie ist sie?« Alle glaubten, er hätte endlich wieder eine Neue. Oder was mit Hannah Lohberg angefangen. Wurde langsam Zeit nach der Trennung von Feli, meinten sie. Aber da war nichts. Und da würde auch nichts sein, solange Flo und Caro bei ihm wohnten.
Ihretwegen nahm er heute das Auto. »Es ist kein Wasser mehr da!« Flo, gestern abend, vorwurfsvoll. »Und denk an die Bionade, Papa!« Caro. Also irgendwo Wasserkisten einladen und bei dem Bioladen auf der Eckenheimer vorbeifahren, damit die beiden Damen ihr Kultgetränk kriegten. Die Generation Bionade. Toll. Er war die Generation Tri Top gewesen. »18 Gläser aus einer einzigen Flasche.« Bevorzugt Kirsch. Und Milch gab es in Schwabbeltüten, die man in einen Extraständer stellen mußte. Platzsparende Verpackung. War damals das Ding.
An allem mußten sie sparen zu Hause. Schon deshalb war er mit fünfzehn Jahren weg. Zur Polizei. Besser, als gleich im Knast zu landen.
DeLange schloß die Haustür hinter sich ab und lief zum Auto auf der anderen Straßenseite. Beim Anfahren hörte er noch die Nachrichten, bevor er die neue CD in den Player schob. Verdi, La forza del destino. Keine Meldung über den verschwundenen Jungen. Er war also weder tot noch lebendig gefunden worden. Das eine war keine schlechte und das andere keine gute Botschaft.
Me pellegrina ed orfana. Er zoomte die Lautstärke auf volle Dröhnung. »Mich, die Heimatlose, Verwaiste, treibt ein unerbittliches Schicksal ...« Er konnte sich noch immer nicht zwischen Renata Tebaldi und Maria Callas entscheiden, aber im Moment tendierte er zur Tebaldi. Sie hatte die wärmere Stimme.
»... fort vom Haus meiner Kindheit und fremden Gestaden zu.« Auf die Autobahn nach Frankfurt, immer schön gemächlich auf der rechten Spur, der Tebaldi lauschen und zusehen, wie der Wind ein paar verhuschte Wolken über den Himmel hetzte. Er kannte jede Ecke der Stadt, das Holzhausenviertel und die Nebenstraßen am Bahnhof, das Messegelände und den Hauptbahnhof, die finsteren Seiten Bockenheims und die Hinterhausidyllen Bornheims. Aber er spürte noch immer die alte Erregung, wenn sie ins Blickfeld kam, die Skyline. Die fernen Türme.
»Heimatgefühle? Du?«
Ja, Feli. Was dagegen, Feli?
»Ach, ich verlasse dich unter Tränen, meine geliebte Heimat ...« DeLange wechselte auf die mittlere Spur und überholte den roten Mazda, der vor ihm herzuckelte, noch langsamer als er selbst. Frau am Steuer? Nein. Ein Außerirdischer. Ein bleicher Mann mit hoher Stirn und einer riesigen Sonnenbrille mit blitzenden Gläsern. Alles Aliens. Mutanten. Er dachte das immer häufiger in letzter Zeit.
Abfahrt Eckenheim. Schon vorbei mit der freien Fahrt. Baustelle. Stop and go, wie immer um diese Tageszeit. Gasgeben. Bremsen. Sich zusammenreißen und weder hupen noch schreien, noch Handbewegungen machen, die jemand richtig deuten könnte. Vorbild sein. Ruhe bewahren. Haltung zeigen. Auch bei blond, Sonnenbrille, dämlich, direkt neben ihm, Mercedes mit Bad Homburger Kennzeichen, warum ist die denn jetzt schon unterwegs, die Geschäfte in der City machen doch erst um zehn Uhr auf. Vielleicht weiß sie das nicht? Das Huhn ahnt ja noch nicht mal, wozu ein Blinker da ist und warum man in den Rückspiegel gucken sollte, auch wenn man sich nicht gerade die Lippen nachzieht.
»Fahr doch nicht so aggressiv.« Feli, früher. Neben ihm, wie sie mit dem Fuß durchs Bodenblech will. »Brems doch!« Caro, auf dem Rücksitz. »Es sind doch nicht alle deine Feinde!« Flo.
Woher weißt du das, Flo? Wachs du mal auf als viertes Kind von viel zu vielen, in den 60er Jahren in Rüsselsheim. Laß du dich mal als Itaker beschimpfen und nach der Schule verprügeln, da lernst du die angesagte Sprache schneller als du »Ciao« rufen kannst. Und bist ein paar Jahre später Klassenbester in Deutsch. »Nehmt euch ein Beispiel an unserem Jo.« Und kriegst wieder Keile. Da will man doch nicht Deutschlehrer werden, oder? Da wird man was Grausames. Zahnarzt. Oder staatlich lizenzierter Gewalttäter.
Er parkte seinen Ford hinter dem Polizeipräsidium neben dem Peugeot von Frank, der noch immer die Babyschühchen seines Sohnes am Rückspiegel hängen hatte, obwohl der Junge längst studierte. Eine Kollegin, Oberkommissarin, ihr Name war ihm entfallen, auch wo sie eingesetzt war, grüßte und lächelte ihm auffällig aufmunternd zu. Wegen seines guten Charakters, des neuen Blazers oder der interessanten Narben? Er hätte fast vergessen zurückzulächeln.
Er mußte wieder lächeln lernen. Entspannter sein. Weniger zornig. Nimm’s doch mal locker, Alter. Feli ist nicht die einzige Frau auf der Welt. Und manche standen auf Typen wie ihn.
»Soll ich vielleicht den ganzen Tag zu Hause hocken und mir die Fußnägel lackieren?« Nein, Feli. Aber mußten es Ölbilder sein? Hätten Aquarelle nicht genügt? Und warum waren die Dinger so groß? Und mußte man damit ein ganzes Reihenhaus zustellen, deins und meins und das deiner Töchter? Für Apfelkuchenbacken wäre Platz gewesen.
»Ach! Und warum hast du nicht gleich deine Mutter geheiratet?«
Hast ja recht, Feli.
DeLange verzog das Gesicht zu einem schiefen Grinsen, während er durch den Innenhof ging. Kriminaloberkommissar Dirks, wie üblich im Schimanski-Look in Jeans und Lederjacke, grinste zurück. Sorry, Kollege, aber du warst nicht gemeint. In den Aufzug. Zwei Jungs von den Spezialeinheiten in Montur. Konnten vor Testosteron kaum ruhig stehen. Der Lichthof. Sein Flur. Abteilung Presse und Öffentlichkeit im Polizeipräsidium Frankfurt. Ausweis vor den Türöffner halten. Durchatmen.
Klara stand vor ihrem Zimmer, weißen Kaffeebecher in der Hand, braun geteert. Auch so eine Sitte. Niemand in der Abteilung wusch seinen Becher ab, das sollte wohl dafür sorgen, daß sich kein anderer daran vergriff.
»Jo! Wie stilvoll!« Sie musterte ihn von Kopf bis Fuß.
Seit er keine Uniform mehr tragen mußte, gab er sich Mühe mit der Kleidung. Die Kolleginnen schätzen das.
»Elegant wie immer!« Sie war verdächtig gut gelaunt. »Alles im grünen Bereich?«
DeLange schenkte ihr ein mattes Lächeln. Alles auf der sicheren Seite. Alles paletti. Alles tranquillo. Alles wie immer. Und verschwand in seinem Büro. Klara sah aus, als ob sie gute Nachrichten hätte. Er wünschte viel Glück. Wenn Klara Merz, Sachgebietsleiterin Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit k Polizeipräsidium Frankfurt am Main, die Karriereleiter hochfiel, hatte er Aussicht auf ihre Stelle. Und das bedeutete Besoldungsgruppe A 12 statt A 11. Stand einem alleinerziehenden Vater doch zu, oder?
Ein Tag Abwesenheit, und schon mit E-Mails zugeschissen. Er scannte die wichtigsten im Schnelldurchlauf. Das meiste erledigte sich durch Nichtbefassen. Klick und weg. Anfrage einer Journalistin, ob Polizeihunde Dienstgrade hätten. Aber sicher doch. Später beantworten. Mit einem guten Witz. Zwei Filmproduktionen wg. Komparsen. Gleich erledigen. Beide wollten SEK-Leute, na klar, ist ja die einzige Polizei, die sie noch kennen. Jungs in Sturmhauben, schlank, schwarz und stark. Einsatzfahrzeuge brauchten sie auch. Welche? Unklar. Ob die wissen, was das kostet? Omega Film. Nie gehört.
Die Redakteurin eines bunten Blattes fragte nach der Ehescheidungshäufigkeit bei »Polizistinnen«. Warum sagte sie nicht gleich Bulletten? Und ob die Gefahren des Polizistenalltags dabei eine Rolle spielten. Die Gefahren eher weniger, dachte DeLange. Höchstens der Alltag. Und die Konkurrenz durch die Diensthunde.
Sein Mobiltelefon. Der Weckruf. Er mußte los. Der Regisseur von Summer of Love bestand auf einem offiziellen Berater der Polizei am Set. Warum auch nicht. Der Film spielte in den 60ern, wie der Titel schon sagte. Er hatte sich extra Mühe mit der Recherche gegeben und die Komparsen geschult, es mußte alles stimmen: die Fahrzeuge, die Uniformen, das Auftreten.
Es war ja niemand von ihnen damals dabeigewesen.
Das Drehbuch schien brauchbar zu sein, wenn er nach den Szenen ging, die ihn und seine Leute betrafen. Da wußte jemand Bescheid, sogar über Dinge, die er erst hatte recherchieren müssen. Zum Beispiel, was Frankfurter Polizisten damals bei Einsätzen auf dem Kopf trugen. Da kannte sich jemand aus, als ob er dabeigewesen wäre. Damals.
Die Belohnung für all die Mühe: Sie war wirklich sehr nett. Hannah Lohberg. Arbeit konnte so schön sein.
6
Der Wind frischte auf. Bremer trat noch einmal in die Pedale und ließ sich dann die Landstraße hinabtreiben. Er versuchte, nicht an den Rückweg bergauf zu denken, den er früher spielend genommen hätte. Heute nicht. Nicht mit fünf Kilo Übergewicht.
Am Hang hatte der Wind eine Schneise in die Buchenschonung geschlagen. Der grob zusammengezimmerte Hochsitz oben auf der Anhöhe lag auf dem Rücken wie eine tote Kuh, an seinen Beinen hatten sich Laub, Zweige, Papier- und Plastikfetzen gesammelt. Am Himmel segelte ein einsamer Greifvogel, und aus dem Gebüsch am Feldweg stob ein Schwarm Spatzen auf, als er vorbeifuhr.
Gleich nach dem Ortsausgangsschild bog er ab und nahm den Weg hoch zur Grillhütte. Links lag das Holzlager, das Otto Busse und sein Sohn angelegt hatten und immer schwunghafter betrieben, seit auch auf dem Land ein flackerndes Kaminfeuer wieder geschätzt wurde. Das war noch vor ein paar Jahren anders gewesen, als das Hausfrauenmotto lautete: Macht Dreck, macht Arbeit, kommt mir nicht ins Haus.
Rechts ging es in den Auenweg. Die Siedlung aus den 20er Jahren sah aus wie ein Spielzeugdorf aus Disneyland. Die prächtigen Villen mit geschnitztem Fachwerk und ausladenden Balkonen, wie man sie aus den feinen Badeorten des 19. Jahrhunderts kannte, paßten nicht hierhin, in die karge Landschaft aus Wiesen, Maisfeldern und spärlichen Wäldern, in denen nichts gedieh außer Rindern und Schweinen. Der Volksmund hatte die Siedlung »Heinrichs Verhängnis« getauft. Ihr Erbauer war an den acht Häusern pleite gegangen, und nachdem sie jahrelang leer gestanden hatten, waren die alten Schmuckstücke so gründlich renoviert worden, daß alle gleich gesichtslos aussahen. Und alle hatten ordentlich beschnittene Thujahecken, sauber umgegrabene Gartenbeete, Beerensträucher, vielleicht ein paar Rhododendren im Vorgarten.
Alle, bis auf eines.
Bremer wich einem dicken schwarzweißroten Kater aus, der mit gelassener Menschenverachtung über die Straße promenierte.
Nur eines der Häuser zeigte noch immer sein geschnitztes Fachwerk unter den Dachgauben, am Balkon und am romantischen Wintergarten. Doch nur, wenn man genauer hinsah: Das Haus war umstellt von wucherndem Grün, von schwankenden Kiefern und düsteren Tannen, so, als ob es das Sonnenlicht scheute.
Bremer bremste und stieg vom Rad. Das Haus hatte am längsten von allen leer gestanden, erst seit gut einem Jahr wohnte wieder jemand hier. Er hatte die Bewohnerin ein paarmal beim Joggen gesehen, nur flüchtig, sie hatten einander zugenickt, mehr nicht. Alle behaupteten, man müsse komplett verrückt sein, um einen alten, heruntergekommenen Schuppen wie diesen hier zu kaufen und auch noch mutterseelenallein darin zu wohnen.
Verrückt wirkte sie auf Bremer nicht. Sie war eine zierliche Person mit hellbraunen Augen, halblangen weißen Haaren und Haltung, Typ: Vor Rehen wird gewarnt. Also elegante Erscheinung, aber im Kern stabil wie ein Rennradrahmen aus Carbon.
»Also arbeiten hat man die doch noch nie gesehen.« Marianne, der Ausbund einer fleißigen Landfrau. »Hat wohl reich geheiratet.«
Weiber.
Einmal hatte er sie halb gebückt im Garten entdeckt, die Haare zusammengebunden, in der rechten Hand eine Handschaufel, in der linken einen Blumentopf. Sie hatte hochgeblickt und ihn plötzlich angelächelt. Ihr Gesicht war nicht mehr jung, im Sonnenlicht sah man die Kanten und Furchen, aber es leuchtete. Dennoch hatte er sich nicht getraut, anzuhalten und mit ihr zu sprechen. Sie wirkte nicht unnahbar, das nicht. Aber ein bißchen – na ja: wie nicht ganz von dieser Welt. Unirdisch. Überirdisch.
Jedenfalls nicht wie eine früh pensionierte Lehrerin. Außerdem fuhr sie eine Antiquität, einen roten Mercedes 190 SL, der als einziges Auto draußen auf der Straße stand. Das Haus hatte keine Garage.
Bremer lehnte das Fahrrad an den Gartenzaun. Daß Ulla Abel nicht nach ihr hatte sehen wollen, war ungewöhnlich. Nachbarschaftshilfe gehörte zum Landleben wie Gülle auf den Feldern. Und wenn tatsächlich etwas passiert war?
Der Garten war unaufgeräumt, Bremer kannte ihn nicht anders. Äste auf dem Boden unter den hohen Bäumen, neben dem Gartentor ein umgestürzter Blumentopf. Das Gartentor stand sperrangelweit offen. Er ging durchs Tor über den gepflasterten Weg auf die Haustür zu. Die Haustür war geschlossen, aber das kleine Fenster daneben stand offen. Erst als er näher kam, sah er, daß dem Fenster die Scheibe fehlte. Nur ein paar Glassplitter staken noch im Rahmen. Und es knirschte unter seinen Schuhen. Glasscherben. Warum lagen sie hier draußen und nicht drinnen, was normal wäre, wenn es sich um einen Sturmschaden handelte?
Kein Name neben der Türklingel aus stumpf gewordenem Messing. Er klingelte trotzdem. Kein Laut. Nichts rührte sich. Als er versuchsweise die Klinke herunterdrückte, riß ihm ein Windstoß die schwere Holztür aus der Hand. Eine weiße Katze sprang ihm entgegen und an ihm vorbei.
»Hallo? Ist jemand zu Hause?«
Nichts. Niemand. Und das bei unverschlossener Tür. Die Stille machte ihn unruhig. Und obwohl er sich scheute, ein fremdes Haus zu betreten, sah er in jeden Raum. Die Küche war groß und kalt. Das Kaminzimmer noch größer und etwas wärmer. Die Bücherregale fielen ihm auf und die Tatsache, daß sie voller Bücher waren. Doch Lehrerin? Oder nur Leserin? Im ersten Stock klopfte er, bevor er die Türen öffnete, aber es war nur ein Zimmer bewohnt. Ein Schlafzimmer. Auch hier keine Menschenseele.
Was hatte Wilhelm gesagt? Was hatte Ulla Abel gehört?
Er lief wieder hinunter und hinaus, zog die Haustür hinter sich zu und ging ums Haus herum. Die Nachbarn hielten sich nach hinten heraus gepflegte Rasenflächen, eine Terrasse, einen Grillplatz, aber in diesem Garten gab es nichts als Bäume. Mindestens drei von ihnen hatte es erwischt, soweit er erkennen konnte, zwei Nadelbäume waren umgeknickt, und eine Birke wurde von einer der Tannen gegen das Haus und das Dach gedrückt. Bei jedem Windhauch gab es ein häßlich schabendes Geräusch. Bremer trat näher. Unter dem tief herabhängenden Ast der Tanne schimmerte es weiß. Er beschleunigte seine Schritte. Die Birke knarrte und knarzte, die Tanne zitterte, und unter ihren Zweigen flackerte das Weiß. Er kniete nieder und schob die Zweige zur Seite.
Die Frau hatte die Augen geschlossen und atmete flach. Die linke Hälfte ihres blassen Gesichts war überzogen von schwarzen Rinnsalen, wie eine Faschingsmaske sah das aus, es mußte getrocknetes Blut sein. Wie lange sie wohl hier schon lag? Bremers Blick glitt an der schlanken Gestalt im weißen T-Shirt entlang. Der Baum hatte sie eingeklemmt, der schwere Ast lag über ihren Oberschenkeln. Er schaute wieder hoch. Was würde passieren, wenn er versuchte, sie unter der Tanne hervorzuziehen? Wie schwer war sie verletzt?
Hilfe holen. Aber vielleicht war es dann schon zu spät.
Die Frau gab ein Geräusch von sich, ein mattes Seufzen. Sie war blaß, viel zu blaß. Keine Zeit, um auf einen Krankenwagen oder die Feuerwehr zu warten. Er hockte sich unter den Ast, stemmte ihn hoch und drückte ihn zur Seite. Vom Dach her ertönte ein protestierendes Kreischen – Blech, das dem Druck nachgab, es mußte die Dachrinne sein. Er hielt mit dem Rücken den Ast in Position und zog den regungslosen Körper darunter zur Seite. Dann ließ er den Ast langsam wieder sinken. Für einen Moment herrschte Gleichgewicht, bis sich die Birke mit einem Protestschrei zur Seite neigte und die Dachrinne mitriß. Stille. Bremer horchte auf den Wind und auf den Atem der Frau. Die weißen Haare lagen wie Federn um ihr Gesicht, der Mund schien zu lächeln. Aber die Augen waren geschlossen. Kein Lebenszeichen.
Erst jetzt spürte er die Kälte.
7
Ein Treppenhaus. Altbau mit ausgelatschten Treppenstufen. Schäbiger Putz. Auf dem Treppenabsatz drei Gestalten in Lederjacken und Schnürstiefeln. Und jetzt los. Langsam. Stufe für Stufe. Körperkontakt halten, leise auftreten, nicht schnaufen beim Atmen.
Gut so.
Treppenabsatz. Nach hinten sichern. Nach vorne nicht drükken. Vor allem nicht stolpern. Weiter. Immer vorwärts. Nicht schwitzen. Mit Schwitzehändchen verlierst du gleich die Waffe, Kerl.
Ganz schlecht.
Sichern! Seid ihr blöd? Was macht ihr, wenn hinter der nächsten Biegung einer mit dem Messer steht?
Na also. Das ist besser. Weiter so.
Jetzt die Wohnungstür. Klingeln? Nicht klingeln. Auch recht. Einen Schritt zurück. Ein Tritt. Tür auf. Der Sound von In-A-Gadda-Da-Vida, voll aufgedreht. Na dann.
»Und – danke!« Der Regisseur. Martin Vogelsang, ein Hüne von einem Mann mit einem Gang wie ein Brauereipferd. Die Komparsen in den Lederjacken entspannten sich. Auch Giorgio DeLange atmete auf. Hoffentlich war die Szene im Kasten. Seine Leute hatten die Wohnung an diesem Vormittag bestimmt schon an die zehnmal gestürmt. »Ist gutes Training,Jungs«, hatte er ihnen gesagt, aber keiner hatte auch nur die Mundwinkel verzogen.
Der Drehort bewegte DeLange, er kannte ihn gut: Es war das ehemalige Frankfurter Polizeipräsidium an der Friedrich-Ebert-Anlage, heute Partylocation und Kulisse für Filmproduktionen. Und Martin Vogelsang faszinierte ihn. Der Mann hatte eine Geduld wie ein Heiliger oder ein armer Irrer. Dagegen war der Job des Aktenführers selbst bei Mordfällen mit erhöhtem Spurenaufkommen die reine Entspannung.
Sein Ding war das nicht. Geduld. Die oberste Tugend von Ordnungskraft und Sicherheitsorgan. Nicht bei ihm. Vor allem heute nicht.
Er machte sich Sorgen.
Du machst dir immer Sorgen, Alter.
Ja, aber diesmal ...
Diesmal. Jedesmal. Immer wenn so etwas in den Nachrichten kam. Immer wenn ein Kind verschwand wie der Junge aus dem Oberhessischen. Das trieb ihn um.
Giorgio DeLange lächelte mit schmalen Lippen in sich hinein, während er auf den Fußballen langsam auf und ab wippte. Die meisten kleinen Schulschwänzer tauchen schnell wieder auf. Die Hälfte der Fälle klärt sich innerhalb einer Woche, vier Fünftel innerhalb eines Monats.
Und trotzdem. Und trotzdem.
»Papa, du siehst zuviel fern.« Flo, total lebenserfahren. Dabei hatte er gestern bloß wissen wollen, was das für ein Kerl war, der sie zur Party eingeladen hatte am Wochenende. »Ein Schulfreund.« Eltern? Beruf? Wohnlage? Asozial oder bessere Kreise, was manchmal das gleiche ist? Migrationshintergrund? »Wir schnupfen nicht alle schon mit fünfzehn Koks.« Nein? Ehrlich nicht? Nicht alle? Nur ein paar?
»Und hast du nicht selbst gesagt, daß man eine verzerrte Wahrnehmung kriegt, wenn man immer alles durch die Polizistenbrille sieht?« Bingo. Die statistische Wahrscheinlichkeit war tatsächlich nicht groß, daß den beiden was passierte. Aber was machen wir gegen den Zufall, den dummen bösen Zufall?