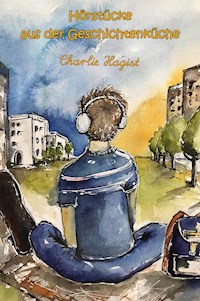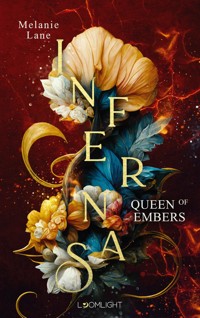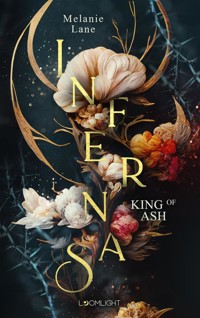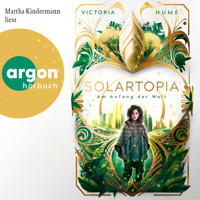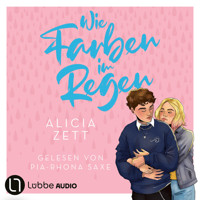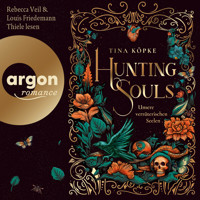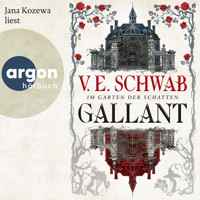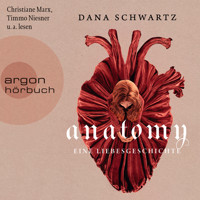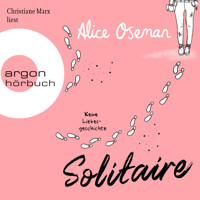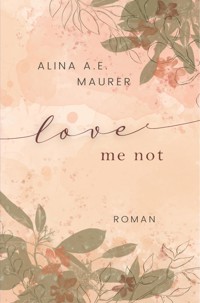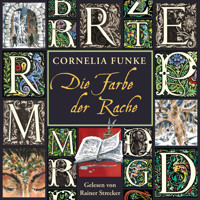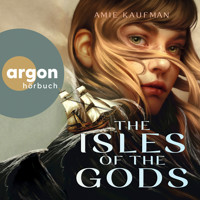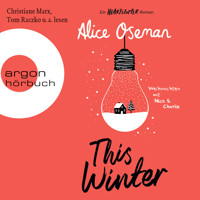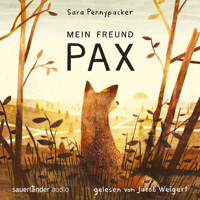6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Papierfresserchens MTM-Verlag
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
Kann Paul wirklich Gedanken lesen? Er kann von Weitem erkennen, was ein anderer sagt. Das behauptet jedenfalls Ben. Der Paul muss ein Außerirdischer sein, da sind sich alle sicher. Die Lehrerin klärt das mit Paul in der Klasse. Jeder soll ein Tier in die Schule mitbringen. Emily hat eine Idee, die die Lehrerin furchtbar erschrecken wird. Gummibärchen sind das nicht. Es ist … Ein Faschingsfest ist eigentlich eine fröhliche Veranstaltung. Leider nicht so in der Klasse von Leonie und Steffi. Hat doch Steffi plötzlich den Einfall, lange mit Karl zu tanzen. Und das, wo sie doch weiß, dass Karl der Freund von Leonie ist. Leonie überlegt sich eine Rache ... und die wird für Steffi ziemlich klebrig. Finn und Felix beobachten aus der Ferne, wie Justin zu Boden geschubst wird. Immer wenn Justin vor der Schule aus dem Bus steigt, meldet er sich per Handy bei seiner Mutter. Heute geht das nicht. Sein Handy wird ihm gestohlen. Soll er das der Lehrerin Frau Bergmann sagen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
o
Schulgeschichten aus der Geschichtenküche
Charlie Hagist
o
Impressum:
Personen und Handlungen sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind zufällig und nicht beabsichtigt.
Besuchen Sie uns im Internet:
www.papierfresserchen.de
© 2023 – Papierfresserchens MTM-Verlag GbR
Mühlstraße 10, 88085 Langenargen
Alle Rechte vorbehalten.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Taschenbuchausgabe erschienen 2019
Cover: A. Hagist
Bearbeitung: CAT creativ - www.cat-creativ.at
ISBN: 9978-3-86196-889-4 - Taschenbuch
ISBN: 978-3-86196-928-0 - Taschenbuch
*
Inhalt
Der Außerirdische
Buchstabenhäufigkeit
Die Klatsche
Die Schülerzeitung
Drei kleine Männlein
Grusel Grusel
Tiertag in der Schule
Von hier ab können wir alleine ...
Leonies Faschingsrache
Freundinnen
Das Geheimnis des Müllers
Der Verkauf
Der Zaubermeister
Nicht bei mir
Digitale Medien
Die Wörterverschlucker
Die Mutprobe
Der Zauberlehrling
Ich sehe ja gar nichts
Die Spionin
Anmerkungen
Autor
Unser Buchtipp
*
Der Außerirdische
Kaum hat die Klassenlehrerin nach der ersten großen Pause ihre Tasche abgestellt, da schießt auch schon der rechte Arm von Ben nach oben. Seine Finger schnipsen aufgeregt.
„Na, Ben, was ist los?“, fragt sie ihn.
„Der Paul ist ein Außerirdischer!“
„Ach, was du nicht sagst.“
„Ja, der Paul kann Sachen, die kann nur ein Außerirdischer. Das weiß ich aus verschiedenen Büchern. Das hab ich gelesen.“
Während Ben das sagt, geht der Begriff wie ein Echo durch die Klasse. Immer wieder kichern die Mädchen und Jungen: „Außerirdischer, der Paul ist ein Außerirdischer.“
Jetzt will es die Lehrerin genauer wissen. „Was kann denn der Paul, was deiner Meinung nach sonst nur ein Außerirdischer kann?“
„Der Paul kann von Weitem erkennen, was ein anderer sagt. Der Paul kann Gedankenlesen, sicher.“
„Du hast ja nicht mehr alle Tassen im Schrank!“, ruft Leon von seinem Platz in der letzten Reihe.
Und Leonie kichert: „Der Paul hat vielleicht Radarohren?“
Nele meint: „Das Einzige, was Paul hat, ist einen Sprung in der Schüssel, aber damit kann man keine Gedanken lesen.“
„So, nun ist aber erst mal genug mit euren Albernheiten. Paul, was ist dran an der Behauptung, dass du ein Außerirdischer bist und Gedanken lesen kannst?“, will die Klassenlehrerin jetzt wissen.
„Ja, Ben hat recht.“ Weiter kommt Paul nicht, sofort bricht ein Kichern und Grölen los.
„Paul ist ein Außerirdischer, Paul ist ein Außerirdischer!“, tönt es wiederholt von allen Plätzen. Die Klassenlehrerin hat große Mühe, den wild gewordenen Haufen von Schülern zur Ruhe zu bringen. Als sie schließlich eine saftige Hausarbeit zur Strafe androht, wenn nicht sofort Ruhe in der Klasse einkehrt, ist es schlagartig still und endlich kann sie das Gespräch mit Paul fortsetzen. „Also, Paul, noch mal, du kannst also Gedanken lesen?“
„Nein, nein“, gibt Paul kleinlaut zu, „Gedanken lesen kann ich nicht, aber ich kann oft erkennen, was einer sagt, auch wenn ich ihn nicht höre. Ich muss sein Gesicht nur dabei aus möglichst kurzer Entfernung sehen. Wenn ich dann seine Lippenbewegungen und sein Gesicht sehe und dabei vielleicht auch noch erkenne, ob er außerdem mit seinen Armen und Händen herumhantiert, dann kann ich einigermaßen genau erkennen, was der andere sagt.“
„Das ist ja ganz toll, Paul“, bestätigt die Klassenlehrerin ihren Schüler. Jetzt wendet sich die Lehrerin wieder Ben zu und will von ihm wissen, wie er denn das bemerkt hat, also die Sache mit dem Erkennen der gesprochenen Wörter.
„Das war eben in der Pause. Da hatte der Luis mit dem Max zusammengestanden und ich stand mit Paul zusammen. Da sagte Paul plötzlich zu mir: Pass auf, wenn wir gleich nach dem Klingeln wieder in die Klasse gehen, dann wird Max dich ganz stark anrempeln. Dazu hatte ihn nämlich der Luis angestachelt. Und was war? Der Max hat mich gleich unten an der Tür fürchterlich zur Seite geschubst, sodass ich fast hingesegelt wäre. Der Paul hat es also richtig gehört oder – besser gesagt – gesehen. Paul ist ein Außerirdischer, dabei bleibe ich.“
„Na dann wollen wir das doch am besten gleich klären, Ben“, sagt die Klassenlehrerin und wendet sich anschließend wieder Paul zu. „Paul, was ist nun, kannst du von Ferne erkennen, was andere sagen oder nicht? Bleibst du bei deiner Aussage?“
„Ja, das klappt meistens ganz gut.“
„Und woher kannst du das? Wo hast du das gelernt oder wer hat dir das beigebracht? Außerirdische doch sicherlich nicht?“
„Nein, Außerirdische nicht. Ich habe das gelernt, weil meine Mutter gehörlos ist. Meine Mutter kam als Gehörlose zur Welt. Und weil sie nicht hören kann, habe ich die Gebärdensprache erlernt. Dabei musste ich lernen, wie die Gehörlosen erkennen, was gesagt wird. Sie achten nämlich auf die Mundbewegungen, auf den Gesichtsausdruck und auf die Arm- und Handbewegungen, die sogenannten Gebärden. Und aus alledem erkennen sie, was ihr Gegenüber meint.“
„Ist ja spannend. Und warum hast du uns das nicht früher mal gesagt? Dann wundert mich nicht, dass zu Elternversammlungen immer dein Vater gekommen ist. Deine Mutter hätte ja gar nichts mitbekommen.“
„Genau. Ich dachte immer, dann lachen mich alle aus, wenn ich das erzähle.“
„Aber Paul, das ist doch nicht richtig. Wir lachen doch nicht darüber – weder über deine Mutter noch über dich.“ Und nach einer kurzen Pause, in der es merkwürdigerweise im Klassenraum ganz ruhig ist, verkündet die Klassenlehrerin einen Vorschlag: „Ich habe da eine Idee. Was haltet ihr davon, wenn ich eine Elternversammlung einberufe und euren Eltern vorschlage, dass wir zu diesem Thema einen ganzen Unterrichtstag erarbeiten, an dem wir uns nur mit der Gehörlosigkeit beschäftigen. Wir laden zu dem Bereich Pauls Mutter und eine Dolmetscherin ein. Und ihr könnt dann Fragen stellen und vielleicht selbst erfahren, wie das ist, wenn man nicht mehr hören kann.“
Alle sind sofort einverstanden und so beruft die Klassenlehrerin die Elternversammlung ein. Dort stellt sie das Projekt vor und erhält auch von allen Anwesenden die Zustimmung.
Zur Vorbereitung des Gehörlosen-Thementages verteilt sie an alle anwesenden Eltern jeweils zwei Ohrstöpsel, mit denen man die Ohren so dicht verschließen kann, dass kein Geräusch von außen zu hören ist.
Die Eltern werden gebeten, ihren Kindern am kommenden Samstag – noch im Bett frühmorgens – die Ohren zuzustöpseln. Dann sollen sie den ganzen langen Tag die Stöpsel nicht herausnehmen dürfen. Erst abends im Bett, wenn sie das Licht ausschalten, sollen sie wieder die Stöpsel entfernen. Die Eltern versprechen, streng darauf zu achten, dass diese Bitte eingehalten wird, denn sie sind von diesem Projekt überzeugt und halten es für wichtig und hochinteressant.
Die Klassenlehrerin erklärt am Schultag nach der Elternversammlung ihren Schülern alles und findet auch dort für diese Vorübung volles Verständnis und von allen die Zusage der strikten Einhaltung des Hörverbots am Samstag.
Mit Spannung erwarten alle den Samstag. Eigentlich ist der Samstag für viele von ihnen der Tag, an dem sie Musik hören, mit Freunden quatschen, Fahrradfahren, ins Kino gehen oder auf dem Computer Filme ansehen. Diesen Samstag werden sie so schnell nicht vergessen. Ein ganz ruhiger, nein ganz stiller Samstag.
Die Klassenlehrerin hat am Montag erst im zweiten Block Unterricht in der Klasse. Sie kann gerade noch die Schüler begrüßen, da geht es auch schon los. Jeder Einzelne möchte gern als Erster die Erlebnisse vom vergangenen Samstag schildern. Damit es nicht ganz durcheinandergeht, einigen sie sich, dass es nach dem Alphabet der Nachnamen geht.
Lars darf als Erster seinen Samstag beschreiben. Es sprudelt förmlich aus ihm heraus. Er beginnt mit dem erstmaligen Erlebnis der vollkommenen Stille beim Frühstück. Mama und Papa unterhielten sich am Frühstückstisch, aber er … er verstand überhaupt nichts. Er konnte auch nicht ahnen, worüber sie vielleicht sprachen. Es blieb ihm nur übrig, seine Eltern zu beobachten.
Damit jeder drankommt, seine Erlebnisse zu schildern, erteilt nun die Lehrerin Anika das Wort und auch sie beginnt beim Frühstück. Sie erzählt, dass ihr ihre Eltern anzeigten, dass sie leiser sprechen solle. Sie hatte nicht bemerkt, dass sie lauter als sonst gesprochen hatte und dass sie dazwischenquatschte, als ihre Eltern noch sprachen. Sie hatte sie ja nicht gehört, während sie schon ansetzte.
Jetzt ist Robert dran. Er berichtet, dass es ihm nach dem Frühstück erst einmal furchtbar langweilig war. Normalerweise geht er in sein Zimmer, schaltet sein Musikabspielgerät an und legt sich auf seine Couch. Aber diesmal ist nichts mit dem Musikhören. Selbst wenn er das Gerät anstellen würde, es wäre ja sinnlos, er hört ja nichts. Also ohne Musik auf die Couch und Löcher in die Luft gestarrt. Langweilig. Die Zeit wollte nicht vergehen.
Leonie darf fortsetzen. Sie berichtet vom Einkaufen und dem anschließenden Mittagessen. „Auf der Straße“, sagt sie, „bin ich bald verrückt geworden. Ich sehe Leute, die sich unterhalten und Autos, die näher kommen, an mir vorbeifahren und ich höre nichts … ich höre einfach nichts. Ich stehe da wie blöd. Wenn ich den Fahrdamm überqueren will, muss ich genauer hinsehen, um abzuschätzen, wie schnell das ankommende Fahrzeug ist. Wenn man hören kann, dann hilft es, weil man dann durch das Motorgeräusch schon so ein bisschen mitkriegen kann, ob das Fahrzeug schnell kommt oder langsam, aber so … plötzlich ist das Auto neben dir. Irre. Einfach irre!“
Die Klassenlehrerin lässt jetzt Luis seine Samstagerlebnisse schildern. Luis meint, dass er ganz irritiert war von der Tatsache, dass er zwar von draußen, also seiner Umgebung, nichts hörte, aber trotzdem wahrnahm, wie sein Blut im Kopf rauschte. Er spürte regelrecht, wie das Blut durch seinen Kopf sauste. Ein ganz irres Gefühl. „Ich habe gestern, also am Sonntag, versucht, mich auf dieses Rauschen im Kopf zu konzentrieren, habe es auch ein wenig wahrgenommen, aber so intensiv wie am Samstag mit den Ohrstöpseln nicht. Ich will es aber auch nicht zu oft versuchen, denn sonst werde ich das Gefühl nicht mehr los und immer, wenn ich im Bett liege, kommt dann automatisch die Konzentration auf dieses Geräusch. Das wäre ja furchtbar.“
Die Lehrerin fragt noch einmal nach: „Ist dir noch etwas aufgefallen, als du am Samstag die Ohrstöpsel im Ohr hattest und du selbst etwas sagtest?“
„Ja. Mir ist aufgefallen, dass meine eigene Stimme anders klang als heute.“
An dieser Stelle bricht die Klassenlehrerin das Gespräch ab. Sie erinnert an die Absprache, dass sie einen ganzen Unterrichtstag zu dem Thema Gehörlosigkeit abhalten wollen. Auch wenn es den Schülern schwerfällt, beenden sie ihre Schilderungen und verabreden mit der Lehrerin, dass sie am Freitag ausführlich darüber sprechen wollen. Paul wird gebeten, auch seiner Mutter zu sagen, dass sie herzlich zu diesem Termin eingeladen ist.
Am Freitag herrscht vor Unterrichtsbeginn helle Aufregung in der Klasse, alle sind sie gekommen: die Schüler, die Mutter von Paul und eine Gebärdensprachdolmetscherin, der Rektor der Schule und sogar der Klassen-Elternsprecher. Der Klassenraum ist gerammelt voll.
Nach kurzer Begrüßung durch den Rektor und die Klassenlehrerin wird zunächst damit begonnen, dass die Schüler ihre Eindrücke vom letzten Samstag erzählen dürfen. Dabei achtet die Lehrerin darauf, dass alle nacheinander zu Wort kommen. Der ganze Tag läuft noch einmal vor den Schülern und den Gästen ab.
Den Schülern fällt dabei auf, dass die Gebärdensprachdolmetscherin Pauls Mutter gegenüber sitzt. Sie hört genau zu und übersetzt simultan, also noch während sie auf die sprechenden Schüler achtet, für die gehörlose Mutter. Ununterbrochen flitzen ihre Hände hin und her. Die Hände bilden bestimmte Formen und die Finger werden für ganz kurze Augenblicke gestreckt, gekrümmt oder zum Beispiel zu einem Kreis geformt. Manchmal setzt sie auch ihren ganzen Körper ein und beugt, dreht oder schüttelt ihn. Immer davon abhängig, was ein Schüler gerade berichtet und ob das Gesagte etwas Fröhliches, etwas Schauriges, etwas Ärgerliches, etwas Heiteres oder etwas ganz Widerliches ist. Die Gebärdensprachdolmetscherin ist die ganze Zeit, die jemand spricht, in Bewegung.
Nachdem Celine ihre Schilderungen des Samstags beendet hat, fragt Jonas die Dolmetscherin, ob denn dieses Übersetzen nicht unheimlich anstrengend ist.
„Es ist schon ganz schön stressig“, antwortet sie und gebärdet dabei für die Mutter weiter. „Ich muss ja ständig aufpassen, was ihr sagt und wie ihr es sagt. Ich muss also auf zwei Dinge achten: Inhalt und Emotion. Seid ihr zum Beispiel in der Stimme dabei erregt oder seid ihr ruhig. Wenn man hören kann, dann erfährt man diese Stimmung zum überwiegenden Teil aus der Lautstärke oder der Betonung der einzelnen Wörter. Gehörlose können das ja nicht bemerken und deshalb muss ich mit meiner Körperhaltung, meiner Mimik, also meinem Gesichtsausdruck, und durch Hand- und Fingerbewegungen den Text und zusätzlich eure Stimmung dabei erklären.“
Ben will jetzt wissen, wo Kinder, die Gehörlosensprache lernen können.
„Zunächst ist es so, dass die Kinder von Gehörlosen zu Hause die Sprache genau so lernen, wie die Kinder von gesunden Eltern. Sie nehmen die Bewegungen von Mund, Gesicht und so weiter von ihrer gehörlosen Mutter oder ihrem gehörlosen Vater auf und lernen sie als Muttersprache. Sie wollen schließlich ihre Eltern verstehen und wollen ihnen auch von sich etwas mitteilen können. Sie lernen also die Gebärdensprache und zusätzlich die Lautsprache, sofern ein Elternteil nicht gehörlos ist. Von Geburt an gehörlose Kinder können in besonderen Schulen unterrichtet werden. Dort wird der Unterricht meist in Gebärden- und gleichzeitig in Lautsprache abgehalten. Und hörende Kinder können die Sprache in besonderen Schul-AGs oder in Kursen an einer Volkshochschule lernen.“
Pauls Mutter, die sich inzwischen in der Klasse voller wissbegieriger Kinder richtig wohlfühlt und jegliche Angst, mit diesen Kindern zu sprechen, verloren hat, ergänzt: „Besonders schwierig ist für die Kinder, dass sie den ganzen Unterrichtstag dem Lehrer auf den Mund und zusätzlich auf seine Gebärden achten müssen. So wie es hier bei uns die Gebärdensprachdolmetscherin die ganze Zeit über tut. Dann müssen sie versuchen, die Laute, die der Lehrer mit dem Mund formuliert, die sie aber nicht oder nur ganz, ganz leise hören, selbst zu sprechen. Da sie sich dabei ja nicht hören, kann ihnen nur der Lehrer anzeigen, ob es richtig war oder nicht. Wenn ihr also mit Menschen zu tun habt, die entweder ganz gehörlos sind oder sehr, sehr schwerhörig, dann wundert euch bitte nicht, wenn diese Personen anders sprechen, als ihr das gewohnt seid. Die Gehörlosen sind deshalb nicht dümmer als hörende Menschen, sie haben nur die besondere Schwierigkeit, dass sie ihr Wissen nicht so herüberbringen können, wie die Mehrzahl der Menschen. Wenn ihr also mit gehörlosen Kindern zusammentrefft, dann wendet euch nicht von ihnen ab, weil sie für euch etwas ungewohnt sprechen. Die Kinder können nichts dafür und sie geben sich bestimmt äußerste Mühe, sich euch gegenüber verständlich auszudrücken. Wenn ihr etwas nicht versteht, was sie sagen wollen, dann macht das ruhig so wie ich hier bei euch – setzt Gesicht, Körper und Hände mit ein. Sprecht langsam. Der Gehörlose oder schwerst Hörgeschädigte wird euch dafür dankbar sein. Und immer daran denken, dass ihr dem Gehörlosen gegenübersteht oder -sitzt, ihn anschaut, langsam und deutlich, aber nicht übertrieben sprecht und ein bisschen mehr Mimik und Körperbewegung – also Hände und Füße – einsetzt.“
Der Elternsprecher hat einen Vorschlag: „Wie wär es denn, wenn wir einen Versuch durchführen? Die Gebärdensprachdolmetscherin formuliert einen Satz so, wie sie ihn für die Gehörlosen formulieren würde und ihr müsst dann sagen, was sie euch mitgeteilt hat.“
Dieser Vorschlag findet sofort die Zustimmung aller.
Bevor die Dolmetscherin den Kindern einen Satz nennt, weist sie noch darauf hin, dass bei diesem Test eine Besonderheit zu beachten ist, die das Erraten des richtigen Textes sehr erschwert. Sie wird später eine Erklärung dazu geben. Aber nun wird’s ernst. Die Gebärdensprachdolmetscherin spricht einen Satz … und zwar so, wie sie ihn für die Gehörlosen sprechen würde.
Die Schüler, die Klassenlehrerin, der Elternvertreter, der Rektor – alle schauen ratlos. Sie wiederholt den Satz.
Die Klassenlehrerin versucht als Erste, den Satz laut zu übersetzen. Leider nicht ganz richtig. Dann versucht es der Rektor. Auch nicht richtig. Die Dolmetscherin spricht noch einmal den Satz. Und dann gibt sie eine Hilfestellung: „Das Besondere an der Gebärdensprache ist, dass sie teilweise eine andere Grammatik hat als die Deutsche Lautsprache, dass also die Wortstellung im Satz geändert ist.“
Jetzt versucht es Ben. Bis auf ein Wort ist seine Antwort richtig. Paul darf nun zeigen, was er kann. Er sagt die Lösung: „Das habt ihr alle am Samstag unheimlich gut gemacht.“
Alles richtig. Und weil alles richtig ist, darf Paul noch einige Sätze übersetzen. Seine Mitschüler sind von ihm begeistert. Jeden Satz, den ein Schüler der Dolmetscherin ins Ohr flüstert, und den sie dann weitergibt, kann Paul korrekt wiederholen. Bravo!
Mit der Frage: „Was ist aber, wenn jemand nicht hören und zusätzlich nicht sehen kann?“, führt die Lehrerin jetzt das Gespräch auf eine noch schwierigere Ebene.
„Na dann ist einfach gesagt Feierabend“, antwortet Luca prompt. „Wenn du nichts mehr hörst und nichts mehr siehst, dann kriegst du von draußen nichts mehr mit, dann kannst du dich weder an einem Gespräch beteiligen, noch kannst du erfahren, was jemand zum Beispiel in der Schule oder bei einem Vortrag erzählt. Du bist dann von der Welt vollkommen abgeschnitten.“
„Genau“, unterstützt Lisa die Meinung von Luca, „wenn du nichts mehr von draußen mitkriegst, dann kannst du auch nichts lernen, du bist und bleibst dann ein kleines Dummerchen.“
Und Tim fügt auch noch hinzu: „Also, ich habe noch keinen mit einem Trichter auf seinem Kopf gesehen, in den ihm das Wissen oben eingetrichtert wird, weil er weder hören noch sehen kann.“
„Ist doch so, oder?“, nimmt Marlene die Aussagen ihrer Mitschüler auf und wendet sich mit dieser Frage gleichzeitig an Pauls Mutter.
„Das ist nicht ganz so“, erklärt sie, „natürlich sind diese Kinder und Erwachsenen zum größten Teil von der Kommunikation mit der Außenwelt abgeschnitten. Aber es gibt auch für diese Menschen eine Sprache. Welche das ist, erkläre ich euch gleich.“ Dann macht sie eine kurze Pause. Sie bittet die Lehrerin, aus dem Lehrerzimmer oder dem Physikraum eine Schüssel oder etwas Ähnliches und einen Löffel zu holen.
Kurze Zeit später kehrt die Lehrerin mit einer kleinen Schüssel und einem Löffel ins Klassenzimmer zurück und setzt sich wieder.
„Machen wir doch ein kleines Spiel. Ihr kennt es bestimmt noch von Kindergeburtstagen, da wurde und wird es noch heute oft gespielt.“
„Topfschlagen!“, rufen gleich mehrere Schüler.
„Genau, Topfschlagen“, sagt sie und schon hat der erste Schüler die Augenbinde um, damit er nichts mehr sieht. Er kniet sich und versucht, durch das Klopfen mit dem Löffel auf den Boden zu hören, ob er die Schüssel, die im Raum an irgendeiner Stelle versteckt ist, trifft. Wenn ihm dies gelingt, trommelt er zur Bestätigung kräftig auf ihr herum.
Nachdem jeweils ein Junge und ein Mädchen erfolgreich die Schüssel gefunden haben, wird dieses Spiel erschwert. Jetzt werden neben der Augenbinde auch noch die Ohren zugestöpselt. Wer jetzt die Schüssel sucht, kann weder sehen noch hören, ob er mit dem Löffel die Schüssel und damit das Metallgeräusch erwischt hat. Auch diesmal finden sich schnell zwei Schüler, die es ausprobieren wollen.
Nach diesem Spiel machen alle eine Pause. Auf dem Schulhof erholen sie sich und verputzen ihre Pausenbrote und ihr mitgebrachtes Obst. In kleinen Grüppchen stehen sie beieinander und sprechen über das bisher Gehörte. Gespannt erwarten sie den zweiten Teil des heutigen Unterrichtstages.
Das Zeichen zum Pausenende und damit Beginns des zweiten Teils ertönt. Alle gehen wieder in ihr Klassenzimmer und nehmen auf ihren Stühlen Platz.
Die Klassenlehrerin eröffnet die Runde mit der Frage an Pauls Mutter: „Und wie sieht es nun mit diesen Menschen aus, die weder hören noch sehen können?“
„Diese Menschen können teilweise eine andere Kommunikationsform anwenden, Lormen heißt sie. Ihr habt vorhin mit dem Löffel am veränderten Widerstand gemerkt, ob ihr auf etwas Hartes, also die Schüssel, oder etwas Weicheres, zum Beispiel unsere Füße, geklopft habt. Beim Lormen kriecht natürlich niemand auf dem Boden herum und schlägt mit dem Löffel auf Dinge ein. Beim Lormen wird den Hör- und zusätzlich Sehbehinderten durch Streichen und Tippen über die Finger und den Handteller, also die Handinnenseite, der Text mitgeteilt. Jeder Buchstabe des Alphabets kann durch eine bestimmte Streich- oder Tippbewegungen auf der Handinnenseite mitgeteilt werden. Das ist natürlich für die Beteiligten, also den Taubblinden ebenso wie für den Mitteilenden, sehr anstrengend. Deshalb kann man nicht ewig lange Texte mit Lormen dem Geschädigten in einem Stück mitteilen, aber ganz auf Informationen und damit Wissen brauchen auch diese Menschen nicht verzichten. Ich kann euch das ja mal vorführen.“ Auch zu dieser Übung finden sich sofort Schüler und auch der Klassen-Elternsprecher sowie der Rektor bereit.
Anschließend nehmen sie dankbar das Angebot der Mutter an, Informationsblätter über das Lormen und die taktile Gebärdensprache – dabei legt der Taubblinde seine eigenen Hände auf die gebärdenden Hände und kann dadurch die Form und die Bewegungen der Gebärden abfühlen – der Klasse zu überlassen.
Der Unterrichtstag geht zu Ende. Doch bevor die Lehrerin den Tag schließen will, fragt sie noch einmal Pauls Mutter und die Gebärdensprachdolmetscherin, ob sie den Kindern noch etwas mitteilen möchten, worüber vielleicht bisher noch nicht gesprochen wurde.
Pauls Mutter macht den Anfang und sagt, dabei gleichzeitig von der Gebärdensprachdolmetscherin übersetzt: „Sicherlich denkt ihr, dass es für einen Gehörlosen ganz furchtbar sein muss, wenn er nichts hören kann. Und dann wundert ihr euch vielleicht, dass die Gehörlosen trotz ihres Leidens fröhliche Leute sind, oder?“
Zustimmendes Nicken der Schüler.
„Für einen, der vorher hören konnte und dies vielleicht später durch einen Unfall nicht mehr kann, ist es bestimmt ganz furchtbar. Er weiß ja, wie etwas klingen muss, aber er hört es nicht mehr. Für von Geburt an Gehörlose ist das anders, sie wissen ja nicht, wie eine Glocke klingt, wie ein Auto hupt, wie ein Vogel zwitschert. Er kennt nur die Stille. Und ihr könnt euch vorstellen, wie schwer es ist, zu erklären, wie eine Glocke klingt, ohne sie mit etwas Klingendem zu vergleichen. Es ist so, als wolltet ihr einem von Geburt an blinden Menschen erklären, wie die Farben Rot oder Blau aussehen. Der gehörlose Mensch freut sich trotzdem seines Lebens, weil er mit den Augen seine Umwelt wahrnehmen und mit den Händen und Fingern fühlen kann, was um ihn herum geschieht. Er nimmt trotzdem mit Begeisterung am Leben teil. Und auch die Personen, die taub, blind und gehörlos sind, sind liebenswerte Menschen. Mitleid allein hilft keinem! Alle verdienen Aufmerksamkeit, Fürsorge, Hilfe und Anerkennung durch alle anderen Menschen. Und noch eins: Von Gehörlosigkeit spricht man, wenn die Hörschädigung angeboren oder bis zum dritten Lebensjahr erworben wurde. Menschen, die später im Leben ihr Gehör verlieren, also nachdem sie die Lautsprache erlernt haben, nennt man Ertaubte oder Spätertaubte.“
Die Gebärdensprachdolmetscherin möchte auch noch etwas ergänzen. „Ich möchte noch etwas klarstellen, nämlich, dass es nicht nur eine Gebärdensprache gibt. Jedes Land hat eine besondere Gebärdensprache. In Deutschland gibt es die offiziell anerkannte Deutsche Gebärdensprache. Diese Sprache hat eine eigene Grammatik – ihr habt es ja vorhin in der Übung selbst gemerkt – und auch regionaltypische Dialekte gibt es, ganz so wie bei den Lautsprachen. Und wenn ihr euch bitte noch einmal daran erinnern wollt, was ihr hören oder nicht hören konntet. Als ihr die Ohrstöpsel am Samstag getragen habt, habt ihr trotzdem ganz, ganz leise Geräusche wahrgenommen. Die Knochenleitungen eures Kopfes leiten nämlich Geräusche über eure Hörnerven ins Gehirn. Deshalb hattet ihr ja auch euer Blut rauschen hören. Der gehörlose Mensch kann das nicht. Es ist also für einen hörenden Menschen nicht möglich, sich komplett in die Welt ertaubter oder gehörloser Menschen hineinzuversetzen.“
Die Lehrerin bedankt sich herzlich bei Pauls Mutter für die vielen Informationen, bei der Dolmetscherin für ihre geleistete Dolmetsch-Tätigkeit, beim Rektor und beim Elternsprecher. Sie haben an diesem Schultag sehr viel gelernt. Der Elternsprecher wird über diesen Tag in der folgenden Klassenelternversammlung und der Schulelternsprecherversammlung ausführlich und begeistert berichten. Der Rektor will in der nächsten Rektorenkonferenz vorschlagen, dass derartige Unterrichtsstunden an allen Schulen der Stadt durchgeführt werden.
Und Paul, der Außerirdische? Paul ist zwar kein wirklich Außerirdischer, aber weil alle Mitschüler von seiner Lippen-Lese-Sprachleistung und dem besonderen Unterrichtstag so begeistert sind, geht er in die Schulgeschichte seiner Schule als Der Außerirdische ein.
*
Buchstabenhäufigkeit
Wenn ihr euch diesen Text anschaut, wird euch auffallen, dass einige Buchstaben öfter vorkommen als andere. Welche drei Buchstaben der insgesamt 142 dieses Absatzes sind wohl die häufigsten? Von Wenn bis häufigsten.
Solltet ihr auf den Buchstaben e getippt haben, dann habt ihr richtig vermutet. Dieser Buchstabe kommt 23 mal vor. Es folgt dann der Buchstabe s (14 mal) und auf dem 3. Platz das n (12 mal).
Dabei wurde einfach ausgezählt, wie oft ein bestimmter Buchstabe innerhalb eines Textes vorkommt. Man nennt dann die Anzahl des Vorkommens der einzelnen Buchstaben die absolute Anzahl. In unserem Beispiel also die Ergebnisse 23, 14 oder 12.
Man kann die ermittelte Anzahl bestimmter einzelner Buchstaben aber auch in Relation (ins Verhältnis) zu der Gesamtzahl aller im gewählten Text verwendeten Buchstaben berechnen. Das heißt, dass in unserem obigen Beispiel die Ergebnisse 23, 14 und 12 in Relation zur Gesamtanzahl von 142 gesetzt werden. Als Ergebnis erhalten wir 16,20 Prozent, 9,86 Prozent und 8,05 Prozent (jeweils gerundet).
Dass das e sowohl groß als auch klein geschrieben in einem Text oder in einer Sammlung von Texten der meistverwendete Buchstabe ist, hat man übrigens auch schon vor vielen Jahren ermittelt. In der von Fachleuten ermittelten Häufigkeitstabelle der Buchstaben im Schriftdeutsch sieht es so aus, dass der Buchstabe e auch hier den ersten Platz belegt. Sie ermittelten dann aber auf die Plätze 2 und 3 die Buchstaben n und i. Das s folgte erst auf Platz 4 – bei mir war es auf Platz 2.
Vielleicht fragt ihr euch jetzt: Wen interessiert das? Wer kann damit etwas anfangen? Das interessiert beispielsweise die Menschen, die sich mit der Entschlüsselung von Geheimtexten beschäftigen. Wenn sie wissen, welche Buchstaben wie oft in geschriebenen Texten vorkommen, dann haben sie es leichter, Geheimtexte zu übersetzen. Wenn sie also sehen, dass bestimmte Zeichen öfter vorkommen als andere, dann könnte dieses Geheimzeichen vielleicht im deutschen Text ein e sein. Und so versuchen sie, mit der Tabelle der Häufigkeiten einen Text zu erstellen. Wenn dann der übersetzte Text noch etwas unverständlich klingt, dann beginnt man, diesen Text in einen sinnvollen Text zu übertragen.
Das Wissen der Häufigkeit der Buchstaben ist aber auch für die Entwicklung von Tastaturen auf PCs und Handys wichtig. Man hat nämlich bei der Anordnung der Buchstaben auf der PC-Tastatur beziehungsweise der Position der Buchstabenanzeigen auf der Handytastatur berücksichtigt, welche Buchstaben werden am häufigsten benutzt und mit welchem Finger sind diese Buchstabentasten am leichtesten erreichbar. Der Zeigefinger und der Mittelfinger sind ja beweglicher als kleine Finger oder der Ringfinger.
Übrigens hat man auch untersucht, welche Buchstaben am häufigsten am Anfang und welche am häufigsten am Ende von Worten stehen. Im Jahr 2001 wurde auch ermittelt, welche die hundert häufigsten Worte im Deutschen – in der sogenannten Schriftsprache – sind.
Und was meint ihr, welche Worte die ersten drei Plätze belegen?
Es sind die Worte:
1. Platz der
2. Platz die
3. Platz und
Wenn ihr euch zu diesem Thema noch schlauer machen wollt, dann gebt einfach mal den Suchbegriff Buchstabenhäufigkeit in eine Suchmaschine am Computer ein. Es ist toll, was man da alles zu diesem Thema findet.
*
Die Klatsche
Justin nahm auf der linken Seite gerade noch irgendetwas Heranfliegendes wahr. Dann spürte er einen kräftigen Schlag auf seiner linken Wange. Klatsch, das hatte gesessen. Gleich darauf bekam er einen Faustschlag an die Brust und gleichzeitig wurde ihm in die Kniekehle getreten. Justin fiel um wie ein Boxer nach einem k. o.-Schlag. Als er benommen auf der Erde lag, beugte sich sein Gegenüber zu ihm herunter, griff in die Innentasche seiner Jacke, zog das Handy heraus und erwischte dabei auch gleich noch seine Fahrkarte.
„Wenn du deinen Mitschülern oder deinen Eltern davon erzählst, dann mache ich dich alle, das schwör’ ich dir“, drohte der Kerl, drehte sich um und ging in Richtung Schultor. Neben ihm liefen die gleichgroße und gleichaltrige Leoni und der etwas kleinere Tim, die beide neugierig dem Geschehen zugeschaut hatten.
Justin rappelte sich wieder auf, klopfte sich den Schmutz von seiner Jacke, griff sich seinen Schulranzen und ging langsam in Richtung Schuleingang.
Den ganzen Vorfall hatten aus einiger Entfernung Felix und Finn gesehen. Sie waren zu weit ab, um helfend eingreifen zu können. Aber sie hatten den Jungen und auch seine beiden Begleiter erkannt. Als sie Justin eingeholt hatten, fragte Finn: „Ey, Justin, wie geht’s dir? Ist alles in Ordnung?“
„Ja, ja, alles in Ordnung. Mannomann, die Ohrfeige hat aber gezeckt. Das andere war nicht so schlimm. Bin bloß ein bisschen dreckig.“
„Und was fehlt? Was wollten die denn von dir?“
„Mein Handy ist weg. Und meine Fahrkarte auch. So ein Mist aber auch“, schimpfte Justin.
„Kannst du wohl laut sagen“, bestätigte Felix.
„Ich musste versprechen, keinem was zu sagen, weder in der Schule noch zu Hause, sonst machen die mich alle. Und das machen die bestimmt. Also … kein Wort zu jemandem.“
„Aber, Justin, das geht doch gar nicht. Dein Handy weg, deine Fahrkarte weg. Wer weiß, was die morgen von dir haben wollen. Vielleicht sollst du denen morgen Geld geben. Und das geht dann Tag für Tag so weiter. Und außerdem kann das ja morgen jedem anderen passieren, wenn du nichts in der Schule oder deinen Eltern sagst. Die zocken dann jeden ab, der sich nicht wehrt“, versuchte Felix, Justin zu erklären.
„Ihr habt ja recht, aber sollen die mich zum Schluss dann auch noch abmurksen, wenn ich die Sache in der Schule bekannt gebe?“
„Damit genau das nicht passiert, musst du überall von dem Überfall berichten. Die müssen überall Bescheid wissen, was hier für Übeltäter ihr Unwesen treiben.“
Justin muss seine Mutter anrufen, aber …
„Ach du meine Güte, das erste Problem ist ja schon entstanden“, sagte Justin bleich. „Immer, wenn ich aus dem Bus gestiegen bin und dann den kleinen restlichen Weg zu Fuß laufe, rufe ich auf dem Handy meine Mutter an. Da lasse ich es dann dreimal klingeln und dann weiß sie, dass ich gut angekommen bin. Meine Mutter muss nämlich früh aus dem Haus und mein Vater geht auch schon vor mir. Und wenn sie dann mein Klingeln gehört hat, dann meldet sie sich mit zweimal Klingeln wieder zurück. Und heute geht das nicht, mein Handy ist ja weg.“
„Dann nimm am besten mein Handy, ruf deine Mutter an und sag ihr, was passiert ist“, bot Felix Justin an.
Der zögerte zwar zuerst, meinte aber dann, dass es wohl doch das Beste sei. Felix reichte ihm sein Handy und Justin wählte die Telefonnummer seiner Mutter. Diesmal ließ er es klingeln, bis sie sich meldete.
„Was ist los, Justin?“, fragte sie besorgt. Sie ahnte schon, dass etwas passiert sein musste.
„Nein, nein, es ist alles okay, Mama.“ Justin schilderte kurz, was soeben passiert war.
„Da bin ich aber froh, dass du nicht verletzt bist. Morgen komme ich mit in die Schule zu deiner Lehrerin, damit wir die Angelegenheit klären. Bitte gib deiner Lehrerin heute schon Bescheid, dass ich morgen früh mit ihr sprechen will. So, und nun ab in die Klasse, gleich beginnt deine erste Stunde. Tschüss mein Sohn!“
Er lief jetzt mit schnellen Schritten zusammen mit Felix und Finn in die Schule. Gleich würde es zur ersten Unterrichtsstunde läuten. Und gleich in der ersten Stunde bei seiner Klassenlehrerin, Frau Bergmann, wollte er von dem Überfall berichten.
Erschrecken in der Klasse
Kaum hatten die drei ihren Klassenraum erreicht, ertönte auch schon das Zeichen zum Unterrichtsbeginn. Frau Bergmann hatte ebenfalls pünktlich die Klasse erreicht. Sofort entdeckte sie die rote Wange. „Was ist denn mit dir passiert?“, fragte sie Justin.
„Ich wurde kurz vor dem Schultor überfallen. Erst bekam ich eine saftige Ohrfeige, dann einen kräftigen Faustschlag“, er deutete dabei mit seiner Hand auf die Stelle, „und gleichzeitig trat er mir in die Kniekehlen. Ich fiel um wie ein angeschlagener Boxer im Ring.“
„Hast du dir etwas getan? Bist du verletzt, außer deiner roten Wange?“, wollte die Lehrerin wissen.
„Nein, aber er hat mein Handy und meine Fahrkarte geklaut.“
Alle Mitschülerinnen und Mitschülern machten plötzlich ernste Gesichter. Sie hatten schon ab und zu gehört, dass irgendwo junge Menschen überfallen wurden, aber das war eben irgendwo, also für sie weit weg. Nun aber war mit einem Mal das Risiko, überfallen, beraubt oder gesundheitlich geschädigt zu werden, ganz nahe. Die Gefahr eines Überfalls mit allen dazugehörigen Konsequenzen war plötzlich vor die eigene Tür, die Schultür, gekommen. Frau Bergmann fragte jetzt in die Klasse: „Hatte jemand von euch den Überfall beobachtet?“
Felix und Finn meldeten sich.
„Wir haben das von Weitem gesehen. Wir konnten Justin nicht helfen. Es ging alles sehr schnell. Auch mit Rennen hätten wir den Kerl nicht mehr erwischt“, sagte Finn.
Frau Bergmanns Vorschlag
„Na gut. Nach dem Unterricht kommst du, Justin, und ihr, Finn und Felix, bitte mit mir zusammen zum Rektor. Wir werden dort ein Protokoll aufnehmen und die Angelegenheit nochmals in Ruhe besprechen.“
„Und morgen früh will meine Mutter zu Ihnen kommen, um mit Ihnen zu sprechen“, informierte Justin jetzt die Lehrerin.
Sie war einverstanden. „Ich schlage euch Folgendes vor“, sagte Frau Bergmann anschließend, „wir werden am kommenden Mittwoch, das ist der letzte Schultag vor den Ferien, uns ausschließlich mit dem Thema beschäftigen. Wir werden gemeinsam über alles ausführlich sprechen, was damit zusammenhängt oder zusammenhängen könnte. Ich werde nachher den Rektor fragen, ob er auch kommen möchte. Einverstanden?“
Die Schülerinnen und Schüler stimmten zu und dann begann Frau Bergmann mit dem Unterrichtsstoff.
Der letzte Schultag vor den Ferien
Der letzte Schultag vor den Sommerferien. Alle Schülerinnen und Schüler waren wie aufgedreht. Nur die Schüler in Justins Klasse waren heute verhaltener, ruhiger.
Mit dem Klingelzeichen zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde betraten Frau Bergmann und der Rektor der Schule den Klassenraum. Gemeinsam stellten sie die Stühle so, dass ein großer Kreis gebildet wurde. Dann nahmen alle Platz.
Der Rektor eröffnete die Gesprächsrunde. „Zunächst möchte ich euch sagen, dass ich diesen ernsten Vorfall vor unserer Schule sehr bedauere und überhaupt nicht gutheißen kann. Es tut mir für Justin sehr leid. Wir wollen heute darüber sprechen und versuchen, ein wenig hinter das Geschehen zu blicken.“
Dann übernahm die Klassenlehrerin die Gesprächsleitung. „Justin, bist du bitte so nett und schilderst uns den genauen Hergang des Geschehens“, bat sie ihn.
Justin stand von seinem Stuhl auf, stellte sich in die Mitte des Kreises und berichtete, wie sich das Ganze zugetragen hatte. Nachdem Justin seine Schilderung beendet hatte, wurden Felix und Finn gebeten, ihre Beobachtungen zu berichten.
„Als Erstes, Justin, würden wir gern wissen wollen, wie du dich gefühlt hattest, als die drei auf dich zukamen“, begann jetzt die Klassenlehrerin.
„Zuerst hatte ich mit gar nichts gerechnet. Ich hatte ja nichts Unrechtes getan. Ich bin wie jeden Tag aus dem Bus gestiegen und wollte zum Eingang. Erst als sie ganz dicht vor mir standen und mich nicht vorbeilassen wollten, wurde es mir mulmig. Und dann hat der kräftige Junge auch gleich angefangen, mir die Ohrfeige zu geben und mich umzustoßen. Gleichzeitig trat er mir in die Kniekehle. Da ich damit überhaupt nicht gerechnet hatte, bin ich wehrlos umgefallen. Und vom Boden sah der Kerl noch böser aus als vorher. Als er sich über mich beugte und das Telefon und die Fahrkarte aus meiner Jacke raubte, hatte ich überhaupt keinen Mumm, mich mit ihm zu prügeln. Das wäre bestimmt schlimm für mich ausgegangen.“
Vermutungen
„Danke, Justin“, sagte die Klassenlehrerin. Sie fragte in die Runde, ob jemand vermuten könnte, was sich der Täter in diesem Augenblick gedacht haben könnte.
Leon meldete sich. „Ich denke mal“, begann Leon zaghaft, „dass der Täter sich stark fühlte, weil er den anderen beiden zeigen wollte, was er für ein toller Kerl ist. Und Justin ist im Vergleich zum Täter einen Kopf kleiner. Da war es für ihn kein großes Risiko, dass er vielleicht selbst eins auf die Mütze kriegen könnte.“
„Vielleicht wollte er die beiden anderen mit seiner Kraft oder seiner Tat so beeindrucken, dass sie denken, den wollen wir unbedingt als Freund haben.“
„Oder der ist einfach nur doof!“, fand Mareile. „Wie kann man sich denn an jemandem vergreifen, der viel kleiner ist als man selbst? Der muss ja nicht alle beisammen haben“, erregte sie sich und tippte sich dabei mit dem Zeigefinger an die Stirn.
„Wie kann man denn so einen Prügelknaben als Freund haben wollen? Da muss man ja selbst nicht ganz in Ordnung im Kopf sein“, ereiferte sich Mario.
Frau Bergmann erklärt
Jetzt war es an der Zeit, dass sich die Lehrerin wieder in das Gespräch einschaltete. „Jeder von euch hat zum einen Teil recht und zum anderen Teil auch unrecht. Das Schlagen als solches ist schon etwas, was nicht hinnehmbar ist. Es ist in der Tat keine großartige Leistung, auf einen körperlich Kleineren loszugehen und ihn zu verprügeln! Dass er anderen damit imponieren wollte, stimmt gewiss. Leider meinen manche, dass derjenige, der sich mit seinen Fäusten in der Welt zu behaupten glaubt, auch ansonsten ein toller Kerl sei. Und an diesen tollen Kerl müsse man sich heften, dann geht’s einem selbst auch gut. Man fühlt sich dann in seiner Gegenwart auch stark und mächtig. Sicherlich habt ihr schon erlebt, dass eine Gruppe von Jungen auf der Straße läuft und sie sich bewegen, als wenn ihnen die ganze Gegend gehört und alle Platz machen und Angst haben müssten. Und wenn ihr dann aber mal nur einen Einzelnen aus dieser Gruppe getroffen habt, dann war von diesem Imponiergehabe nichts mehr da, dann schien dieser Junge ganz normal zu sein. Das ist dann unter anderem ein Zeichen dafür, dass er den anderen in seiner Gruppe zeigen wollte, was er doch für ein toller, draufgängerischer Kerl ist. Er ist es aber eben nur in der Gemeinschaft mit den anderen tollen Kerlen. Jeder für sich allein ist vielleicht ein ganz umgänglicher Typ. Aber in der Gruppe legen sie plötzlich ein schwer zu verstehendes Verhalten an den Tag. Da habt ihr alle, wie ihr eben geantwortet hattet, richtig vermutet. Aber es steckt bestimmt noch viel mehr hinter dem schlimmen Verhalten des Schlägers.“
Der Rektor macht einen Vorschlag
Jetzt mischte sich der Rektor in das Gespräch ein. „Justin hatte ja den Täter gut beschreiben können und so konnten wir ermitteln, dass es ein Schüler unserer Schule, zusammen mit zwei Klassenkameraden, war. Natürlich habe ich inzwischen mit ihm unter vier Augen gesprochen. Dabei habe ich einiges über ihn und sein familiäres Umfeld erfahren. Ich schlage Folgendes vor: Wir holen ihn jetzt aus seiner Klasse zu uns. Dann kann er uns allen den Ablauf aus seiner Sicht und vielleicht seine Gründe für die Tat schildern.“
„Ob der sich das traut, hier in die Klasse zu kommen und uns allen zu erzählen, was das mit dem Diebstahl sollte? Ich glaub das nicht“, sagte Miriam. Sie erhielt dabei zustimmendes Kopfnicken.
„Er hatte mir versprochen, dass er sich der Klasse stellen will“, antwortete der Rektor und bat die Klassenlehrerin, ihn zu holen. „Wir werden sehen.“
Auge in Auge mit dem Täter
Wenige Augenblicke später betrat die Klassenlehrerin mit einem Jungen den Klassenraum. „Bitte setze dich auf den freien Stuhl in unserer Runde. Du stellst dich am besten selbst vor“, sagte der Rektor zu dem Jungen, der zwischen Leonie und Lukas Platz nahm. Scheu, fast ein wenig ängstlich blickte er in die Runde. Ein Teil der Schülerinnen und Schüler wollte gar nicht glauben, dass es sich bei dem Jungen um denjenigen Schüler handeln sollte, der Justin geschlagen hat.
„Ich heiße Ben. Ich gehe in die achte Klasse.“ Mehr sagte er nicht.
„Ben, du hast Justin geschlagen, das hast du uns, also der Klassenlehrerin, mir und Justin gegenüber zugegeben. Bitte schildere uns, wie es bei dir zu Hause ist. Sprichst du mit deinen Eltern über deine Probleme? Was machst du in deiner Freizeit? Hast du Freunde?“, fragte der Rektor.
„Mein Vater ist arbeitslos und meine Mutter ist auch den ganzen Tag zu Hause, sie hat keine Arbeit. Als ich kleiner war, habe ich oft Schläge bekommen. Ich brauchte nur einen kleinen Augenblick zu spät nach Hause zu kommen oder wieder eine schlechte Note in der Schule bekommen haben, schon habe ich Prügel einstecken müssen. Meistens mit Vaters Hand, aber ab und zu auch mit einem Stock oder was er gerade greifen konnte. Vater hat ja immer schon gesoffen. Manchmal war er morgens, wenn ich zur Schule gehen sollte, noch so besoffen vom Tag davor, dass ich ihn nur im Bett schnarchend habe liegen sehen. Und Mutter hat oft abends so lange Filme im Fernsehen gesehen, dass sie auch nicht aufgestanden ist. Dann habe ich eben kein Frühstück gekriegt und auch nichts für die Pause mitbekommen.“
„Aber du musst doch irgendetwas essen?“, fiel ihm Vanessa ins Wort.
„Ich habe dann eben einfach in der Pause eine Schülerin oder einen Schüler angequatscht und den dann dazu gebracht, mir sein Brot zu geben.“
„Und was heißt, den dazu gebracht?“, hakte Vanessa nach.
„Na, ich habe erst gesagt: Ey, gib mir mal dein Brot. Und weil der aber nur Nein gesagt hat, habe ich ihn gestoßen, sodass er auf den Boden gefallen ist. Und dann habe ich einfach seine Brotbüchse genommen und fertig. Schon hatte ich Frühstück.“ Als er diesen Vorfall erzählte, zog sich ein leichtes Grinsen über sein Gesicht. Er schien richtig stolz zu sein, dass er endlich berichten konnte, was er – aus seiner Sicht – Großartiges vollbracht hatte. Ganz so, als wollte er sagen: „Das ist ganz einfach, das könnt ihr auch alle. Versucht’s doch mal.“
Der Rektor kam noch einmal auf die Schulnoten zurück: „Und wie sehen deine Schulnoten aus?“
„Nicht so berühmt. Wie denn auch. Schule ist Mist, langweilig. Was die Lehrer da vorne erzählen, versteht sowieso niemand und helfen kann mir zu Hause auch keiner. Wie denn auch?“
„Na, vielleicht kann dir einer deiner Freunde helfen“, zog ihn Melanie mit einem zynischen Unterton auf.
„Wie denn? Die finden doch die Schule auch bloß scheiße. Die wissen auch nicht mehr als ich. Die Einzige, die ein bisschen was drauf hat, ist Leni. Aber die kann ich nicht mit nach Hause bringen. Die kriegt ja ’nen Schlag, wenn die sieht, wie es bei uns aussieht. Und zu ihr darf ich nicht kommen, da haben ihre Eltern was dagegen. Die haben zu Leni gesagt: Wenn du den mit zu uns nach Hause bringst, dann kannst du aber was erleben. Das lass dir gar nicht einfallen. Uns gefällt das sowieso nicht, dass du dich mit dem Jungen triffst.“
„Ben, gehst du in einen Sportverein oder hast du irgendein Hobby? Was machst du in deiner Freizeit?“, fragte jetzt die Lehrerin in ruhigem Ton.
Ben machte eine längere Pause, ehe er antwortete. Mit gesenktem Kopf sagte er leise: „Ich bin in keinem Sportverein. Und so ein richtiges Hobby habe ich eigentlich auch nicht. Ich sitze viel vor meinem Computer und spiele da so vor mich hin. Und wenn ich dann genug davon habe, rufe ich Tim an und wir treffen uns dann bei ihm. Aber da gammeln wir auch bloß rum oder ziehen uns Videos rein, die er entweder von seinem Vater oder ich weiß nicht woher hat.“
„Und was ist mit Leonie?“, fragte Verena.
„Die gehört eigentlich zur Clique von Florian. Aber manchmal kommt sie auch zu uns.“
„Was heißt zu uns, seid ihr noch mehr als Tim und du?“, wollte Maike wissen.
Ben richtete sich auf seinem Stuhl auf und blickte jetzt mit vor Begeisterung funkelnden Augen in die Runde. „Na ja, eigentlich sind wir erst zwei, also der Tim und ich, manchmal eben auch noch die Leonie. Wir wollen ja auch eine richtige Clique werden. Aber dazu muss sich erst mal rumsprechen, dass wir auch was drauf haben, dass wir tolle Ideen haben und vor nichts und niemanden Angst haben. Das dauert eben noch ein bisschen.“
Die Lehrerin, Frau Bergmann, wandte sich an Ben und dankte ihm für seine Schilderungen. Sie betonte dabei, dass es heute nicht darum ging, über ihn zu richten, sondern einzig und allein darum, zu versuchen, die möglichen Hintergründe für seine Tat zu erfassen und vielleicht auch in Ansätzen zu verstehen. Der Klasse dankte sie dafür, dass in Bens Beisein keine wertenden Äußerungen gemacht wurden, sondern dass nur Fragen gestellt wurden. Dann bat sie Ben, wieder in seine Klasse zu gehen.
Bis zur ersten Pause waren es noch zehn Minuten, aber der Rektor schickte die Schülerinnen und Schüler schon jetzt auf den Hof in die Pause. In kleinen Gruppen standen die Mädchen und Jungen, ihr Pausenbrot essend, zusammen und diskutierten über das, was sie soeben gehört hatten.
Nach der Pause wird das Gespräch analysiert
Kaum war das Läuten zum Pausenende verklungen, saßen die Schülerinnen und Schüler wieder in der Klasse. Alle waren in gespannter Erwartung, was die Lehrerin und der Rektor als Erklärung für das schlimme Verhalten von Ben nennen würden.
„Bevor wir gemeinsam über Bens Verhalten sprechen wollen, möchte ich euch sagen, dass ich ihm ganz deutlich gesagt habe, dass er etwas getan hat, das auf gar keinen Fall hinnehmbar ist. Ben hat sich anschließend in meinem Beisein bei Justin entschuldigt und auch die Fahrkarte und das Handy wieder zurückgegeben. Ob er auch verinnerlicht hat, dass er einen schlimmen Fehler begangen hatte, weiß nur er selbst, wir können nicht in ihn hineinschauen.“ Mit diesen Worten eröffnete der Rektor die Gesprächsrunde nach der Pause.
Dann setzte Frau Bergmann fort. „Wenn ihr genau aufgepasst habt, ist euch bei den Sätzen, die Ben gesprochen hat, vielleicht etwas aufgefallen. Was ist das gewesen?“, fragte die Lehrerin. Sofort reckten mehrere Schüler ihre Finger in die Höhe. „Markus, bitte“, forderte sie ihn zur Antwort auf.
„Ben hat oft den Satz mit ich begonnen.“
„Richtig“, bestätigte sie. „Ben begann seine Sätze oft mit ich. Ben ist eine Ich-bezogene-Person. Er stellt sich damit in den Vordergrund. Zunächst einmal kommt er, dann eine ganze Weile nichts, dann erst der andere. Er zeigt damit, dass er die Hauptperson ist, die Person, die angibt, wo es langgeht. Die anderen haben sich unterzuordnen. Was ist euch noch aufgefallen?“
„Mir fiel auf, dass er anfangs einen bedrückten Eindruck machte. Später, als er von der Sache mit dem Pausenbrot erzählte, war seine Bedrücktheit verschwunden, da wirkte er gelöster.“
„Gut bemerkt, Fabia“, bekräftigte die Lehrerin deren Feststellung. „Ben schien in dem Augenblick aufzublühen, als er meinte, mit seiner Tat prahlen zu können. Als er sein nicht hinzunehmendes Vorgehen im Zusammenhang mit der Erpressung des Pausenbrotes beschrieb, schien er zu meinen, uns von der Richtigkeit seines Handelns überzeugen zu können. Für ihn schien sein Handeln normal und damit nachahmenswert zu sein. Er hat weder ein Wort des Bedauerns dafür übrig, dass nun der andere nichts zu essen hat, noch die Einsicht, dass er sich für sein Verhalten entschuldigen muss. Sein fehlendes Unrechtsbewusstsein hat in ihm gegen das Rechtsbewusstsein gesiegt.“
Kein einfaches Zuhause
„Ben hat’s natürlich zu Hause auch nicht einfach. Schlagende, arbeitslose Eltern, ein trinkender Vater, wenig Geld, das ist natürlich auch nicht gerade berauschend“, sagte Stephanie, die fast ein wenig Mitleid mit Ben zu haben schien.