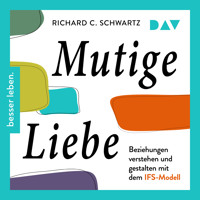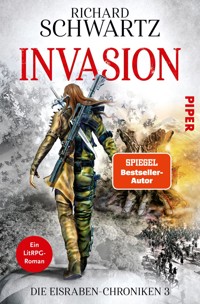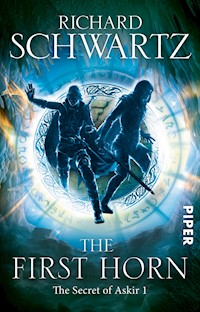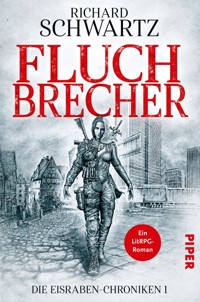4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
1632: Zwischen den herrschenden Häusern in Europa brodelt es. Doch nicht nur Menschen, sondern auch Vampire und Werwölfe lenken das politische Geschehen. Als ein Teil der spanischen Königsfamilie einem heimtückischen Mordanschlag zum Opfer fällt, gibt es nur eine Überlebende: die junge spanische Infantin. In den kargen Gemäuern der Schwarzen Wacht, einer mysteriösen Assassinen-Gilde, lässt sie sich zur Kriegerin ausbilden. Unter dem Decknamen Eva verfolgt sie eisern ein einziges Ziel: den Mörder ihrer Familie zu finden und die Toten zu rächen … Einzigartige historische Fantasy vom Bestsellerautor der »Askir«-Reihe!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Entdecke die Welt der Piper Fantasy!
www.Piper-Fantasy.de
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, schreiben Sie uns unter Nennung des Titels »Schwarze Wacht« an [email protected], und wir empfehlen Ihnen gerne vergleichbare Bücher.
© Piper Verlag GmbH, München 2025
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Michael Meller Literary Agency GmbH, München
Redaktion: Antje Steinhäuser
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Covergestaltung: Guter Punkt, München
Coverillustration: Uwe Jarling
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
BUCH I
Kapitel 1
Mordnacht am Ammerbach
Kapitel 2
Tutto Nero
Kapitel 3
Demut
Kapitel 4
Sangre du muerte
BUCH II
Kapitel 5
Die jungen Wölfe
Kapitel 6
Der Vier-Finger-Hannes
Kapitel 7
Ein Nachtmahr im Stall
Kapitel 8
Eine unerwartete Audienz
Kapitel 9
Vier Gaben für Hochwürden
Kapitel 10
Leitwolf
Kapitel 11
Drei für drei
Kapitel 12
Opferlämmer
BUCH III
Kapitel 13
Der Handel gilt
Kapitel 14
Das Schachspiel
Kapitel 15
Zu Nero
Kapitel 16
Wölfe befragen
Kapitel 17
Ränkespiel
Kapitel 18
Eine besondere Schulung
Kapitel 19
Masken und die Lust
BUCH IV
Kapitel 20
Sigrids Anmut
Kapitel 21
Drei heilige Männer
Kapitel 22
Das ehrbare Handwerk eines Schusters
Kapitel 23
Ein Schneesturm
Kapitel 24
Das Blut des Bischofs
Kapitel 25
Süß
Kapitel 26
Das Wunder zu Brünn
Kapitel 27
Das geheime Fass
Kapitel 28
Du sollst nicht töten (oder vielleicht doch)
BUCH V
Kapitel 29
Son una mierda
Kapitel 30
Geschäfte und Gold
Kapitel 31
Tatsächlich ein Freund
Kapitel 32
Wahre Blutmagie
Kapitel 33
Hecho una mierda
Kapitel 34
Akten und Würfel
Kapitel 35
Da habt ihr ihn
Kapitel 36
Adrian Petridis
Kapitel 37
Mit einem Strauß Blumen
Kapitel 38
Ein Blick von ihr
Kapitel 39
Wir sind alle Gottes Kinder
Kapitel 40
Ein gutes Mysterium
BUCH VI
Kapitel 41
Ein Ball ist Krieg
Kapitel 42
Ein wundervolles Missverständnis
Kapitel 43
Für die nächsten zwölf Jahre
Kapitel 44
Infiziert und vergiftet
Kapitel 45
Jemand mag Euch wirklich nicht
Kapitel 46
Gecken
Kapitel 47
Talentschau
Kapitel 48
Ein gutes Omen für das neue Jahr
Glossar
Eine kurze Geschichte des zwölfjährigen Krieges
Die Lanze Gottes
Das Wunder von Konstantinopel
Der zwölfjährige Krieg
Der Schwedenkrieg
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
BUCH I
Kapitel 1
Mordnacht am Ammerbach
»Eine ideale Nacht für üble Taten«, flüstert der hochgewachsene schlanke Mann, der zusammen mit anderen dunklen Gestalten hinter Buschwerk auf einem flachen Hügel steht und sich jetzt zum wiederholten Mal wünscht, er hätte sich nie auf diesen Handel eingelassen.
Vielleicht ist ihm unwohl bei dem Gedanken, und sein Kragen ist ihm zu eng geworden, oder aber er kratzt tatsächlich, schließlich ist der Mann Seide mehr gewohnt als das Leinen, das er heute trägt.
Und genau so ist die Nacht. Nicht nur, dass gerade Neumond ist, jedes noch so schwache Sternenlicht wird von den dichten Wolken, die den Himmel bedecken, verschluckt, als wollten sie erneut eine biblische Sintflut über die Menschen ergehen lassen. Der Mann lächelt bei dem Gedanken und senkt seinen Kopf ein wenig, sodass das Wasser in breiten Strömen von seinem breitkrempigen Hut fließt.
Es ist so dunkel, dass ein normaler Mensch die Hand vor Augen nicht sehen wird, zudem beschränkt der strömende Regen die Sicht und dämpft jedes Geräusch.
Dennoch hat der Mann, der ihm am nächsten steht, die Worte gehört und dieses Lächeln gesehen. »Was amüsiert Euch so, Hochwürden?«, fragt er mit seiner rauen Stimme. Anders als sein hochgewachsener Nachbar ist dieser Mann gut anderthalb Köpfe kleiner, dafür aber breit und kräftig gebaut. Sein Bart ist so dicht und wild, dass darunter das Gesicht kaum zu erkennen ist. Ein Barbier, denkt Hochwürden abgelenkt, könnte hier nicht schaden.
Wo der eine in jeder noch so kleinen Bewegung eine fließende Eleganz verkörpert, scheint der andere, selbst so still und bewegungslos, wie er jetzt hier steht, von roher Kraft und Gewalt erfüllt zu sein. Sogar seine raue Stimme drückt dies aus, ein Unbeteiligter könnte meinen, dass er nahe daran wäre, dem anderen mordlüstern an die Kehle zu gehen.
So falsch ist das nicht, denkt im selben Moment Hochwürden, aber nicht heute würde er’s tun, nicht in dieser Nacht. Heute Nacht sind sie Verbündete, gemeinsam verdammt. »Ich dachte daran, dass im Alten Testament eine Geschichte erzählt wird, in welcher Gott beschließt, die sündigen Menschen mit einer Sintflut wegzuspülen.« Sein Lächeln ist schmal, kaum zu sehen. »Passend, findet Ihr nicht?«
»Wohl wahr, wohl wahr«, knurrt der andere tief in seiner Kehle. Er schaut zu Hochwürden hoch. »Das Ganze liegt mir nicht. Solche Heimtücke und Mordgeschäfte sind mehr Euer Ding als das unsere. Ich mag es mehr direkt. Ohne die Heimtücke und die Schandtaten. Offen. So wie es sein sollte.«
Eigentlich sollte ich ihn mögen, denkt Hochwürden. Der Mann ist klar und geradeheraus, es gibt nicht einen Funken Heimtücke in ihm. Wäre er nicht so … aufbrausend. Was milde ausgedrückt ist. Hochwürden neigt leicht den Kopf. »Niemand hindert Euch«, antwortet er mit einem Lächeln, das man selbst mit viel gutem Willen nicht freundlich nennen könnte. »Geht hin. Stellt Euch ihm in den Weg. Fordert ihn offen heraus. Nach dem, was wir wissen, ist er ein Magister der arkanen Künste. Bevor Ihr blinzelt, hat er Euch schon mit einem Blitz gegrillt. Seht, wie weit Ihr kommt damit. Reden wir nicht von den sechzig oder so berittenen und schwer bewaffneten Wachen, die unseren Freund vor genau solchen wie Euch schützen sollen.«
»Hrrmpf«, knurrt der andere. »Solchen wie uns, meint Ihr wohl. Heute Nacht habt Ihr in meinen Augen bereits jede moralische Überlegenheit verloren. Ihr nennt uns Tiere, doch wenn wir kämpfen müssen, ist es für uns kein Sport. Kein Kalkül. Keine …« Er macht eine weit ausholende Geste zur Straße hin, die selbst er mit seinen scharfen Sinnen eher erahnen als tatsächlich sehen kann. »… politische Notwendigkeit. Nennt es beim Namen. Ihr seid zum Morden hier.«
»Um die Gesellschaft vor dem Untergang zu bewahren«, protestiert der große Mann in mildem Ton.
Der andere schnaubt verächtlich. »Mittels Mord.«
»Ein kleines Opfer für den Nutzen von vielen.« Hochwürden spricht hier gegen seine Überzeugung, doch würde diese bekannt, könnte das leicht sein Ende bedeuten. Also behält er seine Meinung für sich und gibt die wieder, die er wiedergeben soll. Gott, ich hasse Politik, denkt er, ich verstehe nicht, wie ich an diesen Punkt kommen konnte.
»So sagt Ihr«, knurrt der kräftige Mann. »Es ist eine Behauptung. Vielleicht bringt dieser Mann der sogenannten Gesellschaft die lang ersehnte und versprochene Rettung. Nur wollt Ihr nicht gerettet werden. Die Welt gefällt Euch so, wie sie ist. Ihr oben, der Rest von uns … unten. Und seid bereit, Blut zu vergießen, damit diese Rettung auf keinen Fall geschehen kann.«
Der Mann hat recht. Es ist eine Warnung, denkt Hochwürden, darauf bedacht, dass sein Gesicht keinen seiner Gedanken widerspiegelt. Manche schimpfen sie Bestien, doch man darf nicht vergessen, dass hinter den scharfen Zähnen und dem dichten Fell ein nicht weniger scharfer menschlicher Verstand zu Hause ist. Meistens jedenfalls. Mit Ausnahmen. Doch es sind genau diese Ausnahmen, die dafür sorgen, dass sie dort bleiben, wo sie sind. Wie der Mann sagte.
Unten.
Ein anderer tritt an Hochwürden heran. Er ist blond, wobei er die wallenden Haare heute in einem Pferdeschwanz zurückgebunden hat, nicht besonders groß, nicht besonders kräftig, ein eher schmächtiger, unauffälliger Mann, der heute einfache Kleidung trägt. Das Prominenteste an ihm sind seine graublauen Augen sowie sein Schnauzer und Spitzbart. Vor allem der sonst so sorgsam gezwirbelte Schnauzer leidet unter dem Regen. Doch die Erscheinung täuscht. Es hat sich noch nicht gezeigt, denkt Hochwürden, wer von den dreien hier das größte Ungeheuer ist. Nun, vielleicht wird es die Nacht noch zeigen.
»Fünf Minuten noch. Sie haben eben die Köhlerhütte passiert.«
Es ist nicht klar erkenntlich, woher der Mann seine Informationen hat, doch Hochwürden ist wenig verwundert. Eine Nacht wie diese ist ideal für diesen dritten Mann. Sieht man genauer hin, kann man sogar erkennen, dass der Regen ihn kaum berührt. Solche wie er haben ihre Wege. Hochwürden kennt den Mann nur flüchtig, ein Neuzugang im Rat, aber er ist für ihn undurchschaubar, vor allem deshalb kann er ihn nicht leiden.
Es gibt noch jemanden hier, der den Mann nicht leiden kann, doch in dem Fall ist es fast schon instinktiv. Und beruht auf Gegenseitigkeit.
»Erzählt mehr«, knurrt der Kräftige. »Ist es so, wie man uns gesagt hat, oder gibt es Abweichungen?«
Der Mann schaut zu Hochwürden hin und nickt zustimmend. »Euer Spion ist gut«, erklärt er. »Alles wie versprochen.«
»Ist jedes Eurer Worte ein Goldstück wert? Erzählt mir, was Ihr gesehen habt. Was kommt.«
Der kräftige Mann ist aggressiv, ballt seine Fäuste und stiert den schmächtigen Mann mordlüstern an.
Was diesen wenig beeindruckt. Der lächelt nur schmal und deutet eine leichte ironische Verbeugung an. »Wie Ihr wünscht. Weil Ihr es seid. Und heute Dienstag ist. Fünf Kutschen. Drei für den Herzog, seine Familie und Gefolge. Zwei für Gepäck und Fracht. Alle fünf Kutschen gezogen von Nachtmahren. Ein seltener Anblick hier in Böhmen. Was das angeht, hat der Herzog gut gewählt, es gibt kaum ein Kutschtier, das einem Nachtmahr ebenbürtig ist. Vor allem bei solchem Wetter. Pferde hätten damit ihre Mühe, doch die Nachtmahren sind noch frisch, als wären sie nicht schon dreißig Tage unterwegs. Der Herzog und seine Familie werden von vierundsechzig Wachen begleitet. Keine Nachtmahren für sie, doch sie reiten Pferde, die ihr Gewicht in Gold wert sind. Der Voraustrupp ist mit leichten Armbrüsten bewaffnet, Stahlsehnen, falls Ihr Hoffnung hattet, sie sind durch das Wetter unbeeindruckt. Flankiert werden die Kutschen von leichter Kavallerie, Säbel und Radschlosspistolen …« Er schnaubt und schaut zum dunklen Himmel hoch. »Es wäre wirkungsvoller, wenn sie diese würfen. Bei dem Wetter wird nur eine von vier zünden.«
»Ich bin dankbar für das Wetter«, knurrt der breit gebaute Mann. »Ich höre, diese Pistolen verschießen Silber, und sie können Rüstungen durchschlagen. Was ist mit den anderen?«
»Der Rest der Wachen besteht aus Lancieren. Leichte Speere und Säbel. Sie bilden die Nachhut, sie werden versuchen, uns niederzureiten. Jede der Wachen trägt kostbare Halbpanzer, manche haben sogar Oberschenkel und Arme geschützt. Eine kleine Armee, die der Herzog da in unser friedliches Land bringt. Kein Wunder, dass er auf seinem Weg keine Probleme hatte. Jede dieser Wachen ist kampferfahren. Dazu kommen noch die drei Magister, die im Dienste des Herzogs stehen, sie sind nicht zu erkennen, geben sich wie leichte Kavallerie. Viele ihrer Waffen sind geweiht …« Der Mann schüttelt sich leicht. »Einfach wird das nicht.« Er schaut sich in der Dunkelheit um, selbst Hochwürden ahnt nicht, was er sieht. »Es werden gerade genug sein«, erklärt er anschließend. »Die meisten von uns werden den morgigen Tag nicht erleben. Ich hoffe nur, Hochwürden, es ist das Blut wert.«
»Wir haben dreimal so viele Leute«, knurrt der kräftige Mann zweifelnd.
»Wir werden sehen, wie es kommt«, meint der zierliche Mann und schaut herausfordernd zu Hochwürden hin. »Aber man ist ja bereit, jeden Preis zu zahlen, nicht wahr?«
»Ihr tut beide so, als wäre dies meine Entscheidung«, protestiert Hochwürden milde. »Wenn es nach mir ginge, säße ich mit einem guten Buch oder einer guten Frau in der Hand zu Hause vor dem warmen Feuer und würde einen Wein genießen.« Er zuckt mit den Schultern. »Wie Ihr sehen könnt, geht es nicht nach meinem Willen.«
Er hebt den Kopf, wischt sich Wasser aus dem Gesicht, schaut in die ferne Dunkelheit. »Wie lange noch?«
»Sie werden jeden Moment kommen«, antwortet der Schmächtige. »Die Brücke über den Ammerbach ist schmal, sie müssen langsamer werden, um sie zu passieren. Vielleicht haben wir Glück, und niemand ist ortskundig, dann wird es ein Chaos geben, das wir nutzen können.«
»Also ist es bald so weit. Möge Gott mit uns sein«, flüstert Hochwürden und führt das Dreieck der Dreieinigkeit vor seiner Brust aus.
»Ha!«, meint der Schmächtige dazu. »Daran habe ich so meine Zweifel!«
Die Kutsche schwankt heftig, als eines ihrer Räder ein tiefes Schlagloch findet. Der Ruck ist heftig genug, um ein kleines Mädchen zusammenzucken und sich erschreckt in der Kutsche umsehen zu lassen.
Die Kutsche selbst ist ein Meisterwerk aragonischer Kutschenbauer, selten genug, dass sie so ins Schwanken gerät. Außerhalb der im Moment mit Läden verschlossenen Fenster tobt ein Sturm, wie es ihn in dieser Heftigkeit schon seit Jahren nicht mehr gegeben hat, doch im Inneren der Kutsche, innerhalb der mit rotem Samt ausgeschlagenen Wände, ist es warm und trocken.
Die Kutsche ist massiv, normale Pferde hätten nicht die Kraft, sie zu ziehen, aber genau wegen ihres Gewichts und der hervorragenden Federung vermittelt sie ein Gefühl der Gelassenheit, Geborgenheit, fast schon Sicherheit.
Ein trügerisches Gefühl, was jeder hier in der Kutsche bereits weiß, auch die siebenjährige Antasia, die lächelt, als ihr nur zwei Jahre älterer Bruder Fernandez nach dem heftigen Schwanken der Kutsche versucht, sie zu beruhigen, ihr zu versichern, dass nichts geschehen ist, dass alles gut ist. Und gut sein wird.
Don Fernando de Aragón, Herzog von Gandía, Graf von Denia und Ribagorza, Antasias Vater, verbirgt ein Lächeln, als er den Blick seiner Tochter sieht, während sie ihrem Bruder den Gefallen tut, dass er sie beruhigen darf. Dieser braucht es mehr als sie, und sie weiß es.
Donna Marie Annabella de Aragón, Antasias Mutter, hat es auf den Punkt gebracht. Antasia, sagte sie schon vor Jahren, besitzt eine alte Seele. Donna Marie gilt noch heute als eine der großen Schönheiten am Hofe von König Phillipe, und Antasia ist nach Donna Marie geraten. Zierlich gebaut, fast zerbrechlich wirkend, mit großen dunklen Augen, die schon als Kind alle Geheimnisse der Welt zu hüten scheinen, mit einem fein gezeichneten Gesicht und einer Art, ihr Gegenüber mit einem Blick vergessen zu lassen, dass sie nur ein Kind sein sollte.
»Ihr seid besorgt, Vater.« Es ist keine Frage, es ist eine Feststellung.
Don Rafael, der Bruder des Herzogs, der neben diesem sitzt, schnaubt verächtlich auf. »Warum sollte er besorgt sein?«
Antasia sieht ihn mit ihren dunklen Augen an. »Ich finde es kurios, dass Ihr nicht besorgt seid, Onkel.«
»Ach ja?«, antwortet dieser. »Kurios? Was, denkst du, soll schon geschehen? Wir werden von einer kleinen Armee geschützt, stark genug, um selbst Dämonen in die Flucht zu treiben!«
Donna Marie öffnet den Mund, will ihre Tochter mahnen, nicht immer so direkt zu sein, überlegt es sich dann aber anders. Es gibt keine Fremden hier in der Kutsche, nur Familie. Der Herzog selbst, sie, seine Herzogin, Antasia, Fernandez und Don Rafael, der Bruder des Herzogs. Niemand hier erwartet noch, dass Antasia sich verhält, wie es ihrem Alter entspricht.
Auch Fernandez nicht, der stolz darauf ist, ihr älterer Bruder zu sein, und doch nie zugeben wird, dass er oft genug ihrer Führung folgt.
»Es ist nicht das Wetter, die Straße oder die Kutsche, die Euch Sorgen macht, Vater«, stellt Antasia fest. »Was ist es dann?«, fragt sie, um nach kurzer Überlegung fortzufahren. »Sagtet Ihr nicht, dass Reinhardt vertrauenswürdig wäre? Ein alter Freund, dem Ihr Euer Leben anvertrauen würdet?«
»Ja«, nickt der Herzog. »So ist es. Aber König Reinhardt ist alt, er gehört zu der Generation deines Großvaters. Und er hat viele Feinde im Land, die nur darauf lauern, dass er fällt.«
»Also habt Ihr nicht Angst, dass der König uns betrügt, sondern seine Neider.« Sie schaut ihrem Vater tief in die Augen. »Warum habt Ihr dann erlaubt, dass Phillipe uns auf diese Mission schickt?«
Der Herzog seufzt. »Unser Botschafter in Brünn ist gestorben. Zudem sieht sich mein Bruder als Beschützer des Glaubens, und es ist ihm nur allzu recht, der Dreieinigkeit einen Stein in den Weg zu werfen. Zu sehr hat sich dieser Glauben in den letzten Jahren ausgebreitet. Hier stimme ich Phillipe zu, die Dreieinigkeit geht zu aggressiv vor, und nur ein Blinder könnte übersehen, was ihr Ziel ist.«
Donna Marie nickt. Es gibt wenig, in dem sie mit dem ältesten Bruder ihres Mannes einig ist, aber was die Dreieinigkeit angeht, stimmt sie Phillipe in vollem Umfang zu. Alles, was schlecht für die Dreieinigkeit ist, ist gut für die Menschen. »Aber Phillipe ist dein Bruder. Hätte es nicht möglich sein müssen, ihn davon zu überzeugen, einen anderen zu schicken?«, fragt sie mit leichtem Unwillen in der Stimme.
Spätestens jetzt ist deutlich zu erkennen, dass sich niemand in dieser Kutsche bereitwillig auf dieser Reise befindet.
»Wenn es nur das wäre, vielleicht«, antwortet Don Fernando. »Aber diese Reise hat noch einen anderen Grund und …«
Bevor er zu Ende sprechen kann, wird er von einer Stimme außerhalb der Kutsche unterbrochen. »Don Fernando!«, ruft einer der Späher, und als Don Fernando das Fenster öffnet, sieht er den Mann triefend nass auf seinem Pferd sitzen. »Was gibt es?«, fragt der Herzog.
»Der Weg führt über eine schmale Brücke, und diese ist durch einen umgestürzten Baum blockiert. Es ist zu still dort, es riecht mir nach einem Hinterhalt«, antwortet der Mann.
»Ein Hinterhalt?«, fragt Don Fernando nach. »Hat Er Hinweise gefunden?«
Der Mann schüttelt den Kopf. »Keine, Sire«, antwortet er. »Aber mein Gefühl in solchen Dingen trügt nie.«
»Wie lange noch bis zu dieser Brücke?«
»Etwa fünf Minuten.«
»Lasst halten und schickt die Vorhut, die Brücke zu räumen. Und zu klären, ob es ein Hinterhalt ist.«
»Jawohl, Sire«, antwortet der Mann und zieht sein Pferd herum, doch Don Fernando hält ihn auf. »Warte Er hier bei mir. Wenn es sich zeigt, dass Er recht behält, kann ich einen Mann mit solch guten Instinkten gut brauchen.« Er schaut kurz zu seiner Tochter hin. Diese begegnet seinem Blick offen und zustimmend. Es würde ihn nicht wundern, denkt der Herzog in diesem Moment, wenn sie weiß, was er beabsichtigt.
»Sehr wohl, Eure Hoheit«, antwortet der Mann und deutet im Sattel eine Verbeugung an. Ein Blitz zuckt herab, erhellt für einen Bruchteil die nasse Landschaft. Die Kutsche ist mittlerweile zum Stehen gekommen, und ungeachtet des Schlamms unter seinen Sohlen, verlässt der Herzog die Kutsche beim zweiten Blitz.
In Sekunden ist er durchnässt, aber es scheint ihn nicht zu stören, er reckt sein nasses Gesicht dem Himmel entgegen. »Antasia«, sagt er leise. »Pass gut auf.«
Antasia nickt und kommt zur offenen Tür der Kutsche, verlässt diese aber nicht. Ihr Vater nickt ihr zu und streckt die linke Hand dem Himmel entgegen, scheint auf etwas zu warten.
Das Gefolge des Herzogs weiß, was diese Geste bedeutet, und hält respektvoll Abstand. Der Mann, der vor einem möglichen Hinterhalt gewarnt hat, schaut ebenfalls neugierig drein.
»Wie ist Sein Name?«, fragt Don Fernando.
»Pedro Alvarez. Ich bin der Bruder von Rigo, Eurem Seneschall.«
»Ah«, nickt der Herzog. »Daher kommt Er mir bekannt vor. Trete Er zwei oder besser drei Schritte zurück. Sollte Er recht haben, werden wir diese Blitze …«
Ein gleißender Blitz fährt vom dunklen Himmel direkt in Don Fernandos Hand, und ein alles erschütternder Donnerschlag überdeckt sein letztes Wort.
»Kch!«, zischt der Herzog und wedelt mit der Hand, bläst auf seine Fingerspitzen, die leicht rauchen. »Der war stärker als erwartet. Wir …«
Eine Trompete ertönt in nicht allzu großer Entfernung. Der Regen gibt sein Bestes, um den hellen Klang zu dämpfen, doch es ist nicht genug, die Warnung erreicht Don Fernando und seine Eskorte. Es ist ein Signal der Vorhut. Ein Angriff. Ein Hinterhalt. Der Feind ist in der Überzahl. Es sind Ungeheuer beteiligt und … Das Signal bricht kläglich ab.
Der Herzog flucht leise. »Jemand gab sein Leben, um uns zu warnen! Ruiz!«, ruft er in die Dunkelheit und hört eine ferne Antwort. Er nickt zufrieden. Capitano Ruiz ist ein erfahrener Mann, er weiß, was zu tun ist. Verlässlich in allen Dingen. Er ist ein guter Mann. »Lasst uns die Gelegenheit nicht verschwenden«, meint Don Fernando grimmig. »Frederik!«, ruft er zur zweiten Kutsche hin, die in ein paar Schritt Entfernung ebenfalls angehalten hat. »Bring mir mein Schwert!« Er winkt den Mann mit Namen Pedro Alvarez mit zwei Fingern zu sich heran. »Ich habe eine Aufgabe für Ihn. Gelingt sie Ihm, wird er bis zu seinem Lebensende ausgesorgt haben. Versagt Er … nun … Er versteht, dass ich sichergehen muss?«
»Ja, ich verstehe«, sagt Alvarez respektvoll und kniet sich vor den Herzog in den Schlamm, bevor dieser ihn mit einer Fingerspitze und ein paar gemurmelten Worten an der Stirn berührt. »Ich werde nicht versagen«, schwört er und schaut zu Antasia hin, die ihn mit tiefgründigem Blick mustert. »Wie lautet mein Befehl?«
»Bleibe Er zunächst bei den Kindern. Wenn Er fühlt, dass die Gefahr zu groß wird, bringe Er beide in Sicherheit. Vor allem aber die junge Herrin.«
»Noch vor dem jungen Herrn?«, fragt Alvarez verwundert. Der junge Don Fernandez ist der Erbe, müsste dieser nicht an erster Stelle stehen?
»Meine Schwester ist wichtiger«, sagt der junge Mann aus der Kutsche heraus. Er mag keine alte Seele besitzen wie seine Schwester, aber er ist nicht dumm, versteht, was es bedeutet, wenn sein Vater nach seinem Schwert ruft und die Mutter insgesamt vier doppelläufige Radschlosspistolen unter dem Sitz hervorholt. Jede einzelne von ihnen ist ein Meisterwerk der Büchsenmacherkunst und ein Vermögen wert, doch im Moment zählt für ihn nur, dass sie zuverlässiger als Steinschlosspistolen sind.
Er nimmt eine der Pistolen auf, er muss sie mit beiden Händen greifen, aber er weiß mit solchen Waffen umzugehen. Auch der Bruder des Herzogs nimmt eine der Waffen an sich, mit dem Schwert ist er nicht halb so gut wie sein Bruder, doch mit der Pistole ist er ein Meister. Donna Marie behält die beiden letzten Pistolen für sich und legt sie griffbereit in ihren Schoß.
Ihr Gesicht zeigt sich unberührt von all dem, doch dies ist nur eine Maske. Sie weiß von den Sorgen ihres Mannes, sie kennt Phillipe und seine Ränkespiele, sie weiß auch von Reinhardt und seinen Widersachern.
Sie kennt auch ihren größten Feind, die Dreieinigkeit. In jungen Jahren hat sie erfahren müssen, welche Fratze sich hinter der scheinbaren Ehrbarkeit verbirgt, hat bluten müssen, ist nur mit Mühe entkommen. O ja. Besser als die meisten kennt sie die Dreieinigkeit und gibt sich keinen Illusionen darüber hin, zu was diese Kirche fähig ist.
Sie sind mit einer Eskorte unterwegs, die in Friedenszeiten kaum stärker sein kann, ohne diplomatische Probleme zu verursachen.
Don Fernando ist ein Magister, drei weitere Magister der Kunst befinden sich in ihrer Eskorte. Die Eskorte selbst besteht aus den besten Männern und Frauen, die der Herzog hat finden können, die meisten stehen schon seit Jahren in seinen Diensten. Eine solche Eskorte hätte abschreckend wirken sollen, so wie es in den letzten Wochen der Reise auch gewesen ist.
Donna Marie ist eine kluge Frau. Wenn sie jetzt angegriffen werden, dann ist es nicht irgendwer, dann ist es keine Räuberschar oder ein versprengter gieriger Söldnerhaufen aus Venezia. Nein. Wenn sie hier und jetzt, so kurz vor dem Erreichen ihres Ziels, angegriffen werden, bedeutet dies nur eines: Es ist ein gezielter Angriff auf Don Fernando. Nein. Auf sie alle. Donna Marie ist sich sicher, dass es die Dreieinigkeit ist, die hier die Fäden zieht. Sie riskiert damit bereits einen Krieg, auch wenn die große Entfernung zwischen Bohemia und Aragón dies unwahrscheinlich macht. Doch so politisch brisant die Situation ist, wird man es sich nicht erlauben können, Überlebende zu hinterlassen.
Auch nicht, wenn es Kinder sind.
Erst recht nicht, wenn der eine der Erbe des Herzogtums ist und die andere ein noch größeres, gefährlicheres Erbe in sich trägt.
Sie schaut zu Antasia hin, die ihren Blick gefasst erwidert, dann zu Fernandez, der sich bemüht, der beste große Bruder zu sein, den es gibt.
Götter, in dieser Welt gibt es nichts, das sie mehr liebt als ihre Kinder.
Donna Marie schließt die Augen, spricht im Stillen ein inbrünstiges Gebet, fleht alle ihr bekannten Götter an, Antasia und Fernandez sicher zu halten, holt dann tief Luft und nimmt beide Pistolen auf.
Wer an ihre Kinder will, muss an ihr vorbei.
Sie ist eine gute Schützin. Wer kommt, wird das erfahren. Es werden dann weniger Gegner sein. Ob es genug ist … nun, das wird sich zeigen. Sie besitzt auch noch einen Dolch. Wenn das nicht reicht, so hat sie auch Zähne und Krallen. Niemand kommt an ihre Kinder. Nicht, solange sie noch lebt.
Und sie ist nicht allein.
»Don Fernando!«, hört Hochwürden durch den Regen jemanden rufen. Die Stimme ist tief, grollt im Hintergrund und ist eine, die er kennt. Sein kräftiger Mitverschwörer von vorhin. »Versteckt Euch nicht und kämpft wie ein Mann!«
Die Nacht ist stockdunkel, der heftige Regen trägt seinen Teil dazu bei, nur mit Mühe kann Hochwürden den kräftigen Mann erkennen, der mit einem erhobenen Schwert auf den hochgewachsenen Mann zustürmt, der neben der offenen Tür der Kutsche steht. Und sich nicht im Geringsten versteckt.
Das muss Don Fernando sein. Es ist das erste Mal, dass Hochwürden diesen Mann sieht, und er gibt für sich selbst zu, dass er überrascht ist. Sollten Magister nicht klein und zierlich sein, mit gebeugtem Rücken von dem Studium alter arkaner Texte?
Don Fernando ist weit davon entfernt. Groß und kräftig, gekleidet in rote Seide und Brokat, mit einem Hermelin-Umhang, der nur von jenen getragen werden darf, in deren Adern königliches Blut fließt, wirkt das Schwert fast wie ein Spielzeug in seiner Hand. Der blonde Hüne neben ihm, noch mal zwei Köpfe größer als Don Fernando selbst, muss Frederik sein, ein Schwede, ungeschlagen im Kampf. Seinen Informationen nach verbindet die beiden Männer eine tiefe Freundschaft, und sie sind bereit, füreinander zu sterben. Frederik ist wirklich furchterregend, denkt Hochwürden, als er sieht, dass der blonde Hüne ein zweihändiges Schwert in jeder Hand hält.
Unter dem durchnässten schwarzen Umhang glänzt kalter Stahl. Frederik ist schwer gerüstet, und es heißt, dass es selbst im gesamten Frankenreich niemanden gibt, der ihm im Kampf ebenbürtig ist.
»Don Fernando!«, ruft der kräftige Mann erneut. »Kämpft mit mir, wenn Ihr kein Feigling seid!« Noch während er dies ruft, geschieht etwas Furchterregendes mit ihm. Er wächst in Höhe und Breite, sein Gesicht verformt sich zu der Schnauze eines Wolfes, seine Hände werden zu Krallen, und dichter grauer Pelz wird überall dort sichtbar, wo die Kleidung des Mannes unter der Verwandlung gerissen ist.
Ja, sicher, denkt Hochwürden, weil ein jeder ein Feigling ist, der einem Kampf mit einem Werwolf ausweichen will. Hochwürden selbst würde nicht einen Moment zögern, in einer solchen Situation die Flucht zu ergreifen, nur würde er es nicht feige nennen, sondern vernünftig.
Hochwürden verflucht die düstere Nacht und den Regen, als er eine Geste des Herzogs mehr erahnt denn tatsächlich sieht. Jeder hier scheint trotz der Finsternis und dem Regen bestens sehen zu können, nur er selbst ist blind wie ein Maulwurf in dieser dunklen Nacht.
Dennoch, er ist sich sicher, dass der Herzog soeben mit den Augen rollte.
Währenddessen stürmt der Werwolf mit einem eigenartig schaukelnden Gang auf den Herzog zu, sein Schwert achtlos hinter sich herziehend, fast vergessen in der krallenbewehrten Pranke.
Don Fernando zuckt mit den Schultern, hebt die linke Hand an, deutet auf den heranstürmenden Werwolf, und ein gleißender Blitz erhellt das Schlachtfeld, fährt von dem ausgestreckten Zeigefinger des Herzogs direkt ins linke Auge des grau bepelzten Werwolfs. Eben noch ein furchterregendes Ungeheuer, ist der Werwolf einen Sekundenbruchteil später nur noch eine Masse aus verbranntem, verkohltem Fleisch und stinkenden Haaren.
»Hhm«, meint eine Stimme neben Hochwürden, wo eben noch niemand gestanden hat. Es ist der schmächtige Mann von vorhin. »Es scheint«, grinst dieser, »dass Ihr über die Gabe eines Propheten verfügt, der Blitz kam, wie Ihr es ihm versprochen habt!« Während er dies sagt, wischt er achtlos seine zierliche, schlanke Hand an seiner Kleidung ab, Blut und Fleischbrocken werden im Regen davongespült. »Arme Bestie«, meint er dann mit falscher Betroffenheit. »Einmal einem animalischen Impuls gefolgt und schon erleuchtet …!«
»Ich bin wie üblich von Eurem Wortwitz beeindruckt«, meint Hochwürden trocken. »Wenn Ihr schon Witze macht, wie ist die Lage?« Er kennt den Namen des Mannes nicht, doch er versteht, dass dieser nur dann Witze macht, wenn er sich unter großem Duck fühlt.
Ein Blitz fährt herab, diesmal vom Himmel und nicht aus Don Fernandos Hand, doch auch dieser Blitz trifft ein Ungeheuer, dieses ähnelt mit seinen Fledermausflügeln, dem schmalen, lang gezogenen Kopf und langen Reißzähnen eher einem klassischen Dämon. Das Ergebnis ist das gleiche, das Ungeheuer fällt rauchend, schwelend und verkohlt in sich zusammen, während der Regen auf den Resten verdampft.
Der schmächtige Mann blinzelt einmal.
»Einer von den Euren?«, fragt Hochwürden. Er klingt etwas, wenn auch nur ein wenig, gehässig dabei. »Ich dachte, ihr wäret geschützt vor solchen Dingen?«
»Hrmpf«, grollt der Schmächtige tief in seiner Kehle. »Dies war ein Akt Gottes, Hochwürden, und keine Magie.« Wieder zuckt ein Blitz herab vom Firmament, erhellt das blutige Schlachtfeld. »Aber Ihr habt recht, es steht nicht gut für uns. Der Hinterhalt wurde zu schnell entdeckt, der Gegner hatte Zeit, sich zu sammeln, und unsere Übermacht schmilzt dahin wie Butter in der Sonne.« Er wirft einen Blick hoch zu Hochwürden. »Normalerweise würdet Ihr bereits die Flucht ergreifen. Nicht aus Feigheit, nein, aus Vernunft.« Seine Lippen kräuseln sich, als er sich diese Spitze leistet, er weiß, dass Hochwürden es hasst, wenn jemand seine Gedanken lesen kann. »Da Ihr es nicht tut, habt Ihr noch etwas in der Hinterhand. Was ist es?«
Hochwürden bestreitet es nicht. Er zuckt mit den Schultern. »Lest meine Gedanken.«
»Ich höre nur manche«, erklärt der schmächtige Mann. »Also, was ist es?«
Hochwürden verzieht verächtlich das Gesicht »Was soll es sonst sein, außer Gier, Neid und Missgunst?«
»Wohl wahr«, nickt der schmächtige Mann. »Das schlummert wohl in jeder Seele. Ein Verräter also? Ihr musstet bestimmt nur ein wenig nachhelfen.«
»Gar nicht«, schnaubt Hochwürden. »Er trat selbst mit dem Vorschlag an uns heran.« Er schaut auf den zierlichen Mann hinab. »Ich möchte daran erinnern, dass ich dagegen war, mich auf ein solches Spiel einzulassen. Das Wagnis scheint mir zu hoch. Doch Ihr habt im Rat dafür gestimmt.«
Der Mann zuckt mit seinen Schultern. »Ich stimmte dafür, weil man mich dazu angehalten hat, und nicht, weil ich von der Klugheit dieses Handelns überzeugt gewesen bin. Aber wer weiß … man sagt, wer wagt, gewinnt.«
»Allzu oft verliert man, wenn man zu viel wagt.«
»Auch das ist wahr …« Der zierliche Mann schaut zur Kutsche hin, wo Don Fernando mit dem Schwert in seiner Hand steht und durch die Nacht sie beide mit seinen dunklen Augen zu fixieren scheint. »Schaut, der Herzog hat uns bemerkt.«
»Kein Wunder. Wir sind nicht in den Kampf verwickelt«, stellt Hochwürden fest. »Genauso wenig, wie er es ist. Also müssen wir die Anführer auf unserer Seite sein. Und, gottverdammt, warum habe ich das Gefühl, dass er in der Nacht so gut sieht wie ich am Tage?«
»Weil es so ist, Hochwürden. Schändliche Magie, ich bin mir sicher. Nun, was immer Ihr in der Hinterhand habt, es wird Zeit, die Karte auszuspielen, sonst rate ich selbst dazu zu fliehen, bevor Don Fernando uns erschlägt. Oder uns eine gleißende Erleuchtung zukommen lässt.« Er schüttelt sich delikat. »Ich mag eine gewisse Resistenz gegen Magie besitzen, aber dieser Blitz, der Thorim grillte, war doch von etwas heftiger Natur.«
»Wer ist Thorim?«, fragt Hochwürden verwirrt.
Der schmächtige Mann zeigt wortlos auf einen noch immer schwelenden Klumpen Fleisch. »Mein Name ist Feldix Insbrucker«, sagt er dann. »Für den Fall, dass Ihr ihn auch vergessen habt.«
»Nicht vergessen, nur nicht gemerkt.« Hochwürden seufzt. »Der beste Zeitpunkt ist vergangen. Ich befürchte, der Mut hat unseren Mann verlassen. Diese Schlacht ist verloren. Also lasst uns gehen.«
Insbrucker nickt. »Alle Verräter sind Feiglinge.« Er holt tief Luft, schaut sich auf dem blutigen Schlachtfeld um und leckt sich die Lippen. »Schade um das Blut, das hier so sinnlos verschwendet wurde. Also gut, lasst uns fliehen.«
»Gehen«, korrigiert Hochwürden.
»Ihr könnt gehen, wie Ihr wollt«, gibt Insbrucker mit einem Grinsen zur Antwort. »Ich für meinen Teil hasse Blitze, also fliehe ich!«
Doch genau in diesem Moment blitzen mehrfach orangefarbene Mündungsflammen in der Kutsche auf, und dichter Pulverdampf weht durch die offene Kutschentür, vor der Don Fernando, mit einem ungläubigen Ausdruck im Gesicht, langsam erst auf seine Knie fällt und dann, halt- und kraftlos, vorneüber, mit dem Gesicht zuerst, in den kalten Schlamm.
Sieben Schüsse sind in rascher Folge gefallen. Frederik, der nun ebenfalls taumelt und langsam in sich zusammenbricht, ist eines der Opfer. Don Fernando, der Herzog, von Verrat gefällt, ein anderes.
Hochwürden runzelt die Stirn. Doch wem galten die anderen Kugeln?
Für einen Moment ist es so, als ob die Zeit stillstünde, als ob auch die Kämpfer auf dem Schlachtfeld, von gleißenden Blitzen erleuchtet, erstarrten. Bis sich jemand regt. Ein Mann in einem Halbpanzer, mit einem Federbusch auf seinem Helm, Capitano Ruiz, wie Hochwürden vermutet, eilt auf die Kutsche zu, reißt die Tür auf der anderen Seite auf und erstarrt, als ihm ein schmächtiger Körper entgegenfällt.
Er greift nach ihm, wirft einen hasserfüllten Blick in die Kutsche, die immer noch von dichtem Pulverdampf erfüllt ist, wieder fällt ein Schuss, doch diesmal verfehlt die Kugel ihr Ziel.
Capitano Ruiz presst den zerbrechlichen Körper an sich, gibt das Signal zum Rückzug. Diese Schlacht ist verloren, nun gilt es zu retten, was noch zu retten ist. Der Regen spült ihm die Tränen aus den Augen, als er, voller Gram, den kleinen Körper unter seinen linken Arm gepresst, auf sein Pferd aufspringt und in vollem Galopp durch die düstere Nacht davonreitet.
Im nächsten Moment, als hätten sie es vorher abgesprochen und geübt, zieht sich der Gegner zurück, folgt dem Capitano, und sie lösen sich wie Geister in der dunklen Nacht auf.
Ruiz hat jetzt Wichtigeres zu tun.
Hochwürden ist es recht so. Er denkt nicht im Traum daran, dem Capitano zu folgen. Er ist froh, dass der Gegner sich zurückzieht. Es sieht nicht so aus, als gäbe es hier noch viel, was sich ihm in den Weg stellen kann.
Hochwürden reckt seinen Hals, es knirscht. Diese Schlacht ist gewonnen, er müsste zufrieden sein, doch er ist alles andere als das.
Die Kutsche schwankt, als sich eine korpulente Person durch die offene Tür zwängt und dann neben dem gefallenen Herzog stehen bleibt, auf diesen herabsieht. In einer schlaff herabhängenden Hand hält der Mann noch immer eine Pistole, die andere ist gegen seinen Hals gepresst.
Es ist zu dunkel, und der Regen ist zu dicht, um es klar zu erkennen, doch Hochwürden vermutet dort eine Verletzung. Wenn dem so ist, dann hat der Verräter Glück gehabt. Ein kleines Stück nur nach links, und er hätte für seinen Verrat selbst mit dem Tod bezahlt.
Noch immer schwallt Pulverdampf aus der Kutsche und wird vom regennassen Wind verweht.
Es ist wahr, denkt Hochwürden voller Verachtung, Verrat ist die zweitmächtigste Waffe, die es gibt.
»Was ist dann die mächtigste Waffe?«, fragt der schmächtige Mann. Zum einen, weil er wirklich neugierig ist, zum anderen, um Hochwürden zu provozieren, weil er es hasst, dass dieser sich nicht aus der Reserve locken lässt.
So ist es auch diesmal. »Hoffnung«, antwortet Hochwürden gelassen. »Hoffnung ist die stärkste Waffe.«
Er richtet seinen Blick auf den korpulenten Mann bei der Kutsche, wendet ihn dann von diesem ab, als ob er den Anblick nicht ertragen könnte.
»Der neue Herzog, nehme ich an?«, meint Insbrucker zynisch, als er Hochwürden folgt, der nun langsam auf die Kutsche zugeht. »Warum nur verstehen so viele Neider nicht, dass es kein ungerechtes Schicksal ist, wenn nicht sie den Lorbeer tragen? Vielmehr ist es verdient. Ich meine, es ist klar erkennbar, wer der größere Mann gewesen ist, wenn es Verrat gebraucht hat, ihn zu fällen?«
»Ihr redet zu viel, Binsdrecker«, mahnt Hochwürden den Mann milde. Vor allem, weil es das ist, was er selbst gerade denkt und der Mann seine Gedanken gelesen hat. Schon wieder.
»Don Retial?«, fragt Hochwürden höflich, als er den Bruder des Herzogs mit einem leichten Nicken begrüßt.
Dieser schaut irritiert drein.
»Verzeiht meinem Freund«, drängt sich Insbrucker hastig vor und wirft Hochwürden einen mahnenden Blick zu. »Er hat es nicht so mit Namen.« Vor allem, wenn er die Person nicht ausstehen kann. »Willkommen in Böhmen, Don Rafael.« Er wirft einen Blick zur Kutsche in, durch dessen offene Tür er einen schlaffen bleichen Arm sehen kann. Donna Maries, ohne Zweifel. »In Anbetracht der Umstände erkundige ich mich jetzt wohl besser nicht, wie Eure Reise war.«
»Er redet zu viel«, teilt Don Rafael ihm als Antwort im groben Ton mit und mustert Hochwürden mit gerunzelter Stirn. »Habt Ihr hier das Sagen?« Die Haltung und Kleidung von Hochwürden lassen das vermuten.
Hochwürden nickt leicht. »In Vertretung. Wenn wir Prag erreichen …«
»Besorgt mir einen Arzt«, unterbricht ihn Don Rafael. »Ich bin schwer verletzt.«
Richtig. Jetzt, da Hochwürden nahe genug an dem Mann heran ist, kann er das dünne Rinnsal an Blut sehen, das spärlich zwischen den Fingern des korpulenten Verräters hervortropft. Schwer verletzt, in der Tat. Hochwürden hebt einen Finger an, und ein dünner Mann, in allen Dingen unauffällig, erscheint wie aus dem Nichts neben ihm. Insbrucker hebt eine Augenbraue an, selbst mit seinen scharfen Sinnen war ihm nicht bewusst gewesen, dass Hochwürdens Leibwächter in der Nähe gewesen ist. »Führe er Don Rafael zur Kutsche, und sorge Er dafür, dass es ihm in Prag an nichts mangelt.« Er ringt sich ein Lächeln ab. »Wir kümmern uns derweil um …« Er macht eine fahrige Geste zur Kutsche hin. »… das da.«
»Sehr wohl«, meint Don Rafael herablassend. Vielleicht bildet Hochwürden es sich auch nur ein, aber in seinen Ohren klingt jedes Wort des Verräters nasaler und hochtrabender und kratzt an seinen Nerven. »Kümmere Er sich darum, mache Er es gut, damit es keinen Ärger gibt.« Er schaut sich auf dem Schlachtfeld um, und Hochwürden fragt sich, ob Don Rafael wirklich mehr sieht als er, für ihn ist es hier nur nass und dunkel. Was vielleicht auch gut ist, so hat er die blutigsten Gräueltaten auf dem Feld nicht mit ansehen müssen.
»Gott war auf unserer Seite und hat uns geholfen, die Schlacht erfolgreich zu schlagen«, stellt Don Rafael befriedigt fest. »Heute ist ein guter Tag.«
Ja, sicherlich, denkt Hochwürden, als er zusieht, wie sein Mann Don Rafael davonführt. Er hat den fragenden Blick seines Leibwächters gesehen, und für einen Moment war die Versuchung übermächtig stark. Ein Blick, eine Geste, und Don Rafael hätte diese Schlacht ebenfalls nicht überlebt.
Eine Schlacht, die er hätte früher beenden können, hätte er den Mut dazu nur aufgebracht.
»Irre ich mich, oder haben wir das gründlich verbockt?«, fragt Insbrucker, der ebenfalls dem spanischen Adeligen nachschaut. »Und Ihr habt recht. Er ist ein Arschloch.«
»Hört auf, meine Gedanken zu lesen«, mahnt Hochwürden milde. »Und ja, es ist gründlich verbockt. Zwei Drittel der herzoglichen Eskorte haben den Kampf überlebt. Und zumindest Capitano Ruiz weiß, wer den Herzog auf dem Gewissen hat.« Er schaut in die ferne Dunkelheit und kratzt sich am Hinterkopf. »Es gibt keinen Weg zu verhindern, dass das herauskommt.«
»Don Rafael ist jetzt der letzte überlebende Bruder des spanischen Königs«, erinnert Insbrucker, der nun seinen Kopf in die Kutsche hineinsteckt. »Ihm wird nichts geschehen. Und wenn das, was Ihr auf der Ratssitzung gesagt habt, tatsächlich zutrifft, hat Don Rafael seinem königlichen Bruder sogar einen Gefallen getan. Oh.« Er pfeift leise durch die Zähne. »Das wird Euch nicht gefallen, Hochwürden.«
»Was ist?«, fragt dieser und beugt sich ebenfalls in die Kutsche hinein. Mittlerweile hat sich der Pulverdampf etwas verzogen, dennoch muss er die Nase rümpfen. Es riecht nach Schwefel, Blut und Tod.
Donna Marie wurde seitlich in die Schläfe getroffen, die schwere Kugel hat ihr dann auch jeden Rest von Schönheit genommen. Wenigstens hat sie den Verrat nicht mitbekommen, denkt Hochwürden und hebt eine Augenbraue an. »Ich sehe, was Ihr meint«, sagt er dann, denn Donna Marie ist die Einzige in der Kutsche.
Insbrucker nickt und hebt drei Finger an. »Da war dieser Mann, der vor dem Herzog kniete, das war am Anfang, habt Ihr es gesehen?«
Hochwürden nickt. Undeutlich, aber ja.
»Dann die Infantin und der junge Don Fernandez, der Erbe des Herzogs.«
»Wobei unklar ist, ob dieser noch lebt, Capitano Ruiz hat den Jungen mitgenommen, aber so schnell, wie er geritten ist, hat er wohl noch Hoffnung gehabt.«
»Der Junge lebt. Ob er in einer Woche noch leben wird, hängt davon ab, ob ihm jemand helfen kann, der seine Kunst versteht.«
»Ah«, meint Hochwürden interessiert. »Woher wisst Ihr das?«
»Blut riecht anders, wenn es aus einer tödlichen Wunde kommt … es riecht dann mehr nach Verzweiflung und Endgültigkeit. Dieses Blut riecht nach Rache.« Er deutet mit seinem Blick auf die leere Sitzbank gegenüber Donna Marie. »Es ist der junge Don gewesen, der Don Rafael verwundet hat. Gleich nachdem dieser Donna Marie erschossen hat. Don Rafael schießt auf seinen Neffen, trifft ihn schwer, sodass diesem die Pistole aus der Hand fällt. Die Infantin nimmt die Pistole ihres Bruders auf, schießt den zweiten Lauf ab, verfehlt. Der Mann von vorher greift sich die Infantin und rollt sich mit ihr auf der anderen Seite aus der Kutsche. Der Mann besitzt beeindruckend schnelle Reflexe. Don Rafael schießt dreimal, zwei Kugeln verfehlen, doch die letzte trifft den Rücken des Mannes, durchschlägt ihn und bleibt in der Schulter der Infantin stecken. Der Mann ist schwer, vielleicht tödlich getroffen, doch für den Moment ist ihm die Flucht gelungen.«
»All das könnt Ihr erkennen?« Hochwürden ist diesmal sichtlich beeindruckt.
»Es ist eine Gabe«, erklärt Insbrucker bescheiden. »Wir nennen es Blutsinn. Wo Blut beteiligt ist, zeichnet es für mich ein Bild.« Er leckt sich über die Lippen, und sein Gesicht nimmt einen verklärten Ausdruck an. »So etwas wie das Blut der Infantin habe ich noch nie gerochen. Ich werde es bis an mein Lebensende nicht vergessen.«
Hochwürden will eigentlich nicht fragen, doch Insbrucker sieht so beeindruckt aus, dass …
»Ihr Blut riecht … heilig. Ja«, nickt der Mann in Gedanken, »Das ist das Wort, das es am besten beschreibt. Es wäre nicht nur ein Sakrileg, von ihr zu trinken, ich bin sicher, es wäre ein tödlicher Fehler.« Er schaut mit weiten Augen zu Hochwürden hoch. »Wer ist die Infantin?«
»Als Erstes hört auf, sie die Infantin zu nennen«, meint Hochwürden in einem ungewöhnlich scharfen Ton. »Jetzt, da ihr Vater tot ist, ist ihr Anspruch auf den Thron nur dürftig. Und Kronprinzessin Isabelle erfreut sich bester Gesundheit.«
»Ja. Sie ist nur etwas matt im Kopf. Ihr glaubt, es ist all diese Inzucht.«
»Linsbacker, seid vorsichtig. Euer Mund wird Euch noch den Kopf kosten.«
»Hhm«, meint Insbrucker. »Ihr seid aufrichtiger, als ich es vermutet habe. Ihr hasst all das, was heute hier geschehen ist.« Er sieht, wie Hochwürden sich umsieht. Versucht, sich umzusehen. Die Nacht ist noch genauso nass und dunkel wie zuvor. »Was sucht Ihr?«
»Das Kind«, antwortet Hochwürden grimmig. »Sie darf diese Nacht nicht überleben.«
»Das ist sehr schade«, seufzt Insbrucker »Sie riecht gut, und ich mag sie.« Er deutet in die dunkle Nacht. »Dorthin müssen wir.«
Es braucht eine Weile, bis sie das Mädchen und den Mann finden. So schwer verletzt, wie die beiden sind, ist es überraschend, wie weit sie gekommen sind. Hochwürden muss sich eingestehen, dass er sie ohne Insbruckers Hilfe nie gefunden hätte.
»Nun, da sind sie«, meint dieser und deutet auf einen dunkleren Fleck in der Dunkelheit. Hochwürden greift unter seinen nassen Umhang und holt eine kleine Laterne hervor, die einen Stein enthält, von dem ein dauerhafter schwacher Schein ausgeht. Nicht genug, um weit zu sehen, aber genug, um ein Ziel abzugeben, was erklärt, warum Hochwürden sie nicht vorher schon verwendet hat.
Ungeachtet des Schlamms und Matsches kniet Hochwürden sich jetzt neben den Körper des Mannes und wuchtet ihn zur Seite, dort unter ihm begraben findet er Antasia. Sie ist bleich und kalt und starrt mit offenen Augen in den schwarzen Nachthimmel. Ein daumengroßes Loch findet sich in ihrer Schulter, und der Matsch und Schlamm um die beiden Körper herum ist mit Blut vermischt.
Hochwürden hält die kleine Laterne neben das Gesicht des Mädchens und holt eine gefaltete Zeichnung unter seinem Umhang hervor, flucht leise, als er feststellt, dass diese nass geworden ist und die Tusche so sehr verlaufen, dass man kaum etwas erkennen kann.
»Nun«, fragt Insbrucker, »ist sie es?«
Hochwürden zögert kurz und nickt. »Sie ist es.«
Der schmächtige Mann mustert Hochwürden sorgfältig. »Seid Ihr wirklich kaltherzig genug, um ein wehrloses Kind zu meucheln?«
»Sie ist bereits tot«, stellt Hochwürden kalt fest.
»Sie ist es nicht. Auch der Mann hier ist noch am Leben. So wiederhole ich meine Frage. Soviel ich weiß, habt Ihr Euch von Gewalttaten immer ferngehalten, doch jetzt ist es an Euch. Seid Ihr also auch ein kaltblütiger Mordgeselle?«
»So wie Ihr es seid?«, fragt Hochwürden spitz. Er mustert das Mädchen genauer, hält einen Finger unter ihre Nase, fühlt den Puls. Kein Atem, kein Herzschlag. Das Mädchen ist tot. Nur … er schaut zu Insbrucker hin. Sein Clan wird nicht ohne Grund auch der Clan der Todeshändler genannt. Er ist ein Blutmagier. Was er sagt, hat für Hochwürden Gewicht.
»Ich mag ein Mörder sein«, sagt Insbrucker erhaben. »Aber ich habe meine Prinzipien. Ich töte keine Kinder … und vergreife mich nicht an Wehrlosen. Es liegt keine Ehre darin.«
»Sie leben?«, fragt Hochwürden unsicher.
»Sie leben«, antwortet der schmächtige Mann und sieht zu, wie Hochwürden ein schlankes Stilett aus einem Stiefelschaft zieht. Und zögert. »Aber wenn ich es recht bedenke, muss ich mich irren. Sie sind tot. Kalt, kein Atem, kein Puls … es bräuchte schon Magie, damit sie überleben.« Er zuckt hilflos mit den Achseln. »Aber was verstehe ich schon von Magie.«
Der Herzog hat wortwörtlich Bücher über Magie geschrieben. Hochwürden beugt sich vor, zerrt etwas an der Kleidung des Mädchens, ein Anhänger an einer goldenen Kette fällt in seine Hand. Darauf ist ein Mann mit Bart zu sehen, der schützend einen Säugling in seinen Händen hält.
»Das ist das Zeichen des heiligen Stylianus«, erklärt Insbrucker und schüttelt sich leicht. »Sie steht unter seinem Schutz. Kein Wunder, dass ich das Gefühl hatte, es wäre … unangebracht … sich an ihr zu vergehen. Und dass sie so heilig riecht.«
»Wie riecht heiliges Blut?«, fragt Hochwürden. Es ist nur eine belanglose Frage, um die Stille zu füllen.
Insbrucker weiß das, er antwortet trotzdem. »Wie Eisen mit einem Soupçon von Weihrauch.« Er sagt es andächtig, mit einem Ton von Ehrfurcht in der Stimme.
Es ist alles kalt und nass hier. Die Nacht, der Regen, der Matsch und Schlamm. Der Körper des Mädchens. So kalt und klamm, die Kälte des Todes. Und doch … der Anhänger in Hochwürdens Hand ist warm. Scheint zwischen seinen Fingern zu pulsieren. Wie ein langsamer Herzschlag. Vorsichtig legt er den Anhänger wieder auf die Brust des Mädchens zurück, sorgsam darauf bedacht, nicht an der dünnen Kette zu zerren, zieht ihre Kleidung zurecht, damit der Anhänger nicht mehr zu sehen ist. Steckt das Stilett wieder zurück in den Stiefel und richtet sich auf. »Selbst wenn sie noch leben würden, so schwer verletzt, wie sie es sind, werden sie den Morgen nicht erleben.« Er versucht, kühl und unberührt zu klingen, doch er ist es nicht.
»Wir fanden sie bereits verstorben vor. Habt Ihr das vergessen?«
»Insbrucker«, sagt Hochwürden. »Ihr seid ein Ungeheuer. Und doch, vielleicht, ein guter Mann.«
»Ich war einmal ein guter, treuer, gläubiger Mann, Ehemann, Sohn und Vater«, sagt Insbrucker tonlos. »Bevor ich zu einem Ungeheuer wurde.« Ein flüchtiges Lächeln huscht über seine Lippen. »Manchmal möchte ich Reste von dem, was ich gewesen bin, aufrechterhalten.« Seine Lippen kräuseln sich. »Und es liegt wahrlich keine Ehre darin, wehrlose Kinder abzuschlachten.«
Hochwürden nickt, schaut noch einmal auf die beiden reglosen Körper herab, dreht sich dann entschieden um und geht davon.
In der Ferne sind Wagenlaternen zu sehen, viele Laternen für viele Wagen. Bei all den Toten wird es eine Weile dauern, bis sie alle abtransportiert sind.
Am Morgen wird an dieser Stelle nichts mehr zu sehen sein. Das ist der Plan. Alle Spuren verwischen.
Sinnlos jetzt, da Capitano Ruiz mit dem jungen Don Fernandez entkommen ist. Aber das ist der Plan, also hält man sich daran.
»Ich schulde Euch etwas«, sagt er leise, als die beiden im Regen dem Wagen entgegengehen.
»Nein. Ich schulde Euch etwas«, antwortet Insbrucker genauso verhalten. »Es war nicht mein Wunsch, meine Seele noch mehr zu verdammen, als sie es schon ist.« Er holt tief Luft. »Es ist bereits ein Fiasko. Ich sehe nicht, wie ein Leben mehr oder weniger daran etwas ändern wird.«
Hochwürden sagt nichts dazu. Doch er sieht es nicht anders.
»Hey, Hochwürden«, sagt Insbrucker mit einem breiten Grinsen etwas später, als sie den Wagenzug erreichen. »Sind wir in dieser dunklen, nassen Nacht gar zu Freunden geworden?«
Hochwürden schnaubt durch die Nase. Wohl kaum.
Er spricht es nicht aus, er denkt es nur. Doch sie sind keine Feinde mehr. Er weiß nicht, wie weit er Insbrucker vertrauen kann. Da er ist, was er ist. Aber …
»Aber es ist ein Anfang«, lächelt der schmächtige Mann.
Kapitel 2
Tutto Nero
Am nächsten Morgen, als die Sonne gerade so eine Handbreit über dem Horizont steht, erreichen zwei Reiter die kleine Brücke über den Ammerbach. Der Ältere der beiden trägt einen breitkrempigen schwarzen Lederhut, eine schwarze, mit feinen Silberfäden bestickte Jacke, gleicher Art sind seine Hose und die hohen Schaftstiefel. Die wiederum besitzen eine Besonderheit, die der Jüngere der beiden anderswo noch nicht gesehen hat; es sind auf der Außenseite der Stiefel jeweils zwei Dolchscheiden mit schmalen Dolchen eingearbeitet. Dazu trägt der Mann noch einen langen schwarzen Lederumhang, der bis über die Kuppe seines Pferdes fällt. Der Mann ist hochgewachsen, aber hager und bereits älter, auch wenn es schwer ist, sein Alter abzuschätzen. Unter dem breiten Hut sind schulterlange, schneeweiße Haare zu sehen, die Augen unter den buschigen grauen Augenbrauen sind eisblau, und der Jüngere findet es noch schwer, dem Blick aus diesen Augen standzuhalten. Sie scheinen in sein tiefstes Inneres sehen zu können, jedes Geheimnis zu ergründen und ihn nach Belieben aufzuspießen.
Es ist schwer, den Mann einzuschätzen, sein Gesicht zeigt selten eine Regung, und auch seine Kleidung gibt wenig Aufschluss; sie ist von einfachem Schnitt, aber von bester Qualität. Der ganze Mann ist schwarz, so wie er selbst sagt, seine Seele auch. Eine Voraussetzung für sein Handwerk, wie er zwei Tage zuvor dem Jüngeren beim Frühstück erklärt hat.
Dieser hat nicht das Gefühl, als sei es ein Scherz gewesen.
Auf der rechten Seite des Sattels hängt ein schwerer spanischer Degen mit einem Griffkorb aus Silber, auf der linken Seite ragt aus einem Sattelhalfter ein mit mattem Silber verzierter Gewehrkolben hervor. Daneben, bequem zu erreichen, zwei Pistolen. Beide Satteltaschen, selbstverständlich schwarz, sind ungewöhnlich groß und voluminös und so schwer, dass der Jüngere, als er sie am Morgen zum Stall bringen musste, beide Hände brauchte, um sie anzuheben.
Er hat den Mut aufgebracht, zu fragen, was sich denn in diesen Taschen befinden würde.
Alles, was man braucht.
Der Mann ist schwarz, sein Pferd ist schwarz, seine Seele ist schwarz, und der Name, der meist nur hinter vorgehaltener Hand geflüstert wird, ist Nero. Nur denkt der Jüngere, dass es nicht viele geben wird, die seinen Namen tuscheln. Die meisten, die den Namen kennen, weilen nicht mehr unter den Lebenden.
Der Jüngere ist leichter einzuschätzen. Er sieht aus wie das, was er ist. Ein Adeliger, jung und eitel, sein rotes Lederwams ist mit Goldbrokat bestickt, der leichte Degen an seiner Seite so neu, dass am Griff nicht ein einziger Kratzer zu finden ist. Er reitet ein schneeweißes Pferd, sein hellblauer Umhang trägt das Wappen seines Vaters, eine Axt und ein auf dem Rücken liegender, erschlagener Eber, durch einen Schrägbalken geteilt. Das Wappen derer von Ebertoths.
Der einzige Misston hier ist das prächtige blaue Auge, das in allen Tönen schillert und noch immer halb zugeschwollen ist.
Der Name des jungen Mannes ist Hendrik von Ebertoth, er ist seit vier Tagen vierzehn Jahre alt, und es gibt im Moment nichts, was er mehr bereut, als den Reizen einer Magd erlegen zu sein, dieser auf die Stube zu folgen, wo er dann, mitten während der Verrichtung, von dem Geliebten der Magd erwischt wurde, sodass er, mit hängender Hose und blankgezogen, aus dem Fenster hat flüchten müssen, was damit endete, dass er direkt vor den Füßen seines Vaters, Thomas von Ebertoth, in einer Pfütze landete.
Woraufhin der Vater, angesichts des blanken Hinterns und der wütenden Rufe aus dem Fenster der Magd, der Ansicht war, dass es an der Zeit sei, mit dem jüngsten Sohn ein ernstes Wort zu sprechen. Was zur Folge hatte, dass der junge Mann den eisernen Griff seines Vaters an seinem Ohr fühlen durfte, und an diesem, des blanken Hinterns ungeachtet, quer durch den Hof, durch die Haupthalle und dann in den zweiten Stock zum Arbeitszimmer des Vaters gezerrt wurde. Erst dort gelang es, dem junge Hendrik zu richten, was schon vorher dringend hätte gerichtet werden sollen.
Zu den Wahrheiten des Lebens, die der junge Hendrik nun erfahren durfte, gehörte unter anderem, dass er als dritter Sohn wenig Hoffnung auf ein Erbe hätte. Der Älteste, Wilfried, war bereits zwanzig Jahre alt und dem Vater in allen Dingen eine Stütze, der mittlere Bruder, Leopold, war belesen und studierte seit Jahren schon in Aachen die Juristerei, ein Gelehrter also.
Und dann war da Hendrik. Ein Taugenichts, der nun auch schon den Weibern nachstellte. Bei der Gelegenheit erwähnte der Vater noch wie nebenbei, dass er den jungen Mann eigenhändig kastrieren würde, sollte dieser es wagen, ihm einen Bastard in die Familie zu setzen, bevor er noch sechzehn Jahre alt ist.
Hendrik war sich nicht sicher, wie ernst die Drohung zu nehmen war, aber er hat sie sehr wohl gehört. Es folgte eine Aufzählung all der Dinge, in denen sich der junge Hendrik hervortat, indem er jede Eignung dafür missen ließ. Nach Meinung des Vaters taugte der junge Hendrik zu nichts anderem als zum Schlafen, Fressen, Herumhuren und ihm, dem Vater, Ärger zu bereiten.
Ein wenig ungerecht war dies schon. Hendriks tat sich in Wort und Schrift hervor, besaß ein Talent für Sprachen, ein Auge für Details, die anderen gerne entgingen, sowie Charme und ein einladendes Lächeln, einen Sinn für Wort und Witz, der ihn überall willkommen machte und leicht Freunde finden ließ.
Oder aber, wie der Vater es nannte, sich in jeder Gasse herumzutreiben und sich zusammen mit den anderen Nichtsnutzen zu besaufen.
Nachdem er sich über zwanzig Minuten anhören durfte, zu was er alles nicht taugte, kam der Vater dann zum Wesentlichen. Zu diesem Zeitpunkt wäre Hendrik bereits gerne geflüchtet, doch die daumendicke Rute, die der Vater zu Beginn des Gesprächs bedeutsam auf seinem Schreibtisch platziert hatte, erinnerte ihn daran, weiterhin so zu tun, als ob er beflissentlich jedem Wort des Vaters folgen würde.
»Kurzum«, schloss der Vater, leicht außer Atem, »Er erinnert mich an einen anderen Nichtsnutz, der sich selbst beinahe das Leben zerstörte.« Er holt tief Luft. »Mich selbst.« Er sah Hendrik tief in die Augen. »Und es gab nur eines, was mich geradebiegen konnte und auch dich geradebiegen wird. Morgen früh, pünktlich zur sechsten Stunde, wirst du an der Wache am Südtor einem Ser Nero deine Aufwartung machen und in die Dienste Seiner Majestät eintreten. Er hat mich geradegebogen, also wird er auch dich zurechtbiegen.«
»In die Dienste Seiner Majestät, des Königs? Einfach so? Vater, wer ist dieser Nero?«
»Er gehört zur Schwarzen Wacht.«
»Noch nie davon gehört.«
»Und so ist es gut. Hendrik, mein Junge, dies ist die beste Gelegenheit, die sich dir jemals bieten wird.«
Als der junge Hendrik am nächsten Morgen mit dem Hahnenschrei und dem gesiegelten Brief des Vaters an der rot-weiß gestreiften Tür der Torwache anklopfte, fand er dort ein halbes Dutzend Stadtwachen beim Würfelspiel und in bester Laune vor.
Kaum hatte er gesagt, wen er suche, wurde ein jeder still. Es war der Hauptmann, der den Würfelbecher weglegte, aufstand und Hendrik lange musterte, bevor er einen tiefen Seufzer von sich gab. »Folge mir.«
Der Hauptmann führte nun den jungen Hendrik erst tief in die Gewölbe hinab, vorbei an den Kerkern, tiefer noch, wo die grob behauenen Wände nass waren, Wasser von der Decke tropfte und die Laterne in der Hand des Hauptmanns gegen diese abgrundtiefe Dunkelheit kaum etwas auszurichten wusste.
Weiter ging es, den langen Gang entlang, bis der Hauptmann an eine andere Tür klopfte. Deren Holz war feucht und verzogen, die Angeln rostig, und man hätte meinen können, sie wäre seit Ewigkeiten nicht mehr geöffnet worden, doch tatsächlich ging sie auf, noch bevor das Klopfen verhallt war.
Ein Mann, ganz in Schwarz, mit einer schwarzen Maske, durch deren Augenlöcher man nur dunkle Augen glitzern sah, richtete seinen Blick auf Hendrik und lachte. »Was ist das?«
»Frischfleisch«, antwortete der Hauptmann und deutete mit dem Daumen auf den jungen Hendrik. »Er sagt, er will Nero sehen und hätte einen Brief für ihn.«
»Na, wenn das so ist«, meinte der Mann in Schwarz. »Dann folge mir.«
Wieder führte der Weg durch endlose nasse, dunkle Gänge, deren absolute Stille nur durch die Geräusche fallender Tropfen, des Atems und der Schritte Hendriks unterbrochen wurde, wobei es eine Weile dauerte, bis Hendrik bemerkte, dass er die Schritte des anderen nicht vernehmen konnte.
Endlich ging es wieder aufwärts. Treppe um Treppe, so viele Stufen, dass Hendrik sich fragte, wie tief diese nassen, dunklen Gänge letztlich waren. Dann, zum ersten Mal nach einer schieren Ewigkeit, Licht, das durch eine Schießscharte an einer Wendeltreppe fiel. Hendrik erhaschte nur einen kurzen Blick von der Welt da draußen, er dachte, er kennt Brünn, ist groß geworden in der Königsstadt, doch er ist verloren.
Die Wendeltreppe weiter empor und noch höher, bis sein Führer an eine andere Tür klopfte, sich umdrehte und wortlos ging.
Bevor Hendrik fragen konnte, wurde die Tür aufgezogen, und Nero stand vor ihm, musterte ihn ausdruckslos. »Du hast einen Brief für mich?« Der Mann streckte eine behandschuhte Hand aus. Hendrik gab ihm den Brief des Vaters, Nero brach das Siegel, warf einen kurzen Blick auf das Schreiben und lachte kurz und trocken auf.
»Du besitzt ein Pferd?«
»Ja, Ser.«
»Wir haben jetzt knapp vor der siebten Stunde. Zur achten Stunde erwarte ich dich, mit allem Wesentlichen für zehn Tage gepackt, am nördlichen Tor.«
Gut. »Aber wie …«, begann Hendrik, der nicht die geringste Ahnung hatte, wo er sich befand oder wie er von hier aus zu dem Haus seines Vaters und den Stallungen kommen sollte.
Nero machte mit seinem linken Zeigefinger eine kreiselnde Bewegung nach unten. »Die Wendeltreppe vier Stockwerke nach unten. Die rechte Tür.«
Als Hendrik diese Tür aufzog, sah er eine Straße vor sich liegen, die er gut kannte. Es gab einen alten Wachturm hier, aus dem er gerade kam, und schräg über die Straße hinweg, in vielleicht dreißig Schritten Entfernung, das Stadthaus seines Vaters. In dessen Stallungen sich sein Pferd befand.
Und der Stallknecht.
Der Liebhaber der Magd.
Hendrik war pünktlich. Nero warf nur einen kurzen Blick auf ihn und sein blaues Auge. »Folge mir«, befahl er ihm und saß auf. Auf ein Pferd, das so schwarz war wie die gesamte Ausstattung des Mannes.
Nachdem sie den ganzen Tag geritten waren und Nero kaum ein Wort von sich gegeben hatte, erreichten sie einen großen, im Umland recht bekannten Gasthof.
»Zum Amboss«, stellte Nero fest und warf einen zweifelnden Blick zu dem Amboss hin, der an viel zu dünnen Ketten hoch über dem Eingang hängt. »Einer der besten und größten Gasthöfe an der Grenze zu Böhmen. Fünf Straßen kreuzen sich hier. Wichtiger ist, dass Meister Haberlein hier abgestiegen ist. Er befindet sich auf der Durchreise, ist auf dem Weg nach Prag, aber heute wird er hier nächtigen.«