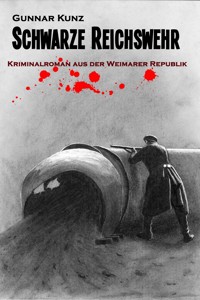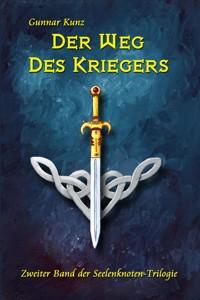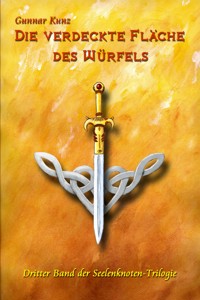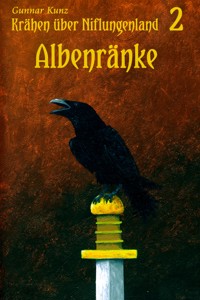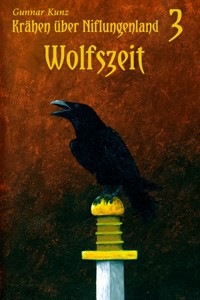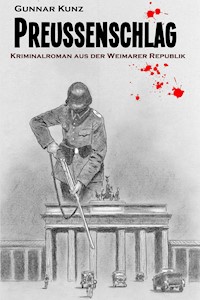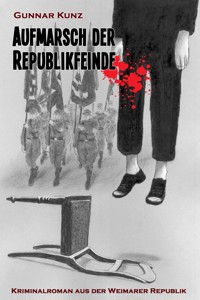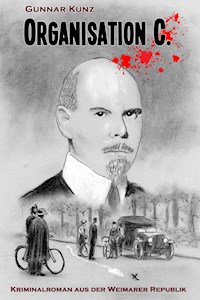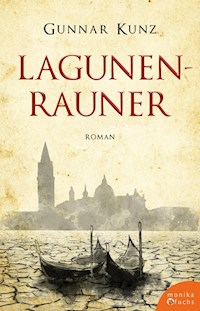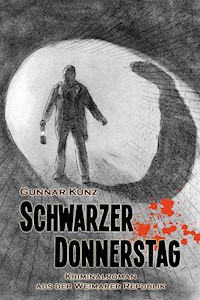
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Krimi
- Serie: Kriminalroman aus der Weimarer Republik
- Sprache: Deutsch
Berlin 1929. Die Weltwirtschaftskrise wirft ihre Schatten voraus, der Sklarek-Skandal erschüttert das Vertrauen in die Republik, die Polizei richtet am 1. Mai ein Massaker in der Bevölkerung an. Kommissar Gregor Lilienthal, unterstützt von seiner Frau Diana und seinem Bruder Hendrik, will den Mord an einem Rauschgifthändler aufklären. Dabei werden die drei auf einen Bankierssohn mit einem morbiden Faible für Selbstmorde aufmerksam. Oder hat gar Hermann Göring, Abgeordneter der NSDAP im Reichstag und morphiumsüchtig, etwas mit der Sache zu tun? Die Untersuchung führt im wahrsten Sinne des Wortes in die Unterwelt Berlins, nicht nur zu Ringvereinen und Prostituierten, sondern auch in Brauereikeller, tote U-Bahntunnel und Abwasserkanäle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 310
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Gunnar Kunz
Schwarzer Donnerstag
Kriminalroman aus der Weimarer Republik
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Schwarzer Donnerstag
Prolog
1.
2.
3.
Nachwort
Empfehlenswerte Literatur zum Thema:
Weitere Bücher aus der Serie:
Impressum neobooks
Schwarzer Donnerstag
Kriminalroman aus der Weimarer Republik
von Gunnar Kunz
Impressum:
Copyright 2020 by Gunnar Kunz, Berlin
Tel. 030 695 095 76
E-Mail über www.gunnarkunz.de
Alle Rechte vorbehalten
Einbandgestaltung: Rannug
Dieses E-Book, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt und darf ohne Zustimmung des Autors nicht vervielfältigt, wieder verkauft oder weitergegeben werden. Danke, dass Sie die Arbeit des Autors respektieren!
Prolog
Rasmus Gehler war nicht so blöd, das Zeug selbst zu nehmen, das er verkaufte, dazu hatte er schon zu viele Idioten an einer Überdosis krepieren sehen. Aber er hielt sich für einen harten Kerl, der etwas aushalten konnte, deshalb war er sicher, mit einem blauen Auge davonzukommen, wenn er gehorchte. Von einem Mal würde er noch lange nicht abhängig werden, auch wenn es sich in diesem Fall um reinen Stoff handelte, weil er noch keine Gelegenheit gehabt hatte, die Ware mit Reispuder, Borsäure oder Novocain zu strecken.
Zuerst hatte er daran gedacht, trotz der auf ihn gerichteten Pistole Gegenwehr zu leisten, aber wenn er die Chancen gegeneinander abwog, war es einfacher, sich die Nadel in die Vene zu stecken, das Kokain in seine Blutbahn zu drücken und sich anschließend selbst an das Heizungsrohr zu fesseln, wie es von ihm verlangt wurde: erst die Füße, dann die linke Hand, danach die andere durch die hingehaltene Schlinge stecken, während der Lauf der Waffe gegen seine Schläfe drückte. Zulassen, dass auch diese Hand an das Rohr gebunden wurde.
Was soll schon sein, dachte er. Ein bisschen Rausch, vielleicht würde er sogar kotzen, weil er das Zeug nicht gewohnt war, na schön. Morgen war er wieder auf dem Damm, dann würde er für alles, zu was er heute gezwungen wurde, blutige Rache nehmen. Er lehnte sich zurück, schloss die Augen und strafte sein Gegenüber mit Missachtung, während er seinen Gewaltfantasien nachhing.
Eigentlich hatte er vorgehabt, gleichgültig zu bleiben und zu zeigen, dass nichts ihn beeindrucken konnte, doch schon nach kurzer Zeit wurde ihm angenehm leicht zumute. Alles war mit einem Mal so intensiv: die Farben der Flaschen und Dosen auf dem Tisch, das Tropfen des Wasserhahns, sein Atem. Er konnte spüren, wie sein Herz schneller schlug und Geist und Körper sich belebten. Hellwach war er und wesentlich cleverer als all seine Neider und Konkurrenten zusammen. Seine Gedanken überschlugen sich, sein Verstand arbeitete doppelt so schnell wie sonst. Ihm fielen zehn, zwanzig, hundert Möglichkeiten ein, wie er sich befreien und die Demütigung heimzahlen konnte. Er brauchte bloß seine Muskeln anzuspannen und die Wand einzureißen. Er brauchte bloß einmal tief einzuatmen und dem Heizungsrohr einen Tritt zu geben, dann konnte er sich das Ding schnappen und damit alles zu Kleinholz verarbeiten, was ihm im Weg stand.
Das Bedürfnis umherzulaufen, um mit seinen Gedanken Schritt zu halten, wurde übermächtig. Rasmus Gehler versuchte aufzuspringen, wurde aber von den Fesseln daran gehindert. Er brauchte Raum, er brauchte Luft zum Atmen, er brauchte Bewegungsfreiheit! Sein Brustkorb verlangte danach, sich auszudehnen. Geradezu euphorisch zerrte er an den Stricken; sie gaben nicht nach. Offenbar hatte er vorhin ganze Arbeit geleistet, der beste Beweis für seine Überlegenheit. Wenn er erst loszog, um all die Dinge zu tun, die mit einem Mal klar und einleuchtend vor seinem geistigen Auge standen, konnte ihn niemand mehr aufhalten, niemand. Nicht mal die Bullen.
Ein Stich an seinem Arm lenkte ihn ab. Unwillig schüttelte er sich, konnte aber nicht verhindern, dass ihm eine zweite Dosis Kokain verabreicht wurde. Sollte ihn das etwa in die Knie zwingen? Lächerlich! Er war zehnmal so schlau wie jeder andere, er war zehnmal so stark, er war unbesiegbar. Wenn er wollte, konnte er das Gebäude auseinandernehmen. Wenn er wollte, konnte er die gesamte Unterwelt von Berlin unter seine Knute bringen. Wenn er wollte, konnte er durch Wände gehen.
Warum war es bloß so heiß? Er schwitzte wie eine Sau. Und sein Handgelenk blutete. Vermutlich hatte er sich die Verletzung bei seinen Befreiungsversuchen zugezogen, das war ihm gar nicht aufgefallen. Er spürte keinen Schmerz; ein weiterer Beweis seiner Überlegenheit. Rasmus Gehler lachte. Er würde es mit jedem aufnehmen, der ihm in die Quere kam. Mit jedem.
Die nächsten Einstiche bemerkte er nicht mehr, auch nicht, dass die Spritze wahllos in Venen, Fleisch und Muskeln gestoßen und sein Körper mit Kokain überflutet wurde. Sein Herz schlug unregelmäßig, setzte einmal kurz aus und schlug danach so hart, dass er glaubte, es müsse jeden Augenblick durch seine Brust brechen.
Die Schatten im Raum hatte er vorher nicht bemerkt, doch jetzt sah er, dass sie hinter dem Schrank und unter dem Tisch lauerten, dass sie allmählich näherkrochen und darauf warteten, dass er sich eine Blöße gab. Das Tropfen des Wasserhahns steigerte sich und hallte wie eine Trommel in seinen Ohren. Und war da nicht ein Kratzen in der Wand zu vernehmen? Das mussten Leute sein, die zwischen den Mauern lebten und ihn beobachteten. Die ihn in den Wahnsinn treiben wollten. »Kommt raus, ihr Feiglinge!«, brüllte Rasmus. »Zeigt euch, wenn ihr euch traut!«
Insekten krabbelten über seine Haut, Flöhe, Spinnen, Ameisen, die sicher diese Dreckskerle auf ihn losgelassen hatten. Hektisch versuchte er, die Viecher abzustreifen, aber seine Hände waren immer noch gefesselt, so musste er ertragen, wie sie höher krochen und immer höher, wie sie in seine Nasenlöcher krabbelten, hinein und wieder heraus, wie sie sich in seine Haut bohrten und durch seine Bauchhöhle arbeiteten, durch seine Blutbahn, bis sie in seinem Kopf waren und seine Gedanken fraßen.
Er brüllte, weil er plötzlich Schmerzen in der Brust verspürte, unvorstellbare Schmerzen, während sich seine Muskeln verkrampften und seine Organe dabei zu erdrücken schienen. Ein Gurgeln drang aus seinem Mund, als ihn der Herzinfarkt einem Stromstoß gleich ereilte. Ein letztes Mal bäumte sich Rasmus Gehler auf, ehe er zusammenbrach.
Zehn, zwanzig Sekunden lang herrschte abwartende Stille.
Dann stieß ein Schuh den Körper an, der leblos am Heizungsrohr hing. Behandschuhte Hände überzeugten sich davon, dass der Rauschgifthändler wirklich tot war, verstauten die Spritze in einem Beutel und diesen in einer Manteltasche. Schließlich entfernten sich lautlose Schritte und ließen nur das Tropfen des Wasserhahns zurück.
1.
Dienstag, 23. April – Montag, 3. Mai 1929
Das Verhalten der Polizeibeamten in der Öffentlichkeit wird häufig genug Maßstab für die Beurteilung des Staates selbst.
Der preußische Innenminister Grzesinski
(zitiert nach: Léon Schirmann: Blutmai Berlin 1929)
1
Dieses Land kommt einfach nicht zur Ruhe, dachte Hendrik, während er auf die dunklen Schlieren starrte, die die Ruderstange des Fährmanns im Wasser hinterließ. Zwei bis drei Millionen Menschen arbeitslos. Die Arbeitslosenversicherung wegen der vielen Bezugsberechtigten vor dem Zusammenbruch. Immer mehr Obdachlose. Konkurse nahmen zu. Zehntausende Schulkinder hungerten in Berlin und waren auf Schulspeisung angewiesen. Die Dauerkrise der Landwirtschaft, verursacht durch veraltete Betriebe und den Verfall der Preise auf dem Weltmarkt, hielt an; trotz der Notprogramme waren viele Bauern verschuldet.
Und dann die Regierungsmisere! Die rechtslastige Große Koalition unter SPD-Reichskanzler Hermann Müller, die aus fünf Parteien bis hin zur Deutschen Volkspartei bestand, konnte über kaum ein Thema Einigung erzielen. Der umstrittene Bau des Panzerkreuzers A, die Steuererhöhung, der Streit, ob die unterfinanzierte Arbeitslosenversicherung durch Leistungskürzung oder Erhöhung des Beitragssatzes gerettet werden sollte – all das lähmte die Regierung. Auch die gerade erfolgte Kabinettsumbildung änderte nichts daran. Zudem ließen die Feinde der Demokratie in ihrer Wühlarbeit gegen die Republik nicht nach. Die Sabotage des Schiedsspruchs der Tarifverhandlungen in der Ruhreisenindustrie durch die Arbeitgeber richtete sich nicht zuletzt gegen den Staat.
Als würde all das nicht ausreichen, gab es da noch das Problem der Reparationszahlungen an die Siegermächte des Großen Krieges, die sich mittlerweile nach dem Dawes-Plan auf 2,5 Milliarden Goldmark im Jahr erhöht hatten. Dabei war die deutsche Wirtschaft noch immer damit beschäftigt, Krieg und Inflation zu verarbeiten. Um die Zahlungen aufzubringen und die Wirtschaft anzukurbeln, hatte das Reich hohe Auslandskredite aufgenommen, sich damit allerdings abhängig gemacht. Außenminister Stresemann hatte schon im vergangenen Jahr davor gewarnt, ein Leben auf Pump zu führen. Bei der geringsten Krise würden die Amerikaner ihre Kredite abrufen, und der Bankrott wäre kaum noch aufzuhalten. Reichsbankdirektor Schacht hatte der Vollversammlung des Young-Komitees, das eine Einigung über die Reparationszahlungen zu erreichen suchte, ein Memorandum über die deutsche Leistungsfähigkeit überreicht, war damit aber nicht gut angekommen.
Diana stupste Hendrik an. »Du bist kein bisschen entspannt«, sagte sie.
Da hatte sie recht. Aber wie sollte er? Zur allgemeinen Situation im Land kamen noch seine persönlichen Probleme hinzu. Das Semester hatte gerade begonnen, und die ersten Tage waren immer besonders schlimm. Er ertrug die nationalistischen Sprechchöre eines großen Teils seiner Studenten und die Plattitüden seiner Kollegen nicht mehr. Einige Studenten hatten angefangen, seine Vorlesungen wegen seiner »vaterlandslosen Gesinnung« zu boykottieren. Nicht selten endete der Unterricht in Geschrei, wenn er mal wieder eine unliebsame Wahrheit aussprach. Es kursierten bereits Petitionen, ihm die Lehrberechtigung abzuerkennen, organisiert vom Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund.
Wie konnten sich engagierte junge Menschen so leicht von Ideologien vereinnahmen lassen? Dabei gab er ihnen doch ein Werkzeug an die Hand, um Propaganda zu durchschauen. Was war die Philosophie anderes als eine Anleitung, kritisch zu sein und selbstständig zu denken? Nichts als gegeben hinzunehmen? Die richtigen Fragen zu stellen? Wer, wie, was, wo, wann, warum, und wem nützt es? Wer finanziert die Nationalsozialisten? Wem gehören die Zeitungen, die unablässig gegen die Republik hetzen und keine Gelegenheit auslassen, Errungenschaften wie die Sozialversicherung zu kritisieren? Wessen Interessen vertreten also Leute wie Adolf Hitler oder Alfred Hugenberg, der Parteivorsitzende der Deutschnationalen?
Aristoteles nannte die Philosophie die Wissenschaft der Wahrheit und war schon in der Antike zu dem Schluss gekommen: Für die richtige Erkenntnis sind gründliche Zweifel unabdingbar. Warum also gaben sich so viele Menschen mit einfachen und vor allem: vorgekauten Antworten zufrieden? Wenn das Studium unser Urteilsvermögen nicht verbessert, hatte Montaigne einst geschrieben, könnte der Student seine Zeit ebenso gut beim Ballspiel verbringen, das würde zumindest seinen Körper ertüchtigen. Mit erfüllter Seele sollte er vom Studium zurückkommen, aber sie ist ihm nur geschwollen. Er hat sie aufgeblasen, statt sie wachsen zu lassen.
Hendriks Widerwille zu unterrichten war mittlerweile so groß, dass er sich bereits Gedanken über berufliche Alternativen machte. Keine Überlegung war zu absurd, um nicht ins Auge gefasst zu werden. Sein Freund Reinhold Pfeiffer, Reporter der Vossischen Zeitung, hatte mal halb im Spaß vorgeschlagen, bei seiner Profession und mit seiner angenehmen Stimme könnte er doch »erbauliche Gedanken« im Rundfunk verbreiten. Und Hendrik zog es ernsthaft in Erwägung.
Die Verleumdungen und Attacken gegen ihn belasteten ihn so sehr, dass es ihn buchstäblich krank machte. Im vergangenen Jahr war er zweimal für längere Zeit ausgefallen, weil er keine Kraft mehr besaß, um Viren etwas entgegenzusetzen. Gleichzeitig war er sich bewusst, dass seine Beschäftigung mit beruflichen Alternativen rein akademischer Natur war. Solange es mit der Wirtschaft so schlecht stand wie im Augenblick, musste er froh sein, überhaupt Arbeit zu haben. Die Schrecken der Inflation steckten ihm noch in den Knochen.
»Wo ist Onkel Hendrik?«, fragte Diana mit kindlicher Stimme.
Hendrik sah zu ihr hinüber.
Lissi, ihre Tochter, deutete auf ihn und strahlte.
»Das ist nur sein Körper. Sein Geist weilt irgendwo im Nirwana.«
Jetzt musste Hendrik grinsen. »Schon recht. Ich hab’s verstanden.«
Er winkte Lissi zu, und Lissi winkte zurück. In ein paar Tagen wurde sie zehn Monate alt, kaum zu glauben! Hendrik empfand väterliche Gefühle für die Tochter seines Bruders und ließ sich von ihr genauso leicht um den kleinen Finger wickeln wie Gregor.
»Lass deine Sorgen für den Augenblick ruhen und genieß den Tag«, sagte Diana. »Deshalb sind wir schließlich hergekommen. Sieh doch nur, wie schön es hier ist.«
Auch damit hatte sie zweifellos recht. Hendrik ließ seinen Blick über die Büsche und Bäume schweifen, die dicht an den Rand des schmalen Flusses drängten und mit ihrem üppigen Grün die Augen zu betören suchten. Frösche quakten, Vögel zwitscherten, ein Eichhörnchen sprang von Erle zu Erle über das Wasser hinweg. Es roch nach Baumblüte und frisch gemähtem Gras. Hinter einer Biegung schreckten sie einen schwarzen Storch auf, der machte, dass er davonkam.
Der Fährmann, der das Boot durch die Flussarme und Kanäle des Spreewalds stakte, trällerte:
»In Lübbenau, in Lübbenau
sitzt ein Indianer hinterm Bau
und schmeißt mit sauren Gurken.
Was sagen Sie zu dem Schurken?«
Hendrik musste lachen, und auch Diana kicherte. Lissi schaute ihre Mutter überrascht an und ahmte dann das Kichern nach. »Da-da-da«, rief sie und zappelte mit Händen und Füßen. Diana gab ihr einen Keks, den sie erst aufmerksam betrachtete und mit ihren Fingern untersuchte, ehe sie an einer Ecke zu knabbern begann.
Ausnahmsweise hatte Diana, die im Allgemeinen einem zerrupften Vogel glich, der sich aus den Federn von zwanzig verschiedenen Vögeln ein neues Kleid zusammenstoppelte, heute Geschmack in der Kleiderwahl bewiesen. Sie trug mit Seide überzogene Spangenschuhe und ein schlichtes knielanges Kleid mit losem Oberteil in dezenten Gelbtönen. Einzige Extravaganz waren die mit Stickereien und Perlbändern verzierten Ärmel. Und auf ihre Fingernägel hatte sie rosa Polierpaste aufgetragen.
Hendrik hatte ebenfalls sein Möglichstes getan, um präsentabel zu erscheinen, und sich Mühe gegeben, ein Hemd zu finden, das nicht zerknittert war, und seine wirr abstehenden Haare zu bändigen. Letzteres war ihm jedoch nur bedingt gelungen.
Die Anlegestelle kam in Sicht. Am Steg warteten schon etliche Ausflügler und ein halbes Dutzend Spreewaldfrauen mit ihren weiten Röcken und den Flügelhauben auf dem Kopf. Geschickt lenkte der Fährmann den Kahn an Land. Diana nahm Lissi auf den Arm, Hendrik half ihnen heraus. Dann zog er seine Taschenuhr aus der Weste und klappte sie auf.
»Wie spät ist es?«, wollte Diana wissen.
»Gleich zwei.« Eine halbe Stunde noch, ehe Gregor kam, um sie abzuholen. Er brachte einen Gefangenen nach Cottbus, der dort ein Juweliergeschäft überfallen hatte und der Polizei zufällig in Berlin in die Fänge geraten war.
Lissi machte mit Geplapper auf sich aufmerksam. Die glänzende Rückseite der Taschenuhr hatte es ihr angetan. Hendrik reichte sie ihr, obwohl er wusste, dass sie sie vermutlich auf den Boden werfen würde. Es war schwer, ihr etwas abzuschlagen. Diana setzte sie auf die Wiese, wo sie sich zufrieden damit beschäftigte, die Uhr zu schütteln und gegen ihren Keks zu hämmern, der prompt zerbröselte. Nach einer Weile verlor sie die Lust daran und fing stattdessen an, Dianas Handtasche auszuräumen und den Inhalt auf der Wiese zu verteilen.
Lissi war ein passender Name für seine Nichte, fand Hendrik. Der Klang spiegelte ihren vorwitzigen Charakter. Dabei war die Namensfindung nicht einfach gewesen. Diana wollte unbedingt, dass ihre Tochter Elisabeth hieß, Gregor bestand auf Katharina, bis Hendrik vorgeschlagen hatte, sie Elisabeth Katharina zu nennen. Dabei war es geblieben. Am Ende nannte sie ohnehin jeder nur Lissi.
Ein Zeitungsjunge lief zwischen den Ausflüglern umher und verkaufte die Morgenausgaben der Berliner Zeitungen. Hendrik erstand ein Exemplar des Berliner Tageblattes. Es interessierte ihn brennend, welche Fortschritte die Beleidigungsklage machte, die derzeit vor dem Schöffengericht in Moabit verhandelt wurde.
Reichsanwalt Jorns wollte dem verantwortlichen Redakteur der Zeitschrift Das Tagebuch an den Kragen, wegen eines Artikels über die skandalösen Umstände der Untersuchung gegen die Mörder von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die Jorns damals als Kriegsgerichtsrat geleitet und hintertrieben hatte. Das Verfahren erwies sich allerdings als Bumerang. Es war Jorns, der immer mehr in die Bredouille geriet. Der Verteidiger des Redakteurs hatte erklärt, dass man dem ehemaligen Kriegsgerichtsrat fünfzig Untersuchungsanordnungen vorhalten könne, die nicht zweckmäßig oder sogar zweckwidrig gewesen seien.
Je länger sich der Prozess hinzog, desto deutlicher wurde, dass Jorns bei der Vertuschung des Mordkomplotts ganze Arbeit geleistet hatte. Offenbar hatte er Informationen an Verdächtige weitergegeben, Haftbefehle verschleppt und Beihilfe zur Flucht geleistet. Es war geradezu bemitleidenswert, wie er sich herauszuwinden versuchte und immer dann, wenn es brenzlig wurde, unter Gedächtnislücken litt. Vielleicht widerfuhr Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht am Ende doch noch so etwas wie Gerechtigkeit.
In den letzten Tagen war ans Licht gekommen, dass Jorns damals veranlasst hatte, einen unliebsamen Kriegsgerichtsrat vom Fall abzuziehen. Außerdem hatte er einen Brief, der die Verhaftung eines Verdächtigen veranlassen sollte, über Hauptmann Pabst geleitet, den Hauptverantwortlichen der Morde. Dadurch konnte natürlich auch sein Adjutant, der ebenfalls beschuldigte Hauptmann Pflugk-Harttung, mitlesen. Das alles, obwohl sich Jorns durchaus bewusst war, dass die betreffenden Militärs wie Pech und Schwefel zusammenhielten. Im Prozess mit dieser seiner Aussage konfrontiert, erwiderte er, er habe sich darüber gefreut, weil es doch ein Zeichen von Kameradschaft sei.
Hendrik überflog den aktuellen Artikel im Tageblatt. »Hör dir das an!«, sagte er zu Diana. »Der Hauptverdächtige, Kurt Vogel, war gar nicht mehr Offizier, als die Tat begangen wurde, sondern Zivilist.«
»Das heißt, Jorns hätte ihn eigentlich dem Militärgericht entziehen und an ein Zivilgericht herausgeben müssen?«
»Genau.«
»Aber dann wäre ja alles aufgeflogen, nicht wahr?«
»Mhm. Und dann steht hier noch, dass damals behauptet wurde, Liebknecht sei auf der Flucht erschossen worden, nachdem er mit einem Messer auf seine Bewacher losgegangen sei. Ein Federmesser zum Bleistiftspitzen gegen sechs schwer bewaffneten Soldaten! Diese dreiste Lügerei ist einfach zum Kotzen.« Hendrik faltete die Zeitung zusammen, verstaute sie in einer Tasche seines Regenmantels und setzte sich ins Gras, um seine Uhr wieder an sich zu nehmen.
Diana suchte derweil ihre Utensilien auf der Wiese zusammen und stopfte sie in ihre Handtasche zurück. Lissi begutachtete Blumen und entfernte sich dabei krabbelnd immer weiter. »Komm zurück, wir wollen bald los«, rief Diana. Da ihre Tochter nicht hören wollte, stellte sie die Handtasche beiseite und folgte ihr. Als Lissi merkte, dass ihre Mutter hinter ihr her war, juchzte sie und krabbelte schneller.
»Hab’ ich dich!« Diana hob ihre Tochter hoch, gab ihr einen Kuss und trug sie zu Hendrik zurück. Sobald sie sie jedoch absetzte, krabbelte Lissi wieder davon. »Bleib hier!« Dianas Stimme wurde schärfer. Das kümmerte Lissi nicht im Geringsten. Im Gegenteil, sie blickte über ihre Schulter, und sobald Diana Anstalten traf, ihr zu folgen, quietschte sie vor Vergnügen und bemühte sich wieder, ihr zu entkommen.
»Genug jetzt!« Diana schnappte sich ihre Tochter, trug sie zurück und versuchte dann, ihr einen Hut aufzusetzen, um sie vor der Sonne zu schützen, die sich soeben zwischen den Wolken hervorwagte, was nicht ohne Geschrei abging und einen Kampf erforderte, den Diana am Ende für sich entschied. Nur Sekunden, nachdem die Tränen versiegt waren, krabbelte Lissi schon wieder umher, stupste Gänseblümchen an und untersuchte ein leeres Schneckenhaus.
Motorengebrumm kündigte ein Auto an, kurz darauf brauste ein Dienstwagen der Polizei heran. Gregor schien es eilig zu haben. Tatsächlich war der Wagen kaum zum Stehen gekommen, da sprang auch schon die Fahrertür auf, Hendriks Bruder reckte sich heraus und winkte sie zu sich.
»Was hat er denn?«, murmelte Diana.
Sie beeilten sich, Gregors Aufforderung Folge zu leisten. Lissis Gesicht hellte sich auf, als sie ihren Vater erkannte; sie streckte ihre Arme nach ihm aus.
Normalerweise wirkte Gregor auf Außenstehende so spritzig wie ein Teilnehmer einer Fachtagung für Steuerprüfer, aber wenn seine Tochter bei ihm war, wurde er ein anderer Mensch. »Hallo, kleine Maus!«, sagte er, nahm sie Diana ab und herzte und küsste sie.
»Ga-ga-ga«, sagte Lissi.
Gregor hörte aufmerksam zu, als verstünde er jedes Wort. »Klingt, als hättest du heute viel erlebt«, sagte er. Dann wandte er sich Diana und Hendrik zu, und sein Gesicht war wieder ernst. »Steigt ein, wir müssen uns beeilen. Kriminalrat Gennat hat mich höchstpersönlich in Cottbus angerufen, ich muss zu einem Mordfall. Edgar ist bereits da und wartet auf mich.«
Er bemühte sich, Dianas begeisterten Gesichtsausdruck zu übersehen, als er ihr Lissi zurückgab und alle ins Auto stiegen. Hendrik grinste. Es gefiel seinem Bruder immer noch nicht, wenn sie beide allzu großes Interesse an einer Untersuchung bekundeten, doch seit sie ihm im Mordfall Bartels beigestanden und geholfen hatten, sich seiner Vergangenheit zu stellen, hatte er jeden Widerstand gegen ihre Amateurspürnasen aufgegeben. Zumal ihm bewusst war, dass er selbst nicht gerade von Verfehlungen frei war. Hendrik hatte ihn damals davor gewarnt, Selbstjustiz zu üben, und natürlich haderte Gregor seitdem mit seiner Entscheidung. Er sprach nicht viel darüber, aber er hatte durchblicken lassen, dass er seinem eigenen Urteil nicht länger traute und Hendrik als moralische Instanz schätzte, die ihm auf die Finger sah.
Wenn du Nietzsche kennen würdest, hättest du die Gefahr vorhergesehen, dachte Hendrik: Wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird. Und wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.
Der Wagen setzte sich in Bewegung. Lissi winkte zum Abschied nach draußen. »Bll-bll«, machte sie.
Gregor gab ordentlich Gas, deshalb erreichten sie Berlin in Rekordzeit. Da sich die meisten Autofahrer an die neue Berliner Verkehrsordnung hielten und nicht schneller als vierzig Stundenkilometer fuhren, überholten sie einen Wagen nach dem anderen. Gregor hatte seine Signalvorrichtung in die Steckhülse auf der Motorhaube gesteckt, den Stab mit der Blechscheibe, die ihn als Polizisten im Einsatz auswies. Auf die neue Fanfare, die ihm freie Bahn verschafft hätte, verzichtete er, auch wenn er in Eile war. Schließlich war keine Gefahr im Verzuge, die Leiche würde schon nicht davonlaufen.
Edgar Ahrens, Gregors Assistent, hielt bereits nach ihnen Ausschau, als sie am späten Nachmittag am Dennewitzplatz ankamen. Er stand vor einem Tätowieratelier und wirkte erleichtert bei ihrem Anblick.
Gregor parkte den Wagen und drehte sich zu Diana um. »Ich bitte Edgar, dich und Lissi nach Hause zu fahren«, sagte er.
»Keine Umstände. Wir kommen mit rein.«
»Das ist nichts für dich. Und für ein kleines Kind schon gar nicht.«
»Lissi schläft. Ich nehme sie auf den Arm und bin ganz still.«
»Also schön, meinetwegen kannst du mit in den Laden, aber vom Tatort hältst du dich fern, verstanden?«
Diana nickte. Jeder, der sie kannte, wusste, dass das keineswegs bedeutete, dass sie sich seinen Wünschen fügen würde. Gregor gab sich dennoch damit zufrieden.
Sie stiegen aus. Lissi wurde nicht wach, als ihre Mutter sie auf den Arm nahm. Die Aufregungen des Tages hatten offensichtlich ihre Kräfte verbraucht.
Edgar begrüßte sie und brachte Gregor auf den neuesten Stand. »Simon und Oliver sind schon weg. Oliver sagt, der Tod dürfte gestern Nacht eingetreten sein, nach sieben, aber deutlich vor Mitternacht. Er untersucht die Leiche, sobald sie in der Gerichtsmedizin eintrifft. Simon hat nicht viel Verwertbares gefunden. Ein paar Fasern, die vermutlich vom Toten stammen.«
»Wer ist es?«
»Ein gewisser Rasmus Gehler. Ist anscheinend den Kollegen vom Rauschgiftdezernat bekannt.«
»Ein Rauschgifthändler?«
»Mhm.«
»Wer hat ihn gefunden?«
»Eine Prostituierte, Lina Buchholz. Du kannst sie befragen, sie wartet im Dienstwagen.«
»Erst sehe ich mir den Tatort an.«
Während dieses Wortwechsels hatten sie den Laden betreten. Hendrik sah sich neugierig um. An der Wand hing ein Plakat: Wer untätowiert ist, ist nackt. Schämst du dich nicht, nackt herumzulaufen? Darunter wurde damit geworben, dass der Eigentümer des Geschäfts zwanzig Jahre Berufserfahrung besitze und giftfrei, schmerzlos, an allen Körperstellen und zu zivilen Preisen arbeite. Damen bekämen eine Spezialbehandlung, was immer das bedeutete. Meine Tätowierungen dauern über den Tod hinaus, hieß es. Und: Referenzen aus allen Hafenstädten. Daneben hing ein Preisliste: Ein kleiner Anker kostete eine Mark fünfzig, ein großer zwei Mark, ein Drache über den gesamten Rücken fünfundzwanzig.
Auf einem Regal standen Fläschchen mit Ausziehtusche, ein aufgeschlagenes Tuch enthielt eine Sammlung Tätowiernadeln. Auch ein Grammophon war vorhanden, anscheinend verrichtete der Besitzer des Ladens seine Arbeit gern bei Musik. Ein Stapel Geschäftskarten warb mit dem garantierten Entfernen von Tätowierungen ohne Stechen und Schneiden. Prunkstück des Raumes war jedoch die elektrische Tätowiermaschine, von O’Reilly, wie ein Aufdruck verriet. Hendrik hätte sie zu gern eingeschaltet, nur um zu hören, welches Geräusch sie verursachte.
Diana beugte sich über einen Tisch, auf dem, wie Hendrik jetzt sah, ein Musterbuch mit Abbildungen bereitlag. Fotos, Radierungen und die Reproduktion von Kupferstichen gab es da, die Motive reichten vom größten Kitsch – von einem Pfeil durchbohrte Herzen, Segelschiffe, unbekleidete Frauenfiguren, Jesus am Kreuz, ein Mädchen am Marterpfahl und Sprüche wie Gott mit uns – bis zu komplexen Arabesken und Nachbildungen berühmter Gemälde wie Leonardo da Vincis Abendmahl.
»Was ist mit dem Besitzer des Ladens?«, erkundigte sich Gregor.
»Hält sich derzeit in Hamburg auf. Sein Hinterzimmer hat er dauerhaft an den Toten vermietet. Dass er nicht wusste, welche Geschäfte dort getätigt wurden, ist kaum anzunehmen.«
Edgar ging voran, Gregor und Hendrik folgten ihm durch eine schmale Tür in einen muffigen Raum, in dem noch immer die Leiche lag. Vermutlich war sie noch nicht abtransportiert worden, damit sich Gregor ein Bild von der Tat machen konnte.
Rasmus Gehler war mit Stricken an ein Heizungsrohr gefesselt, sein Gesicht zu einer Fratze verzerrt. Niemand hatte sich die Mühe gemacht, seine Augen zu schließen, weshalb er die Eintretenden anzustarren schien. Gregor hockte sich vor ihn hin und suchte mit seinem Blick jeden Zentimeter der Leiche und der Umgebung des Tatorts ab. Sah zur Decke, wo eine nackte Birne brannte, zu den fensterlosen Wänden, schließlich zur Tür. Horchte und drehte sich dann zum Waschbecken in der Ecke um, über dem ein Wasserhahn vor sich hintropfte. Ein guter Kriminalist arbeitet nicht mehr als nötig mit den Händen, sondern vor allem mit dem Kopf, war seine Devise.
»Keine Spur eines gewaltsamen Eindringens«, sagte Edgar. »Er muss seinen Mörder selbst eingelassen haben.«
Hendrik versuchte, dem Blick seines Bruders zu folgen. Den tropfenden Wasserhahn hatte er auch schon bemerkt, und natürlich waren ihm die protzigen Ringe an den Fingern des Toten nicht entgangen. Auch nicht die Tätowierung auf seinem Oberarm, ein brennendes Herz mit der Aufschrift Ewige Treue. Die rauesten Burschen hatten oft eine Schwäche für Sentimentalitäten.
Gregor erhob sich und fing an, den Raum zu untersuchen. In einer Schublade des Schreibtisches fanden sich ein Papiertütchen mit fünf losen Zigaretten der Marke Greiling Auslese mit Goldmundstück, ein Wohnungsschlüssel und ein halbes Dutzend Briefe. Gregor studierte die Anschrift. »An seine Privatadresse gerichtet«, sagte er. »Kirchbachstraße, gleich um die Ecke.« Er nahm den Wohnungsschlüssel an sich und dachte nach. »Hast du schon die Nachbarn befragt?«, wollte er von Edgar wissen.
»Maulfaule Bande. Keiner will etwas gesehen oder gehört haben.«
Das überraschte Hendrik nicht. Die Gegend war verrufen und Polizei nicht gern gesehen.
»Also gut. Widmen wir uns der Dame, die den Toten entdeckt hat.«
»Ich hole sie«, sagte Edgar und traf Anstalten, sich nach draußen zu entfernen.
Hendrik bemerkte, wie sich die Tür bewegte, als würde sich jemand hastig zurückziehen. Offenbar hatte Diana hereingespäht. Das war nicht anders zu erwarten gewesen.
Gregor hatte es auch bemerkt, sagte aber nichts.
Schweigend warteten sie darauf, dass Edgar mit Lina Buchholz zurückkam, und lauschten dabei dem Tropfen des Wasserhahns.
2
Solange sie still war, merkte man Lina Buchholz ihre Profession nicht an. Sie war dezent und keineswegs aufreizend gekleidet und, abgesehen von ihren Lippen, nicht geschminkt. Wenn sie jedoch sprach, lag sie mit dem Eindruck, den sie zu vermitteln suchte, immer eine Spur daneben, ob sie sich nun betroffen zeigte oder sich bemühte, ihrer Stimme einen verführerischen Unterton zu geben. Wie ein solides, aber schlecht gestimmtes Instrument, dachte Hendrik. Alles an ihr war auf Wirkung bedacht, nur wenn sie das Bild, das sie von sich zu entwerfen versuchte, für einen Moment vergaß, schimmerte ein natürlicher Tonfall durch.
Gregor hatte sie im Tätowierladen erwartet, um Edgar Gelegenheit zu geben, Rasmus Gehler im Hinterzimmer von seinen Fesseln zu befreien und diese für die spätere Untersuchung einzupacken. Außerdem sollte er dafür sorgen, dass die Leiche abgeholt und in die Gerichtsmedizin gebracht wurde.
»Setzen Sie sich.« Gregor deutete auf einen Stuhl.
Gehorsam nahm Frau Buchholz Platz und blickte sehnsüchtig auf den Aschenbecher auf dem Tisch, der überquoll vor Kippen. Das Warten hatte sie nervös gemacht. Sie versuchte, es sich nicht anmerken zu lassen, aber ihre Augen wanderten unstet umher, und ihre Finger konnten nicht stillhalten.
»Sie haben den Toten entdeckt und die Polizei gerufen?«
»Ja.«
»Wann?«
»Heute früh, kurz vor elf.«
»Was wollten Sie von Herrn Gehler?«
»Wir waren, na ja, ein Paar. Mehr oder weniger.«
»War er Ihr Zuhälter?«
Sie zuckte die Achseln. »Wie immer Sie es nennen wollen.«
»Seit wann waren Sie zusammen?«
»Seit gut ’nem Jahr.«
»Wann haben Sie ihn zuletzt lebend gesehen?«
»Gestern Abend. Gegen sieben. Das hab’ ich alles schon Ihrem Kollegen erzählt.« Wieder sah sie zum Aschenbecher hinüber und leckte sich über die Lippen.
»Wie war das, als Sie ihn fanden?«
»Er … Er lag so da wie jetzt, die Augen aufgerissen und alles. Schrecklich«, sagte sie und senkte fromm die Lider.
Es wirkte aufgesetzt. Ließ der Tod ihres Liebhabers sie kalt? Möglich, aber Hendrik war eher geneigt anzunehmen, dass sie sich so theatralisch benahm, weil sie glaubte, dass es sich so gehörte.
»Ist Ihnen etwas aufgefallen, als Sie kamen? Eine Tür, die offen stand? Ein Hinweis auf den Täter, irgendwas?«
»Nein.«
»Haben Sie etwas verändert?«
»Ich bin sofort raus und hab’ die Polizei gerufen, das könn’ Se glauben.« Ihre Hände beschäftigten sich mit dem Aschenbecher, drehten ihn hin und her.
»Und wo waren Sie gestern Abend zwischen sieben und Mitternacht?«
»Wo soll ich schon gewesen sein? Arbeiten.«
»Zeugen?«
»Die Herren stellen sich mir in der Regel nicht vor.« Sie ließ den Aschenbecher wieder los, nicht ohne einen weiteren sehnsüchtigen Blick auf die Kippen.
»Wussten Sie, dass Herr Gehler mit Rauschgift handelt?«
Die Prostituierte zögerte, das allein verriet sie bereits. Sie schien es selbst zu merken, deshalb nickte sie schließlich.
»Mit was?«
»Morphium, Kokain, Heroin. Was immer er kriegen konnte.« Sie öffnete den Mund, um etwas hinzuzufügen, schloss ihn wieder und sprach dann doch aus, was ihr durch den Kopf ging: »Er hat das Zeug selbst nie angerührt, das könn’ Se glauben.«
»Sie meinen, die Einstiche stammen von jemand anderem? Jemand, der wollte, dass er durch eine Überdosis starb?«
»Er hat Süchtige verachtet.«
»Also eine Art Rache?«
Sie zuckte die Achseln.
»Haben Sie jemanden in Verdacht?«
»Ich weiß nich’. Nein, eigentlich nich’.«
»Wissen Sie, wen er gestern Abend erwartet hat? Er hat doch jemanden erwartet?«
»Kunden, halt.«
»Namen?«
»Kenne ich nich’. Bloß einen.«
»Warum gerade den?«
»Weil Rasmus sich oft über ihn lustig gemacht hat. Zahnloser Tiger, hat er ihn genannt. Trat immer auf wie ein Mann von Welt, dabei ließ er sich Koks unterschieben, das zur Hälfte aus Zucker bestand. Hat Rasmus jedenfalls behauptet.« Auf Gregors auffordernden Blick fuhr sie fort: »Er heißt Zacharias Doehring. Der Sohn von irgend so einem Bankmenschen.«
»Und den hat Herr Gehler gestern Abend erwartet?«
»Unter anderem, ja.« Die Prostituierte schnaubte verächtlich. »Was wollen solche Leute, die alles haben, hier bei uns? Gibt ihnen das irgendeinen Kitzel, damit sie später, wenn sie sich in ihre behaglichen Viertel zurückziehen, vor ihren Freunden damit prahlen können, dass sie in der Unterwelt waren?«
Zum ersten Mal wirkte Lina Buchholz authentisch. Ihre Empörung jedenfalls war echt. Jetzt hielt sie es doch nicht länger aus, kramte in ihrer Handtasche, holte ein Zigarettenetui hervor und entnahm ihm eine Zigarette.
»Bitte nicht«, sagte Gregor.
Lina Buchholz fluchte, steckte das Etui wieder ein und legte die Zigarette auf den Tisch, ohne sie angezündet zu haben.
»Woher kannte Herr Gehler den Namen des Kunden?«
»Er kannte die Namen von all seinen Kunden. Er wollte immer erst ’n Ausweis sehen, bevor er sich auf was einließ, das könn’ Se glauben. Und man brauchte ’ne Empfehlung. Bei so was war er vorsichtig. Er wollte nich’ auf ’n Lockvogel der Polizei reinfallen.«
»Hat Herr Gehler allein gearbeitet?«
Wieder zögerte die Prostituierte.
»Wir bekommen es sowieso heraus«, hakte Gregor nach. »Sie ersparen uns Zeit und sich Ärger, wenn Sie sagen, was Sie wissen.«
»Uwe hat manchmal geholfen, wenn ’ne Lieferung kam«, gab sie zu. »Uwe Rademacher.«
»Was macht dieser Rademacher hauptberuflich?«
»Keine Ahnung. Ich … kenne ihn kaum.«
Das war gelogen, so viel konnte selbst Hendrik erkennen, auch wenn er nicht über die Erfahrung seines Bruders verfügte.
»Wie war das Verhältnis der beiden zueinander?«
»Ich versteh’ nich’, was Sie meinen.«
»Kamen sie gut miteinander aus? Gab es Rivalitäten?«
Lina Buchholz zuckte die Achseln. Sie bereute offensichtlich, Rademacher überhaupt erwähnt zu haben. »Nich’ dass ich wüsste. Geschäft ist Geschäft, oder?«
Gregor wechselte das Thema. »Sie haben also sofort die Polizei gerufen, als Sie die Leiche entdeckten.«
»Ja.«
»Wirklich sofort?«
»Klar.« Zum wiederholten Mal streifte ihr Blick die beiseite gelegte Zigarette.
Gregor schien ein Einsehen zu haben. »Von mir aus stecken Sie sich eine an.«
Hastig griff Frau Buchholz nach der Zigarette und ließ sich von Gregor Feuer geben. Ihre Finger zitterten, ob vor Gier oder wegen der Anspannung, vermochte Hendrik nicht zu entscheiden.
Gregor zog den Aschenbecher mit den Kippen heran, schob ihn der Prostituierten hin und sah sie erwartungsvoll an.
Sein Blick irritierte sie. Sie verstand nicht, was er von ihr wollte, ebenso wenig wie Hendrik.
»Dreizehn Kippen«, sagte Gregor. »Sie sind sicher, dass Sie die Polizei umgehend angerufen haben?«
»Natürlich. Die hier sind sicher von Rasmus.«
»Er hat Greiling Auslese geraucht. Vier Kippen. Der Rest ist Manoli Privat, ohne Mundstück. Ihre Marke.«
»Ich, ähm, hab’ geraucht, während ich auf Sie gewartet hab’.«
»Und warum haben Sie dann behauptet, die Kippen stammen von Ihrem Lebensgefährten?«
Auch ihr musste klar sein, dass sie bei einer Lüge ertappt worden war. Und indem Gregor schwieg und sie nur abwartend beobachtete, erhöhte er den Druck auf sie. Nur wenige Menschen hielten es aus, auf einen Schlag zu warten, der unweigerlich kommen musste, die meisten zogen es vor, etwas zu sagen, und redeten sich dabei um Kopf und Kragen. Lina Buchholz gehörte nicht dazu. Sie besaß vermutlich Erfahrung im Umgang mit der Polizei, jedenfalls saugte sie nur heftig an ihrer Zigarette und schwieg.
Gregor nickte. »Wie Sie wollen. Sie können jetzt mit meinem Assistenten ins Präsidium fahren und dort Ihre Aussage zu Protokoll geben. Vielleicht fällt Ihnen ja in der Zwischenzeit wieder ein, was wirklich geschehen ist, als Sie die Leiche fanden.«
3
Es dämmerte bereits, als sie den Tätowierladen verließen. Hendrik verabschiedete sich, weil er mit Josephine verabredet war. Diana sah ihm nach. Die beiden waren seit letztem Jahr wieder ein Paar. Sie empfand noch immer keine große Sympathie für Hendriks Flamme, was im Übrigen auf Gegenseitigkeit beruhte. Aber sie musste zugeben, dass Josephine eine außergewöhnliche Frau war und Hendrik gut tat.
»Wir sehen uns nur schnell Rasmus Gehlers Wohnung an, dann fahren wir nach Hause«, sagte Gregor. »Es war ein anstrengender Tag.«
Diana nickte. Kurz überlegte sie, ob sie im Wagen auf ihn warten sollte, denn Lissi wurde ihr allmählich zu schwer. Schließlich folgte sie doch ihrem Mann in die Kirchbachstraße, weil sie sehen wollte, wie der Tote gelebt hatte.
Die Wohnung von Rasmus Gehler befand sich im ersten Stock. Gregor probierte den mitgenommenen Schlüssel; er passte. Sie traten ein.
Durch die Küche, in der ein rostiges Fahrrad am Herd lehnte, am Klosett vorbei gelangte man in den Wohnraum. In einer Ecke des Zimmers befand sich ein Kachelofen, daneben standen das Bett und ein Nachttisch. Außerdem gab es einen Schrank, ein ramponiertes Sofa, einen Sekretär und einen Tisch mit drei Stühlen. Mehr Möbel hätten auch nicht hineingepasst.
Dem Ofen gegenüber stapelten sich zwei Dutzend Kacheln. Ein Hammer, Meißel und weiteres Werkzeug lagen herum, außerdem stand dort ein Besen, der anscheinend selten benutzt wurde. In der dritten Ecke befanden sich ein Autoreifen und zwei Hanteln. Kleidung war achtlos über Stühle und Sofalehnen und sogar auf den Boden geworfen. Es roch nach Schweiß und alten Socken.
Einige Gegenstände verrieten, dass es Rasmus Gehler nicht an Geld gemangelt hatte. Das nagelneue Telefon, zum Beispiel, oder die leeren Whiskyflaschen auf dem Tisch. Dort lagen auch einige ungelenke Zeichnungen herum, die aussahen, als könnten sie Vorlagen für Tätowierungen abgeben.
Gregor durchsuchte den Raum schnell und methodisch. Der Schrank enthielt einen Koffer, Bettzeug, Unterwäsche, einen Anzug, drei Hüte, Handtücher, ein Mückennetz, zwei Decken, eine leere Metallschachtel und einen ausgestopften Marder, der den Eindruck erweckte, als ob er Flöhe oder anderes Ungeziefer beherbergte. Rasmus Gehler war offenbar kein ordentlicher Mensch gewesen. Alles war mit irgendwelchem Zeug vollgestopft, überall gab es leere Zigarettenschachteln, Dosen, Schreibutensilien, lediglich eine Schublade des Sekretärs war leer.
Diana beobachtete ihren Mann. Zum ersten Mal sah sie ihn bei der Arbeit, seit er im vergangenen Jahr im Fall Bartels das Gesetz in die eigenen Hände genommen hatte, und sie war froh, dass er noch genau so engagiert war wie früher. Wenn möglich verhielt er sich noch korrekter als sonst und bemühte sich, nichts in Unordnung zu bringen, obwohl es den Toten kaum stören würde.
Manchmal – nicht oft, aber gelegentlich – bekam Gregor Zweifel, ob das, was er tat, richtig war. Er käme sich wie ein Hochstapler vor, der für Recht und Gesetz eintritt, obwohl er es selbst gebrochen hat, sagte er dann. »Unterscheiden wir uns wirklich so sehr von denen, die wir einsperren?« Er hatte keine Gewissensbisse wegen des Mannes, den er ins Gefängnis gebracht hatte, der hatte es verdient. Aber seine Methoden waren nicht sauber gewesen, und für jemanden mit so strengen Prinzipien wie ihn, für den das Gesetz ein unantastbares Ideal darstellte, machte das den entscheidenden Unterschied aus.
Gregor hatte eine Zuckerdose geöffnet, leckte den kleinen Finger seiner rechten Hand an, tauchte ihn hinein, zog ihn wieder heraus und kostete, was daran klebte, mit der Zungenspitze. Es schien wirklich nur Zucker zu sein. »Er hat das Zeug nicht mal selbst angerührt«, murmelte er, während er weitersuchte. »Was bringt solche Dreckskerle dazu, anderen das Leben zur Hölle zu machen?«
Er sprach aus eigener Erfahrung, wie Diana wusste. Viele Soldaten waren im Krieg mit Morphium in Berührung gekommen und zeit ihres Lebens nicht mehr davon losgekommen. Gregor schon. Aber was es ihn gekostet hatte, konnte sie nur ahnen.
Lissi fing an, sich zu bewegen. Jeden Augenblick würde sie aufwachen. Diana wiegte sie auf ihrem Arm hin und her. Hoffentlich war die Durchsuchung bald beendet.