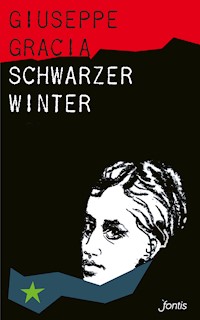
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fontis AG
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Seit ihrer gemeinsamen Jugend ist Sala in Julia verliebt. Er würde alles für sie tun, doch Julia kämpft für den Klimaschutz und gerät in den Sog einer radikalen Gruppe. Sie wird zur international gesuchten Terroristin und plant, von der Polizei in die Enge getrieben, einen letzten großen Schlag gegen "das System", der sie und ihre Mitstreiter alles kosten könnte. Wird es Sala gelingen, Julias Leben zu retten? Hat die Liebe eine Chance in Zeiten des Terrors? Ein politischer Thriller zwischen Hoffnung und Klima- Apokalypse, Freundschaft und Verrat, Revolution und Liebe. So packend wie scharfsinnig, so radikal wie romantisch.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 281
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Giuseppe Gracia Schwarzer Winter
www.fontis-verlag.com
Giuseppe Gracia
Schwarzer Winter
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
Der Fontis-Verlag wird von 2021 bis 2024 vom Schweizer Bundesamt für Kultur unterstützt.
© 2023 by Fontis-Verlag Basel
Bibelstelle (1. Korinther 13): Einheitsübersetzung der Heiligen Schrift © 2016 Katholische Bibelanstalt GmbH, Stuttgart Umschlag: Antje Gracia Satz: Samuel Ryba – Design Ryba E-Book-Herstellung: Textwerkstatt Stefan Jäger
ISBN (EPUB) 978-3-03848-704-3
«Und wenn ich prophetisch reden könnte und alle Geheimnisse wüsste und alle Erkenntnis hätte; wenn ich alle Glaubenskraft besäße und Berge damit versetzen könnte, hätte aber die Liebe nicht, wäre ich nichts. Und wenn ich meine ganze Habe verschenkte und wenn ich meinen Leib opferte, um mich zu rühmen, hätte aber die Liebe nicht, nützte es mir nichts.»
1. Korinther 13
1
Zuerst ist es, als würde sie nur zuschauen, als würde sie neben sich selber im Auto sitzen, stumm, abgetrennt von den anderen. Erst als sie die Kalaschnikow in die Hände nimmt – die Kühle des Griffs, der Geruch nach Schmierfett –, bricht es durch: das warme, unangenehme Fiebergefühl. Und das Zittern.
Das ist wirklich, denkt sie. Ich tue es wirklich.
Betroffen vom Zittern sind vor allem die Hände, auf die sie nicht achten will. Die Hände, die ruhig bleiben sollen, weil es keinen Grund für die Anspannung gibt, weil sie mit den anderen trainiert hat und vorbereitet ist.
Doch das Zittern bleibt, wandert hinab in die Beine.
Auf dem Beifahrersitz dreht sich Julia zum Fenster und blickt nach draußen, um sich abzulenken. Blickt in die dunkelblaue Dämmerung über dem Stoppelfeld, an dem sie entlangfahren.
In der Ferne taucht ein Hochspannungsmast auf, mit den dünnen, schwarz in den Himmel gezeichneten Zweier- und Dreierlinien der Stromleitungen.
«Fünf Minuten», sagt Popeye.
Das ist nicht sein richtiger Name, sondern ein Deckname, wie sie hier alle einen verwenden. Alle außer Julia, weil es bei ihr keinen Sinn macht, weil jeder ihren Namen – Julia Schwarz – aus der Zeitung kennt, aus dem Fernsehen.
Ob Popeye das Zittern bemerkt? Chris, Marge? Sie haben das T2 eingenommen und wirken konzentriert. Marge stiert mit großen glänzenden Augen auf den Schirm ihres Smartphones.
Haben sie Angst? Das T2 putscht auf und bringt einen in Fahrt, doch die Angst kann trotzdem kommen, durch die Ritzen der Entschlossenheit.
Immer wieder hat Popeye Julia das T2 angeboten – ausgerechnet er, der es bestimmt nicht braucht. Popeye ist der Letzte in der Gruppe, der das Zeug braucht.
Noch drei Minuten.
Alles okay, sagt sich Julia.
Zugleich hat sie das Gefühl, dass es ein Fehler gewesen ist, die Sache zu planen, dass der Plan zu viele Löcher hat. Dass sie spätestens beim Schlachthaus Probleme bekommen werden. Dass jemand erschossen wird.
Julia hält ihre Kalaschnikow fest.
Zwei Minuten.
Chris, bisher still am Steuer, räuspert sich.
Julia muss an ihren Vater denken, an jenen Nachmittag, als er sie mit dem Auto vom Bahnhof abgeholt hat. Wie viele Jahre ist es her? Zehn? Zwölf?
Damals muss sie um die vierzehn gewesen sein. Sie erinnert sich, wie überrascht sie war, den Vater auf dem Bahnsteig zu sehen, weil er sie noch nie vorher abgeholt hatte. Weil es ihn noch nie interessiert hatte, wann sie von einem Schulausflug zurückkehrte.
Sie erinnert sich an sein ernstes Gesicht beim Verlassen des Bahnhofs. Sie erinnert sich an das Schweigen, als sie zum Wagen gingen und der Vater sich ans Steuer setzte, um sie durch den Verkehr zu lenken.
Und dann sagte er leise: «Es tut mir – leid.»
Julia verstand nicht. Was war los?
«Deine Mutter», sagte der Vater.
Er blickte durch die Windschutzscheibe nach draußen in den Verkehr. «Sie liegt im Krankenhaus, wir fahren hin.»
«Im Krankenhaus?»
«Sie hat versucht, sich das Leben zu nehmen.»
Natürlich hatte Julias Vater noch mehr gesagt. Er hatte sich Mühe gegeben, seiner Tochter die Lage zu erklären – doch Julia erinnert sich an kein einziges Wort. Sie erinnert sich nur an den Klang der Stimme. Dass es eine fremde Stimme war. – Warum sie ausgerechnet jetzt daran denken muss?
Noch eine Minute.
Das Smartphone von Marge: Jetzt leuchtet der Bildschirm auf. Ein Anruf – Klingelton stummgeschaltet.
Marge nimmt den Anruf entgegen, hört einige Sekunden zu und schaltet das Gerät aus.
Gute Nachrichten: Die anderen sind unterwegs, keine Zwischenfälle. Sie werden wie geplant beim Osttor vor dem Schlachthof warten.
Marge schickt ein Lächeln in die Runde, doch Julia fällt auf, dass die Hand, mit der sie das Smartphone hält, leicht zittert.
«Es ist so weit», sagt Popeye.
Ja, man kann jetzt die Anhöhe sehen. Es ist nicht mehr weit bis nach Fischertal, der Siedlung im Berner Oberland, ihrem Ziel.
Nun muss es schnell gehen. Julia hat den Text eingeübt, die Notizen stecken in ihrer Jackentasche.
Den ersten Teil des Videos haben sie im Warenlager in Oerlikon gedreht. Es war klar, dass Julia auftreten würde, wegen ihrer Erfahrung beim Schweizer Fernsehen, weil sie weiß, wie man sich in Szene setzt, wie man die Stimme moduliert, die Hände ruhig hält, in die Kamera blickt.
Popeye ist bereits aus dem Wagen gesprungen.
Julia folgt ihm und bezieht neben dem Ortsschild «Fischertal» Stellung – so, dass im Hintergrund die ersten Häuser der Siedlung zu erkennen sind.
Popeye richtet das Smartphone auf Julia.
«Etwas nach links», sagt er.
Julia gehorcht.
Sie wirft einen letzten Blick auf den Zettel und steckt ihn weg, bevor Popeye zu filmen beginnt. Sie blickt in die Kamera.
«Direkt hinter mir befindet sich das Dorf Fischertal», sagt sie. «Hier wohnt der Vizedirektor der Schweizer Nationalbank, Thomas Bächler. Hier steht sein schönes Haus. Das Haus, das Thomas Bächler mit dem Blutgeld seiner Bank bezahlt hat. Das Haus, das wir gleich aufsuchen und aus dem wir den Vizedirektor rausholen werden. Wir holen uns Thomas Bächler und nehmen ihn mit.»
Bei dieser Passage – nehmen ihn mit – scheint Popeye hinter dem Smartphone zu grinsen, als müsse er sich ein Lachen verkneifen.
«Ihr wisst, warum wir das tun», spricht Julia weiter. «Ihr wisst, dass die Nationalbank blind und taub ist für die Folgen des Klimawandels. Blind für die Konzern-Plutokratie, die uns zu Sklaven macht. Blind für den Zombie-Kapitalismus, den wir Demokratie nennen und der unsere Welt aussaugt. Taub für die Schreie der Natur, der Obdachlosen und Schwachen, die wir hungern, ertrinken, verschwinden lassen unter den Fluten und Tornados, unter den Hitzewellen der Maschinen des Westens mitsamt ihren gekauften Diktaturen.»
Julia legt eine Kunstpause ein. Sie blickt ernst in die Kamera, dann fährt sie fort.
«Immer wieder haben wir es gesagt, immer wieder haben wir gewarnt. Wir haben gekämpft mit euch und für euch. Wir führen seit Jahren den Krieg, der unvermeidbar geworden ist. Weil man eure Stimme sonst niemals ernst nehmen wird, eure Zukunft, die Zukunft eurer Kinder. Weil wir keine Macht haben. Die Milliardeninvestitionen in die fossile Industrie gehen weiter. Die schmutzigen Geldanlagen und Großinvestitionen laufen gut geölt. Ihr wisst es, wir wissen es. Aber heute – 2023 – unterbrechen wir den Kreislauf! Heute bringen wir sie zum Schwitzen. Kommt und seht!»
Popeye hört auf zu filmen. Er beugt sich über das Smartphone und betrachtet einen Ausschnitt des Videos, viel Zeit haben sie nicht. Er scheint mit dem Take zufrieden.
Sie gehen zurück zum Wagen.
Als Chris losfährt, lehnt Julia sich im Beifahrersitz zurück. Für einen Moment schließt sie die Augen.
Bum-bum.
Das Herz. Es klopft schneller, aber dafür ist das Zittern weg.
Sie erreichen den Dorfkern von Fischertal, fahren langsam über den Dorfplatz. Neben einem kleinen Friedhof erkennt Julia den Spitzturm einer Kirche und später, nach dem Postgebäude, einen dunkelgrauen, birnenförmigen Steinbrunnen, einsam, verlassen.
Sie rollen durch das Dämmerlicht des Morgens, das Julia vorkommt wie Abendlicht, als würde die Sonne nicht auf-, sondern untergehen.
Da ist es! Das Haus von Vizedirektor Bächler. Genau wie auf Google Maps angezeigt, steht es am Ende der Berggasse, direkt neben einer kleinen Gruppe von Birken.
An diesem Morgen ist die Frau des Vizedirektors rund 160 Kilometer entfernt in Genf. Aufgrund ihres Engagements für eine Kunstgalerie verbringt sie zwei Tage pro Woche in der französischen Schweiz.
Das ist einer der Gründe, warum die Kidnapper heute kommen, auch wenn sie natürlich nicht ganz sicher sein können, ob Bächlers Frau nicht ausgerechnet diese Woche eine Ausnahme macht und zu Hause bleibt.
Wenn die Gattin in Genf ist, sieht der Zeitplan des Vizedirektors so aus, dass er normalerweise gegen acht Uhr das Haus verlässt, um die 5-jährige Tochter zu Fuß in den nahegelegenen Kindergarten zu bringen, bevor er vom Chauffeur abgeholt wird, der ihn zur Nationalbank nach Bern fährt, meistens gegen 8.30 Uhr.
Es ist jetzt kurz nach sieben Uhr. Der Vizedirektor steht – grauer Anzug, blaue Krawatte – in der Küche. Er blickt zum Küchentisch, an dem seine Tochter sitzt.
«Komm, Schatz, trink aus», sagt er. «Du musst noch die Zähne putzen, bevor wir gehen.»
Zufrieden – und wie immer langsam – nippt die Kleine an der Tasse mit der warmen Schokolade.
Bächler checkt mit dem Smartphone seine Mails und teilt dem Chauffeur per SMS mit, dass er um 8.20 Uhr mit dem Wagen bereitstehen soll.
«Schatz», sagt er. «Mach schneller.»
Scheinbar unbehelligt nippt die Tochter weiter.
«Schatz –», versucht es Bächler erneut.
Weiter kommt er nicht, denn plötzlich ertönt Krach! – aus Richtung der Haustür? Es klingt wie ein Rütteln, ein Poltern.
In diesen Minuten ist Team Nummer zwei in einer Gegend namens Laufingen eingetroffen, wo sich der Zentralschlachthof befindet.
Blacky und Rouge – ebenfalls Decknamen – sind junge, bärtige Männer aus dem Raum Zürich. In der Gruppe gehören sie eher zu den Stillen, reden nicht viel und erledigen alles, was man ihnen aufträgt, ohne groß nachzufragen.
Nun steigen sie aus dem VW Polo, den sie gestern in einem Kaff im Berner Oberland gestohlen haben, und beziehen vor dem Osttor des Zentralschlachthofs Stellung.
Inzwischen haben Chris, Popeye und Julia den hydraulisch betriebenen Spreizer aus dem Wagen geholt und aktiviert. Eine Maschine, wie sie auch von der Feuerwehr eingesetzt wird, um Türen aufzubrechen.
Das Gedröhne und Geknatter ist so laut, dass Julia im ersten Moment zusammenzuckt.
Die Eingangstür von Bächlers Haus zittert, während Popeye mit weit aufgerissenen Augen auf die Türe starrt, als würde das dabei helfen, den Druck auf sie zu erhöhen.
Der Spreizer ist viel lauter als erwartet. Sie haben damit gerechnet – einem Kumpel aus der Feuerwehr vertrauend –, dass die Türe ohne großes Gedröhne sofort nachgeben würde. Doch es dauert.
Risse erscheinen im Holz, das Schloss fröstelt, schlottert. Unendlich lange, wie Julia meint.
Bis die Tür endlich nachgibt.
Die verdammte Maschine, nun können sie sie abstellen. Und dann schaffen sie es ins Haus: zuerst Popeye mit vorgehaltener Maschinenpistole, dann Chris, dann Julia. Wie geplant wartet Marge im Auto mit laufendem Motor.
Als Julia den Korridor in Bächlers Haus entlanggeht, fühlt sie zuerst den Widerstand ihrer Beine, als wären sie blockiert, als würde sie jeder Schritt unendlich viel Kraft kosten.
Popeye und Chris verschwinden im Zimmer weiter vorne, Julia kann sie nicht mehr sehen. Schnell! Sie geht weiter durch den Korridor bis zur Treppe, die hinauf in den nächsten Stock führt.
Am Treppenabsatz hört sie einen Schrei und blickt nach oben, wo ein Mädchen steht.
«Papa!»
Natürlich, sie will zu Papa. Die Kleine ist wahrscheinlich nach oben gegangen, in ihr Zimmer, um ihre Kindergarten-Sachen zu holen. Dann hat sie Geräusche gehört, von unten, aus dem Raum am Ende des Korridors, aus der Küche. Ja, Julia erinnert sich an den Bauplan des Hauses. Der Raum gegenüber dem Treppenaufgang ist die Küche, und dort sind Chris und Popeye wohl gerade dabei, Bächler zu fesseln.
Julia nimmt die Stufen, nähert sich dem Mädchen, kann die Augen sehen, die stumm auf sie gerichtet sind, die Blässe des Kindergesichts, die Reglosigkeit des kleinen Körpers.
«Geh in dein Zimmer», sagt Julia.
Sie gibt sich Mühe, ruhig zu klingen, freundlich.
Das Mädchen weicht ihrem Blick aus, schaut zu Boden. Vielleicht kommt ihr der Gedanke, dass das alles bloß ein Traum ist, aus dem sie gleich erwacht? Warum nicht? Das alles sollte nur ein Traum sein, ein böser Traum.
«Bitte», sagt Julia. «Wo ist dein Zimmer?»
Immer noch zu Boden blickend, ruft die Kleine erneut nach Papa, und diesmal hallt unter ihnen – aus der Küche – ihr Name zurück.
«Sophie!»
Thomas Bächlers Stimme, wie ein Schmerzensschrei. Dann herunterfallende Teller, Tassen, Besteck.
Die Kleine will wegrennen, Julia hält sie am Arm fest.
«Wo ist dein Zimmer?»
Das Mädchen macht die Augen zu, windet sich.
«Bald ist es vorbei, bald kommt deine Mama.»
Aber während Julia das sagt, muss sie wieder an damals denken und kann die Stimme ihres Vaters hören: Deine Mutter – Krankenhaus.
Julia schiebt die Erinnerung weg.
Sie kann das Zimmer sehen, gegenüber der Treppe links. Ja, die Tür des Zimmers steht offen.
Julia zerrt die Kleine – das Ärmchen fest im Griff – hinüber.
Sieht aus wie ein Gästezimmer; nur ein Kleiderschrank und ein schmales, nicht bezogenes Bett.
Die Kleine beginnt zu weinen.
2
Die Hände hinter dem Rücken gefesselt, auf dem Mund ein schwarzer Kleber, barfuß, Hemd aufgerissen: So schleppen sie Vizedirektor Bächler aus dem Haus und bringen ihn zum Wagen.
Als sie losfahren und das Dorfzentrum hinter sich lassen, bäumt Bächler sich auf dem Rücksitz auf und gibt Laute von sich: «Mhh!» – «Wuah!»
Popeye schlägt ihm die Hand ins Gesicht.
Bächler wimmert. Und krümmt sich auf dem Rücksitz, ächzt, versucht die Füße hochzuheben.
«Was denn?!», ruft Popeye.
Er reißt dem Vize den Kleber vom Mund.
«Tochter», stöhnt Bächler, «mei-ne Toch-ter.»
Er kann nicht weiterreden, ringt nach Atem.
«Sie ist in Sicherheit», sagt Julia. «Ich habe sie in ein Zimmer gebracht und ihr gesagt, sie soll dort warten.»
Bächler ringt weiter nach Luft.
«Tochter», wiederholt er. «Mutter – Genf!»
«Halt die Klappe!» Popeye droht mit der Maschinenpistole. «Willst du eine Kugel im Schädel, he? Verdammte Kapitalistensau. Bringt die Welt an den Rand des Untergangs, scheißt aufs Klima, scheißt auf Entwicklungsländer und will unser Mitgefühl!»
Der Vizedirektor beugt sich nach vorn. Er würgt und muss sich, beinahe geräuschlos, übergeben. Er verspritzt eine warme, grünliche Suppe auf dem Rücksitz.
Chris und Popeye wenden sich ab.
Julia, vorne auf dem Beifahrersitz, kriegt bei dem Gestank augenblicklich Brechreiz. Sie lässt das Fenster runter.
Eine Weile fahren sie schweigend im Fahrtwind, über die Landstraße in Richtung Autobahn.
«Verdammte Sauerei», flüstert Popeye. Er reißt ein neues Stück Kleber von der Rolle ab.
Der Fahrtwind tut gut. Trotzdem würde Julia am liebsten aussteigen. Nein, damit haben sie nicht gerechnet. Die frische Luft mildert es zwar etwas ab, doch das Erbrochene – dunkelgrün und brockig – stinkt. Die ganze Zeit über stinkt es, auch während sie den dritten Teil ihres Videos vorbereiten. Den Teil, der im Kasten sein muss, bevor sie den Schlachthof erreichen.
Erneut zappelt Bächler und erneut knallt ihm Popeye eine. Dann klebt er ihm den Mund zu.
«Los», sagt Chris.
Marge verlangsamt das Tempo, damit die Schüttelbewegungen nachlassen.
Julia dreht sich auf dem Beifahrersitz um, und Chris filmt mit dem Smartphone. Zuerst richtet er die Kamera auf die gefesselte Geisel, dann auf Julia.
«Wir haben ihn aus seinem Haus geholt. Er hat in der Afrika-Abteilung des Internationalen Währungsfonds gearbeitet. Er war Exekutivdirektor beim IWF. Er machte Deals für die Schweiz, für Aserbaidschan, Kirgistan, Polen, Usbekistan. Vor zwei Jahren ernannte ihn der Bundesrat zum Vizepräsidenten des Direktoriums der Nationalbank.»
Julia macht eine Pause. Sie lächelt in die Kamera.
«Ich versichere euch: Seit Jahren sorgt dieser Mann dafür, dass die Milliardengeschäfte mit Kohle, Öl und Gas weiterlaufen. Thomas Bächler leugnet den Klimawandel. Er ist der Meinung, der Mensch sei nicht schuld daran, die Banken seien nicht schuld daran, die Reichen seien nicht schuld daran, er sei nicht schuld daran.»
Erneut macht Julia eine Pause, diesmal ist es keine einstudierte. – Was für ein Gestank!
Sie braucht ein paar Sekunden, bevor sie fortfahren kann.
«Was ihr ebenfalls wissen müsst: Dieser Mann hat eine Millionärin geheiratet. Der Vater von Bächlers Frau ist der deutsche Multimillionär und Fleischfabrikant Dobermann. Dobermann beliefert McDonald’s und Burger King, betreibt große Schlachthäuser in der Schweiz. Deshalb bringen wir Bächler jetzt nach Laufingen. Dort geben wir ihm dieselbe Medizin, die er seit Jahren den Tieren und der Umwelt zumutet.»
Bei diesem letzten Satz versucht Bächler erneut, sich freizustrampeln.
«Aheer!» – «Huuwm!»
Popeyes Augen gefallen Julia nicht. Das ruhelose, tanzende Licht darin, das typisch für ihn ist; als würde in seinem Kopf ein Flipperkasten aus Gedanken und Impulsen blinken.
In den meisten Schweizer Schlachthöfen werden im Minutentakt Rinder, Schafe und Schweine getötet und in ihre Bestandteile zerlegt.
Manche Anlagen verfügen über Stallungen, in denen die Tiere einige Tage vor der Tötung untergebracht werden. Daran angeschlossen sind Schlachthallen, Kühlräume und Untersuchungsräume. In diesen überwachen Veterinäre das Einhalten der Vorschriften hinsichtlich Hygiene, Betäubung und Korrektheit des Schlachtvorgangs. Direkt unterhalb der Hallen befinden sich Abwasserkläranlagen für Körperflüssigkeiten: Blut, Urin, Magensäfte, Schweiß.
Im Zentralschlachthof Laufingen herrscht ab 5 Uhr morgens in der Regel Hochbetrieb: Es dauert etwa eine Stunde, bis die ersten 250 Schweine betäubt, mit Elektroschocks getötet, ausgeweidet und in zwei Hälften zerlegt worden sind. Zwei Stunden, bis nach dem ersten Durchgang Schweinsköpfe, Borsten und Exkremente im Abfall liegen, umgeben vom dampfenden Blut.
Beim nächsten Durchgang bekommen Rinder und Schafe einen Bolzenschuss ins Hirn, bevor man ihnen die Hauptschlagader aufschneidet.
Die dafür zuständigen Arbeiter stehen in der Schlachtstraße. Das ist ein langgezogener, fensterloser Raum, in dem die Männer bis zur Mittagspause die immer gleichen Handgriffe ausführen, im Gleichtakt, manchmal fast wie im Schlaf.
An diesem besonderen Vormittag werden die Arbeiter gegen 8.30 Uhr von Maschinenpistolensalven überrascht. Es sind Blacky und Rouge. Sie sind durch den Eingang beim Osttor in die Halle eingedrungen und feuern in die Luft.
Ratatata!
Die Kugeln stanzen Löcher in die Hallendecke, und es regnet zerplatzte Neonröhren.
«Achtung!», rufen Blacky und Rouge. «Niemand rührt sich!»
Einer der Arbeiter steht am Eingang zur Schlachtstraße. Neben ihm liegt ein blutendes, keuchendes Rind, im Schädel ein münzgroßes Loch. Der Arbeiter dreht sich zu den Eindringlingen um, in der rechten Hand die Bolzenpistole.
Für einen Moment hebt er die Pistole in Richtung der Fremden, wie um damit zu drohen.
Niemand sonst in der Schlachtstraße wagt es, sich zu rühren. Keiner sagt etwas. Es ist, als würde alles für einen Moment stillstehen.
Schließlich kommt Popeye in die Halle gestürmt. Er stößt, die Augen aufgerissen, einen Schrei aus.
«Hoka-heey!»
Er rennt an seinen Komplizen vorbei nach vorne zur Schlachtstraße, wo der Arbeiter mit der Bolzenpistole steht.
«Hoka-heey!»
Julia kennt das Geschrei. Hat irgendetwas mit Indianern zu tun. Popeye steht auf Indianer.
Der Arbeiter bei der Schlachtstraße wirkt erschrocken. Er starrt den Bewaffneten an, würde es bestimmt nie wagen, sein Bolzengerät gegen ihn einzusetzen, gegen irgendeinen Menschen.
Trotzdem schießt Popeye.
Die Kugel trifft das rechte Bein des Mannes. Er sackt zusammen, geht mit seinem Bolzengerät zu Boden, direkt neben dem blutenden, schnaubenden Rind.
Julia, die mit Chris und dem gefesselten Bächler die Halle ebenfalls betreten hat, kann alles sehen.
Wieder Schüsse, wieder in die Hallendecke – ratatata –, bis Blechsplitter herunterfallen, Plastikteile, Kabelfetzen.
Julia und Chris schleppen die Geisel zum Kontrollpult der Abwasserkläranlage. Blacky und Rouge folgen ihnen. Zögernd, wie es scheint, irritiert.
Natürlich, denkt Julia. Niemand hat etwas davon gesagt, auf Arbeiter zu schießen.
«Verdammte Sauerei!»
Wieder Popeye. Er beginnt mit den Füßen zu stampfen, als wolle er auf dem Hallenboden einen imaginären Trampelpfad bilden. Er schüttelt den Kopf und starrt mit geweiteten Augen auf das Blut und die dampfenden Gedärme am Boden, auf die halbierten, geviertelten, in die Ecke gespülten Tierklumpen, Innereien, Hautfetzen.
«Verdammte Sauerei!»
Er stampft weiter durch den Schlachtabfall, dreht sich um die eigene Achse. Und bleibt plötzlich stehen, richtet die Kalaschnikow auf einen zweiten Arbeiter, der graue Gummihandschuhe trägt.
«Bitte …», sagt der Arbeiter.
«Was ist das?» Jetzt klingt Popeyes Stimme heiser. «Was ist das?!»
Er feuert eine Salve ab, über die Köpfe der Arbeiter hinweg nach hinten, in eine weiß gekachelte Wand, in der sich dunkelbraune, spinnenförmige Einschlaglöcher bilden.
Julia hat genug.
Mit einer Ruhe, die sie sich später nicht erklären kann, geht sie auf Popeye zu, über den klebrigen Hallenboden, durch unsichtbare Vorhänge aus Wärme und Fleischgeruch.
Popeye blickt sie an. Für einen Moment funkeln seine Augen; das helle, tanzende Licht.
«Wir müssen das Video drehen», sagt Julia. «Bevor die Polizei eintrifft. Du kennst das Timing.»
Sie wartet einige Sekunden.
Popeye antwortet nicht.
Sie lässt ihn stehen und geht zurück zu den anderen.
Angrenzend an die Haupthalle befindet sich der Untersuchungsraum, in dem in der Regel auch Sitzungen stattfinden. Der Betriebsleiter ist gerade dabei, mit den Veterinären die Einsatzpläne für kommende Woche durchzugehen, als sie aus dem Nebenraum die ersten Schüsse hören.
Zuerst ignorieren sie die Geräusche und machen mit der Sitzung weiter – in der Annahme, es handle sich bei den Schüssen um die Bolzenpistolen. Aber dann wird der Betriebsleiter doch misstrauisch, weil sich die Bolzengeräte noch nie so angehört haben. Er steht von seinem Platz auf, um nachzusehen, was in der Halle vor sich geht.
Inzwischen haben Julias Leute Vizedirektor Bächler zur Schlachtstraße geschleppt.
Die Kollegen des Arbeiters, der von Popeye angeschossen wurde, bringen den Verletzten zum schwarz-rot gestrichenen Tor vor den Kühlräumen. Man versucht, ihm das Bein abzuklemmen, mit einem Reinigungsschlauch aus Gummi.
Im Hintergrund ertönen Stimmen. Die Stimmen des Betriebsleiters und der Veterinäre.
«Hallo! Wer sind Sie?»
«Was ist das, hä!», kreischt Popeye sie an. Er richtet seine Kalaschnikow auf sie. «Bist du hier der Boss?»
Keiner der Männer antwortet.
«Was ist das für eine gottvergessene Sauerei!»
Julia kann sehen, wie Popeye auf dem Boden herumstampft, als würde ihm das dabei helfen, seine Wut oder seinen Ekel loszuwerden.
Sie geht weiter und erreicht die dampfige Wärme der Schlachtstraße. «Du da», sagt sie zum Arbeiter vor der stählernen, mechanisch betriebenen Aufhängung.
An der Aufhängung baumeln Schweine – halbiert, gehäutet, geköpft. Julia weist den Arbeiter an, zwei Schweinshälften abzuhängen, um für die Geisel Platz zu machen.
Der Arbeiter gehorcht. Er bekommt Unterstützung von Blacky und Marge.
«Gut», sagt Julia. Sie wundert sich, wie ruhig ihre Stimme klingt. Sie richtet die Maschinenpistole auf den Arbeiter. «Los, weitermachen.»
Also hilft der Mann Blacky und Marge, Vizedirektor Bächler an der Aufhängung zu befestigen, mit Seilen um Oberschenkel, Arme und Brust.
Gemeinsam heben sie ihn in die Höhe, an zwei Haken.
Julia beginnt mit dem Handy zu filmen, als Bächler über dem Boden baumelt, die Augen aufgerissen, zwischen den halbierten Schweinen – ein zusammengeschnürtes, zitterndes Menschenpaket.
3
Die Filmsequenzen aus dem Schlachthof werden am selben Tag ins Netz gestellt und gehen – zusammen mit den Szenen von Bächlers Entführung aus dem Haus in Fischertal – viral. Verbreitung finden sie über Kanäle von Umweltaktivisten und Tierschutzgruppen in Deutschland, England und Frankreich, ebenso durch die Berichterstattung großer Zeitungen und öffentlich-rechtlicher Sender.
Das Bild des zwischen den Schweinshälften baumelnden Vizedirektors der Nationalbank erreicht ein internationales Millionenpublikum.
Weil Thomas Bächler, von einem Trauma abgesehen, keine körperlichen Schäden davonträgt und bloß zwei Tage im Krankenhaus verbringen muss, zeigen die Medien nur wenig Verständnis für die Seite der Nationalbank.
Der redaktionelle Grundtenor geht eher dahin, dass man die extreme Aktion zwar verurteilt – insbesondere den Schuss in das Bein des Schlachthofarbeiters – und festhält: Jede Form von Gewalt ist falsch. Doch kaum ein Medium kritisiert die eigentlichen Anliegen von Schwarzer Winter, sondern man gibt ihnen im Zuge der Entführungsstory viel Raum.
Der Überzeugung folgend, verzweifelte Zeiten riefen nach verzweifelten Maßnahmen, interpretieren namhafte Kommentatoren die Aktion als Versuch, eine dringende politische Botschaft zu verbreiten.
Genauer gesagt, eine Botschaft an die Konsumgesellschaft, die aus der Corona-Pandemie und der europaweiten Energiekrise nichts gelernt habe und in den alten Ego-Materialismus zurückgefallen sei. Wie auch die Regierungen nicht ernsthaft vorgehen würden gegen die Klimakatastrophe, gegen das Aussterben von Tieren, Pflanzen und der Menschheit. Und das Ganze, obwohl die Wissenschaft seit Jahrzehnten vor der Katastrophe warne, machtlos gegen die Interessen der Großfinanz, der Konzerne und Rohstoffdynastien.
Viele Medien bieten eine solche Lesart der Ereignisse, auch wenn es Redaktionen gibt, die Schwarzer Winter kritisch gegenüberstehen.
Zum Beispiel spricht eine Schweizer Zeitung von der «traurigen Wende der Julia Schwarz». Julia wird als «einst geschätzte» Journalistin des Schweizer Fernsehens gezeichnet, geboren 1997 im ostschweizerischen St. Gallen. Julias Kindheit gilt als «schwierig»: Sie ist die alleinige Tochter des erfolgreichen Schweizer Bauunternehmers Gregor Schwarz und seiner depressiven, 2013 durch Suizid aus dem Leben geschiedenen Ex-Frau.
Drei Jahre nach dem Tod der Mutter – so steht es auf Wikipedia – studierte Julia Umweltnaturwissenschaft und Journalismus. Schon während des Studiums publizierte sie zu Klimafragen. Dabei spezialisierte sie sich auf die «europäische Aktivisten-Szene» und sympathisierte mit Schwarzer Winter.
Ab 2019 wurde Julia als Medienstimme dieser Gruppe wahrgenommen, die in Deutschland Farbanschläge auf Bankgebäude organisierte und in England Wasserpump-Lastwagen, um 2000 Liter Kunstblut vor der Nationalbank zu verspritzen. Sitzblockaden vor Konzernzentralen, Camping-Aktionen auf Hauptverkehrsstraßen, die nächtliche Befreiung von Tieren aus dem Zoo, Drohnen, um den Betrieb über den Flughäfen von London, Paris und Berlin zu stören.
Es folgten die schwierigen Jahre 2020 bis 2022 mit der weltweiten Corona-Pandemie und dem brutalen russischen Angriffskrieg auf die Ukraine: zwei Themen, die den Klimaschutz aus den Schlagzeilen verdrängten.
Kenner der Szene berichten, dass Schwarzer Winter während dieser Zeit damit begann, Autos und Büros der «Feinde des Planeten» in Brand zu stecken und die Entführung von verantwortlichen Politikern und Unternehmern zu planen – Vizepräsident Bächler war nur der Anfang.
Bei dieser Aktion hat sich Julia mit der Maschinenpistole filmen lassen und gilt nun als «staatsgefährdendes» Mitglied der Gruppe. Sie landet auf der gleichen Fahndungsliste wie die anderen Mitglieder. Auf der gleichen Liste wie Kilian Winter, der Mann, der Schwarzer Winter 2016 gegründet hat.
Gemäß Polizeiakten handelt es sich bei Kilian Winter um den Kopf der Gruppe. Geboren 1992 in Düsseldorf, als Sohn eines Religionslehrers und einer Krankenschwester, verlässt er mit 17 Jahren das Elternhaus, um in Berlin politische Ökonomie und Kulturwissenschaft zu studieren. Trotz hervorragender Leistungen bricht Winter das Studium ab, geht in die USA, dann nach Indien, wo sich seine Spur verliert. Bei seinem Wiederauftauchen 2014 in Deutschland ist er Mitglied von «Extinction Rebellion», von denen er sich jedoch wieder trennt, um seine eigene Gruppe zu gründen.
Im Jahr 2017 kommt es zur ersten Begegnung zwischen Winter und Julia Schwarz: Für die Homepage des Schweizer Fernsehens hat Julia einen Beitrag über dessen Umweltbewegung verfasst. Einen Beitrag, der Winter gefällt. Deswegen bietet er ihr ein exklusives Interview, das vom Sender zuerst abgelehnt wird, denn Winter wird in den USA wegen Autodiebstahl und Drogendelikten gesucht. Trotzdem kommt es, in Zusammenarbeit mit Kollegen vom Ersten Deutschen Fernsehen, zum Interview. Bei diesem Auftritt schafft es Winter, sich gegenüber einer breiteren Öffentlichkeit als energiegeladener Rebell mit «prophetisch stechenden Augen» zu inszenieren.
Bis heute greifen Medienschaffende auf dieses erste TV-Interview zurück, um daraus zu zitieren.
Unter den Anhängern in den sozialen Medien ist besonders eine Szene beliebt, in der Julia Kilian Winter vor laufender Kamera fragt, ob er jemals Gewalt anwenden würde, um seine Ziele zu erreichen? Winter beugt sich, um zu antworten, langsam und theatralisch vor. Er wirft Julia einen Blick zu, in den Augen ein Scheinwerfer-Funkeln: «Unser System ist Genozid an der nächsten Generation. Das ist Gewalt. Wenn wir uns dagegen wehren, nenne ich das Selbstverteidigung.»
«Und was ist mit den unschuldigen Menschen, die wegen Ihrer Aktionen in Lebensgefahr geraten?», möchte Julia wissen. «Die Bürgerinnen und Bürger unserer Demokratie?»
Langsam bewegt Winter, ohne den Blick von Julia abzuwenden, den Kopf hin und her. «Wenn eine Gesellschaft so unmoralisch handelt, wird Demokratie irrelevant.»
Es ist diese Szene, die Winters Ruf festigt – während die Behörden bereits mit Hochdruck gegen ihn und seine Gruppe ermitteln.
Im Nachgang der Bächler-Entführung findet die Polizei die gestohlenen Fahrzeuge, welche die Aktivisten verwendet haben, rund drei Kilometer vom Zentralschlachthof entfernt, auf einer Landstraße.
Den Beamten gelingt es nicht, den Fluchtweg der Gesuchten zu rekonstruieren oder ihren aktuellen Aufenthaltsort ausfindig zu machen.
Seit über einem Jahr versuchen sie schon, die Gruppe zu fassen, ohne dass es zu einer Verhaftung gekommen ist. Die Behörden gehen davon aus, dass die Gruppe wechselnde «Lager» nutzt, nicht nur in der Schweiz, auch im angrenzenden Ausland, und dass sie von einflussreichen Kreisen unterstützt wird.
Beamte, die mit dem Fall vertraut sind, bescheinigen Schwarzer Winter gute Organisation und Ausrüstung. Wer das Dossier kennt, muss den Aktivisten ein nahezu militärisches Planungsvorgehen attestieren, dazu einen geübten Umgang mit Waffen. Abgesehen davon verfügen die Gesuchten wohl über «Krypto-Handys»– schwer zu erwerbende, kostspielige Geräte, mit denen verschlüsselt kommuniziert werden kann, sodass eine Ortung innerhalb einer nützlichen Frist unmöglich ist.
Die Vermutung liegt nahe, dass diese und andere Geräte, wie auch die logistische Unterstützung, nicht von Schwarzer Winter selbst kommen, sondern dass es Verbindungen zu einflussreichen Kreisen gibt, nicht zuletzt aus dem «Big-Tech-Business».
Das ist eine Vermutung, die nur Kilian Winter aus der Welt schaffen könnte, wenn er grundsätzlich daran interessiert wäre, Vermutungen aus der Welt zu schaffen.
Winter hat die Übersicht über die Geldflüsse der Gruppe. Nur er weiß, wer ihnen die technische und logistische Unterstützung bietet, die sie bisher davor bewahrt hat, geschnappt zu werden.
Auch Julia kann nicht sagen, welche Finanziers es im Hintergrund gibt, obwohl sie Winter nahesteht. Tatsächlich sind die beiden ein Paar. Winter hat auch schon Witze darüber gemacht und gesagt, dass die Zeitungen «das sicher geil» fänden, wenn sie wüssten, was «wir beide nach Mitternacht treiben». Der endgültige Name der Gruppe war geboren: Schwarzer Winter.
Nach dem Erfolg der Bächler-Aktion zieht sich die Gruppe in ihr vorübergehendes Refugium nach Deutschland zurück. Es handelt sich um einen abgelegenen Bauernhof auf einem Landstrich zwischen Bechhofen und Weidenbach, in unmittelbarer Nähe eines Waldes mit kleinem, schilfbewachsenem Weiher.
Die Stimmung in der Gruppe ist gut. Es ist das erste Mal, dass sie eine Aktion ohne Winter durchgeführt haben, und trotzdem ist alles perfekt gelaufen. Winter hat die Aktion zwar mit Julia geplant – bis ins kleinste Detail –, aber dann musste er unerwartet nach Hamburg, für einen wichtigen Termin betreffend des «nächsten großen Dings»: eine Aktion, die größer sein soll als alle ihre bisherigen Aktionen zusammen, wie Winter meint.
Doch daran mag jetzt niemand in der Gruppe denken. Jetzt wollen sie Spaß haben.
Der verlassene Bauernhof verfügt über eine leergeräumte Scheune, in der Popeye, Chris und die anderen Technomusik laufen lassen und tanzen.
Nach Einbruch der Dämmerung essen und trinken sie draußen im Gras, zwischen der Scheune und dem angrenzenden Stoppelfeld. Sie machen ein Feuer und genießen das Najé, eine psychedelisch wirkende Pflanze, die sich rauchen oder eingekocht trinken lässt.
Winter hat das Zeug vor ein paar Jahren in Peru entdeckt. Angeblich nutzten es schon die Naturvölker des Amazonas für rituelle Zeremonien und um sich in Trance zu versetzen.
Manchmal mischen sie ins Najé einen anderen Saft, etwas Indianisches, auf das Popeye steht. Und dann ist da noch das T2, ein Zeug aus Kalifornien: hellblaue Pillen, die sie einnehmen, wenn sie im Einsatz sind, um fokussiert zu bleiben. Popeye nennt es «chemische Kriegsbemalung», typisch.
Julia meidet das T2. Aber das Najé hat sie schon probiert und fand es entspannend. Sie hat nichts dagegen, dass die Gruppe feiert, und sie hört es gern, wenn die anderen lachen. Sie hat auch nichts gegen den Technosound oder den Schnaps. Hier draußen kann sie kein Mensch hören, die nächste Siedlung ist Kilometer entfernt.
Julia beobachtet gern die anderen, wenn sie gut drauf sind, zum Beispiel Chris und Marge. Sie erzählen Witze am Lagerfeuer. Dann tanzen sie wie Indianer um die Flammen herum. So, wie Popeye es am liebsten macht.
Blacky und Rouge tanzen einige Minuten mit, dann verschwinden sie wieder in der Scheune mit dem Technogewummer.
«Ihr Toten!», ruft Popeye ins Feuer, den Kopf umschwirrt von Glutsternen. «Unterwegs auf der Autobahn, in euren Blechsärgen! Wacht auf! Geld-Marionetten! Humankapital-Zombies!» Er klatscht in die Hände und dreht sich im Kreis.
Chris und Marge drehen sich mit ihm, bevor sie alle drei, weiter drüben, ins Gras torkeln und hinfallen.
Julia kann sehen, wie Popeye auf dem Rücken liegen bleibt und nach oben in den nachtblauen Himmel lacht, in dem sich die Rauchwolken des Feuers verlieren.
Sie gönnt ihm den Moment. Sie gönnt ihnen allen den Moment. Aber sie kann nicht mitfeiern. Sie hört den Singsang ihrer Stimmen, das Gekicher, riecht das Feuer, alles in gedämpfter, innerer Entfernung. Sie kennt das – schon ihr Leben lang, denkt sie. Manchmal schiebt es sich wie eine Glaswand zwischen sie und die Welt.
Julia entfernt sich von den anderen. Sie will allein sein. Sie begibt sich auf die Rückseite des Bauernhofs. Sie mag es, wie das Gelächter und das Gewummer hinter ihr zurückbleiben.
Sie überquert das stille, dunkle Feld hinter der Scheune.
Sie erreicht den Wald auf der anderen Seite und sucht den Trampelpfad, der zum Weiher führt. Sie sucht den Anblick des schilfbewachsenen Ufers, den Glanz des Wassers, wenn es windstill ist, wenn nichts sich rührt.
Aber natürlich ist sie, als sie den Weiher erreicht, nicht allein: Winter ist da. Er sitzt auf dem umgefallenen Baumstamm am Ufer.
Als sie auf einen knackenden Ast tritt, dreht Winter den Kopf.
Julia setzt sich zu ihm, während er wieder zum Weiher blickt. Sie beobachtet – aus dem Profil – die kleinen, schwarzen Wellen seiner Haare, die geschwungene Nasenform. Sie stellt sich vor, ihn zu küssen, mit ihm ins Wasser zu springen, einen Schrei auszustoßen und sich, genau wie die anderen, zu verlieren. Verlieren in der Bewusstlosigkeit eines Augenblicks. Sie stellt sich vor, etwas Verrücktes zu tun, irgendetwas.
Jetzt, denkt sie, jetzt. Aber sie ist wie blockiert. Sie fühlt sich schwach, abgestumpft.
Und Winter? Er sagt kein Wort.
Erst jetzt fällt ihr auf, dass auf dem Waldboden neben ihm die Thermosflasche steht, die sie zusammen aus London mitgebracht haben, mit dem hellgrünen Deckel. Die Flasche mit dem eingekochten Najé.
«Du hast ohne mich angefangen?»
Er reagiert nicht auf Julias Frage, als würde ihn die Betrachtung des Weihers vollkommen in Beschlag nehmen.
«Winter?»
Nun blickt er sie an.
«Ich habe von dir geträumt», sagt er.
«Geträumt?»





























