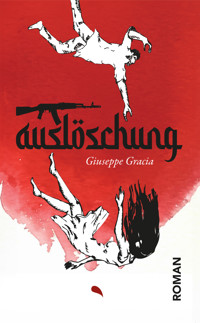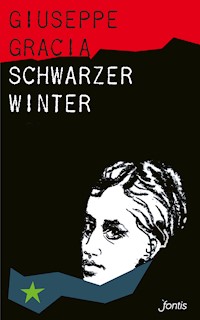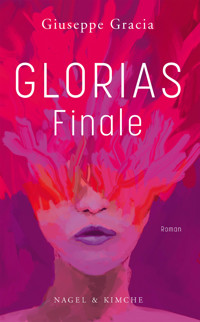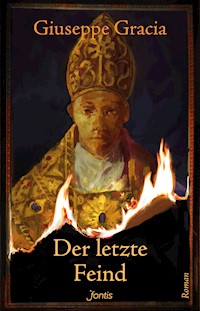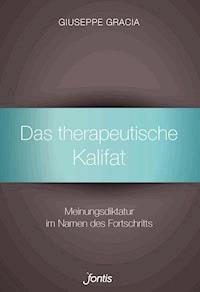
5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fontis AG
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es ist eine Binsenweisheit, dass die Eliten den öffentlichen Diskurs in Medien, Kultur und Politik dominieren. Immer öfter agieren sie jedoch mit dem moralischen Anspruch von Volkstherapeuten, die alle zum friedlichen Zusammenleben erziehen wollen. Unmerklich hat sich in Westeuropa auf diese Weise ein therapeutisches Kalifat etabliert: Wer mit seinen Ansichten von der verordneten Therapie abweicht, muss mit Sanktionen rechnen. Schließlich wollen die Eliten die Wahrheit alleine definieren. So ist ein neuer Klassenkampf zwischen "Therapeuten" und "Patienten" in unseren Breitengraden entstanden. Feinsinnig und mutig skizziert der Schriftsteller Giuseppe Gracia die "öffentliche Patientenverordnung" in Medien und Politik und plädiert für einen zivilen Ungehorsam und den Mut zum Widerspruch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 36
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Giuseppe Gracia Das therapeutische Kalifat
Giuseppe Gracia
Das therapeutische Kalifat
Meinungsdiktatur im Namen des Fortschritts
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.
© 2018 by Fontis-Verlag, Basel
Umschlag: Spoon Design, Olaf Johannson, Langgöns Umschlagfoto: Wolf Suschitzky, Getty Images E-Book-Vorstufe: InnoSet AG, Justin Messmer, Basel E-Book-Herstellung: Textwerkstatt Jäger, Marburg
ISBN (EPUB) 978-3-03848-518-6
Inhalt
Gegen die Intoleranz
Das therapeutische Kalifat
Narrative
Political Correctness
Mikroaggression und Safe Space
Management der Volks-Emotionen
Die Patienten
Ideologische Grundlagen
Keine Verschwörung
Meinungsfreiheit
Macht und Moral
Schlussfolgerungen
1. Dem eigenen Zeugnis vertrauen
2. Öffentlich mitreden
3. Nicht moralisieren
Anhang
Praktische Tipps
Glossar
Narrative
1. Klimawandel
2. Islam
3. Emanzipation der Frau
4. Abtreibung
5. Sexualität
6. Migration
Der Autor
Anmerkungen
Gegen die Intoleranz
«Im Namen der Toleranz sollten wir uns das Recht vorbehalten, die Intoleranz nicht zu tolerieren.»
Dieser Satz des österreichisch-britischen Philosophen Karl Popper stammt aus dem Jahr 1945 und beeinflusst unsere westliche Kultur bis zum heutigen Tag. Er strahlt eine moralische Standhaftigkeit aus, die uns das Gefühl gibt, auf der richtigen Seite zu stehen. Es tut gut, sich sauber gegen Intoleranz abzugrenzen und zu den Guten zu gehören.
Das zeigt sich immer dann, wenn uns ärgerliche öffentliche Stimmen oder politische Bewegungen begegnen, die angeblich Intoleranz oder Hass schüren, die also moralisch minderwertig sind und uns vor unserem Gewissen dazu verpflichten, im Namen des sozialen Zusammenhalts Zensur zu üben. Wir fühlen uns berechtigt, geistige Brandstifter gegen eine gemeinschaftsdienliche Gesinnung anzuprangern, bevor das Volk unnötig aufgehetzt wird.
Ein Beispiel aus dem Jahr 2018 wäre der Besuch des damaligen Beraters von Donald Trump, Steve Bannon, in der Schweiz. Wie schon beim Besuch anderer politisch unliebsamer Personen fühlten sich moralisch entrüstete Aktivisten, in diesem Fall die sogenannte «Bewegung für den Sozialismus», dazu verpflichtet, den Auftritt zu verhindern.
Der Sprecher der Bewegung begründete das im Falle von Steve Bannon so: «Trump hat hier nichts verloren. Rassismus und Sexismus sind keine Meinung, sondern ein Verbrechen.»
Diese Aussage ist eine Zuspitzung des Gedankens von Karl Popper: Was wir nicht tolerieren, kann als Verbrechen gelten.
In der Tat sehen wir heute sowohl in Europa als auch in den USA immer mehr «antifaschistische», «antirassistische» oder «antisexistische» Gruppen, die uns davon überzeugen wollen, moralisch dubiose Personen oder Ansichten aus dem öffentlichen Raum zu verbannen. Es sind Gruppen, die unerwünschte Meinungen und Auftritte auch gern niederpfeifen und mit Begriffen wie Hate Speech oder Hate Crime öffentlich kriminalisieren.
Selbst ein Mark Zuckerberg, Chef von Facebook, musste bei einer Anhörung vor dem US-Kongress 2018 versichern, dass Facebook keinerlei Hate Speech toleriert. Ob allerdings Facebook selbst, ohne rechtsstaatliche Instanz, darüber entscheiden darf, was genau als Hate Speech gilt, diese Frage wurde von niemandem gestellt.
Das zeigt, wie problematisch die Aussage von Karl Popper ist. Denn auch Popper blendet die Frage aus, wer in einer liberalen Gesellschaft die legitime Instanz sein soll, die den Begriff «Intoleranz» für alle verbindlich definiert. Wer darf festlegen, wann eine Ansicht unter dem Banner der Meinungsfreiheit weiter durch den öffentlichen Raum segeln darf und wann sie verschwinden muss?
Ist es die Justiz? Aber darf ein Richter in Deutschland oder in der Schweiz mehr verlangen als Loyalität zum Gesetz? Darf er Gefühle wie Hass und Antipathie als Verbrechen ahnden? Darf er moralische Zustimmung im Sinne einer Regierung oder scheinbaren Mehrheitsmeinung verlangen? Darf er vom Staat unerwünschte Ansichten bestrafen, zum Beispiel islamkritische, migrationskritische, gendertheorie-kritische oder einfach nur wertkonservative Ansichten?
Das therapeutische Kalifat
Im Namen des Kampfes gegen Intoleranz, Rassismus und Sexismus entsteht in Westeuropa gegenwärtig ein «therapeutisches Kalifat».
Dieser Ausdruck stammt vom Schweizer Philosophen Michael Rüegg. Gemeint ist eine neue Form von Herrschaft, nicht im Namen eines Gottes oder im Sinne einer Diktatur wie in China oder Nordkorea. Sondern im Sinne einer gewissermaßen sanften Gesellschaftstherapie. Die Therapie einer politisch-kulturellen Elite, welche die christlichen Wurzeln des Abendlandes abschneidet und uns im Zuge der Globalisierung befreien möchte vom Hemmschuh veralteter religiöser, nationaler oder geschlechtlicher Identitäten.
Westeuropa als internationales, großes Therapiehaus – ein Haus für friedliche Volksentwicklung. So ähnlich wie das «Haus des Friedens» im Islam («Dar as-Salam»), nur eben typisch europäisch, das heißt: atheistisch und wirtschaftsgetrieben.
Wie muss man sich das genauer vorstellen? Wer sind in einem solchen Haus die Chefärzte? Wer sind die leitenden Sozial-Ingenieure, die assistierenden Gesellschaftsmediziner? Wer wacht über das Heilverfahren? Wer sind unsere Polit-Internisten? Wer sind die öffentlichen Meinungs-Krankenschwestern?
Es sind natürlich Leute, die zur Elite gehören. Ich weiß: Heute ist Elite ein negativer Begriff. «Die Korrupten da oben gegen uns Wehrlose hier unten.» Das ist ein beliebtes Narrativ von Populisten. Das ist hier aber nicht gemeint. Jede Gesellschaft braucht eine gute Elite, die aufgrund besonderer Talente eine Führungsrolle für die Allgemeinheit übernimmt.
Hier geht es jedoch um eine Elite, die ihr politisches Mandat mit moralischer Autorität gegenüber dem Wähler verwechselt. Beispiele wären der Regierungsstil in Schweden, Frankreich oder Deutschland. Doch es gibt auch in der Schweiz genug Politiker, die wie eine moralische Instanz des Volkes auftreten, wie Heilpädagogen des sozialen Zusammenhalts. Solche Politiker sind nicht Teil einer Elite, die der Allgemeinheit dient, sondern einer Elite, die sich über uns erhebt und die für uns alle das gute Leben kennt. Eine solche Elite möchte ihre Ideen nicht in einen demokratischen Willensbildungs-Prozess einspeisen, sondern sie möchte sich einfach nur durchsetzen.
Bei diesem Regierungsstil, von vielen Medien öffentlich mitgetragen, geht es im Grunde nicht mehr um die Leitung des Staates, sondern um die Leitung seiner Bürger. Deswegen suchen die Funktionäre eines solchen Staates bei umstrittenen Themen wie Migration, Islam oder EU mit den Bürgern auch gar keine Kommunikation auf Augenhöhe, sondern eine pädagogisch austarierte, taktische Kommunikation. Genauer gesagt: eine Kommunikation, die uns in die richtige Richtung lenkt, nämlich zur Zustimmung für längst beschlossene Regierungsprogramme.
«Die Welt ist im Umbruch, aber wir schaffen das. Wir erleben große Herausforderungen, aber wir haben keine Angst vor den offenen Grenzen unserer Solidarität.»
Das sind typische Botschaften dieses Regierungsstils.