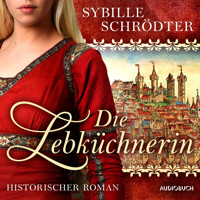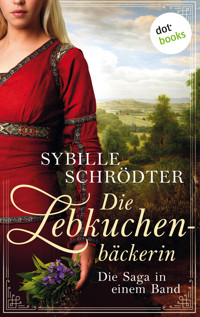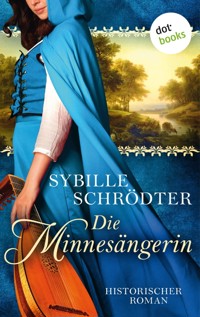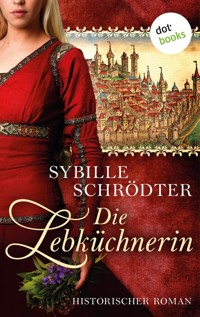12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
In einer Zeit, die Gehorsam verlangt, beginnen sie zu kämpfen: vier Schwestern zwischen den Weltkriegen – eine dramatische Familien-Geschichte und ein bewegendes Stück Zeitgeschichte aus Flensburg Weihnachten 1919 ist ein trauriger Anlass für die Familie Danneberg, denn ein Platz an der festlich gedeckten Tafel bleibt leer: Der einzige Sohn ist im 1. Weltkrieg gefallen. Wie soll es nun weitergehen mit dem alterwürdigen und mächtigen Flensburger Rumhaus Danneberg? Für den alten Danneberg kommt es nicht infrage, die Geschäfte einer seiner vier Töchter zu übertragen – doch die Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten, wollen sich nicht länger in ein Weltbild fügen, das längst in Trümmern liegt. Jede auf ihre Weise, beginnen die Schwestern zu kämpfen: für das Recht, das Rumhaus zu führen, das Recht, den Ehemann selbst zu wählen – oder das Recht, überhaupt nicht zu heiraten. »Schwestern fürs Leben« von Sybille Schrödter ist historischer Roman, Familien-Geschichte und ein authentisch und kenntnisreich erzähltes Stück Zeitgeschichte in einem. Mitreißend und emotional folgt der Roman dem Schicksal der vier Danneberg-Schwestern und des Flensburger Rumhauses zwischen den beiden Weltkriegen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 797
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Sybille Schrödter
Schwestern fürs Leben
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
In einer Zeit, die Gehorsam verlangt, beginnen sie zu kämpfen: vier Schwestern zwischen Frieden und dem nächsten Krieg. Die große Familiensaga aus dem hohen Norden.
Weihnachten 1919 ist ein trauriger Anlass für die Familie Danneberg, denn ein Platz an der festlich gedeckten Tafel bleibt leer: Der einzige Sohn ist im 1. Weltkrieg gefallen. Wie soll es nun weitergehen mit dem altehrwürdigen und mächtigen Flensburger Rumhaus Danneberg?
Für den alten Danneberg kommt es nicht infrage, die Geschäfte einer seiner vier Töchter zu übertragen – doch die Schwestern, die unterschiedlicher nicht sein könnten, wollen sich nicht länger in ein Weltbild fügen, das längst in Trümmern liegt. Jede auf ihre Weise, beginnen die Schwestern zu kämpfen: für das Recht, das Rumhaus zu führen, das Recht, den Ehemann selbst zu wählen – oder das Recht, überhaupt nicht zu heiraten.
Inhaltsübersicht
Wichtigste Personen
Flensburg, August 1910
1. Teil
1. Flensburg, Heiligabend 1919
2. Flensburg, Dezember 1919
3. Gut Runohr, Silvester 1919/1920
4. Gut Runohr, Silvester 1919/1920
5. Gut Runohr, Silvester 1919/1920
6. Flensburg, Januar 1920
7. Flensburg, Januar 1920
8. Flensburg, Januar 1920
9. Flensburg, Januar 1920
10. Flensburg, Januar 1920
11. Flensburg, 13. März, 1920
12. Flensburg, 14. März 1920
13. Flensburg, April 1920
14. Ochseninseln, April 1920
15. Flensburg, Ostern 1920
16. Flensburg, Ostern 1920
17. Sonderburg, Ostern 1920
18. Flensburg, Ostern 1920
19. Sonderburg, Ostern 1920
20. Sonderburg, Ostern 1920
21. Flensburg, Juli 1920
22. Flensburg, Juli 1920
2. Teil
23. Zugfahrt nach Berlin, 1923
24. Berlin, Mai 1923
25. Flensburg, Juni 1923
26. Flensburg, Juni 1923
27. Flensburg, Juni 1923
28. Flensburg, Juni 1923
29. Gut Runohr, Oktober 1924
30. Berlin, Oktober 1924
31. Berlin, Oktober 1924
32. Berlin, Oktober 1924
33. Flensburg, Weihnachten 1925
34. Flensburg, Weihnachten 1925
35. Flensburg, Mai 1930
36. Flensburg, Mai 1930
37. Flensburg, Mai 1930
38. Gut Runohr, April 1932
39. Flensburg, Dezember 1932
40. Flensburg, April 1933
3. Teil
41. Flensburg, April 1935
42. Sonderburg, April 1935
43. Flensburg, Juni 1936
44. Flensburg, August 1936
45. Flensburg, Ochseninseln, Mai 1937
46. Flensburg, Mai 1937
47. Gut Runohr, Juni 1937
48. Glücksburg, Juni 1937
49. Kopenhagen, Mai 1938
50. Flensburg, November 1938
51. Flensburg/Gut Runohr, April 1940
52. Flensburg, September 1941
53. Kopenhagen, Mai 1942
54. Flensburg, August 1943
55. Sonderburg, Weihnachten 1944
56. Gut Runohr, Mai 1945
57. Flensburg, Heiligabend 1945
Nachwort
Wichtigste Personen
Ole F. Danneberg – Patriarch des Rumhauses Danneberg
Ida – seine Frau
Käthe – die älteste Tochter
Helene (Lene) – die zweitälteste
Elisabeth (Lizzie) – die dritte Tochter
Henriette (Jette) – die jüngste
Henning Danneberg – Oles Bruder, »Onkel Henning«
Paul – Hennings Sohn
Ole P. – Lenes Sohn
Dörthe – Lenes Tochter
Klara – Jettes Tochter
Frederike – Lizzies Tochter
Johann von Runohr – Idas Vater
Carl – Idas Bruder, »Onkel Carl«
Freya – Carls Tochter und beste Freundin von Lene und Lizzie
Charlotte – Freyas Tochter
Klaas Bahnsen – Lenes Geliebter
Herrmann Jensen – Lenes Ehemann
Dr. Gottfried Lüdtke – Lizzies Ehemann
Georg von Renz – Jettes große Liebe
Simon Larsson – Idas erste Liebe
Henrik Larsson – sein Sohn
Rasmus – Gutsverwalter auf Runohr
Frida – dänische Köchin der Dannebergs
Kaja – ihre Tochter, Kindermädchen bei Lene
Lotte – Hausmädchen der Dannebergs
Vilma – Kindermädchen bei Freya
Smilla – Onkel Hennings Haushälterin
Christian (Krischan) Jensen – Rumhändler
Broer – sein ältester Sohn und Erbe des Rumhauses
Herrmann s. oben
Anna – Herrmanns Schwester und Käthes Freundin
Flensburg, August 1910
An ihrem achten Geburtstag bot sich Helene unerwartet jene große Chance, auf die sie schon so lange vergeblich gewartet hatte. Sie sah es als Zeichen, als man ihr versicherte, dass man ihr an diesem Tag jeden Wunsch erfüllen würde.
»Au fein, dann darf ich heute endlich Vatis Rumreich erkunden!« Vor lauter Freude klatschte sie in die Hände und ließ ihre neue Schildkröt-Puppe auf den Boden fallen. Zur großen Erleichterung der Mutter überstand Celtid, wie die bezopfte Puppe hieß, den freien Fall unbeschadet.
»Lene, das ist ungezogen!«, ermahnte die Mutter sie.
»Gar nicht! Ihr habt doch eben selbst gesagt, heute wird mir jeder Wunsch erfüllt!« Lene verschränkte die Arme vor der Brust und baute sich kämpferisch vor der Mutter auf.
»Lene, jetzt hör mir mal gut zu«, mischte sich daraufhin der Vater in strengem Ton ein. »Die Betriebsstätten sind nichts für kleine Kinder!«
»Vati, du lügst!«
An einem anderen Tag hätte sich Helene für diese Frechheit höchstwahrscheinlich eine Backpfeife eingefangen, aber an ihren Geburtstagen hatten die Danneberg-Kinder eine Art Freibrief, der jedoch, wie Lene nun schmerzlich erfahren musste, nicht ihren sehnlichsten Wunsch einschloss.
»So etwas sagt man nicht! Auch nicht an seinem Geburtstag!«, schalt sie die Mutter.
»Aber, wenn es doch stimmt. Albert darf auf den Speicher und sich die Fässer anschauen, wann immer er will. Er nimmt sogar seine Freunde mit, und dann spielen sie dort oben Verstecken!«
»Das ist doch etwas ganz anderes. Albert ist ein Junge!«
Helene rollte mit den Augen. Ihr lagen noch mehr Widerworte auf der Zunge, aber sie wusste aus leidvoller Erfahrung, dass diese Diskussionen jedes Mal mit einer energischen Bekräftigung des Verbots endeten, das Rumhaus auf der anderen Seite des gepflasterten Hofs zu betreten. Und sie wusste auch, dass sie mutterseelenallein mit ihrem Wunsch dastand, das Reich des Vaters zu erkunden. Ihre drei Schwestern verspürten keinerlei Verlangen, auf dem dunklen Speicher zwischen den Fässern herumzulaufen oder den vierschrötigen Männern in ihren Lederschürzen bei der Arbeit zuzusehen.
»Mein Liebling, ich habe in meinem ganzen Leben noch keinen Fuß dort hineingesetzt. Allein der Geruch. Entsetzlich!«, versuchte die Mutter, sie zu trösten.
Helene schob trotzig die Lippen vor und schwieg. Keiner konnte sie an diesem Morgen mehr aufheitern. Die Puppe hatte sie mit den Worten: »Sie gehört dir, Lizzie. Puppenspielen ist langweilig! Außerdem bin ich dafür jetzt viel zu groß!«, ihrer verdutzten ein Jahr jüngeren Schwester Elisabeth in den Arm gedrückt.
»Aber du hast sie dir doch so sehr gewünscht!«, protestierte ihre Mutter fassungslos.
»Da war ich erst sieben, Mutti«, gab sie trotzig zurück.
Das alles ging Helene noch einmal durch den Kopf, während sie voll ungestillter Neugier aus ihrem Zimmerfenster zu dem dreistöckigen Speicher auf der anderen Seite des kopfsteingepflasterten Hofs hinübersah und den unvergleichlichen Duft einatmete. Das ist der Anteil für die Engel, hatte ihr Vater ihr einmal erklärt, und dass dieser den Fässern entweichende Alkohol den Rum weicher mache. Lene hatte jedes Wort aufgesogen, denn es war die absolute Ausnahme, dass ihr Vater sie in die Geheimnisse seines Geschäfts einweihte.
In dem Moment vernahm sie das Klappern eines Pferdefuhrwerks, und sie zuckte zurück, aber nur so weit, dass sie noch den Überblick behielt. Sie wollte nicht dabei erwischt werden, wie sie von ihrem Ausguck beobachtete, was dort unten geschah. Ihr Vater kam nun mit ausgebreiteten Armen aus dem Kontorhaus, um den Besucher, der neben dem Kutscher gesessen hatte und nun vom Bock gestiegen war, herzlich zu begrüßen. Gemeinsam verließen die beiden Herren daraufhin recht eilig den Hof. Auch das Prozedere kannte Helene bereits von ihren zahlreichen Beobachtungen. Der andere Mann war ein Großabnehmer aus Kappeln, und immer wenn er seine Lieferung abholte, gingen die beiden ein paar Häuser weiter zu Henningsen, um ihren Kontrakt bei einem guten Schluck und einem deftigen Mahl zu feiern. Diese Ausflüge ihres Vaters in »die Spelunke für Fahrensleute« waren ihrer Mutter stets ein Dorn im Auge. Besonders seit der Papagei, den Piet Henningsen als ausgemusterter Seemann zusammen mit Souvenirs aus aller Welt nach Flensburg mitgebracht hatte, ihre Mutter angeblich einmal schrecklich blamiert hatte. Jedenfalls hatte Onkel Carl diese Anekdote einst lautstark in einer Männerrunde auf Gut Runohr zum Besten gegeben, nicht ahnend, dass seine sechsjährige Nichte vor der angelehnten Tür jedes Wort mit anhören konnte. Er behauptete, eines Tages wäre ihre Mutter wie eine Furie in das Lokal gestürmt gekommen und hätte unverrichteter Dinge wieder abziehen müssen, nachdem der freche Papagei ihr hinterhergerufen hätte: »Hest du ok betolt?« Über diese Geschichte durfte man im Haus Danneberg allerdings kein Wort verlieren. Das konnte Helene sehr gut verstehen, denn wenn das wirklich passiert war, genierte sich ihre Mutter sicherlich furchtbar, dass sich die betrunkenen Gäste auf die Schenkel geschlagen hatten, weil ein Papagei eine feine Dame wie sie bezichtigt hatte, die Zeche zu prellen. Ihre Mutter war eine besonnene und überaus korrekte Person. Deshalb hielt Helene das Ganze auch eher für ein dummes Gerücht.
Ihre Eltern hatten selten Streit, aber diese Kneipenbesuche am helllichten Tag sorgten für einigen Unfrieden. Ihre Mutter verlieh dann in der Regel mit tränenerstickter Stimme ihrem Unmut darüber Ausdruck, während der Vater jedes Mal hoch und heilig schwor, in Zukunft nicht mehr bei Piet Henningsen zu versacken. So streng er auch als Vater sein konnte, der Mutter gegenüber war er stets sanft wie ein Lamm. Das änderte allerdings nichts daran, dass er sich keinerlei Vorschriften machen ließ und lediglich versuchte, noch diskreter vorzugehen.
Deshalb waren die beiden Männer wohl nun auch so überstürzt vom Hof geflüchtet, mutmaßte Helene amüsiert. Sie stockte. So schnell würde ihr Vater nicht zurückkehren. Das war die Gelegenheit!
Ohne weiter zu überlegen, verließ sie ihr Zimmer und eilte die Treppe hinunter. Sie atmete auf, als sich die Hintertür ganz leise hinter ihr schloss, denn sie war keiner Menschenseele begegnet.
Mit klopfendem Herzen schlich sie sich an dem Pferdefuhrwerk vorbei, das gerade mit Fässern beladen wurde. Immer in der Angst, einer der Männer in den Lederschürzen könnte sie im Nacken packen und am Betreten des Speichers hindern. Doch da war sie bereits durch die offene Tür in das Innere gelangt. Dort blieb sie erst einmal stehen und versuchte, ihren fliegenden Atem zu beruhigen, bevor sie sich vorsichtig umsah und ihr Blick an der Treppe hängen blieb. Auf Zehenspitzen stieg sie die knarzenden Stufen nach oben und erschrak, als ein Mann im Alter ihres Vaters sie mit großen Augen anstarrte.
»Wen haben wir denn da? Ein Engelchen?«, fragte er verwundert. Helene sah an sich hinunter. Sie trug, wie stets zu ihrem Geburtstag, ein weißes Kleid. Und wie jedes Jahr fiel ihr Geburtstag in die Sommerferien.
»Was machen Sie da?«, erwiderte sie neugierig, ohne seine Frage zu beantworten. Und schon war sie ganz dicht an den Kupferkessel getreten, in dem eine für ihre Nase wohlriechende Brühe brodelte. Daher kam also der teils süßliche Geruch, der auch vor den hinteren Räumen des Wohnhauses der Familie nicht haltmachte und vor dem sich ihre Schwestern ekelten. Nach vorne heraus lag das Gebäude an der Förde, was ihnen stets einen frischen Ostseewind bescherte. Ihre Schwestern Lizzie und Jette hatten sich im Gegensatz zu ihr darum gerissen, ein Zimmer mit Blick zum Wasser zu haben.
»Ich stelle einen Rumverschnitt her. Schau, die klare Flüssigkeit hier, das ist reiner hochprozentiger Rum, den wir mit –« Er deutete auf eine andere Karaffe, »– dieser Sorte mit Getreideschnaps mischen.« Mit offenem Mund sah sie zu, wie er diese Substanzen zusammenrührte.
»Und willst du mir jetzt verraten, wie du heißt?«, fragte er, ohne den Blick vom Kessel zu nehmen.
»Ich bin Lene, aber bitte petzen Sie nicht meinem Vater, dass ich hier gewesen bin!«
Er warf ihr einen prüfenden Blick zu, und sie sah ein gewisses Verständnis aus seinen Augen blitzen.
»Ach, dann bist du die berühmte Helene.«
»Sie kennen mich?«
»Du bist Albert wie aus dem Gesicht geschnitten.« Das hörte Helene gern, denn sie war stolz darauf, dass ihr Bruder und sie einander so ähnlich sahen, aber ihr Stolz war verflogen, als sie ihn lachend sagen hörte: »Das ist also das Mädchen, das am liebsten später eine Lehre zum Destillateur machen würde!«
»Woher wissen Sie das?«
»Dein Vater hat uns von deinen Absichten berichtet.«
»Und er lacht mich deshalb aus! Genauso wie Sie, nicht wahr?«, fauchte Helene erbost.
Sein Lachen verebbte. »Kind, nein, das verstehst du falsch. Dein Vater ist stolz auf dich, aber sieh mal, dein Bruder wird sein Nachfolger. Und du wirst später einmal heiraten und …«
»Ich will nicht heiraten!«, zischte sie. »Und ich möchte auch nur einmal den Speicher ansehen und die Fässer. Ich habe doch heute Geburtstag, und das ist mein größter Wunsch.« Sie hob beschwörend die Hände.
Er stieß einen Seufzer aus. »Na gut, Helene, dann komm mit. Ich werde dir alles zeigen. Aber das muss wirklich unser Geheimnis bleiben. Dein Vater wird mich noch entlassen, wenn er erfährt, dass ich dir das Rumhaus gezeigt habe.«
Erschrocken ließ Helene die Arme sinken. »Aber das will ich auf keinen Fall!«
»Keine Sorge, ich habe maßlos übertrieben. Ich habe als junger Bursche schon für deinen Großvater gearbeitet. Ich kann das verantworten.« Er zwinkerte ihr verschwörerisch zu und nahm sie bei der Hand. Gespannt ließ sich Helene über eine noch engere Stiege in das nächste Stockwerk des Speichers führen. Ihre Augen leuchteten beim Anblick der vielen Fässer, die dort im Schein einer schummrigen Gaslampe lagerten. Hier oben roch es angenehm nach dem alkoholgetränkten Holz. Lene atmete diese Luft gierig ein.
»Darf ich?«, fragte sie und machte sich, ohne eine Antwort abzuwarten, von seiner Hand los. Mit einem Satz war sie im ersten Gang zwischen den Fässern verschwunden. Ohne Angst ging sie bis zum Ende und von dort in eine weitere Reihe, in der die großen Fässer lagerten. Bis sie an die Luke kam, die sie von ihrem Zimmer aus schon so oft gesehen hatte. Dort gab es einen großen Flaschenzug, mit dem die Fässer hoch- und hinuntergezogen wurden.
Sie streckte ihren Kopf aus der Luke, doch dann trat sie erschrocken zurück. Dort unten im Hof stand ihre Mutter und blickte sich suchend um. An der Hand hielt sie Jette, die ihren Blick nach oben gewandt hatte, als wüsste sie, wo sich ihre große Schwester versteckt hatte. Helene liebte ihre kleine Schwester über alles, obwohl sie so anders aussah als ihre Schwestern und sie. Jette, die eigentlich Henriette hieß, aber so nannte sie keiner, hatte große braune Augen und dunkle Locken. Aber gerade diese Unterschiedlichkeit zu den übrigen Danneberg-Schwestern faszinierte Helene. Vor lauter Begeisterung für die Kleine wäre sie beinahe aus der Deckung gekommen, aber da hatte sich bereits eine schwere Hand sanft auf ihre Schulter gelegt und sie in das Innere des Speichers zurückgezogen. Es war der Destillateur, der sie davor bewahrt hatte, sich zu weit aus der Luke zu lehnen.
»Lene!«, rief ihre Mutter nun sichtlich verzweifelt. »Deine Gäste kommen gleich!«
Helenes Herz klopfte bis zum Hals. Ihre Mutter durfte sie auf keinen Fall hier oben entdecken. Wahrscheinlich würde sie das dann zwar nicht dem Vater verraten, aber sie mit diesem waidwunden Blick ansehen, den sie immer bekam, wenn Helene Dinge tat, die ihren Schwestern im Leben nicht einfallen würden: auf Bäume klettern, auf die Ostsee mit Alberts Jolle allein hinaussegeln oder sich auf dem Schulweg mit eingebildeten Burschen vom Jungen-Gymnasium prügeln … Angst kannte sie nicht vor den Kerlen, zumal ihr Bruder Albert sofort zur Stelle war, wenn es kritisch wurde. Ja, auf ihren großen Bruder konnte sich Helene verlassen.
»Ich glaube, es ist höchste Zeit. Du solltest jetzt lieber zurück ins Haus schleichen, bevor dich noch jemand ertappt«, hörte sie den freundlichen Mann hinter sich sagen.
»Wie heißen Sie eigentlich?«, fragte sie, während sie sich zu ihm umdrehte.
»Broder Bahnsen.« Er streckte ihr die Hand entgegen. Sie nahm die Riesenpranke entgegen und schüttelte sie voller Ehrfurcht. »Von Ihnen habe ich schon viel gehört. Mein Großvater redet ständig von Ihnen.«
»Das ist mir eine große Ehre, dass der alte Herr mich nicht vergessen hat. Wie geht es ihm denn?«
Helene zuckte die Schultern. Über die Gesundheit des bettlägerigen alten Mannes, der bei ihrem Onkel Henning lebte, wurde wenig gesprochen. Helene erinnerte nur, dass sie sich als kleines Kind vor dem strengen Mann gefürchtet hatte, der nun ein leidender Kranker war. Sie hatte ihn nie besonders in ihr Herz geschlossen. An ihre Oma dachte sie dafür umso lieber. Sie war so ganz anders als die Frauen, die sie sonst kannte. Die Bedstemor, wie die Kinder sie auf ihren Wunsch genannt hatten und was auf Dänisch Großmutter hieß, hatte Helene schon als kleines Mädchen mächtig imponiert, wenn sie, statt mit den Frauen beim Tee Stickarbeiten zu machen, mit den Männern beim Grog über das Geschäft fachsimpelte. So wie ihre dänische Großmutter wollte sie auch einmal werden. Bei dem Gedanken, wie sie die von ihr bewunderte Bedstemor vor ein paar Monaten zum letzten Mal wachsweiß in dem Sarg hatte liegen sehen, fröstelte es Helene.
»Tja, er hat sich von Birtes Tod nicht erholt …« Der Mann wischte sich eine Träne aus dem Augenwinkel. »Entschuldige, ich meine, deine Großmutter fehlt ihm sehr.«
»Mir auch«, pflichtete Helene ihm traurig bei und meinte in diesem Augenblick, den Hauch von Zigarrenrauch zu riechen, der die Bedstemor stets umgeben hatte. Sie war die einzige Frau, die Helene jemals hatte Zigarre rauchen sehen. Ihre Mutter fand das schrecklich und ermahnte ihre Töchter, sich bitte keine dänischen Angewohnheiten bei der Großmutter Danneberg abzugucken.
»Lene! Wo steckst du denn bloß?«, hallte es da vom Hof vorwurfsvoll hinauf.
»Dann muss ich wohl gehen«, stöhnte Helene und nahm wahr, wie besorgt Broder Bahnsen auf ihr Kleid schielte. Bevor sie nach dem Grund fragen konnte, deutete er auf einen hässlichen Fleck, der ihr ehemals weißes Kleid grau bis schwarz einfärbte.
»Wenn deine Mutter das sieht, dann weiß sie sofort, wo du gewesen bist«, sagte er und überlegte. »Pass auf, ich gehe runter und lenke sie ab. So, dass sie mit mir nach vorn an die Straße geht. Und den Moment nutzt du, um dich durch den Hintereingang zu schleichen und dich umzuziehen«, schlug er eifrig vor.
Helene nickte und folgte ihm nach unten. Dort wartete sie hinter der Tür ab, bis ihre Mutter tatsächlich zusammen mit Broder Bahnsen den Hof verließ und durch das Tor verschwand.
In dem Moment kam ihr ein Junge entgegen, den sie noch nie gesehen hatte und den sie auf zehn oder gar elf schätzte. Er ging grußlos an ihr vorbei zum Allerheiligsten ihres Vaters. Ohne daran zu denken, dass sie auf dem schnellsten Weg ins Haus schlüpfen sollte, rief sie: »Halt, da darfst du nicht einfach reingehen. Das ist verboten!«
Der große blonde Junge drehte sich um. An seiner abgewetzten Kleidung konnte sie auf einen Blick erkennen, dass er sicher nicht aus einem der Handelshäuser kam, sondern eher aus der Neustadt.
»Ohaueha«, gab er mit spöttischem Ton zurück. »De Juschkatrin hat een anne Marmel!«
»Wie redest du denn? Petuh spricht man nicht, sagt meine Mutter!«, fuhr sie ihn an. »Und was heißt das überhaupt?«
Er verdrehte die Augen. »Dass du ein unordentliches Mädchen mit einem verschmutzten Kleid bist und einen Vogel hast …« Er tippte sich an die Stirn. »Und dass du mir gar nichts zu sagen hast. Mein Vater ist nämlich der Meister von all das da.« Er deutete stolz auf das Rumhaus.
Helene kämpfte kurz mit sich, den Lügner ungestraft ziehen zu lassen, weil sie dringend im Haus verschwinden sollte, doch ihr Kampfgeist siegte über die Vernunft.
»Du bist ein Lügner! Meinem Vater gehört das Rumhaus, und ich verbiete dir, es zu betreten!«, fauchte sie.
»Und wenn dein Vater der liebe Gott wäre, ich bringe jetzt meinem Vater sein Mittag.« Mit diesen Worten setzte er seinen Weg unbeirrt fort. Beim Tor drehte er sich noch einmal um. »In ein paar Jahren werde ich selber hier arbeiten!«, verkündete er voller Stolz.
»Wirst du nicht, weil ich dann Direktor bin. Und du bist mir zu frech!«
»Ich bin vermuten, du tünst ’n büschen. Ein Mädchen als Direktor vom Rumhaus?« Und schon brach er in schallendes Gelächter aus.
Wutentbrannt drehte sich Helene auf dem Absatz um. »Ich werde es euch allen noch zeigen!«, schimpfte sie, während sie durch die angelehnte Hintertür ins Haus schlüpfte.
Sie war schon bei der Treppe im Wohnhaus, als sie hinter sich ihre älteste Schwester Käthe vorwurfsvoll sagen hörte: »Lene, was hast du bloß mit deinem Kleid gemacht? Mutti wird schimpfen.«
Sie machte eine wegwerfende Bewegung. »Ist nicht so schlimm. Ich ziehe mich um, bevor ich ihr unter die Augen trete.«
Ihre ältere Schwester schüttelte den Kopf. »Aber, Kleines, das merkt sie bestimmt. Das ist doch dein Geburtstagskleid.«
Ihre Schwester hatte recht. Sie besaß kein zweites weißes Kleid. Eine andere Farbe würde ihre Mutter auf jeden Fall stutzig machen.
»Und nun?«
»Komm schnell!« Käthe zog sie eilig die Treppen empor zu ihrem Zimmer. Auch sie wohnte noch nach hinten raus, aber nicht, weil sie den Geruch von Alkohol und Holzfässern liebte, sondern weil sie ihren Schwestern jederzeit den Vortritt ließ. Ihr schien immer nur wichtig zu sein, dass es den anderen gut ging. Helene zuckte wie jedes Mal zusammen, wenn sie Käthes Zimmer betrat. Über ihrem Bett hing nämlich ein Gemälde, das den Herrn Jesus mit der Dornenkrone zeigte. Als kleines Kind hatte sie ihre Schwester einmal gefragt, ob das Blut ihr beim Schlafen nicht direkt auf den Kopf tropfen würde. Mit Engelsgeduld hatte Käthe Helene Jesus’ Leidensgeschichte erzählt und ihr versichert, dass dies aber nur ein Bildnis sei. Trotzdem erschrak Lene jedes Mal aufs Neue bei diesem Anblick. Und es gruselte sie die Vorstellung, dass sich Käthe dieses Bild, das ihre Mutter wohl von ihrer Mutter geerbt und auf dem Dachboden gelagert hatte, freiwillig als Zimmerschmuck ausgesucht hatte. Aber Käthe liebte ihren Herrn Jesus Christus so sehr, wie sie Lene gegenüber stets betonte, dass sie sein Leiden nicht fürchtete.
Helene aber wandte den Blick hastig von dem Gemälde ab, während Käthe zu ihrem Kleiderschrank eilte und ein schneeweißes Kleid hervorholte, das Lenes verschmutztem wie ein Ei dem anderen glich. »Mutti lässt uns stets dasselbe schneidern, damit sich keine von uns benachteiligt fühlt, aber mir ist es mittlerweile zu klein. Das müsste ich ohnehin an Lizzie oder dich weitergeben.«
Genervt ertönte die Stimme der Mutter unten im Haus. »Lene! Lene! Wo bist du denn nur?«
»Komm, schnell, sonst sucht dich Mutti noch!« Käthe half ihr beim Auskleiden und Anziehen. Erstaunt drehte sich Helene vor dem Spiegel in der Schranktür. »Als wäre es meins«, stieß sie verwundert hervor.
»Es gehört dir«, sagte Käthe. Helene gab der Schwester einen Kuss auf die Wange. »Wenn ich dich nicht hätte«, seufzte sie und rannte aus dem Zimmer.
Unten an der Treppe lief sie ihrer Mutter in die Arme. »Kind, wo warst du denn bloß?«, fragte sie kopfschüttelnd.
»Ich, ich habe mit Käthe noch in der Bibel gelesen«, erwiderte sie mit fester Stimme. Die angespannten Gesichtszüge ihrer Mutter wurden weicher.
»Ach, mein Schatz, und ich hatte schon befürchtet, du stellst wieder irgendetwas an.«
»Aber Mutti, wie kannst du nur so etwas denken?«, gurrte Helene. »Ich habe mir vorgenommen, mit acht Jahren folgsamer zu werden und euch zu gehorchen«, fügte sie hinzu, denn es tat ihrem Herzen gut, wie sie ihre Mutter mit diesem Bekenntnis erfreuen konnte. Und ja, sie war tatsächlich ernsthaft entschlossen, sich in Zukunft weniger ungestüm zu gebärden, allerdings nur, weil Trotz der Erreichung ihrer Ziele anscheinend nicht besonders förderlich war. Vielleicht schaffte sie es mit Sanftmut, ihren Vater eines Tages davon zu überzeugen, dass ihr Platz genauso wie der von Albert im Rumhaus war … und dann wollte sie das dumme Gesicht des eingebildeten Schnackers mal sehen, der sie eben so gemein ausgelacht hatte.
1. Teil
Das Kleeblatt
Drei nordische Fräuleins jubilieren
Ihr Reifezeugnis in den Händen
Bei einer knapp, ist einzuwenden
nun zu Erwachsenen sie avancieren
Ihr heiratet jetzt, mahnen himmlisch Tante und Mama
Die gute Partie, die wartet schon
Sie ist Berufung und euer Lohn
Für Töchterchen nur den Besten, ruft der Danneberg-Papa
Doch wir pfeifen auf’s Gattinnensein
Wollen erst einmal die Welt erkunden
Die Freiheit genießen unumwunden
Und nicht ins Ehejoch hinein
Wir haben uns, sind nicht allein
Eine für alle, alle für eine
Ich die deine, du die meine
Ein Kleeblatt wollen wir auf ewig sein
Mit freiem Geist und forschem Streben
Mit Mut und Kraft zu neuen Wegen
Bei Sonnenschein und auch bei Regen
Morgen beginnt das wahre Leben
Freya von Runohr, 1920
1. Flensburg, Heiligabend 1919
Nieselregen zu Weihnachten. Das war kein gutes Omen, dachte Ida Danneberg. Man konnte kaum die Lichter auf der anderen Seite der Förde sehen. Jedes Jahr dieses Bangen bis zum letzten Augenblick: Würde sich das typische »Flensburger Schietwetter« durchsetzen, oder würde es schneien und sich die Fördestadt in eine märchenhafte Winterlandschaft verwandeln? Ida zog hastig die schweren Gardinen aus Samt vor das große Fenster der klassizistischen Fassade, so als wolle sie das schlechte Wetter aussperren aus der weihnachtlichen Pracht, die den Salon im Lichterglanz erstrahlen ließ. Sie hatte gerade die Kerzen angezündet. Gleich würde sie die Flügeltüren zum Wohnzimmer öffnen und das Glöckchen läuten zum Zeichen, dass die Familie den geschmückten Weihnachtsbaum bewundern durfte. Dabei sah er seit Jahren immer gleich aus. Seit es im Haus Danneberg einen Baum gab, existierten diese bunten Holzspielzeuge, die ihn zierten. Sie wurden höchstens ergänzt von modischem Weihnachtsschmuck wie bunten Vögeln aus Glas, die vor dem Krieg der letzte Schrei gewesen waren. Dieses Jahr waren die neuen Errungenschaften allerdings keine teuren Kugeln, sondern Strohsterne, die ihre älteste Tochter Käthe gebastelt hatte. Kein Mensch würde an diesem ersten Weihnachten nach Kriegsende sein Geld für extravaganten Christbaumschmuck ausgeben. Ach, dieser verdammte Krieg, der alles zerstört hatte, dachte Ida, bevor sie noch einen prüfenden Blick auf ihr Werk warf, und hoffte wie jedes Jahr, dass noch einmal jene Freude aufkommen würde, die sie als Kind beim Anblick eines festlichen Tannenbaums empfunden hatte. Auf Gut Runohr, ihrem Elternhaus, hatte es einen ähnlichen Baumschmuck gegeben. Doch fühlte sie sich ausgerechnet an diesem Tag, an dem das größte Fest des ganzen Jahres zelebriert wurde, leer und ausgebrannt. Sie wusste genau, seit wann der Heilige Abend ihr Herz nicht mehr erwärmte. Es blieb seit jenem Weihnachten 1910 unberührt, an dem ihr jüngstes Kind, der kleine Max, eine Woche nach seiner Geburt an Heiligabend gestorben war. Ida straffte die Schultern und setzte jenes Lächeln auf, das die Familie von ihr erwartete. Sie fuhr sich noch einmal über das hochgesteckte dunkelblonde Haar, das inzwischen von grauen Strähnen durchzogen war, bevor sie die Glocke läutete und die Flügeltür weit öffnete.
Der Anblick ihrer gesammelten Familie löste gemischte Gefühle in ihr aus. Käthe wirkte in sich gekehrt wie meistens, ihre mittleren Töchter Helene und Elisabeth lächelten, ihr Mann Ole F. auch, aber die Augen zeigten, was er wirklich fühlte: tiefe Trauer. Ihre jüngste Tochter Jette vibrierte vor lauter Aufregung, ihr Vater Johann wirkte abwesend, ihr Bruder Carl lachte laut, weil er sich bereits reichlich am Rumpunsch bedient hatte, Carls Tochter Freya, die bei ihnen lebte und für sie wie eine Tochter und für die Mädchen wie eine Schwester war, wirkte peinlich berührt, denn sie hasste es, wenn ihr Vater betrunken war, Oles Bruder Henning hatte diesen leicht spöttischen Blick aufgesetzt, den er immer bekam, wenn er der Familie zuliebe derartig bürgerliche Konventionen über sich ergehen ließ, während sein Sohn Paul Idas Tochter Helene giftige Blicke zuwarf.
»Mutti, der Baum ist wunderschön«, stieß Jette ehrlich begeistert hervor, während Elisabeth sich an den Flügel setzte. Es war früher einmal Idas Aufgabe gewesen, das Weihnachtssingen zu begleiten, doch da Lizzie ein musisches Naturtalent war, hatte sie das schon vor Jahren an ihre Tochter delegiert, die das mit der ihr eignen Ernsthaftigkeit betrieb. Alles, was Elisabeth anpackte, versprach Erfolg. Sie hatte nicht nur eine Klasse übersprungen, sodass sie wie ihre ein Jahr ältere Schwester Lene und ihre Cousine Freya im Frühjahr die Schule abschließen würde. Nur würden Lene und Freya das Oberlyzeum mit der Lehramtsprüfung abschließen, während Lizzie sich nach einem brillanten Abschluss des Lyzeums mithilfe eines Lehrers der Knabenschule und als Gasthörerin auf derselben Latein und Griechisch angeeignet hatte, um ihre Hochschulreife dort mit einer externen Reifeprüfung zu erlangen. Obwohl sie von einigen der jungen Männer – und nicht nur von ihnen, sondern auch von dem ein oder anderen Lehrer – als »Blaustrumpf« bezeichnet wurde, lernte sie auch diese scheinbar schwierigen Sprachen spielend. Außerdem ließ sie solche Beleidigungen derart geschickt an sich abprallen, dass die Kritiker schnell die Lust verloren, sich an ihr abzuarbeiten. Sie war erstaunlich zäh und widerstandsfähig, aber im Gegensatz zu Lene, an der ein Junge verloren gegangen zu sein schien, dabei überaus weiblich und entwaffnend charmant. Eigentlich hätte sie schon mit dreizehn Jahren auf eine Studienanstalt wechseln müssen, die Mädchen seit einer Bildungsreform im Jahre 1908 ihren gymnasialen Abschluss ermöglichte. Nur leider gab es in ganz Schleswig-Holstein keine einzige Studienanstalt. Die befanden sich in den großen Städten wie Berlin und Hamburg. Es gab zwar fortschrittliche politische Stimmen, die unbedingt an den schlechten Bildungsbedingungen für Mädchen etwas ändern wollten, aber noch hatten Mädchen in Schleswig-Holstein nur eine Möglichkeit, ihre gymnasiale Reife zu erlangen: das externe Abitur auf einer Knabenschule. Unter diesen erschwerten Bedingungen machten sich nur ganz wenige Mädchen überhaupt die Mühe, diesen schwierigen Stoff auf eigene Faust und gegen den Widerstand der Männerwelt zu erlernen. Lizzie war zurzeit die einzige Frau, die die gymnasiale Reifeprüfung auf dem Alten Gymnasium ablegte. Sie hatte insofern Glück, weil ihr Privatlehrer in Griechisch und Latein, der große Stücke auf Lizzie hielt, an der dortigen Schule tätig war und sie auch am Unterricht teilnehmen ließ. Ida war sehr stolz auf ihre Tochter und hoffte, dass ihr Mann diesen Fleiß und das Durchhaltevermögen ihrer klugen Lizzie belohnen und ihr das Medizinstudium ermöglichen würde, denn das war ihr größter Antrieb. Sie wollte Ärztin werden, was Ole F. jedoch äußerst missfiel. Er war der Meinung, dass Lizzie diesen ganzen Unsinn wie Griechisch und Latein nicht brauchte, sondern sie damit eher mögliche Heiratskandidaten abschrecken könnte.
Die ganze Familie bis auf Idas Vater, der sich stöhnend auf einen Stuhl am festlich eingedeckten Tisch fallen ließ, versammelte sich nun um den Flügel, der bereits schon seit Generationen im »Hafen-Palais« stand, wie ihr Mann das Wohnhaus an der Schiffbrücke leicht spöttisch nannte. Mit Grausen dachte Ida an den bevorstehenden Umzug in den anderen Teil der Stadt, in dem Ole gerade eine »echte Villa«, wie er voller Stolz behauptete, für seine Familie umbauen ließ, um das Stammhaus der Dannebergs seinem Erben Albert und dessen zukünftiger Familie zu überlassen. Sie kämpfte gegen die Tränen an bei dem Gedanken, dass ihr Sohn jedoch niemals dort einziehen würde … dafür sollte im Haus Danneberg in absehbarer Zeit ein anderer wohnen: Oles Neffe Paul.
Als Lizzie Stille Nacht anstimmte, überkam Ida für einen Augenblick lang jenes erhabene Weihnachtsgefühl, das sie von früher kannte. Jette hatte eine bezaubernde Gesangsstimme, die alle anderen mitriss. Ihr Nesthäkchen sang nicht nur am lautesten, sondern auch am schönsten. Ida war fest davon überzeugt, dass es Jette vorbestimmt war, später einmal auf einer Bühne zu stehen, aber das behielt sie für sich, weil für ihren Mann allein der Gedanke, dass seine Töchter einer Arbeit nachgehen könnten, befremdlich war. Dass er Lene den Besuch der höheren Schule mit dem Abschluss zur Lehrerin ermöglichte, hatte nicht etwa den Grund, dass sie später unbedingt einmal einen Beruf ausüben sollte, sondern dass sie damit als Ehefrau auf dem gesellschaftlichen Parkett glänzen konnte. Und dass sie für den unwahrscheinlichen Fall, dass sie keinen passenden Mann fand, als Lehrerin einer Tätigkeit nachging, die sich für Frauen ziemte. Dabei ahnte Ole F., dass Lene diesen Abschluss nur auf sich genommen hatte, um die Wartezeit auszufüllen, bis sie es endlich schaffte, sein Herz zu erweichen, und er ihr eine wichtige Rolle in seinem Rumreich überließ. Ida befürchtete allerdings, dass er niemals über seinen Schatten springen würde. Dass er in diesem Punkt schrecklich verbohrt war, bewies seine Entscheidung, seinen windigen Neffen Paul zu seinem Nachfolger auszubilden, während er seiner Tochter, die regelrecht für das Geschäft brannte, erst gar keine Chance geben wollte, sich zu behaupten. Er erlaubte ihr weder einen Einblick in das Rumhaus, geschweige denn würde er sie zum Destillateur ausbilden, was ihr größter Wunsch war. Dabei hatte Lene schon früh jede freie Minute heimlich im Speicher bei den Fässern verbracht, während Ida und Lenes Schwestern schon den Geruch nicht ertragen konnten. Ida wusste von Lenes heimlichen Besuchen beim alten Meister Bahnsen, und insgeheim bewunderte sie ihre Tochter für diese Hartnäckigkeit. Um die Frage seiner Nachfolge hatte Ida sogar schon einmal einen Streit mit Ole F. riskiert, aber ohne Erfolg. Dabei wäre Lene die weitaus bessere Wahl gewesen, weil sie ein Händchen für das Geschäft besaß, während Paul wenig Ahnung vom Rumhandel hatte. Aber Ole hoffte darauf, dass er das nun unter seiner Aufsicht lernen würde. Wie Ida ihre Tochter Lene und deren eisernen Willen kannte, würde sie sich allerdings noch lange nicht geschlagen geben. Mutti, er wird Fehler machen, die Vati ihm nicht verzeiht, hatte Lene ihr gerade neulich erst wieder prophezeit. Ida wollte zwar nicht auf das Unglück anderer bauen, aber dem jungen überheblichen Burschen gönnte selbst sie einen ordentlichen Dämpfer. Sie fragte sich, wie immer, wenn sie sich über Paul Gedanken machte, wie ein überaus integrer feiner Mann wie Henning einen derart oberflächlichen Sohn haben konnte. Offenbar hatten sich die Gene seiner flatterhaften Mutter durchgesetzt, die kurz nach Pauls Geburt mit einem brotlosen Künstler durchgebrannt war. Das Einzige, was er von seinem Vater geerbt hatte, war die Attraktivität. Paul war genauso hochgewachsen wie sein Vater und besaß ähnlich markante Gesichtszüge und dieses volle blonde Haar, das auch bei Henning noch nicht grau geworden war.
Nach dem Singen bat Ida die Familie zu Tisch. Dass es auch in diesem Nachkriegsjahr, in dem Lebensmittel knapp waren, einen Festtagsbraten gab, hatte sie ihrem Vater zu verdanken, der auf dem Gut seit Kriegsbeginn Gänse hielt und Kartoffeln anbaute. Frida, die Köchin, hatte daraus einen leckeren Schmaus zubereitet, der dem Braten in besseren Zeiten in nichts nachstand.
Als die Haushaltshilfe Lotte das Essen servierte, blickte Ida in zufriedene Gesichter. Nur ihr Vater reagierte nicht, sondern starrte leer vor sich hin. In dem Augenblick wurde Ida bewusst, dass dies wohl sein letztes Weihnachten sein würde. Sein Arzt hatte ihr neulich die Wahrheit über sein schwaches Herz gesagt und ihr keine großen Hoffnungen gemacht, dass es noch lange schlagen werde. Obwohl Idas Verhältnis zu ihrem Vater nicht besonders herzlich war, tat ihr der Gedanke, ihn zu verlieren, weh. Und außerdem machte sie sich Sorgen, ob ihr Bruder Carl seiner Tochter Freya weiterhin erlauben würde, bei ihnen im Haus zu leben. In dieser Angelegenheit hatte ihr Vater sich mit seiner Ansicht durchgesetzt, dass es für Freya besser wäre, mit ihren Cousinen in der Stadt zu leben als mit den zwei Männern allein auf dem Gut. Im Grunde genommen hieß das im Klartext, dass der alte Johann von Runohr seiner Enkelin das Zusammenleben mit seinem stets betrunkenen Sohn nicht zumuten wollte. Ida befürchtete, dass ihrem Bruder Carl das Wohl seiner Tochter nicht in dem Maße am Herzen lag wie ihrem Vater. Und Carl wäre es wohl auch herzlich gleichgültig, ob er damit das Kleeblatt, wie Lene, Lizzie und Freya sich nannten, trennen würde. Ihr tat Freya wirklich leid. Sie war doch wie ein Kind im Haus. Freya wirkte gequält, als ihr Vater nun laut und mit verwaschener Stimme das Glas auf die herrlichen Gänse von Gut Runohr erhob. Zögernd griffen auch Ole und Henning zu ihren Gläsern, um mit Carl anzustoßen.
Der Anblick ihres Mannes machte Ida das Herz noch schwerer. Er lachte, aber aus seinen Augen sprach der Schmerz über den entsetzlichen Verlust. Natürlich trauerte Ida auch um Albert, so wie sie um den kleinen Max geweint hatte, aber bei Ole war es mehr als nur der Schmerz über den Tod seines Sohnes. Mit Albert war auch die Hoffnung gestorben, dass sein eigenes Fleisch und Blut die Tradition des Rumhauses Danneberg fortsetzen würde. Ida vermutete, dass seine Wahl auf Paul gefallen war allein wegen des Namens Danneberg. Seine Töchter, so glaubte Ole F., würden den Namen ihrer Familie bei der Heirat ablegen, und dann wären die Erben der nächsten Generation keine Dannebergs mehr.
Albert wäre in jedem Fall ein würdiger Nachfolger geworden. Ida würde nie vergessen, wie der junge Soldat vor ihrer Tür gestanden hatte. Er hätte gar nichts sagen müssen. Sie hatte ihm auf den ersten Blick angesehen, dass er der Überbringer einer grausamen Nachricht war. Der junge Mann hatte mit Albert in dem Schützengraben bei Verdun gelegen, als die feindliche Granate eingeschlagen war und ihr geliebtes Kind regelrecht zerfetzt hatte. Wie jedes Mal, wenn Ida daran dachte, liefen ihr die Tränen über das Gesicht.
»Mutti, was hast du?«, fragte Jette erschrocken.
Ida warf ihrer Jüngsten einen warmherzigen Blick zu. Und sie fragte sich, wie so oft, wenn sie ihre Tochter betrachtete, warum außer ihr offenbar keiner je bemerkt hatte, dass sie die Einzige in der Familie mit braunen Augen war. Kurz schweifte sie in Gedanken an den Augenblick in ihrem Leben ab, den sie einerseits bitter bereute, wenngleich er sie in einem bislang nicht gekannten Maß beglückt hatte …
»Sie denkt an unseren geliebten Bruder. Wir sollten unbedingt ein Gebet für Albert sprechen«, schlug Käthe eifrig vor.
»Doch nicht bei Tisch«, widersprach Paul. »Das hättet ihr vorhin in der Kirche machen können!«
»Ich habe im Gottesdienst für ihn gebetet, aber ich finde, wir können es gar nicht oft genug tun«, widersprach Käthe ihrem Cousin.
»Ich bin ganz deiner Meinung«, pflichtete Ida ihrer Ältesten bei. »Vor der Bescherung werden wir ein Gebet für Albert sprechen.«
»Das macht ihn auch nicht wieder lebendig«, brummte Ole F., der zu Idas großem Verdruss nicht mehr allzu viel vom lieben Gott hielt. Dass er an diesem Tag überhaupt mit der Familie in die Marienkirche am Nordermarkt gekommen war, hatte sie viel Überredungskünste gekostet. Als Max tot in seiner Wiege gelegen hatte, war aus dem gläubigen Christen ein Zweifler in Sachen Glauben geworden. Den Rest an Frömmigkeit hatte er verloren, als er von Alberts Tod erfahren musste. Letztlich hatte ihn allein Idas Furcht vor dem Gerede der Leute überzeugt. Was sollten die wohl denken, wenn der Patriarch sich am Heiligabend nicht in der Kirche blicken ließ?
Nachher glauben sie noch, du hältst es jetzt wie dein Bruder und gehst lieber in die dänische Kirche, hatte Ida listig zu bedenken gegeben. Und wenn Ole F. etwas nicht wollte, war es, das dänische Erbe der Mutter nach außen zu tragen. So wie sein Bruder es zu tun pflegte.
Henning sah sich viel mehr als Däne denn als Deutscher. Etwas, das Ole F. ganz und gar nicht verstehen konnte. Er war ein Deutscher wie sein Großvater, der dem Rumhaus zu seiner Blüte verholfen hatte, oder auch sein Vater. Und obwohl seine Mutter dänische Wurzeln besaß, hatte sie ihre Söhne vorwiegend in deutscher Tradition erzogen. Bis auf einige Ausnahmen, die sie ihrem Mann immer wieder abgetrotzt hatte. Manches hatte sie ihren Söhnen aber auch ohne seine Erlaubnis beigebracht. Henning hatte wohl schon als Kind eine starke Affinität zu seiner dänischen Verwandtschaft besessen, während es Ole stets mit den Dannebergs gehalten hatte.
Dieses Thema war auf jeden Fall ein ständiger Zankapfel zwischen den beiden Brüdern. Ida wunderte es, dass sie sich an diesem Abend noch gar nicht über die geplante Volksabstimmung in die Haare geraten waren. Ole missfiel es außerordentlich, dass man den einfachen Leuten so viel Macht gab, darüber abzustimmen, ob ganze Städte und Landstriche in Zukunft zu Dänemark oder Deutschland gehören sollten. Insgeheim befürchtete er nämlich, die Stimmen für Dänemark könnten in der Mehrzahl sein. Er wollte auf keinen Fall, dass seine Stadt dänisch wurde, während Henning die nicht ganz unberechtigte Ansicht vertrat, dass Nordschleswig immer schon zu Dänemark gehört habe. Beide aber beanspruchten eine Parole aus dem Vertrag von Ripen, der einst Schleswig und Holstein zusammengeschweißt hatte, für sich: Up ewig ungedeelt!
Allerdings vertrat Henning den Standpunkt, die Tatsache, dass damals das dänische Königshaus regiert hatte, unterstreiche den dänischen Anspruch auf dieses Gebiet. Das tat Ole als Unsinn ab, weil, wie er sagte, das dänische Königshaus im Jahr 1460 der deutschen Ritterschaft damals umfassende Privilegien hatte erteilen müssen, die man den Deutschen heute nehmen wolle.
Henning hatte sogar angekündigt, im Fall, dass Sonderburg im Rahmen der Abstimmung an Dänemark fiele, ins Rumgeschäft einzusteigen, um die Dänen dort mit Danneberg-Rum zu versorgen. Für Ole F. ein Frevel schlechthin, zumal er seinem Bruder nicht zutraute, den guten Namen der Dynastie angemessen zu vertreten. Schließlich hatte er sich damals von ihrem Vater mit einem ordentlichen Sümmchen dafür auszahlen lassen, dass er seinem Bruder die Geschäfte überließ.
Für Ole war Henning ein reicher Bohemien, der behauptete, dass das Schreiben von Zeitungsartikeln Arbeit sei. In den Augen eines Kaufmanns wie Ole F. war das keine ehrenwerte Beschäftigung für einen erwachsenen Mann. Besonders übel nahm Ole seinem Bruder, dass dieser für die Dannewerk-Bewegung eintrat.
Die Anhänger dieser Bewegung behaupteten, dass alles, was nördlich des in der Nähe von Schleswig befindlichen mittelalterlichen Befestigungswalls der Dänen liege, dänischer Boden sei. Wenn er das wenigstens nur am Familientisch von sich geben würde, pflegte Ole zu beklagen, aber dass er den Unsinn auch noch in Artikeln für die dänische Zeitung, der Flensborg Avis, verbreiten musste, brachte ihn zur Weißglut. Wenn Ole richtig in Fahrt war, beschimpfte er seinen Bruder auch gern mal als »Speckdänen«, wie Deutsche, die für Dänemark angeblich aus rein materiellen Gründen abstimmen wollten, neuerdings gern in der Hitze der Abstimmungskämpfe verunglimpft wurden.
Doch Ole war wohl viel zu angeschlagen, um mit seinem Bruder einen Streit über dieses Thema anzuzetteln. Und auch Henning, dem der Zustand seines Bruders nicht verborgen blieb, war an diesem Abend längst nicht mehr so diskutierfreudig wie sonst. An anderen Tagen hätte es keine fünf Minuten gedauert, und die ungleichen Brüder hätten sich gezankt.
Die einzige kleine Provokation ihres Schwagers hatte Ida glücklicherweise noch rechtzeitig entdeckt, den kleinen Dannebrog, die dänische Fahne aus Papier, die er unauffällig in den geschmückten Baum geschmuggelt hatte. Wenn Ole den entdeckt hätte, hätte es kein Halten mehr gegeben. Natürlich entging ihr keineswegs der suchende Blick ihres Schwagers nach dem kleinen Ausdruck seiner Gesinnung, denn zu einem dänischen Tannenbaumschmuck gehörten die Fähnchen oder zumindest rote und weiße Bänder in den Landesfarben.
Idas und sein Blick trafen sich, und Henning funkelte sie scheinbar strafend an, aber seine Augen strahlten Wohlwollen aus. Er konnte seiner Schwägerin gewiss nicht übel nehmen, dass sie den Stein des Anstoßes noch rechtzeitig entfernt hatte. Aber aus seinen Augen sprach zugleich eine vorwitzige Ankündigung, dass er es noch nicht aufgegeben hatte, dieses Weihnachtsfest mit dänischen Spuren zu versehen. Er zwinkerte seiner Schwägerin zu. Ida schenkte ihm ein Lächeln. Sie war wirklich sehr froh, dass die beiden Streithähne an diesem Abend friedlich waren.
Dafür stritten sich jetzt ihre Kinder. Ida hörte ihre Tochter Helene gerade wenig damenhaft sagen: »Du bist doch zu blöd, einen Rum vom Verschnitt zu unterscheiden!«
»Das hättest du wohl gern!«, konterte Paul.
»Ja, dann erzähl uns doch mal, wie sich ein Rumverschnitt zusammensetzt?«, fragte Lene lauernd. »Na, wie viel reinen Rum muss er enthalten, und wie viel nehmen wir, um die Danneberg-Qualität zu erreichen?«
»Helene! Hör bitte auf, deinen Cousin wie einen dummen Jungen zu behandeln! Das wird nichts an meiner Entscheidung ändern!«, maßregelte Ole seine Tochter.
»Du wirst dich noch wundern, wenn er den guten Namen Danneberg verspielt hat! Wenn du wüsstest, was drüben geredet wird über deinen unfähigen Nachfol…« Lene unterbrach sich hastig.
»Lene, nicht streiten. Heute ist Weihnachten«, mischte sich Käthe ein.
»Ja, Schwesterherz, das Fest der Liebe. Aber nicht, dass ihr später behauptet, ich hätte Vater nicht gewarnt!«, zischte Lene.
Die Antwort war ein lauter Knall, denn Ole hatte mit der Faust auf den Tisch gehauen. Ida mutmaßte, dass er deshalb so scharf reagierte, weil er im Grunde seines Herzens nicht wirklich davon überzeugt war, mit Paul die richtige Wahl getroffen zu haben.
Der kleine Zwischenfall war in dem Moment vergessen, in dem Lotte den Nachtisch, den Milchreis mit den in Rum eingelegten Früchten, servierte, vor allem, als Carl sich eine große Portion der Früchte auffüllte und den Reis nicht anrührte. Es ist zum Schämen, dachte Ida und warf ihrer Nichte einen tröstenden Blick zu. Freya war nämlich anzusehen, wie sehr sie darunter litt, dass ihr Vater sich derart danebenbenahm. Ida fragte sich, ob sein Absturz erst mit dem Tod seiner Frau begonnen oder ob er nicht schon viel früher mit dem Trinken angefangen hatte. Sie erinnerte sich zumindest an ein Saufgelage, das er zusammen mit seinen Schulfreunden auf Gut Runohr zelebriert hatte mit dem Ergebnis, dass er in die Aue hinter dem Haus gefallen war und beinahe darin ertrunken wäre.
Nach ein paar Bissen der köstlichen Nachspeise spürte sie die Wirkung der Rumfrüchte, denn sie trank so gut wie nie Alkohol. Aus dem Augenwinkel beobachtete sie, wie sehnsuchtsvoll ihre Tochter Jette zu den Geschenken unter dem Tannenbaum blickte. Offenbar versuchte sie herauszubekommen, ob sie wohl das heiß ersehnte Akkordeon bekommen würde. Ihr Schwager Henning hatte bei einem Nachbarn eine unbenutzte Quetschkommode entdeckt und ihrer Tochter den Floh ins Ohr gesetzt, sie müsse das Instrument unbedingt lernen. Musisches Talent war ihr schon in die Wiege gelegt. Kein Wunder, bei dem … Erschrocken unterbrach Ida ihren Gedanken. Nein, nicht einmal denken sollte sie daran!
Bevor sie die Familie aufforderte, in die Sofaecke zu wechseln, bat sie die anderen, die Hände zu falten und ein paar Minuten für Albert zu beten. Und zwar jeder für sich. Merkwürdigerweise konnte sie sich in Gedanken gar nicht auf ihren Sohn konzentrieren, sondern wurde mit einem Mal von einer Art Panik ergriffen. Sie spürte beinahe körperlich, dass der Tod ihr in absehbarer Zeit nicht nur den Vater nehmen würde, sondern dass er auch schon wieder um dieses Haus schlich, um sich noch mehr zu holen als ihre beiden Söhne.
Da hörte sie Käthe wie von ferne sagen: »Nun wird alles wieder gut.« Wie gern würde sie den Optimismus ihrer Tochter teilen, doch die Angst ließ sich auch durch diese Worte nicht vertreiben. Im Gegenteil, sie lähmte sie so sehr, dass ihr das Lächeln, das sie für die Familie aufgesetzt hatte, auf den Lippen gefror.
2. Flensburg, Dezember 1919
Der Bootsschuppen war kein komfortabler Ort für ein Stelldichein, aber im Winter der einzige Platz außer dem Lagerraum für die Fässer, in dem sie ein Dach über dem Kopf hatten. Ein heimliches Treffen oben im Rumhaus schien Helene aber im Moment zu gefährlich. Jetzt, wo Paul dort ein und aus ging, wollte sie nicht riskieren, ausgerechnet von ihm erwischt zu werden. Nicht auszudenken, dass ihr Vater von diesem Verhältnis erfuhr. In dem Fall konnte sie ihre Hoffnung darauf, doch den in ihren Augen angemessenen Platz im väterlichen Unternehmen einzunehmen, endgültig begraben.
Helene strich fast zärtlich über das Unterbodenschiff der Augusta, die aufgebockt im Schuppen des Segelvereins lag. Den alten Gaffelkutter hatte ihr Vater einst für den begeisterten Segler Albert auf der Werft von Bootsbauer Isaack zur Jacht umbauen lassen und nun Helene zur Verfügung gestellt. Nicht geschenkt, sondern als eine Dauerleihgabe, betonte er, so als ob er insgeheim doch noch auf Alberts Rückkehr aus dem Krieg hoffte. Noch war sie das Boot nicht allein gesegelt, aber sie konnte kaum das Frühjahr abwarten, wenn die Augusta aus dem Winterlager ins Wasser gelassen wurde. Dann würden auch die heimlichen Treffen einfacher werden. Sie musste nur in einem der kleinen dänischen Häfen anlegen und Klaas an Bord nehmen. Dann konnten sie sich irgendwo auf Anker in einer abgelegenen Bucht ohne Angst vor Entdeckung der Leidenschaft hingeben. Wobei es bislang noch nicht zum Äußersten gekommen war, wie Lene das nannte und wonach Klaas sich verzehrte. Sie küssten sich und streichelten einander in wilder Lust, aber Helenes Angst vor einer ungewollten Schwangerschaft war stärker als die ungezügelte Leidenschaft. Wenn es brenzlig wurde, war stets sie diejenige, die Klaas’ heißes Gemüt zu kühlen verstand. Und dann erinnerte sie ihn wenig romantisch daran, dass er jetzt nicht mit Inken Broders verheiratet wäre, wenn er besser aufgepasst hätte. Klaas war sehr unglücklich in dieser Beziehung, in die er blutjung hineingeschliddert war, aber seinen kleinen Niels, der bald zwei Jahre alt wurde, liebte er über alles. Deshalb, so versicherte er Lene stets mit ehrlichem Bedauern, könne er Inken nicht verlassen. Er war so verzweifelt darüber, dass Lene sich hütete, ihm zu verraten, dass sie auch ohne diese Hürde nicht im Traum daran dachte, ihn zu heiraten. Im Gegenteil, sie sah überhaupt keinen Grund dazu. Der Gedanke, ständig mit ihm zusammen zu sein, schreckte sie eher ab. Sie mochte ihn wirklich von Herzen, wobei er nicht im Geringsten jene inneren Erdbeben in ihr auslöste, wie sie es einmal in einem Roman von Hedwig Courths-Mahler gelesen hatte. Ihre Schwester Käthe verschlang diese Bücher regelrecht, obwohl sie doch am liebsten ihren geliebten Herrn Jesus heiraten würde und keinen Mann aus Fleisch und Blut. In diesen Geschichten glich das Treffen zwischen Mann und Frau stets einem Naturereignis und war mitnichten so profan wie ihre Wiederbegegnung mit Klaas vor nunmehr einem knappen halben Jahr. Ihre Eltern und die Schwestern waren zu einem Besuch bei Onkel Henning auf seinem Anwesen in Sonderburg gewesen. Ihre Abwesenheit hatte Lene ausgenutzt, um Meister Bahnsen an seinem Kupferkessel über die Schulter zu sehen, denn er hatte gerade mit einer neuen Mischung einen preiswerten Verkaufsschlager für die karge Nachkriegszeit geschaffen, der Danneberg einen anständigen Profit einbrachte.
Zu ihrem großen Schrecken war er nicht allein an seinem Arbeitsplatz, sondern ihm assistierte ein hochgewachsener blonder Lockenkopf. Da erkannte sie in ihm den Jungen mit dem ungehobelten Mundwerk, der sie als kleines Mädchen einmal ausgelacht hatte, weil sie ihm prophezeit hatte, dass sie später einmal bei Danneberg das Sagen haben würde. Nun trug er die Schürze der Destillateure, doch bevor sie dem Ausdruck verleihen konnte, hörte sie ihn bereits grinsend sagen: »Oh, die Frau Direktorin persönlich!«
»Klaas, was fällt dir ein?«, maßregelte der alte Bahnsen den Jungspund. »Das ist Lene, Dannebergs Tochter, an der in der Tat ein Destillateur verloren gegangen ist.« Er wandte sich an Lene. »Und das ist mein Ältester Klaas. Er hat bei Jensen gelernt, und nun hat dein Vater ihn eingestellt.« In seiner Stimme schwang Stolz mit. »Klaas hatte die Idee zu dem Verschnitt für jedermann.«
»Du hast es ja weit gebracht, und richtig Deutsch sprechen kannst du inzwischen auch«, bemerkte Lene. Es sollte spöttisch klingen, aber im Grunde genommen imponierte ihr der junge Mann, der schon als Knabe gewusst hatte, dass er einmal bei Danneberg in die Fußstapfen seines Vaters treten würde. Und der seine Pläne im Unterschied zu ihr auch verwirklicht hatte.
»Wenn ich das gewusst hätte, dass du wirklich eine Danneberg bist, dann wäre ich dir damals ganz sicher nicht so dumm gekommen. Ich hatte dich für die Tochter der Haushälterin gehalten.« Grinsend streifte er die Hände an seiner Schürze ab, bevor er ihr versöhnlich die rechte Hand entgegenstreckte.
»Ihr kennt euch schon?«, fragte sein Vater erstaunt.
»Wir sind uns einmal begegnet, aber das ist schon lange her!«, erwiderte Lene. Sie schnupperte am Inhalt des Kessels und rümpfte die Nase. »Hier riecht man den Kartoffelschnaps durch.«
»Mein Reden«, pflichtete ihr der alte Bahnsen bei. »Lieber eine Mark teurer, aber es darf nicht nach billigem Fusel schmecken.«
»Das finde ich auch. Überhaupt, ich bin dafür, neben dem Verschnitt wieder mehr puren Jamaikarum in den Handel zu bringen«, verkündete Lene.
»Ich bin ganz Ihrer Meinung, Fräulein Danneberg, aber im Moment kriegen wir den kaum verkauft. Da müssen wir auf bessere Zeiten hoffen«, entgegnete Klaas Bahnsen.
Das war der Anfang einer Fachsimpelei geworden, der Meister Bahnsen amüsiert lauschte. Schließlich hatte er dem angeregten Austausch jedoch ein Ende bereitet und seinen Sohn zur Arbeit angetrieben. Zufälligerweise fand an diesem Sommertag ein Jahrmarkt statt, und Klaas hatte ihr noch zugeraunt, ob sie nicht später gemeinsam einen Bummel über die Exe unternehmen wollten. Lene hatte sich nichts dabei gedacht, als sein Vater bei diesen Worten, die offenbar auch an sein Ohr gelangt waren, missbilligend den Mund verzog. Sie hatte spontan zugesagt. Der Destillateur gefiel ihr. Aus dem frechen Burschen war ein wirklich hübscher junger Mann geworden. Er sah jedenfalls wesentlich besser aus als die Kavaliere der Jungenschule, die sich früher darum gerissen hatten, Lizzie auf dem Schulweg den Ranzen zu tragen. Seit Lizzie mit diesen Burschen gemeinsam die Reifeprüfung machte, wagte das keiner mehr. Diejenigen, die sie für ihre guten Leistungen beneideten, mieden sie, und die anderen, die sie bewunderten, wollten sich nicht dabei erwischen lassen, wie sie der Streberin die Tasche trugen. Und Lizzie bestätigte Lenes Vorurteil, dass diese Kerle zu unreif waren, um sie als Männer ernst zu nehmen. Das kam dem entgegen, was Lene gern zu verkünden pflegte. Dass es in dieser Stadt keinen Burschen gab, der es wert war, einen einzigen weiteren Gedanken an ihn zu verschwenden. Jedenfalls stimmte es bis zu dem Tag, an dem sie Klaas Bahnsen wiedergetroffen hatte. Das war zweifelsohne ein echter Kerl … Wie gut, dass Lizzie und Freya ihn nicht kannten, weil sich ihre Kreise nicht berührten.
Sie hatten viel Spaß auf dem Fest gehabt, im Kettenkarussell herumgealbert, die Schiffschaukel zum Überschlag gebracht und den Lukas bis zum Anschlag getrieben. Klaas hatte ihr reichlich Komplimente gemacht und verwundert festgestellt, dass man mit so einer hübschen jungen Dame viel Spaß haben konnte. In der Schiffschaukel hatte sie den Ring an seiner rechten Hand entdeckt, aber nicht nachgefragt, was das zu bedeuten hatte. Auch nicht, als er sie zu später Stunde bis zur Haustür an der Schiffbrücke gebracht und sich mit einem innigen Kuss von ihr verabschiedet hatte. Lene hatte für den Bruchteil einer Sekunde mit dem Gedanken gespielt, dem frechen Burschen eine Ohrfeige zu verpassen, aber dann hatte sie den Kuss erwidert und ihn zu ihrer eigenen Überraschung genossen. Genauso wie seine Hände, die derweil sanft ihren Nacken massierten. Sie war danach ziemlich verwirrt in ihr Bett gefallen, weil ihr Körper in hellem Aufruhr war, aber sie nichts von dem spürte, was Freya über die Liebe zu wissen glaubte. Ihre Cousine verschlang ebenfalls alle Liebesromane, die sie in die Hände bekam. Käthe und ihre Cousine pflegten einen regelrechten Tauschhandel mit derartigen Büchern. Freya behauptete, es wäre so, als würde man schweben, wenn man sich verliebte. Und das Herz würde einem bis zum Hals schlagen. Davon merkte Lene nichts. Bei ihr hatte der Kuss ganz woanders ein heftiges Pochen ausgelöst.
Nein, verliebt war sie ganz offensichtlich nicht in Klaas. Deshalb kam sie sich auch nicht wie eine Verräterin vor, dass sie ihrer Schwester Lizzie und ihrer Cousine Freya immer noch nichts von seiner Existenz verraten hatte. Schließlich hatte sie als Anführerin ihres unzertrennlichen Kleeblatts die Parole ausgegeben, einen gewissen Abstand zu jungen Männern zu halten. Die anderen beiden waren sich darin mit ihr einig, nicht von der Schulbank direkt vor den Traualtar zu treten. Für die meisten von Lenes und Freyas Mitschülerinnen war das Oberlyzeum nur ein Ort, um eine gewisse Bildung zu erlangen, damit sie später als Gattinnen auf dem gesellschaftlichen Parkett glänzten, auch wenn der Abschluss sie durchaus dafür qualifizierte, einen Beruf auszuüben. Die Vorbilder des Kleeblatts aber waren jene modernen Frauen, die in ihrer Lieblingszeitschrift Die Dame porträtiert wurden. Diese einmal in der Woche erscheinende Frauenzeitschrift hatte ihnen Onkel Henning eines Tages aus Berlin mitgebracht. Lene und Lizzie waren sofort Feuer und Flamme gewesen. So extravagante Kleidung und derart spannende Geschichten konnte es ihrer Meinung nach nur in der Großstadt geben.
Freya war anfangs etwas skeptischer gewesen, aber auch nur, weil sie das missbilligende Urteil ihrer Tante Ida fürchtete, die angesichts dieser »Amazonen«, wie sie die abgebildeten Frauen bezeichnete, ihre Nase rümpfte. Doch dann hatte sich auch Freya dem aufregenden Lebensstil der Hauptstadt nicht länger verschließen können. Alle drei waren sie regelrecht wild nach dem Blatt geworden und hatten Onkel Henning bekniet, ihnen von jedem seiner Berlinbesuche – und er hatte dort häufig beruflich zu tun – eine neue Zeitschrift mitzubringen. Er erfüllte ihnen den Wunsch, bis es ihm zu bunt wurde und er einen Freund bei dem Verlag, in dem sie erschien, bat, ihm jede Woche ein Exemplar zu schicken. So waren sie nun stets auf dem Laufenden, was die moderne Frau trug, kaufte, las, im Kino sah, wie sie sich einrichtete und was sie dachte.
Da die Titelbilder von bekannten Künstlern gestaltet wurden, rissen sie sich darum, diese als Deko für ihre Zimmer zu verwenden. Lene blickte auf jene Klassenkameradinnen herab, die nach dem kaiserlichen Frauenbild, das ihnen ihre Eltern eingetrichtert hatten, nur ein Ziel verfolgten: eine gute Partie zu machen. Und die nicht einmal den heimlichen Wunsch hatten, anders zu leben als ihre Mütter. Um nicht so zu enden, war es zu ihrem Schwur gekommen, sich von den Herren der Schöpfung vorerst fernzuhalten. Trotzdem dachte sie nicht im Traum daran, nach dem Schulabschluss kleine Quälgeister zu unterrichten, sondern lauerte nur auf eins: dass Paul ein unverzeihlicher Fehler unterlief! Dann käme ihr Vater nicht länger an seiner Tochter vorbei! Dessen war sie sich sicher.
Um ihr schlechtes Gewissen Freya und Lizzie gegenüber zu beruhigen, redete sich Lene ein, dass der Austausch heimlicher Zärtlichkeiten doch nichts an ihrem Vorsatz änderte, einen eigenen Weg im Leben einzuschlagen. Aber würden die anderen beiden diesen feinen Unterschied auch wirklich verstehen? Lene befürchtete, dass sie dafür wenig Verständnis hätten. Und schon gar nicht dafür, dass sie diese Zärtlichkeiten mit dem Ehemann von Inken Broders austauschte. Die war nämlich einmal in ihrer Klasse auf dem Lyzeum gewesen und hatte die Schule dann wegen einer angeblichen mysteriösen Krankheit verlassen müssen. Wenig später hatten die Danneberg-Schwestern und ihre Cousine erfahren, dass sie sich mit einem jungen Mann danieder gelegt hatte, wie in der Schule hinter vorgehaltener Hand gemunkelt wurde. Dass Klaas der Übeltäter war und wie ein Mann zu seiner Verantwortung gestanden hatte, obwohl er sein Herz nicht an Inken Broders verloren hatte, das hatte Lene erst neulich aus seinem Mund gehört. Da wollte sie ihr Techtelmechtel natürlich sofort beenden, aber Klaas hatte sie angefleht, ihn nicht zu verlassen, und ihr eine Liebeserklärung gemacht. Daraufhin sah sie über den »kleinen Makel« hinweg, denn Klaas verstand es, in ihr eine bis dahin unbekannte Lust zu entfachen. Es musste ja keiner erfahren!
Doch wie sie es drehte und wendete und sich einredete, dass das kein Verrat gegenüber ihren Vertrauten war, ein Rest an Unwohlsein blieb bestehen. Sie hatten sich nun einmal geschworen, ein unzertrennliches Kleeblatt zu bleiben und keine Geheimnisse voreinander zu haben. Und dieses Versprechen brach sie mit ihrer Heimlichtuerei ganz sicher. Aber was sollte sie tun? Ihnen verkünden, dass sich die Regeln geändert hatten? Dass sie sich zwar mit einem Mann vergnügen, aber dabei nicht ihr Herz verlieren durften? Das wäre zumindest bei Freya verlorene Liebesmüh. Lene befürchtete nämlich, dass ihre Cousine sich in den ersten Mann, der sie anschmachtete, rettungslos verlieben und ihn vom Fleck weg heiraten würde.
Jedenfalls beneidete sie Inken Broders nicht darum, dass sie Frau Bahnsen war. Das nämlich wäre das Letzte, was Lene anstrebte. Aber das würde sie einer Freya kaum vermitteln können, die »von butterweichen Knien und aus der Brust springenden Herzen« träumte.
Wenn es nach Lene ginge, würde es genügen, Klaas einmal in der Woche privat zu treffen. Dass sie ansonsten jede Gelegenheit nutzte, ihn an seinem Arbeitsplatz zu besuchen, stand auf einem anderen Blatt. Aber auch das war in den letzten Wochen zu ihrem großen Bedauern seltener geworden, seit nun auch Paul unter Meister Bahnsens Fittichen stand und ständig am Kessel herumlungerte. So nutzte Lene neuerdings auch ihre geheimen Treffen, um Klaas über die neuesten Mischungen auszufragen. Er hatte das gar nicht so gern, wenn sie nach einem innigen Kuss plötzlich nach der Möglichkeit fragte, wann man endlich wieder edlere Mischungen kreieren konnte als gleich nach dem Krieg.
Klaas wollte Lene viel öfter sehen. Am liebsten jeden Tag. Selbst zwischen den Jahren, wo er eigentlich bei seiner Familie sein sollte, weil ihr Vater den Angestellten verordnet hatte, vier ihrer zwölf gesetzlich vorgeschriebenen Urlaubstage zu nehmen. Klaas hatte vehement darauf bestanden, sich von Frau und Kind fortzuschleichen.
Jetzt war sie allerdings froh, dass sie sich mit ihm verabredet hatte, denn zu Hause war es recht öde. Freya, Lizzie und ihre Mutter waren zum Gut Runohr gefahren, weil es dem Großvater schlechter ging. Eigentlich hatten sie die Silvesterfeier auf dem Gut absagen wollen, aber der Großvater bestand darauf, dass alles wie geplant stattfinden sollte. Es stirbt sich besser, wenn ich euch unten feiern höre, hatte er sehr zum Kummer ihrer Mutter verkündet.