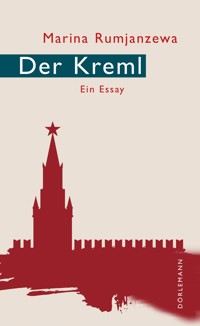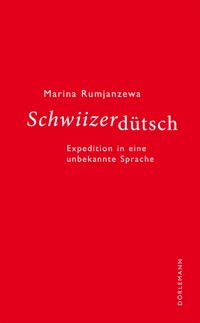
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Dörlemann eBook
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Deutsch
Was ist in der Schweiz eigentlich los? Allseits wird Hoch- durch Schweizerdeutsch ersetzt – auch im Geschriebenen. Was steckt dahinter? Ist Schwiizerdütsch eigentlich ein Dialekt oder eine »richtige« Sprache? Was macht es zum Sonderfall weltweit? Ausgehend von diesen Fragen macht sich Marina Rumjanzewa in ihrem neuen Buch auf eine sprachliche Expedition. Mit dem Blick einer zugezogenen »Ausländerin« und studierten Linguistin zeigt sie scharfsinnig und humorvoll, welche Bedeutung Schweizerdeutsch heute im Alltags- und Berufsleben hat, auch hinter den Kulissen der Schweizer Fernseh- und Zeitungsredaktionen. Begleitet von verschiedenen Sprachspezialisten geht sie dem Phänomen Schweizerdeutsch auf den Grund, betrachtet es in der internationalen Landschaft der Sprachen und Dialekte und durchleuchtet jene globalen Prozesse, die direkte Folgen für die Sprachsituation in der Schweiz hatten. Aus dem Buch erfährt man unter anderem, warum man heute in allen Sprachen in »Stummelsätzen« und mit Fehlern simst, in der Deutschschweiz auch noch in Mundart;oder, warum Plattdeutsch heute offiziell eine Sprache ist;oder, warum die Deutschschweizer eine eigene Schriftsprache im 16. Jahrhundert aufgegeben haben. Die Autorin geht auch der Frage nach, in welche Richtung Schwiizerdütsch sich weiter entwickeln könnte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Marina Rumjanzewa
Schwiizerdütsch
Expedition in eine unbekannte Sprache
Dörlemann
VORGESCHICHTE
Ich komme aus einem Land, in dem es so gut wie keine lebendigen Dialekte gibt. So hatte ich als fünfzehnjährige Moskauerin nur eine sehr vage Vorstellung davon, was ein Dialekt überhaupt ist. Während der Ferien in Südrussland hörte ich, wie die Einheimischen unter sich ein paar unverständliche Wörter gebrauchten und das ›G‹ anders als wir aussprachen – das, dachte ich, sei ein Dialekt.
Und dann machte ich ein Sprachpraktikum. Ich war an einer sogenannten Schule »mit erweitertem Deutschunterricht«, wo wir jeden Tag Deutsch hatten, und in den Sommerferien nach der achten Klasse hat man uns an die Linguistische Uni geschickt. Wir mussten Bänder vom deutschen Tonarchiv anhören – mit authentischen, von Muttersprachlern gesprochenen Aufnahmen, was in der Sowjetunion eine seltene und kostbare Möglichkeit war.
Als wir am ersten Tag ankamen, war schon alles im Sprachlabor vorbereitet: Jedem war eine Kabine zugewiesen, die mit vielen Spulenbändern in Kartonhüllen verstellt war – das war das Pensum für die ganze Praktikumszeit. Auf der ersten Schachtel, die ich in die Hände nahm, stand geschrieben: »Schweiz, St. Gallen-Dialekt«. Ich versuchte, mir etwas darunter vorzustellen – ein Dialekt von einem heiligen Gallen? … Was mochte das wohl sein? Unten wurden die Aufnahmen in einer Liste aufgeführt, es waren irgendwelche Dialoge – in der Bäckerei, am Postschalter, so etwas in der Art.
Ich war schon genug verwirrt, doch als ich das Band anzuhören begann, war die Verstörung komplett. Ich konnte damals schon recht gut Deutsch wegen der Schule, ich bekam auch Privatunterricht – doch von dem, was ich auf dem Band hörte, verstand ich nicht nur kein einziges Wort, es konnte für meine Begriffe unmöglich die deutsche Sprache sein.
Ich stoppte das Band, schaute die anderen Schachteln durch und in allen, ausnahmslos allen, waren Bänder mit Schweizer Dialekten – Aargau, Appenzell, alles Namen, die ich vorher nie gehört hatte, und wenn ich in die Bänder reinhörte, klang es überall nach Abrakadabra-Einerlei … Waren das jetzt Dialekte? Sollte ich mir das jetzt die ganze Zeit anhören? Sollte das mein Sprachpraktikum sein?
Ich ging zu den Assistenten und bat sie, mir andere Bänder zu geben. Das war ihnen zu kompliziert, sie hatten schon alle Pensen »regalweise« verteilt, ich solle, schlugen sie mir vor, die Bänder selber mit meinen Mitschülern tauschen. Das versuchte ich auch und konnte so einen Teil der Bänder wirklich loswerden, bekam im Tausch dafür eine Erzählung von Heinrich Böll, etwas zur Geschichte von Dresden, ein paar andere Aufnahmen dazu, doch auf den meisten Bändern mit Schweizer Dialekten blieb ich sitzen und, nachdem ich mit den »deutschen« Aufnahmen fertig war, nahm ich sie in Angriff.
Morgens lief es noch gut, nach einer Zeit begann ich dann, einzelne Wörter zu erkennen, manchmal den Sinn der Sätze zu erahnen, es wurde sogar spannend, nur war das dermassen anstrengend, dass ich irgendwann das Anhören immer abbrechen musste, weil mein Kopf zu dröhnen begann und alles nur noch nach einem Wortbrei klang. Danach sass ich bis zum Mittag, bis wir alle nach Hause gehen durften, einfach in meiner Kabine und wartete, mit benebeltem Kopf, miserabel gelaunt, während meine Mitschüler all die tollen Aufnahmen abhörten, ihr Deutsch-Verständnis erweiterten, die richtige Aussprache übten, und ich litt hier für etwas völlig Unnötiges – so viel verlorene Zeit … Wenn ich damals gewusst hätte, was für ein Zeichen mir das Schicksal gab, wie es regelrecht mit dem Zeigefinger auf etwas deutete, was später einmal zu einem grossen Thema in meinem Leben werden sollte – Schweizerdeutsch.
Doch vorher absolvierte ich die Schule und dann das Germanistik- und Linguistikstudium an der gleichen Uni, an der ich im Sprachpraktikum gewesen war. Danach unterrichtete ich ein Jahr an einer anderen Uni und dann wurde ich Journalistin. Ich schrieb zu Kulturthemen für Moskauer Zeitungen und Zeitschriften, drehte fürs Fernsehen Beiträge und Filme und hatte mit der deutschen Sprache nicht viel zu tun.
Bis ich 1990 mit 32 Jahren einen Schweizer heiratete und nach Zürich umzog. Und da geriet ich gleichzeitig an zwei Sprachfronten: Im Beruf wechselte ich zu Deutsch, und im Privatleben war ich mit Schweizerdeutsch konfrontiert. Konfrontiert ist milde gesagt, es war ein Aufprall auf eine Sprache, die ich nicht verstand, die ich aber ab sofort existenziell fürs Leben brauchte. Die Mundart verstehen zu lernen, war nur das eine, das andere war, die Mundart zu begreifen – ihre Rolle im Zusammenspiel mit Hochdeutsch, ihren Stellenwert bei den Menschen, all die Inhalte und Emotionen, mit denen sie beladen war, etc., etc. Es dauerte ein paar Jahre, bis ich mit all dem zurechtkam.
Doch das alles war nur die Vorgeschichte zu meiner Geschichte mit dem Schweizerdeutschen. Richtig angefangen hat sie Anfang der 2000er Jahre, als sich die Gebrauchsart der Mundart plötzlich zu ändern begann. Und zwar so radikal, dass es mir vor Staunen den Atem verschlug: Wieso kam das jetzt? Was steckte dahinter? Wohin konnte es führen? Ich begann zu ermitteln – sprach mit Linguisten, verfolgte Publikationen, recherchierte selbst. 2012 machte ich meinen ersten Beitrag zum Thema Schweizerdeutsch fürs Schweizer Fernsehen, schrieb bald darauf einen Artikel für die Neue Zürcher Zeitung und wurde danach sogar – hätte ich das je gedacht? – ein paar Mal zu Podiumsgesprächen eingeladen.
Damit war aber meine Auseinandersetzung mit dem Thema keineswegs beendet, denn die angefangenen Änderungen sind immer noch in vollem Gange und ich verfolge sie weiterhin. Einiges ist passiert inzwischen, vieles ist klar geworden, doch viele Fragen bleiben immer noch offen, auch die Frage, die mich persönlich am meisten interessiert: Wohin kann das Ganze führen? Wie mag wohl die Sprachsituation in der Deutschschweiz in der Zukunft sein?
1Ein falscher Dialekt
Sicher hätte mich das Ganze nie so gepackt, hätte ich zum Zeitpunkt, als sich die ersten radikalen Neuerungen zeigten, nicht bereits bestimmte Sachen gewusst. Einerseits war mir schon aus eigener Erfahrung klar, wie Schweizerdeutsch im realen Leben funktionierte, und andererseits wusste ich noch von meinem Studium, was ein Dialekt als solcher, aus der Sicht der Linguistik, ist.
Und ein Dialekt ist nicht das, was ich von Russland her kannte, wenn Menschen in verschiedenen Landesteilen ein paar Laute eigen aussprechen, ein paar eigene Wörter gebrauchen – so etwas wird »dialektale Färbung« genannt. Ein richtiger Dialekt ist meist in allem eigen – in der Aussprache, in der Grammatik, im Wortschatz. Von der Materie her ist er eigentlich eine selbständige Sprache, nur hat er einige Besonderheiten in der Verwendungsart.
Erstens werden Dialekte nur gesprochen, schreiben tut man in der Standardsprache – ein Grundmerkmal der Dialekte weltweit ist ihre Mündlichkeit. Genau genommen sind »mündliche« Dialekte »gelegentlich schriftlich«, das heisst: Manche Menschen schreiben ab und zu etwas in Mundart – meist kurze Sachen – natürlich jeder auf seine eigene Art, denn Rechtschreiberegeln wie in einer Standardsprache gibt es für Dialekte nicht. Manchmal gibt es in den Mundartregionen Dialektliteratur, doch das ist in der Regel etwas für relativ wenige Fans. Die meisten Menschen, die Dialekt sprechen, können ihn – vor allem in längeren Texten – nur schwer lesen, da sie unter anderem im Mundartlesen nicht geübt sind.
Zweitens, habe ich im Studium gelernt, besteht eine weitere Besonderheit der Dialekte darin, dass sie vorwiegend im Alltag und in informellen Situationen gesprochen werden: Im offiziellen Rahmen, in der Kultur, in den Medien, in der Ausbildung etc., spricht man die Standardsprache. So herrscht in Mundartgebieten die sogenannte Diglossie, eine Form des gesellschaftlichen Bilinguismus, der Zweisprachigkeit, in der eine ganze Gesellschaft lebt. Dabei haben beide Sprachen unterschiedliche Funktionen, werden in unterschiedlichen Kontexten benutzt und haben dadurch einen unterschiedlichen Status. In der Linguistik werden sie traditionell als low und high bezeichnet, bezogen auf die Verwendungsbereiche: Dialekte werden mündlich im Alltag gebraucht – in der Standardsprache schreibt man alles und spricht in öffentlich-offiziellen Bereichen.
Eine weitere Besonderheit der Dialekte ist, dass nicht die ganze Bevölkerung eines Landes sie spricht. Ihr Gebrauch begrenzt sich tendenziell auf ländliche Gebiete und auf weniger gebildete Bevölkerungsgruppen. Doch da gibt es, wurde mir an der Uni beigebracht, einige Ausnahmen, dazu gehört im deutschsprachigen Raum die Deutschschweiz – dort sprechen alle Bevölkerungsgruppen im Alltag Mundart. Warum das so ist, wurde in meinem kurzen und recht allgemein gehaltenen Dialektologiekurs nicht näher erklärt, ich fragte auch nicht, so sehr interessierte es mich damals nicht.
Und nun kam ich 1990 in die Deutschschweiz und fand hier die Sprachsituation so vor, wie es mir an der Uni in Moskau beigebracht worden war: Es herrschte jene »funktional-differenzierte Diglossie«, wenn sie auch nicht in allem gerade typisch war. So sprachen hier in der Tat alle Menschen unter sich Mundart. Und obwohl ich das theoretisch wusste, war es ein Schlag für mich. Denn ganz konkret bedeutete das, dass ich nichts von dem verstand, was man um mich herum redete.
Es war ganz anders als in Deutschland, wo ich zuvor schon gewesen war. Ich war dort nur in Grossstädten unterwegs und hatte nicht einmal jemanden getroffen, der einen Dialekt sprach. Manchmal hörte ich auf der Strasse jemanden dialektal gefärbt sprechen, doch das konnte ich problemlos verstehen, denn Dialektalfärbungen sind allgemein gut verständlich für jemanden, der die Standardsprache beherrscht.
Doch in der Schweiz sprachen alle und überall einen richtigen Dialekt – Bauern wie Professoren, Menschen in einer Bäckerei wie auch Journalisten in einer Zeitungsredaktion. Natürlich wechselte jeder auf Hochdeutsch, wenn man merkte, dass ich Schweizerdeutsch nicht verstand. Mein Mann sowie meine neuen Freunde und Bekannten sprachen mit mir ohnehin nur Hochdeutsch. Doch das änderte nichts daran, dass sich das ganze Leben um mich herum in Mundart abspielte, und das betraf nicht nur praktisch-alltägliche Dinge, sondern zu meiner Überraschung auch alles, was zwischen Menschen privat ablief. Als ich das realisierte, bekam Schweizerdeutsch eine völlig neue Bedeutung für mich.
Als ich mich entschieden hatte, in die Schweiz zu ziehen, hatte ich nämlich gedacht, ich werde hier keine Sprachprobleme haben, mein Deutsch würde mir reichen, Mundart sei sowieso etwas Zweitrangiges, so eine Art »Nebensprache« für die praktischen Sachen des Alltags. Dabei deckte sie, wie ich nun feststellte, auch einen für jede Sprache superwichtigen Bereich ab: die private, zwischenmenschliche Kommunikation. Eigentlich hätte ich mir das schon früher denken können, doch, wenn man so etwas wie eine Diglossie nur theoretisch als abstraktes Modell und nicht aus eigener Erfahrung kennt, kann man sich sehr schlecht vorstellen, was sie für das reale Leben bedeuten kann. Im Laufe der Jahre habe ich noch viel mehr herausgefunden, damals, gerade nach meiner Ankunft, begriff ich erst einmal das Wichtigste: Mundart ist in der Deutschschweiz die »Hauptsprache«, allein mit Hochdeutsch werde ich nie richtig am Leben teilhaben können und für die Menschen immer eine Fremde bleiben. Das wollte ich auf keinen Fall.
Es hiess also, Mundart möglichst schnell wenigstens verstehen zu lernen. Von einer Hamburgerin, die schon lange in der Schweiz lebte, hörte ich aber, dass sie etwa zwei Jahre gebraucht hatte, bis sie definitiv alles verstand. Das war mir zu lang, aber so, wie es aussah, sollte es bei mir auch nicht viel anders werden. Denn alle meine Bekannten wechselten in meiner Anwesenheit konsequent ins Hochdeutsche. Das machte man natürlich aus Rücksicht mir gegenüber, doch diese Rücksicht, wie sehr ich sie auch schätzte, musste ich abblocken, wollte ich das Lernen von Schweizerdeutsch beschleunigen. Deshalb begann ich allen zu sagen, dass ich wegen meines Studiums Mundart schon ziemlich gut verstehen würde. Das stimmte nicht, aber der Trick funktionierte: In meiner Anwesenheit begannen die Menschen wenigstens unter sich Mundart zu sprechen, und das war der Durchbruch – ab da ging es voran.
Natürlich nicht sofort. Anfangs ging es mir nicht viel anders als damals bei meinem Sprachpraktikum in Moskau: Ich sass unter Menschen irgendwo bei einem Essen oder Glas Wein, und alle um mich herum redeten nonstop über Gott und die Welt, und ich strengte mich nach allen Kräften an und versuchte, etwas zu verstehen, und nach ein paar Stunden begann mein Kopf zu dröhnen, alle Wörter verschmolzen zu einer Sauce, oft bekam ich Kopfschmerzen, gegen Ende eines langen Abends mit vielen Menschen wurde mir fast »trümmlig«. Doch ich erreichte, was ich wollte: Nach einigen Monaten konnte ich mindestens im Grossen und Ganzen verstehen, was man um mich herum redete. Sicher half mir auch, dass ich gewisse grammatikalische und phonetische Gesetzmässigkeiten recht schnell erkannte, da nützte mir mein Studium in der Tat.
Am Anfang meiner Lernattacke holte ich mir noch aus der Bibliothek einen Mundart-Lernkurs. Dabei waren eine Kassette und eine Broschüre mit der Grammatik und mit Beispielen in geschriebener Mundart. Das war das erste Mal, dass ich Schweizerdeutsch als Schriftbild in der graphischen Darstellung sah, und diese irritierte mich dermassen, dass es mehr störte als half. Ich legte die Broschüre zur Seite und konzentrierte mich auf die Kassette, auf der es unter anderem Mani Matters Ds Lied vo de Bahnhöf gab. Ich mochte das Lied sofort und studierte es von A bis Z. Das war mein erstes Erfolgserlebnis: Endlich verstand ich von Anfang bis Ende etwas Längeres und Zusammenhängendes in Mundart. Ich versuchte sogar, Schweizerdeutsch auf die Zunge zu kriegen – wiederholte Zeilen, feilte an der Aussprache, lernte fast das ganze Lied auswendig. Das machte ich nach Gehör und musste immer wieder meinen Mann nach der Bedeutung der Wörter fragen. Als er merkte, dass ich mit Mani Matter Mundart »übte«, sagte er als Erstes: »Das ist aber Berndeutsch.«
Das war der falsche Dialekt! Genauer, er war fehl am Platz. Wir lebten eben in Zürich und mein Mann sprach Baseldeutsch. Das war mein nächstes Problem – verschiedene Dialekte, die ich voneinander schlicht nicht unterscheiden konnte. Ich fand es frappierend, wie meine Schweizer Freunde jeden nach der Sprache »lokalisieren« konnten. Wenn man sich etwa an den Namen eines Menschen nicht erinnerte, sagte man: »Weisst du, der grosse Blonde, der Walliser?« – und alle wussten sofort, wer gemeint war.
Doch solche Zuordnungen stiessen bei mir auf taube Ohren. Ich kannte damals das Land noch schlecht und verschiedene Orte, geschweige denn die damit verbundenen »Lebenswelten« und die verschiedenen Dialekte konnte ich mit nichts assoziieren. Ich hörte nur füf oder fiif oder feuf, doch es waren für mich einfach Varianten der gleichen Sprache – vom Schweizerdeutschen. Auf die »Lokalisierung« als solche war ich ohnehin nicht eingestellt – das kannte ich von meiner Muttersprache her nicht.
Russisch ist stark soziokulturell gespalten, die regionalen Färbungen sind aber sehr schwach (aus verschiedenen historischen Gründen, die Hyperzentralisierung des Staates seit dem 16. Jahrhundert ist einer davon). Und so, wenn ich Russen sprechen höre, erfahre ich aufgrund ihrer Sprache sehr viel über sie, aber ich kann, ausser, wenn sie gerade das ›G‹ speziell aussprechen, nie erraten, woher jemand kommt. Dass ich das auch in der Schweiz nicht erraten konnte, störte mich überhaupt nicht. Zwar nahm ich mir später einmal vor, Dialekte unterscheiden zu können, dies aber allein aus Interesse, es gab für mich keine reale Notwendigkeit dafür. Doch so ein abstraktes Wollen ohne Bedarf half nicht. Das Gehirn arbeitet ja bei der Sprache sehr viel im Unbewussten – ordnet Sachen ein, legt sie in den richtigen »Schubladen« ab, sortiert nach der Wichtigkeit – mein Gehirn stufte offenbar die Dialektzuordnung von Anfang an als eine überflüssige, irrelevante Aufgabe ein.
Sogar heute, nach 30 Jahren in der Schweiz, nachdem ich hier schon mehr oder weniger überall gewesen bin, nachdem ich fürs Schweizer Fernsehen quer durch Städte und Dörfer gereist bin und über hundert Interviews gedreht habe, bei denen Menschen in Mundart sprachen, kann ich Dialekte nicht zuordnen, ausser dem Berndeutschen. Sicher hat es einige sehr markante Merkmale, doch ich vermute, das verdanke ich nicht zuletzt dem Lied vo de Bahnhöf.
Was ich auch nicht kann: Ich spreche selber nicht Mundart. Anfangs dachte ich, es käme mit der Zeit von allein, ich habe auch die ersten kleinen Schritte gemacht – mal ein Wort gesagt, mal einen halben Satz. Doch dann stockte ich wieder. Erstens: Selber Schweizerdeutsch zu sprechen, erwies sich als nicht existenziell. Ab einem gewissen Moment lief die Kommunikation mit Menschen problemlos: Ich verstand alle in Mundart, alle verstanden mich auf Hochdeutsch. Zweitens schrieb ich bereits für die Medien auf Deutsch. Und dort für mich einen neuen sprachlichen Ausdruck zu finden und mich gleichzeitig in Mundart ausdrücken zu lernen, das war zu viel aufs Mal, das schaffte ich nicht.
Zudem kam bald meine Tochter zur Welt und mein Sprachmanagement wurde noch komplizierter. Mit ihr sprach ich Russisch, ich hätte es überhaupt nicht anders gekonnt und ich wollte auch, dass sie meine Muttersprache lernt. Ausserdem »durfte« ich mit ihr gar nicht Schweizerdeutsch sprechen. Denn, will man einem mehrsprachig aufwachsenden Kind das Sprachenlernen nicht erschweren, sollte eine Person bekanntlich die Sprachen lieber nicht vermischen, und vor allem sollte man keinesfalls eine Sprache sprechen, die man selber nicht fehlerfrei beherrscht. Damit starb mein Mundartsprechen definitiv.
Und so läuft heute meine Kommunikation mit Deutschschweizern sozusagen zweisprachig: Die meisten Menschen sprechen mit mir Mundart, ich spreche Hochdeutsch. Natürlich verwende ich öfters Mundartwörter und -ausdrücke, doch nicht übertrieben viele. Es sind vielleicht ein paar Dutzend: weisch wie!, öbbedie, ume, nei!, Gopferdeli! oder s’isch mer niene rächt.