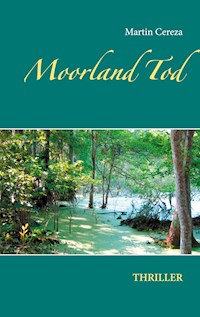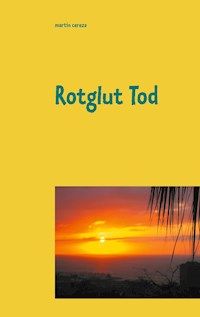Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
SECOLO Im Wind des Lebens Die bezaubernde Geschichte einer eigenwilligen, hingebungsvoll lebenslustigen Frau, deren aufregendes Leben sich über ein ganzes Jahrhundert spannt. Kriege, Zwischenkriegszeit, Wiederaufbau, Wohlstand und Leid, alles kann sie nicht nur bezeugen, sondern musste es am eigenen Leib ertragen und erleiden. Entgegen allen Widrigkeiten, Rückschlägen und Enttäuschungen bewahrt sie ihren unbändigen Glauben an das starke Fundament der Familie. An die innige Liebe zur Heimat, den Respekt vor allen Menschen dieser Welt und den festen Glauben an die unendliche Kraft der Natur unserer Mutter Erde. Der Autor öffnet ein berührendes Schicksal, wobei ihm mit erzählerischem Feingefühl ein Wechselspiel aus Biografie und spannendem Roman gelingt. Ein wunderschönes Buch, das den Leser fasziniert bis zum Ende bleiben lässt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 220
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
martin cereza
Ein Geschichtenerzähler
Familie, Mountainbike, Golfschläger,
drei Dinge, die ihn vom Schreiben
eines Buches abhalten könnten.
Er liebt die einfache Sprache.
Unterhaltsame Literatur zum Schmökern,
spannend, humorvoll, geistreich…
Das wäre der Plan
Bisher bei BoD erschienen:
BlaueisTod - RotglutTod - RachsuchtTod
MoorlandTod - MoorlandAsche
Basima-Leidenschaft am Limit
Söhne von Mali
Alle Werke als E-Book erhältlich
www.cereza.at
Inhaltsverzeichnis
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Prolog
Heftige Gewitter peinigten am zuvor strahlend blauen Sommertag des Jahres 1921 die kleine Stadt Celje am Fuße der gleichnamigen Burganlage im slowenischen Spodnja Stajerska, ehemals Untersteiermark.
Als Teil des Herzogtums Steiermark, gehörte sie vom Mittelalter bis zum Jahre 1918 zu den Habsburgischen Erblanden.
Der gewaltige Donnerschlag, lautstarke Frucht des seit einigen Stunden über der Region liegenden Unwetters, inspirierte mich zu meinem allerersten Schrei, dem daraus erzwungenen ersten Atemzug, den ersten Blick in helles Tageslicht.
Mein Eintritt in die damals nicht gerade schöne Welt vollzog sich unter Wimmern und Wehklagen meiner Mutter in einer einfachen Kammer für Dienstboten, direkt oberhalb des zur Burganlage gehörigen Pferdestalles gelegen.
Durch die breiten Fugen des rustikalen Holzbodens aus groben Eichendielen drang deftiger Wohlgeruch warmen Pferdemistes vermischt mit dampfender Pisse, produziert von dort eingestellten zwanzig edlen Rössern verschiedener Rassen.
Nachdem mich dieser unsägliche Donnerschlag dem schützenden Mutterleib entrissen hatte, blickte ich mich erwartungsvoll um, runzelte meine Stirn, ob der nicht gerade einladenden Umgebung. Das war keinesfalls ein Umfeld, wie ich es mir von der großen Welt ausserhalb der wärmenden Fruchtblase erträumt hatte.
Schon stellte sich die erste fundamentale Frage.
War ich ein Kind des Königreiches der Serben, Kroaten und Slowenen, wie dieser schöne Teil der Erde seit Ende des unseligen Ersten Weltkrieges und des daraus folgenden Vertrages von Saint Germain ab 1919 benannt worden war oder war ich einfach eine Untersteirerin, wie meine Mutter?
Und mein Name?
Meine liebe Mutter hatte in der festen Überzeugung gelebt, einen kräftigen Buben auszutragen. Niemals wäre ihr in den Sinn gekommen ein zartes Mädchen könne ihr derartige Qualen in der Schwangerschaft zufügen. So hatte sie auf die logische Frage der Hebamme nach einem Namen für mich keinen solchen parat.
»Wir nennen sie natürlich Celje, wo sie doch hier im Schloss entbunden wurde«, meinte die eben eingetretene Burgherrin lachend. Alle Anwesenden, außer mir, nickten zustimmend. Eine Ablehnung wäre in Anbetracht der gehobenen Stellung der gnädigen Frau Gräfin ohnehin nutzlos geblieben. So war ich eben die Celje, aus der später die Celia werden sollte.
Hundert Jahre war es mir gegönnt, durch ein oftmals schönes, manchmal schwieriges, aber immer aufregendes Leben zu gehen. Stets eingebettet in eine wunderbare Familie unterschiedlicher Kultur war es eine Gnade, im Wind des Lebens zu wandeln.
Un secolo nel vento della vita.
Ein Jahrhundert im Wind des Lebens.
1
Eine milde Abendsonne wärmte die alte Dame im Lehnstuhl auf der Terrasse des in Hanglage neben dem Weingut erbauten Chalets, hoch über dem Südtiroler Unterland. Ein erster kühler Luftzug kündigte vorwitzig den Herbst an, obwohl man gerade einmal September des Jahres 2021 schrieb.
Nicht ungewöhnlich für die Welt in den Bergen, wo die Jahreszeiten anders wechseln als in den weiten Tälern und Ebenen. Einer der Gründe, warum eine warme Schafwolldecke auf die Knie der alten Dame gelegt worden war. Der zweite Grund war ihrem Alter geschuldet.
Einhundert Jahre war sie vor wenigen Wochen geworden, was mit der Großfamilie samt der ganzen Dorfgemeinschaft, zumindest mit jenen, die ihr gut gesinnt waren, gefeiert worden war.
Musikkapelle, Schützen und natürlich der Bürgermeister ehrten die Jubilarin.
Celia Obakirchler, Bäuerin und Wirtin, weit über die Grenzen des kleinen Südtiroler Dorfes bekannt, schmunzelte, zumal ihr die Stunden der Feierlichkeiten in Erinnerung kamen.
Dankbar war sie, ein so hohes Alter erreicht zu haben, glücklich über den Lebensabend, den sie hier verbringen durfte, aber auch nachdenklich über die Tatsache des nahenden Endes ihrer Zeit.
»Lucia, nimm mir ein Glas vom Lagreiner mit und setz dich zu mir.«
»Komme gleich, Nonna. Muss nur noch schnell was erledigen. Fünf Minuten, dann bin ich bei dir.«
Lucia, Enkelin und Liebling der Altbäuerin, stellte das mit hellrotem Lagreiner gefüllte Baucherl, so nannte Großmutter Celia zeit ihres Lebens das kleine Rotweinglas, auf den Tisch seitlich des Lehnstuhles, richtete die Decke und setzte sich.
»Alles gut mit dir? Ein schöner Abend, geradezu geschaffen für unser Vorhaben, was meinst du, Nonna? Ich bin schon gespannt und aufgeregt.«
»Genau weiß ich jetzt nicht, wo ich anfangen soll, ich versuche es halt einfach. Eines ist mir sehr wichtig, wir sind uns einig, dass ich bald diese Welt verlassen werde, das ist unausweichlich und gehört zum Kreis des Lebens, mein Kind.
Nicht traurig sein, wenn es so weit ist, nehmt es zur Kenntnis, aber behaltet mich in euren Herzen.
Ich durfte ein volles Jahrhundert lang mein Leben mit unglaublich vielen Höhen, aber auch nicht wenigen Tiefen gestalten, erleben, genießen und manchmal verfluchen. Du bist mittlerweile in der Mitte eines, lass es mich so sagen, normalen Lebens angekommen.
Die Zeit ist reif, dir meines mit all seinen guten, oftmals schlechteren, manchmal gar sündigen Seiten zu erzählen. Du bist die Einzige, vor der ich diese Beichte, ja, so will ich es nennen, Beichte, ablege. Warum ausgerechnet du? Von allen meinen Kindern, Enkel und Urenkel sind keine meiner Art so ähnlich wie du, daher weiß ich mit Sicherheit, du, Lucia, du wirst meinen Lebensweg verstehen, meine Werte weitertragen, meine Geschichte in Ehren halten.
Und natürlich auch deshalb, weil du mich danach gefragt hast. Ich merke, speziell die wunderbare Zeit mit Lorenzo, deinem Opa, interessiert dich. Alles, was ich dir in den vielen Jahren während unseres Zusammenlebens erzählt habe, versuche ich noch einmal zusammenzufassen.
Ich denke mir, es ist eine spannende Geschichte. Ein gelegentlich rührseliger, manchmal lustiger, jedoch immer der vollen Wahrheit geschuldeter Roman. Ja, ein Roman, der den Stoff in sich trägt, erzählt zu werden.
Ich lege die Geschichte, alle Worte und Wendungen, in deine jungen Hände, denn du sollst wissen, wie ich wirklich war und warum ich so war, wie ich war. Du sollst Antworten geben können, wenn diejenigen, die es immer schon besser wussten, über mich urteilen werden. Allerdings werden sie es erst nach meinem Tod wagen, dieses zu tun. Glaube mir, Lucia, bis jetzt hat sich keiner dieser Besserwisser getraut, auch nur einen Krümmel Kritik an mir zu üben.
Die Schilderungen meiner Zeit als Säugling hat mir meine Adoptivmutter genau so erzählt, wie ihr von meiner leiblichen Mutter nach deren Gefühlen berichtet worden war.
Meine real gefühlte Erinnerung greift nur langsam. So ab dem fünften Lebensjahr verdichtet sich diese von Jahr zu Jahr, wie es die Natur im heranwachsenden Geist der Kindheit regelt.
Ich habe meine leibliche Mutter nie zu Gesicht bekommen, zumindest nie so, dass ich dies hätte realisieren können. Sie war, wie erwähnt, als Untersteirerin Angehörige der deutschsprachigen Volksgruppe. Ich denke, sie wollte die ständigen nationalistischen Reibereien im neu geschaffenen Königreich der Serben nicht länger ertragen, weshalb sie sich für die Flucht in das neue, noch junge Österreich, ihr Vaterland, entschloss.
Es muss eine unsagbar schwierige Zeit für sie gewesen sein.
Mit nichts als den notwendigen Dingen am Körper und mir als vier Wochen alten Säugling im Arm gelangte sie nach mehreren Tagen hungrig und verstört über Kärnten nach Osttirol und von dort schließlich weiter in das Tiroler Unterland.
In einem Dorf, an der Hauptstraße gelegen, bettelte sie bei einer kleinen Bauernwirtschaft um Brot für sich und etwas Milch für mich.
Die Menschen dort waren sehr arm, nahmen aber Mutter mit Kind großherzig auf. Sie boten uns Essen und Schlafstelle an, halfen uns damit aus höchster Not.
Eineinhalb Jahre war ich alt, als meine Mutter erkrankte und ins Spital gebracht wurde.
Ich sah sie nie wieder. Sie verstarb einsam im Krankenhaus, ließ mich alleine auf dem Bauernhof zurück.
Theresia Schnöller, die Kleinbäuerin, hatte selbst eine Tochter in meinem Alter. Maria-Anna war ihr Name, später nannten sie alle Mariandl.
Theresias Mann Johann war im Ersten Weltkrieg als Kaiserjäger am Monte Grappa in der Region Venetien gefallen.
Resl, wie alle Theresia nannten, war bald klar, dass ich von der Jugendfürsorge in ein Kinderheim verfrachtet werden würde. Es gelang ihr, nach einem Spießrutenlauf durch unzählige Behörden, mich zu adoptieren.
Ab 1924, gerade drei Jahre alt, war mein Name Celia Schnöller.
Es begann eine unglaublich schwierige, sehr harte Zeit. Der kleine Hof lag direkt an einer Durchzug-Straße, was zur Folge hatte, dass täglich Menschen anklopften, um Nahrung bettelten, eine Bleibe suchten und immer wieder eine unserer braven Hennen aus dem Stall entwendeten.
Resl hatte ein großes Herz, gab immer etwas, auch wenn wir selbst Hunger litten. Wenigstens hatten wir unsere beiden Kühe, einmal pro Jahr kam ein Kalb, welches verkauft wurde. Neben der Weide unmittelbar hinter dem Hof lag etwas entfernt ein ebenes Stück Ackerland, worauf Weizen, Mais und Rüben für die beiden Schweine angebaut wurden. Für die schwere Feldarbeit spannten wir die ältere der beiden Kühe, ich erinnere mich gut, ihr Name war Raungerl, vor Pflug, Egge und Heuwagen.
Die Dinge wiederholen sich, Lucia, mir kannst du glauben. Sind die Zeiten schlecht, helfen sich die Menschen gegenseitig. Sind sie aber gut, herrscht Missgunst, Neid und Gleichgültigkeit.
So war es auch in diesen schwierigen Zwischenkriegsjahren. Die Menschen im Dorf halfen einander, respektierten einander und waren demütig und geduldig.
Mariandl und ich besuchten zusammen die Volksschule. Dazu mussten wir täglich drei Kilometer in den nächsten größeren Ort marschieren, in unserem Weiler gab es keine Schule. Besonders hart war es im Winter. Resl versuchte zwar unermüdlich, warme Kleider zu besorgen, was nicht immer gelang. So froren wir oft. Regnete oder schneite es, kamen wir klatschnass in die Schule. Dann durften wir unsere Mäntel neben dem gusseisernen Holzofen im Klassenzimmer auf den Boden legen, wo sie abtrocknen sollten.
Nicht so in der Religionsstunde. Der Herr Dechant konnte den Gestank, der von den nassen Lodensachen ausging, nicht ertragen, also mussten diese in den Gang hinaus zur dortigen Garderobe. Nach der Schule schlüpften wir in die klammen, halbtrockenen Kleider.
Es war wohl Gottes Wille, wie so vieles, das uns Hochwürden im Religionsunterricht einredete.
Heute weiß ich, dass der ehrwürdige Herr Dechant ein großartiger Märchenerzähler, oftmals jedoch ein ausgefuchster Lügner war.
Resl hielt im Gegensatz zu den meisten Frauen und Nachbarinnen nicht viel von den glattzüngigen, heuchlerischen Gesellen der Kirche, wie sie die Herren Priester zu nennen pflegte.
Ihrer Überzeugung folgend, könne es nie und nimmer Gottes Wille sein, dass die kirchlichen Granden und Pfaffen im Überdruss lebten. Erhielten sie doch ausreichend Spenden der tiefgläubigen Bauersleute, während andere Menschen schreckliche Not und Armut litten und manch verzweifelter Mutter ihr Kind am Arm verhungerte.
Sie verachtete alle Systeme der verschiedenen Religionsgemeinschaften. Nicht so ihren Herrgott, zu dem sie täglich abends bettete. Dies sei eben der große Unterschied, erklärte sie uns.
Die Kirche sei der Verein, der über Jahrtausende die Menschen mit Drohungen, wie dem Fegefeuer oder der gnadenlosen, furchtbaren Hölle, an der Stange hielt.
Gott aber ist Gott!
Vor ihm sind alle Menschen gleich.
Er alleine hat uns unsere Art zu leben aufgetragen. Aus gutem Grund auf dem Boden unserer göttlichen, fruchtbaren, Mutter Erde. So hielt sie es mit ihrer logischen Argumentation. Nur dieser Mutter Erde, unserer Natur, seien wir Rechenschaft schuldig.
Dazu brauche es keine aufgeblasene Kirchenpolitik. Eine Messe könne auch von einem einfachen Pater des Schweigeordens im nahen Kloster gelesen werden.
So wuchsen Mariandl und ich in einem charakterlich gefestigten, zum Glück sehr weltoffenen Umfeld auf. Wir durften uns immer unsere eigenen Meinungen bilden, waren angehalten, zu diesen zu stehen, uns nichts gefallen zu lassen, selbstbewusst durch das Leben zu gehen.
Wobei wir die Nächstenliebe nie vergessen dürften, indem wir in Not geratenen Menschen so gut es ging, halfen.
Andere Hautfarben und Kulturen akzeptierten, mit Respekt behandelten und jedem einzelnen Wesen der Natur in seiner ureigenen Art und Weise in Würde gegenübertreten müssten.
So war sie, unsere Resl, damals schon eine emanzipierte Kämpferin für das Gute in uns.
An einen ihrer Sprüche erinnere ich mich immer wieder gerne.
Selbstbewusstsein und Selbsteinschätzung sind Zwillinge–ihr Wert liegt im Gleichklang.
Ich traf im späteren Leben unzählige Menschen unterschiedlichster Ethnien. All jene mit einem maßlos ausgeprägten Selbstbewusstsein, unter jeglichem Verzicht demütiger Selbsteinschätzung, erschienen mir stets als Menschen ohne die Fähigkeit, geistig zu agieren. Einfach gesagt als dumm. Ohne jene Instanz, die für Realisieren und Denken zuständig ist. Nicht erkennen, nicht realisieren, wer man in Wahrheit ist, wozu man in der Lage ist, was man wert ist. Das alles sind jedoch die wesentlichen Dinge eines erfolgreichen Weges in einem langen Leben.
Meine Schulzeit war nicht annähernd so schnelllebig wie der heutige Schulalltag. Die Wirtschaft kam nur langsam in die Gänge, die arbeitende Bevölkerung schuftete redlich.
Bei Löhnen nahe der Existenzgrundlage konnte niemand etwas zur Seite legen, schon gar nicht, wenn er ehrlich war.
Insbesondere in den Städten litten die Bewohner an den schrecklichen Kriegsfolgen. Mehr als die bäuerlich geprägte Landbevölkerung, die ja immer schon mit weniger zurechtkommen musste und daher zufriedener war.
Unser geliebtes Heimatland, nach dem verlorenen Krieg vom mächtigen Kaiserreich zum Kleinstaat Österreich geworden, versuchte mit der Gründung der Ersten Republik den Weg zu einer funktionierenden Demokratie zu ebnen. In Wahrheit gab kein Machthaber im übrigen Europa diesem Österreich eine reelle Chance.
Daher konnte eine gesunde Entwicklung nur sehr langsam voranschreiten.
Ich erlebte diese Zeit, gut behütet von Resl, zusammen mit Mariandl auf unserem kleinen Hof. Wir hatten zu essen, einfache Kleidung, gingen zur Schule und arbeiteten im Stall, auf dem Feld und im Wald, wo wir unser Brennholz besorgten.
Dieser tägliche Ablauf erfüllte uns, was anderes kannten wir ja nicht.
Im Sommer des Jahres 1936 schloss ich mit einem ausgezeichneten Zeugnis die Volksschule ab.
Ich war ein hübsches Mädel von fünfzehn Jahren. Schnell begannen sich die jungen Burschen für mich zu interessieren, was mich im Grunde wenig bis gar nicht beflügelte.
Wie hungrige Kater schlichen sie um unseren Hof, hoffend Mariandl oder mich zu Gesicht oder gar in die Hände zu bekommen.
Sie hatten die Rechnung ohne Resl gemacht. Zweimal jagte sie allzu freche Verehrer davon, danach kehrte Ruhe ein. In dieser Hinsicht war unsere sonst so gütige und großherzige Resl streng und konsequent. Für sie waren wir einfach zu jung für ein Techtl-Mechtl, gemeint war damit ein Verhältnis mit einem der jungen Männer.
Ich als gute Schülerin durfte in einer vierzig Kilometer entfernten Klosterschule eine Lehre als Krankenschwester antreten. Mariandl verblieb am Hof, den sie einmal erben sollte.
Anfangs tat ich mich recht schwer mit den strengen Auflagen im Heim. Die geistlichen Schwestern mit ihren riesigen weißen Kopfbedeckungen, deren breite Flügel in mir die Erinnerung an Erzengel weckten, waren überaus streng und unnachgiebig.
Zutiefst im konservativen Glauben verankert, ließen sie Träumereien junger Mädchen nicht zu. Sie sahen sich und die ihnen anvertrauten Schülerinnen in ihrem Glauben als Bräute des Herrn Jesus Christus.
Bei mir scheiterten die Damen jedoch mit den ständigen Versuchen, ein Gelöbnis zu leisten, mir war die weltliche Seite näher als das Dasein einer Novizin.
Zusammen mit einem anderen Mädchen, zum Glück in etwa gleichdenkend wie ich, belegten wir eine kleine Kammer mit Abstand zu den Unterkünften der Novizinnen, die da noch viel strengeren Kontrollen der geistlichen Lehrerinnen unterworfen waren.
Nach einem Jahr gab die Oberin endgültig die Hoffnung auf, mich in den von ihr geführten engen Kreis zu integrieren. Ich musste ausziehen.
Im Krankenhaus bekam ich Unterkunft in einem Zimmer mit vier anderen Schülerinnen.
Plötzlich fühlte ich mich erwachsen. Frei von Zwang und Bevormundung, meinem Ziel, eine tüchtige Krankenschwester zu werden, sehr nahe. Die Ausbildung war nicht immer einfach, besonders fordernd für mich waren die Stunden im Lehrsaal für Anatomie.
Die Arbeit der Medizinstudierenden an den menschlichen Körperteilen unter Anleitung eines zynischen Professors versetzte mich anfangs in eine schwierige Situation. Mir wurde übel, ich musste mich mehr als einmal in einer dafür vorgesehenen abgeschirmten Ecke übergeben.
Der Herr Professor sah sich dann unter dem Gelächter seiner angehenden Mediziner bemüßigt, mich zu einer Erklärung des körperlichen Vorganges im Zuge des Erbrechens aufzufordern.
»Können Sie erst das Übel an der Wurzel packen, es erklären, so ist es keines mehr, es hat sich ausgekotzt und Sie können den heftigsten Vorgängen an den Tischen beiwohnen, Fräulein Celia.«
So seine Worte.
Letztlich sollte er recht behalten. Je länger ich mich mit den jungen Studentinnen und Studenten über die Geheimnisse der Anatomie austauschte, umso sicherer wurde ich. Es ging dann so weit, dass mir die Öffnung eines leblosen Körpers nichts mehr ausmachte.
Herr Professor, Veteran des Ersten Weltkrieges, war ein glühender Anhänger des in Deutschland an die Macht gekommenen Adolf Hitler. Als dieser im März 1938 in Österreich einmarschierte, reiste er mit unzähligen anderen Nazi-Fanatikern in die Bundeshauptstadt, um den schlimmsten Massenmörder aller Zeiten gebührend zu empfangen. Heute weiß man, dass ihn das Volk mit stürmischen Jubelrufen hochleben ließ. Keine Spur von einem Überfall, wie es nach dem furchtbarsten aller Kriege oft dargestellt wurde. Die allzu gern gehörte Opferrolle stimmte so nicht.
Es dauerte danach nicht lange, da verkündete der Herr Professor, dass es bald Krieg geben werde. Dann, das wusste er aus seinen schlimmen Erfahrungen als Kriegsarzt im Zuge der berüchtigten Isonzo-Schlachten, dann würden wir, die wir hier ausgebildet wurden, erstmals erleben, was wirkliches Grauen sein würde.
An diese Worte würde ich später noch denken.
Glaube mir, liebe Lucia, bei so manchem Ereignis sind wir Menschen hinterher gescheiter, da wissen wir plötzlich, was wir nicht hätten machen dürfen. Wir können dann nicht verstehen, wie es dazu kommen konnte. Mir erging es genau so.
Ich war damals eines der Hitler Mädel, wie die meisten in meinem Alter. Fragst du mich warum, brauche ich nicht lange herumzudrücken, brauche nicht zu sagen: Wir mussten es tun.
Nein, ich wurde nicht verpflichtet, ich tat es aus eigenem Willen. Ich war von den Gegebenheiten, in dieser für uns vollkommen neuen Zeit, einer Zeit des totalen Aufbruchs, anfangs, wie so viele Mitmenschen, fasziniert.
Innerhalb weniger Monate ging es den Leuten und Familien besser, sie hatten Arbeit. Ich erhielt erstmals in meinem Leben eine Entschädigung für meine Tätigkeit im Rahmen der Ausbildung.
Niemand dachte an die Worte unseres Professors, von wegen, Krieg und so. Eingebunden in das Deutsche Reich würden wir garantiert am großen Aufschwung teilhaben können.
Warum sollten wir an Krieg denken?
Ende des zweiten Lehrjahres bekamen meine Freundin Annemarie und ich sogar ein Zweibettzimmer zugeteilt, mit eigenem Waschbecken.
Ein solcher Luxus! Wir mussten nicht mehr mit dreißig anderen Mädels in den großen Waschraum. Herrlich!
Wir durften auch Besuch empfangen, allerdings nur an Sonntagen. Nach dem Mittagessen, für drei Stunden.
2
Der erste Jahrestag des Anschlusses wurde im März 1939 von den neuen Machthabern mit Paraden in den Städten sowie Bierfesten am Land ausgiebig gefeiert.
Bei beiden Veranstaltungen kam die NS-Propagandamaschinerie ungebremst zum Einsatz.
Das grässliche Gebrüll der Nazi-Anhänger, die Flut der roten Flaggen mit dem Hakenkreuz und die hetzerischen Ansprachen der Gauleiter gegen alles, was nicht den arischen Ansprüchen des Regimes gerecht wurde.
Spätestens seit der Reichskristallnacht, bezogen auf jene schrecklichen Ereignisse vom 9. zum 10. November 1938, in welchen die Synagogen in Flammen aufgingen und jüdische Einrichtungen im gesamten Deutschen Reich zerstört wurden, war vielen Menschen klar, in welche Richtung die Reise gehen würde.
Das mörderische Vorgehen des Regimes löste trotz massiver NS-Propagandamaschinerie in weiten Teilen der Bevölkerung tiefe Bedrückung aus.
Jüdische Geschäfte wurden geplündert, Wohnungen zerstört. Menschen jüdischen Glaubens wurden getötet, gedemütigt, verhaftet, misshandelt, vergewaltigt und danach in Konzentrationslager verschleppt, wo Millionen ihr Leben lassen mussten.
Widerstand erschien zwecklos, war sehr gefährlich, zu gut war die Überwachung und Kontrolle organisiert. Das System schlug gnadenlos zu, Gegner konnten schnell am Galgen landen.
Höre ich in jüngerer Zeit im Rahmen der Berichterstattung in den Medien überlaute Marschmusik, grässliches Gebrüll bei diversen politischen Veranstaltungen in übervollen Bierzelten, sehe diesen abgrundtiefen Hass in den Augen des grölenden Pöbels, gerichtet gegen das Zuwandern hilfsbedürftiger Menschen aus den ärmsten Ländern des Planeten und vernehme aus den Texten der Reden hässliche Parolen, ähnlich jenen von damals, so läuft mir als Zeitzeugin der Naziherrschaft stets ein kalter Schauer über den Rücken.
Es heißt aufpassen, meine Liebe. Aufpassen auf unser friedliches Heimatland, auf unsere Werte, unsere stabile Demokratie, auf freie Wahlen, Respekt und Anerkennung aller Menschen sowie auf eure Freiheit und die Zukunft eurer Kinder.
Wehret den Anfängen, ist kein politisches Schlagwort diverser Parteien, es ist eine Warnung, eine Warnung vor Zuständen, die sich in einer Wohlstandsgesellschaft allzu leicht unbeachtet einschleichen können und erst wahrgenommen werden, wenn es zu spät ist.
*
Ich war an diesem 12. März 1939, ich erinnere mich gut, es war ein Sonntag, alleine in meinem Zimmer. Annemarie hatte einen Urlaubsschein für das Wochenende bekommen. Sie war nach Hause gefahren, zur Hochzeit ihrer Schwester. Nach dem Mittagessen saß ich eine Stunde auf einer Bank im Park des Spitals.
Vom Marktplatz kommend, tönte die Musik des Aufmarsches herüber. Mir fehlte die Lust hinzugehen und so entschloss ich mich, auf dem Zimmer zu bleiben, um zu lernen. Du wunderst dich, warum ich das noch so genau im Kopf habe, nach der langen Zeit. Es gab einen triftigen Grund dafür, diesen Tag nicht zu vergessen.
Das Klopfen weckte mich.
Mein Lehrbuch auf der Brust, war ich eingenickt. Es gab damals noch keinen Spion in den Türen, ich musste also öffnen, um zu sehen, wer mich besuchen wollte.
Vor mir stand Matthäus, der Freund von Annemarie. In seiner kurzen Lederhose, den Stutzen und dem Trachtenjanker machte er einen stattlichen Eindruck.
»Grüß Gott, Celia. Ist die Annemarie nicht hier?« Wusste er nicht, dass Annemarie nach Hause gefahren war? Eigenartig, dachte ich.
»Nein, Annemarie ist nicht zugegen. Kommt erst am Montag wieder.«
»Ach so, na ja, kann man nichts machen. Darf ich hereinkommen?«
Es war ein Fehler, ihn hereinzubitten.
Matthäus, einige Jahre älter als ich, hatte, wie ich erst viel später zu Ohren bekam, bereits ausreichende Erfahrungen im Umgang mit Frauen gemacht. Ich war noch keine achtzehn Jahre alt und vollkommen unerfahren.
Es soll keine Ausrede sein, liebe Lucia, ich hätte ihn abwehren können, mich weigern können, ihn einfach nur wegschicken müssen. Er schmeichelte mir, meiner Figur, den weichen Haaren, der straffen Brust. Er küsste mich leidenschaftlich. Ich war weg, mehr oder weniger ohne jegliche Vernunft, ließ ich es geschehen.
Matthäus war längst gegangen, ich lag noch immer im zerwühlten Bett, machte mir schreckliche Vorwürfe über meinen Sündenfall. Wie sollte ich Annemarie je wieder in die Augen sehen können?
Mein erstes Mal war keineswegs so verlaufen, wie ich mir das in meinen Träumen vorgestellt hatte. Ganz im Gegenteil, es tat weh, war zum Glück von kurzer Dauer und es gab keinen Funken von Romantik oder Liebe. Ich war frustriert, verfluchte weinend meine Leichtgläubigkeit.
Annemarie erfuhr nie etwas davon. Sie trennte sich einige Monate später von Matthäus, nachdem sie dahinter gekommen war, dass er es mit der Treue nicht allzu ernst meinte.
Er machte noch einmal einen Versuch bei mir, ich wies ihn ab und sah ihn erst viel später zu einem ganz anderen Anlass wieder.
Der Frühling zog ins Land, der Sommer begann und ich wartete verzweifelt, voller Angst, auf meine Tage. Doktor Baldalin, Gynäkologe und Vortragender in der Schwesternschule, bestätigte meinen Verdacht. Ich war schwanger.
»Kein Problem, Fräulein Celia, es wird ein gesunder Mensch werden. Der Führer freut sich über jeden neuen arischen Erdenbürger. Alles Gute!«
Er hätte seinen Befund nicht mit dem Hitlergruß absegnen müssen, ich wusste längst, dass er zu dieser Clique von Ärzten gehörte, die dem Wahnsinnigen treu ergeben waren.
Im Dezember 1939 lag ich im Ehebett der Resl, wo die Wehen eingesetzt hatten.
Mariandl hielt meine Hand, wischte mir mit einem feuchten Tuch über die nasse Stirn.
»Die Hebamme muss bald hier sein«, murmelte Resl. Eine große Schüssel mit heißem Wasser stellte sie auf die Ablage am Fußende. Daneben stand ein Häferl mit einer geheimen Mischung aus Kräutertee für nachher, wie Resl meinte. Das beste Getränk für eine Wöchnerin, wie damals die entbundene Frau genannt wurde.
Es dauerte für mich eine gefühlte Ewigkeit, bis die Hebamme endlich da war. Im Schein der Petroleumlampen, Strom gab es damals bei uns noch keinen, untersuchte sie meinen Unterleib.
»Gleich geht der Reigen los, Mädel. Keine Angst, du machst das schon, tut ein wenig mehr weh als die Zeugung, aber es kann doch nicht alles lustig sein auf der Welt, nicht wahr?«
Ich wusste über den Zynismus der Frau Bescheid, rang mir ein zaghaftes Lächeln ab. Dann ging alles relativ schnell, die Hebamme hielt den mit Schleim und Blut überzogenen Körper an den Beinchen in die Höhe, klopfte kräftig auf den blau angelaufenen Hintern, was das kleine Wesen zu einem kräftigen Schrei animierte.
»Ein Mädchen, ein strammes Mädchen, Glückwunsch, Dirndl. Haben wir schon einen Namen?«
»Katharina. Katharina wird die Kleine heißen, der Herrgott schenke ihr ein gutes Leben.«
Resl strich über das nasse Köpfchen und drückte der kleinen Kathi einen Kuss auf die Stirn.
Du weißt nicht, wie unglaublich schön dieser Augenblick ist, Lucia. Wenn sie dir deine Tochter in den Arm legen, du ihren Herzschlag spürst, ihr Mund deine Brust sucht und du zufrieden deine Augen schließen kannst, während sie die erste Nahrung erhält.
Noch schöner muss es heutzutage sein, wenn die Väter bei der Geburt dabei sein dürfen. Ich war alleine. Ich hatte die Resl, ja, und die Mariandl, aber keinen Vater für das Kind.
Matthäus wusste über meine Schwangerschaft Bescheid. Annemarie gab ihm die Information, in der Hoffnung, er würde zu seiner Verantwortung stehen. Wusste er doch von Anfang an, dass er der Vater von Kathi war.
Er drückte sich.
Zwei Monate später erfuhr ich von Annemarie über den Einberufungsbefehl in die Wehrmacht, den Matthäus erhalten hatte.
Seit Anfang September 1939 herrschte Krieg. Hitler war in Polen einmarschiert, Matthäus einer der ersten jungen Rekruten, die an die beginnende Ostfront einrücken mussten.
Er war für uns unerreichbar geworden.
Sosehr ich meine kleine Kathi liebte, regte sich in mir auch eine tiefe Enttäuschung. Ich musste meine Ausbildung zur Krankenschwester unterbrechen, hatte insgeheim gehofft, Matthäus würde zu mir stehen, beides erfüllte sich nicht.