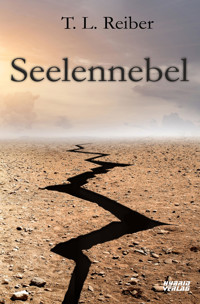
3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Hybrid Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Magie und Mythen sind nichts für die beharrliche Realistin Aledis. Doch als ihre Schwester Nyah in den Symptomen einer Depression versinkt, die keine sein kann, bekommt ihre Lebenseinstellung Risse. Denn Nyah ist nicht das einzige Opfer dieser geheimnisvollen Krankheit. Voller Zweifel, aber entschlossen, Nyah zu helfen, macht sie sich auf die Suche jenseits ihrer vertrauten Wirklichkeit. Die Spur führt nach Tyrsis, einem versteckten Runddorf am Meer, wo Magie noch gelebt wird. Gejagt, bedroht und verraten kämpft Aledis sich voran. Und plötzlich liegt das Schicksal unzähliger Menschen in ihren Händen …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
HYBRID VERLAG
Vollständige elektronische Ausgabe
05/2022
Seelennebel
© by T.L. Reiber
© by Hybrid Verlag
Westring 1
66424 Homburg
Umschlaggestaltung: © 2022 by Creativ Work Design
Lektorat: Matthias Schlicke
Korrektorat: Nola Reiber
Buchsatz: Lena Widmann
Autorenfoto: Denise Ariaane Funke
Coverbild ›Eibe und das Buch der Schatten‹
© 2017 by Creativ Work Design, Homburg
Coverbild ›Wolf Call – Ruf der Bestimmung‹
© 2019 by Creativ Work Design, Homburg
Coverbild ›Die Chroniken von Mytlaghyr - Hexenjagd‹
© 2021 by Magical Cover Design, Giuseppa Lo Coco
Coverbild ›Das Geheimnis des Windes - Erwachen‹
© 2019 Creativ Work Design, Homburg / NaWillArt-CoverDesign
Bildnachweis: depositphotos.com; egal ID17824717; iamsania ID30224805; Pit3d ID222305966; maystra ID15649055; ValentinaPhotos ID43161221; SSerg_dibrova ID79558130
ISBN 978-3-96741-153-9
www.hybridverlag.de
www.hybridverlagshop.de
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Bibliografische Informationen der Deutschen Nationalbibliothek: Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.
Printed in Germany
T. L. Reiber
Seelennebel
Fantasy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Danksagung
DIE AUTORIN
Hybrid Verlag …
Für Nola Fee
1.
Es war wieder geschehen.
Das Stück Quiche glitt Aledis samt Heber aus der Hand. Ihr Kopf fuhr zu der Frau herum, die weinend mit zwei anderen Gästen an Tisch vier sprach.
»Bist du dir sicher?«, fragte der Mann und schob eine Packung Taschentücher über den Tisch.
»Was soll es denn sonst sein? Von einer Minute zur anderen hat sich Anna so verändert, dass ich sie nicht wiedererkenne. Seit Tagen weint sie nur noch und starrt trübe vor sich hin.« Die Frau griff sich ein Tuch und schnaubte laut hinein. »Keine seelische Krankheit bricht so plötzlich aus. Ich sage dir, das war er! Der Nebelmann hat sie hinabgezogen.«
Der Nebelmann, pah! Was für ein Blödsinn, dachte Aledis, während sie sich umdrehte, um einen frischen Teller mit einem neuen Stück vom Quicheblech zu belegen. Alles nur Gerüchte. Reine Panikmache der Pharmaindustrie, damit die fünfmal so viel Pülverchen in Kapseln verkaufen können. Und was für ein kindischer Name! Energisch teilte sie den Rest des Bleches in gleichmäßige Teile und stellte es zurück in die gekühlte Auslage.
»Was ist los? Du bist ganz bleich.« Lorell, ihre Mitarbeiterin, kam mit einem leeren Tablett auf sie zu.
»Gar nichts.« Aledis pustete eine Haarsträhne von der Stirn. Sie wollte das Gespräch von Tisch vier wegwischen, zu ihrer Vernunft und Skepsis zurückfinden, aber es gelang ihr nicht.
»Ach, komm, stell dich nicht so an. Ich habe auch gehört, was die Frau gesagt hat und ich musste sofort an deine Schwester denken.«
»So ein Quatsch!« Aledis warf den benutzten Heber ins Spülbecken und sah Lorell mit zusammengekniffenen Brauen an. »Mit Nyah hat das überhaupt nichts zu tun! Ein Nebelmann, der Leute in eine Welt aus Trauer und Verzweiflung hinabzieht? Ich bitte dich! Wir leben im einundzwanzigsten Jahrhundert.«
»Okay, okay, ganz wie du meinst.« Lorell zuckte mit den Schultern und wandte sich ihrem Bestellblock zu.
Aledis aber konnte das Zittern ihrer Hände kaum noch unterdrücken. Auch Lorell musste also gleich daran denken. Nun ließ sich die Erinnerung nicht mehr verdrängen.
Die Erinnerung.
An den Tag, als ihre Schwester verschwand.
Vor weniger als einem Jahr hatte dieser Anruf ihr Leben aus der Bahn geworfen. Eine Sekunde lang blieb ihr Verstand wie blind. Was hat er gesagt? Krankenhaus? Aledis stand nur da und die Luft blieb im Hals stecken. Ihre Hand krampfte sich um das Telefon. Das Ohr fühlte sich plötzlich ganz heiß an.
»Bitte, können Sie das wiederholen? Wieso Krankenhaus? Hatte Nyah einen Unfall?«
»Nein, nein, beruhigen Sie sich, kein Unfall«, antwortete der Arzt in einem Tonfall, der im Übermitteln schlechter Nachrichten geschult klang. »Die Polizei hat Ihre Schwester aufgelesen und zu uns gebracht. Ins Emilien-Krankenhaus.«
»Die Polizei? O Gott, was ist mit ihr? Kann ich sie sehen?«
»Sicher, deshalb rufe ich an. Es sieht nach einem Nervenzusammenbruch aus. Atypisch zwar, aber keine Sorge, es ist kein unlösbares Problem. Vielleicht könnten Sie uns sogar helfen. Es ist nämlich so ...«
Er machte eine unerträgliche Pause. Aledis schnappte sich die Autoschlüssel und erreichte schon fast die Tür, als der Arzt seinen Satz beendete: »… dass Ihre Schwester nicht spricht. Das heißt, nicht verständlich spricht. Für eine gezielte Behandlung wäre es aber wichtig, an sie heranzukommen, mehr zu erfahren.«
»Bin schon unterwegs!« Damit war sie auf der Straße angelangt und sprang in ihren Fiat 500, der letzte Nacht zum Glück einen Parkplatz direkt vor der Haustür gefunden hatte. Das Handy landete auf dem Beifahrersitz.
»Verflucht, warum müssen ausgerechnet heute alle Ampeln auf Rot stehen?« Während Aledis mit trommelnden Fingern auf Grün wartete, hing das Telefonat weiter in ihren Ohren. Sie verstand immer noch nicht recht, was der Arzt ihr hatte sagen wollen. Nyah hatte einen Nervenzusammenbruch? Sei verwirrt und müsse behandelt werden? Das konnte nur eine Verwechselung sein. Ihre Schwester war immer gesund und fröhlich. Ihr Optimismus ließ sich von nichts und niemandem beeinträchtigen, ihr Glas war immer halb voll. Und diese Frau sollte einen Nervenzusammenbruch gehabt haben? Lächerlich! Nyah bekam keinen Nervenzusammenbruch!
Man habe sie aufgegriffen, völlig verstört auf dem vierspurigen Westboulevard umhertaumelnd, und das Einzige, was Nyah sprach, seien unzusammenhängende Worte gewesen, in denen sich Istari und Aldaloranthus auffallend häuften.
Das war absurd. Das war nicht ihre Schwester!
Keine fünfzehn Minuten später vor der Klinik nahm sie frech die einzige Parklücke, obwohl ein VW schon in Warteposition stand. Egal. Jetzt blieb keine Zeit für Rücksicht. Sie musste da rein und klarstellen, dass es sich um eine Verwechslung handelte. Am Empfang erklärte man ihr, Nyah befände sich auf der Beobachtungsstation, Zimmer sieben. Den Gang entlang, dann rechts bis zur Glastür »Station B«. Aledis rannte los, dankbar für die Turnschuhe an ihren Füßen. Ledersohlen klackten auf Linoleum immer so laut. So weit reichte ihre Rücksicht dann doch noch.
Als Aledis die Tür zu Zimmer sieben öffnete, wurde ihr eiskalt. Furcht überkam sie. Sämtliche Hoffnung schwand. Ihre Beine fingen an zu zittern, die Knie butterweich. Schnell griff sie nach dem Fußteil des Bettes, um nicht auf dem Boden zu landen. Vor ihr auf dem Bett kauerte das Liebste, das sie auf der Welt besaß, die Beine angezogen und den Blick gesenkt. So hatte sie ihre Schwester noch nie erlebt. Wie erstarrt lauschte sie den Worten, die Nyah fortwährend murmelte, und die überhaupt keinen Sinn zu ergeben schienen. Es klang wie ein Kauderwelsch, das nur entfernt an Sprache erinnerte. Aledis spürte, wie sich ihre Brust zusammenzog. Sie beugte sich zu ihrer Schwester hinunter und versuchte ein aufmunterndes Lächeln, aber ganz bis zu ihren Lippen kam es nicht.
»Nyah, Liebes, ich bin’s! Kannst du mich hören?«
Sie hatte nicht ernsthaft mit einer Antwort gerechnet und zuckte erschrocken zusammen, als die Schwester prompt mit teilweise verständlichen Worten reagierte.
»Ich ... höre dich, Mathair, aber ich weiß nicht ... was los ist, Aided, woher ich komme, wo ich bin. Oiche. Der Schutz ... Aldaloranthus ... muss ihn einsetzen. Istari und Dwyvach ... darf nicht unterbrechen.«
Aledis war froh, dass ihre Schwester überhaupt eine Reaktion zeigte, aber die Art und Weise, in der Nyah sprach, entsetzte sie. Die Worte kamen monoton und mindestens zwei Tonlagen tiefer, als ihre Stimme eigentlich klang.
»Sonst ... bin ich ... verloren«, waren die letzten Worte, die Aledis an diesem Tag klar und deutlich von ihrer Schwester hörte.
»Ah, Sie sind schon da, sehr gut. Zum Glück fanden die Beamten Ihre Telefonnummer im Handy.«
Der Klinikarzt trat leise ins Zimmer. Wieder versuchte er, sie zu beruhigen. Ein wenig Ruhe, gezielte Medikation – dann würde es schon wieder werden. Doch all diese Erklärungen halfen Aledis nicht über die Beklemmung hinweg, die sich in ihr auszubreiten begann. Ohne es begründen zu können und gepaart mit einem unbehaglichen Gefühl, meinte sie, dass Nyah etwas Außergewöhnliches widerfahren war. Einfach nur Ruhe würde da gar nicht helfen. Sie musste etwas tun. Sie musste ihr helfen, aber damals im Krankenhaus hatte es nicht den Hauch einer Ahnung gegeben, wie sie das anstellen sollte.
»Zwei Kaffee für Tisch acht.« Lorells Stimme holte sie in die Gegenwart zurück.
»Was? O ja, natürlich.« Aledis nickte ihr verwirrt zu. Das Café nahm wieder Formen an. Und damit auch die Gäste an Tisch vier.
»Ich glaube es trotzdem nicht«, flüsterte Aledis, während sie den Kaffee eingoss. »Obwohl ich immer noch nicht weiß, wie ich ihr helfen soll.«
»Wem helfen? Nyah?« Lorell klapperte hinter ihr mit Geschirr. »Nimmt sie denn die Medikamente regelmäßig?«
»Ja, schon, aber dieses Pharmazeugs hilft nicht die Bohne.«
»Dann freundest du dich vielleicht besser mit diesem Nebelfürsten an. Wenn du ihn bezirzt, sagt er dir bestimmt, was du tun musst.«
»Mach nicht so blöde Witze! Solche Wesen gibt es nicht und Punkt. Ich muss eine andere, eine logische Lösung für ihren Zustand finden.« Aledis setzte ein Lächeln auf und servierte den Gästen ihren Kaffee.
Ein Blick zur Uhr zeigte ihr, dass es für einen Spontanbesuch bei Nyah schon zu spät war. Hoffentlich kam sie klar, so allein in ihrer Wohnung. Aber in einer Klinik eingesperrt zu bleiben, stellte für sie beide nie eine Alternative dar.
»Hast du noch was vor oder könntest du heute alleine Schluss machen?« Aledis seufzte und straffte den Rücken.
»Ich glaube, ich sollte mal früher schlafen gehen.«
»Mach das.« Lorell strich ihr sanft über den Arm. »Deine Gesichtsfarbe ist immer noch recht unvorteilhaft und Schlaf soll ja bekanntlich schön machen.«
Kaum hatte Aledis den Schlüssel in der Tür gedreht, breitete sich vertraute Ruhe in ihr aus. Ihre Wohnung bestand aus nur einem Raum, der sich jedoch über das gesamte Dachgeschoss des Hauses erstreckte. Leichte Wände erweckten den Eindruck abgetrennter Wohn- und Schlafbereiche, aber in den großzügig gestalteten Öffnungen gab es nirgends Türen. Die einzige Ausnahme bildete das Badezimmer.
Sie atmete tief ein und kickte die Schuhe von den Füßen. Die vollen Bücherregale und die Fotos von ihrer Reise riefen: »Willkommen!« Große Fenster unterbrachen die überwiegend schrägen Dachflächen, sodass Aledis sich wie direkt unter dem Himmel vorkam. Eine kurze, sehr heiße Dusche, und schon kuschelte sie sich unter die Daunen.
Ein Gesicht. Ganz nah. Der widerstrebende Körper von unsichtbarer Kraft gezogen.
Zitternd schreckte Aledis hoch. Hatte sie geträumt? In ihren Ohren hämmerte dumpf ein viel zu schneller Herzschlag. Wie spät mochte es sein?
Sie schaute zum Fenster hoch. Draußen herrschte tiefe Dunkelheit. Trotz ihrer siebenundzwanzig Jahre fürchtete sie sich plötzlich vor der Dunkelheit wie ein kleines Kind. Sie horchte tief in sich hinein. Da war noch etwas. Sie spürte es deutlich.
Etwas Lebendiges.
Er hatte also noch nicht gewonnen. Aledis war nicht versunken, abgerutscht in sein Reich, wo es nichts mehr gab, außer Traurigkeit und einer Verzweiflung, die nichts mehr vom bisherigen Leben des Menschen erkennen ließ, den der Nebelmann hinabgezogen hatte.
»Jetzt fange ich auch schon damit an«, brummelte Aledis und mühte sich, wieder einzuschlafen. Es war doch nur ein Traum. Aber für einen Traum fühlte sich alles viel zu real an. Der Mann. Zum Greifen nahe. Sie versuchte, sich genauer an das Gesicht zu erinnern. Faszinierend, mit unergründlichen Augen erschien es direkt vor ihr. Irgendetwas daran fesselte sie besonders. Irgendetwas, das nicht zu einem menschlichen Gesicht gehörte. Sie konnte nicht sagen, worum es sich handelte. Das Traumbild wollte nicht klarer werden. Je angestrengter sie die Erscheinung zu erkennen versuchte, desto rascher entglitt die Erinnerung ihrem inneren Auge wie ein immer schneller fahrender Zug.
Und was, wenn ihr tatsächlich der Nebelmann imTraum erschienen war? Aledis’ kühler Verstand revoltierte vergeblich bei diesem Blitzgedanken. Vielleicht konnte sie mehr herausfinden, wenn sie Nyah von dem Traum erzählte? Vielleicht kannte ihre Schwester das Gesicht auch?
Nach einer ruhelosen Stunde sah Aledis ein, keinen Schlaf mehr finden zu können. Sie schwang die Beine über die Bettkante, um sich einen Kaffee zu machen. Das half doch immer beim Nachdenken. Und es half außerdem, die Zeit bis zum Morgen zu überbrücken, bis sie zu Nyah fahren konnte.
Mit der dampfenden Tasse in der Hand schlenderte Aledis zur gläsernen Gaube hin, ihrem Lieblingsplatz. Dort stand das alte Kanapee, das sie bei einem Trödler entdeckt hatte. Das Muster wirkte verwaschen, kaum noch erkennbar, der Stoff schien bald Risse zeigen zu wollen. Dennoch sträubte sie sich, das Kanapee neu beziehen zu lassen. Es würde danach einfach nicht mehr so schön sein.
Sie hockte sich in ihren Himmel, wie sie es gern bezeichnete, und schaute in die von Sternen übersäte Nacht hinaus. Sie wurde es nie müde, den Sternenhimmel zu betrachten. Er übte eine Faszination auf sie aus, die sie stets aufs Neue vor Ehrfurcht erschauern ließ.
Ah, da waren sie, ihre Plejaden, eine Anhäufung von Sternen, die einer Traube Beeren ähnelte und die sie besonders liebte. Sie lächelte bei diesem Anblick und begrüßte das Sternbild wie so oft mit einem leise gesprochenen »Hallo«, wie einen lieben Freund. Wie immer mit dem ersten Kaffee des Tages und dem Blick in die Weiten des Himmels wanderten ihre Gedanken, von jeder Kontrolle befreit, auf eigenen Wegen und in nicht vorhergeplante Richtungen.
Ob es richtig wäre, Nyah von dem Traum zu erzählen? Sie schien nicht mehr sie selbst zu sein. Okay, manchmal gelang noch ein normales Gespräch mit ihr. Doch meist schien sie wie von einem Nebel umhüllt, den Worte kaum zu durchdringen vermochten. Weder von der einen noch von der anderen Seite. Ihre einst so klaren und meist ein wenig frech blitzenden Augen waren jetzt trüb, der Blick so leer, als gäbe es nichts auf der Welt, das sich anzuschauen lohnte.
Aledis beugte für den letzten Schluck Kaffee den Kopf nach hinten. Obwohl Nyah zehn Jahre jünger ist, waren wir immer unzertrennlich, sinnierte sie und schmunzelte, als ihr Blick das gerahmte Foto der Schwester auf dem Tischchen neben dem Kanapee einfing. Seit damals in der Notaufnahme verging kaum ein Tag, ohne dass Aledis das Abbild betrachtete, als könnte sie ihre Schwester dadurch am Leben erhalten.
»Nyah wird in meinem Leben immer und ewig an erster Stelle stehen.«Es klang selbst in ihren eigenen Ohren wie ein Schwur. Sie holte sich einen zweiten Kaffee.
Komisch eigentlich, überlegte Aledis, während sie die warme Tasse in ihren Händen hin und her bewegte. Wir sind so verschieden. Die reinsten Gegensätze. Wie Nyah sie vom Foto anstrahlte. In ihren fröhlichen hellblauen Augen, die leuchteten wie der Frühlingshimmel, glühte der Schalk. Damit war sie auf die Welt gekommen, wie manche mit einem Muttermal. Zusammen mit der hellblonden Lockenpracht machte er sie gleich zum Liebling eines jeden, dachte Aledis neidlos. Eine Zeit lang glaubte Nyah sogar, ihr Name sei Süße, weil sie in ihren ersten Jahren meist so und fast nie mit ihrem wahren Namen angesprochen wurde. Sie war der Quirl der Familie, zu jedem Unfug sofort bereit und gänzlich ohne Schuldbewusstsein.
Was kann sie nur so verändert haben, fragte sich Aledis betrübt, während die Bilder aus der Vergangenheit in ihr verblassten.
Als der Himmel endlich den Morgen verkündete, hatte Aledis es besonders eilig, ihre Schwester zu sehen und fuhr gleich in der Frühe zu ihr.
»Ich hatte einen furchtbaren Traum«, platzte sie heraus, als Nyah ihr die Wohnungstür öffnete.
»Träume sind gut«, sagte Nyah mit ihrer neuen, fast teilnahmslosen Stimme. »In Träumen lebt man noch.«
Aledis wurde fast schwindelig bei diesen Worten. Sie unterdrückte mühsam die aufkommenden Tränen. Die Reaktion ihrer Schwester erstickte jede Absicht im Keim, Näheres über ihren Traum zu erzählen. Wieder wurde ihr die Notwendigkeit bewusst, herauszufinden, was oder wer ihrer Schwester das angetan hatte. Sie fühlte, dem Schlüssel zu dem Geheimnis ganz nahe zu sein. Ihr analytischer Geist wehrte sich standhaft, dabei irrationale Möglichkeiten auch nur in Erwägung zu ziehen. Aber eines wusste sie mit absoluter Bestimmtheit: Sie musste ihre Schwester befreien, damit sie ins Leben zurückfand.
Während sie in die ausdruckslosen Augen blickte, versprach sie: »Ich werde es herausfinden! Ich will dich wieder lachen sehen!«
»Lachen?«, fragte Nyah, als sei das etwas aus so weiter Ferne, dass sie sich nicht mehr erinnern konnte. »Worüber lachen? Dazu muss man Freude empfinden können. Ich weiß aber doch gar nicht mehr, wie sich Freude anfühlt.« Und sogleich wechselte ihr Ausdruck in vorgetäuschte Zuversicht, wie Aledis sofort erkannte, als Nyah sagte: »Ach, was soll’s. Ich bin nur erschöpft, das geht sicher bald vorüber! Vielleicht sollte ich mir mal ein Wellnesswochenende gönnen.«
Aledis bemerkte das falsche Lächeln, das den Mund dehnte. Als wäre diese Aussage nicht schon aufgrund ihres jugendlichen Alters lächerlich genug, hatte sie diesen Satz nun schon viel zu oft und seit zu langer Zeit von ihrer Schwester gehört, als dass er ihr Mut hätte machen können. Die Worte klangen ein wenig müde, wie abgenutzt durch unzählige Male der Wiederholung.
2.
Nyah saß zusammengekauert in ihrem blau geblümten Lieblingssessel, nachdem ihre Schwester gegangen war. Sie spürte die Sorge in Aledis’ Worten sogar jetzt noch, aber vorhin war sie unfähig gewesen, die Schwester zu beruhigen. Schuldgefühle und Hilflosigkeit übermannten sie und ihr Kopf sackte nach vorne. Sie malte sich aus, wie Aledis jetzt wieder einmal im Café über ihre, Nyahs, Veränderung grübelte, die sie so lustlos und traurig machte.
»Wenn ich ihr das nur ersparen könnte!« Sie fühlte sich verantwortlich für die Zeit, die ihre Schwester mit solchen Gedanken verbrachte; vergeudete Zeit, denn Hoffnung auf Besserung gab es nicht! Diese Überzeugung schrie so laut in ihrem Inneren, dass sie fast meinte, Aledis müsse die Worte hören können.
Wieder rann ein Tränenfluss Nyahs Wangen hinab. Sie verspürte überhaupt keine Hoffnung, in ihr gab es nichts mehr, das einem solchen Empfinden die nötige Kraft geben konnte. Deshalb saß sie auch nun wieder mit hochgezogenen Beinen im Sessel und konnte sich kaum noch an die Zeit erinnern, als sie diese kleine Dachgeschosswohnung mit Freude und großem Elan eingerichtet hatte. Dabei war das noch nicht einmal ein Jahr her.
Nyah hatte darin viele Dinge untergebracht, an denen sie besonders hing, die eine bestimmte Erinnerung mitbrachten. So stand unterhalb des Dachfensters die alte, leicht verbeulte Milchkanne aus dem kleinen Dorf ihrer frühen Kindheit. Wie in einer Bodenvase steckten in ihr drei etwa achtzig Zentimeter hohe Blumen aus buntem Krepppapier. Diese Blumen verkörperten das Versprechen ewiger Treue für sie und ihre damals beste Freundin Elsa. Jedes der Mädchen besiegelte den Schwur durch das feierliche Geschenk dreier selbst gebastelter Blumen.
»Die Kanne mit den Blumen muss unbedingt in meine erste eigene Wohnung einziehen.« Das stand fest. Bei ihrem Anblick verspürte Nyah bisher ein warmes Gefühl, das gegen Traurigkeit und Einsamkeit half. Gegen normale Traurigkeit, nicht diese. Jetzt halfen die Erinnerungen an Elsa und die Kanne nicht mehr. Das warme Gefühl blieb verschwunden, wie lange sie auch auf die Blüten starren mochte.
Wann hat das angefangen? Was habe ich falsch gemacht? Warum gerade ich?
Sie konnte es nicht kontrollieren. Eines Tages begannen die Tränen, sich aus ihren Augen zu drängen und unaufhörlich über ihre Wangen zu rinnen. Immer wenn sie darüber nachdachte, kam ihr dasselbe verschwommene Bild einer schönen Frau mit honigfarbenem Haar und eine bestimmte, völlig fremde Musik in den Sinn. Jedes Mal. Dabei hatte sie die Musik nur ein einziges Mal gehört.
Unheimliche Musik. Überirdische Musik.
Ergreifend melodiös.
Als Nyah sie damals hörte, geschah etwas mit ihr, da war sie sicher, obwohl sie keinerlei Erinnerung mit dem Tag oder Ereignis verband, mit dem alles begann. Ebenso sicher wusste sie, dass sie zu niemandem darüber sprechen würde. Nicht einmal zu Aledis oder Gregor, den beiden Menschen, die ihr am nächsten standen. Zu übermächtig drohte ihre Angst, irrsinnig zu sein oder dafür gehalten zu werden.
Musik zu hören, die niemand erkennbar spielte, Tonfolgen zu hören, die unmöglich mit Instrumenten dieser Welt oder mit menschlichen Stimmen erzeugt worden sein konnten, erschreckte sie nicht nur, es entsetzte sie. So etwas gab es nicht in Wirklichkeit. Solch unbeschreiblich Mysteriöses konnte und würde ihr niemand glauben. An Geister und Mysterien hatten die Leute im Mittelalter geglaubt. Nyah lebte heute und sollte es besser wissen. Aber wenn nicht ... Panik erfasste sie erneut. Sie fürchtete sich, den Satz zu Ende zu denken.
Sie ließ den Blick in der Wohnung umherschweifen, streifte prüfend all jene einst so geliebten Kleinigkeiten, aber keine berührte ihr Inneres. Und wieder einmal spürte sie, wie die massive Traurigkeit, die nicht zu ihr gehörte, von ihr Besitz ergriff. Sie weinte lautlos in sich hinein, stundenlang; weinte und schämte sich für jede Träne.
~
Aledis versank tatsächlich in tiefem Grübeln, als sie sich notgedrungen wieder auf den Weg machte, um rechtzeitig zur Arbeit zu kommen. Die sorgenvollen Gedanken verließen sie den ganzen Tag nicht mehr, wirbelten noch in ihrem Kopf umher, als sie sich am Abend erschöpft auf ihre Couch fallen ließ.
Unterwegs hatte Aledis sich noch schnell eine Pizza besorgt. So gerne sie auch kochte, heute fehlte ihr dazu jeder Antrieb. Dann muss es eben ein fertiges Abendessen geben, beschloss sie. Immerhin kam die Pizza nicht aus der Tiefkühltruhe, sondern von Sandro, dem Italiener um die Ecke.
»Ciao Bella!« Immer begrüßte Sandro sie mit diesen Worten und einem obligatorischen Handkuss. Diese kleine Geste bedeutete Aledis viel. Mit einem zwar günstigen, aber dennoch guten Chianti und der Pizza stand nun ein Abendessen vor ihr, mit dem man zufrieden sein konnte.
Während des Essens kreisten die Gedanken weiter unablässig um ihre Schwester und was damals mit ihr so plötzlich, ohne jeden Hinweis auf eine medizinisch erklärbare Erkrankung geschehen sein mochte. Wie Aledis es auch drehte und wendete, sie verstand es einfach nicht. Sie betrachtete ihre Welt stets realistisch. Um etwas gegen ein Problem unternehmen zu können, musste sie es zunächst verstehen. So lautete ihre Lebensphilosophie. Danach handelte sie schon immer. Das machte ihr Leben vorhersehbar und ruhig. Sie wollte keine Abenteuer und erst recht keine Mystik darin. Als mystisch bezeichnete Begebenheiten sah sie als irreal an. Sie fanden nur in den Köpfen von Menschen statt, die nicht mit beiden Beinen im Leben standen. So etwas war nichts für Aledis. Sie hatte alles unter Kontrolle.
Aber dies hier – unvermittelt kam ihr die Frau von gestern an Tisch vier wieder in den Sinn –, diese unerklärliche Sache, von der neben Nyah inzwischen viele Menschen in der Stadt erfasst waren, was sollte sie davon halten? Wie sollte sie ein Problem lösen, wenn die Ursache rational nicht greifbar war? Aledis wollte nicht an einen dubiosen Nebelmann glauben, wehrte sich mit aller Kraft dagegen.
Und doch, dieser Traum ... er schien ihr so real ... Sie schwenkte den Wein im Glas, verlor sich einen Moment in dem kräftigen Rot, bevor sie trank. Fordernde Augen tauchten blitzartig hinter ihrer Stirn auf. Augen in der Farbe von Met, ein dunkles Gelb, fast golden. Sie erschauerte. Und wenn es ihn nun doch gab? Aber nein. Blödsinn! Sie schüttelte den Kopf und besann sich auf die Gabel in ihrer Hand. Der Zweifel blieb.
Ein schrilles Klirren erfüllte den Raum.
Aledis schreckte hoch. Vorsichtig ordnete sie die Welt, soweit sie sich erkennen ließ und bemühte sich um klares Denken. Draußen alles stockfinster, also Nacht. Sie befand sich in ihrer Wohnung, saß auf ihrer Couch. Soweit keine Gefahr. Um ihre Füße herum lagen Scherben, sowohl auf als auch neben dem Teppich. O Gott, ich muss eingenickt sein und dabei ist mir das Weinglas aus der Hand gefallen, stellte sie erschrocken fest. Zum Glück war das Glas leer gewesen. Um Rotweinflecke muss ich mich also nicht kümmern. Die Scherben haben bis morgen Zeit. Aledis versuchte, die gleichzeitig erwachten düsteren Gedanken über Nyah fürs Erste zu verdrängen und schlurfte zu ihrem Bett hinüber. Sie dachte mit Grauen daran, dass sie für den nächsten Tag die Frühschicht übernommen hatte, rollte sich zusammen, zog die Decke bis über die Schultern und schloss die Augen.
Ein wenig beneidete sie ihre zwei Mitarbeiterinnen im Café, die den Job neben ihrem Studium machten. Eigentlich hatte Aledis sich einen völlig anderen beruflichen Weg vorgestellt. Etwas Wissenschaftliches, Archäologie vielleicht und dabei Aufsehen erregende Altertümer entdecken, oder alte Sprachen erforschen. Philosophie fand sie auch faszinierend, konnte stundenlang an tiefgründigen Worten festkleben.
Doch der plötzliche und viel zu frühe Unfalltod ihrer Mutter löschte jeden Wunsch, sich an einer Universität einzuschreiben, aus. Ganz vorne auf der Liste stand auf einmal die Notwendigkeit, für Nyah und ihrer beider Lebensunterhalt zu sorgen. Die beiden Mädchen standen unvorbereitet vor der Schwierigkeit, sich allein durchs Leben zu kämpfen, denn weitere Angehörige gab es nicht.
»Zu viele Gedanken und die falschen noch dazu.« Aledis drehte sich mürrisch auf die andere Seite. Das alles war doch schon sieben Jahre her und sie musste endlich schlafen!
Ein dumpfes Knirschen ließ sie aufhorchen. Gregors klemmende Balkontür. Er schlief also auch noch nicht. Ein warmes Lächeln erfüllte sie. Fast hatte sie vergessen, wie schwer es ihr anfangs fiel. Zum Glück zog Gregor damals, genau zum richtigen Zeitpunkt, in die Wohnung direkt unter ihr. Ohne ihn hätte sie es nicht geschafft, das kleine Café aufzubauen und zu dem florierenden Geschäft zu machen, auf das sie heute stolz sein konnte. Schließlich war Nyah erst neun Jahre alt gewesen, ein ohnehin schwieriges Alter. Dennoch blieb Gregor trotz seiner vierundfünfzig Jahre unermüdlich, dem Kind die Welt, das Mysterium von Tod und Leben und die Matheaufgaben zu erklären. Wann immer Aledis ihre Schwester nicht selbst betreuen konnte, stand Gregor mit offenen Armen bereit zu helfen.
Gregor war ein komischer Kauz. Er hatte nie geheiratet, und seit Aledis ihn kannte, gab es auch keine Frau in seinem Leben.
Es wäre maßlos übertrieben, Gregor als ansprechend im Sinne von gutaussehend zu bezeichnen. Sein Gesicht strahlte aus jeder Pore Ablehnung und Kampfeslust aus. Die kleinen, grau blitzenden Augen unterstützten diesen Eindruck nachhaltig. Seine rostroten Haare standen wie die Borsten eines alten Handfegers um seinen Kopf herum. Wahrscheinlich trug er sie meist kurz geschnitten, um diesem Vergleich so wenig Nahrung wie möglich zu geben. Was oben geschoren wurde, spross am Kinn umso üppiger: Gregor trug einen langen Bart, den er – als sei das noch nicht genug – teilte und zu zwei geflochtenen Zöpfen arrangierte. Als Aledis ihn zum ersten Mal sah, fühlte sie sich an einen Wikinger erinnert, der unmittelbar davorstand, mit lautem Gebrüll anzugreifen.
Allein der Klang seiner Stimme konnte so voller Zärtlichkeit sein, dass er alle anderen Eindrücke fortschwemmte, als seien sie nur einem Hirngespinst des Lauschenden entsprungen. Und genau dieser Klang erreichte Aledis als Erstes, als Gregor damals an ihrer Tür klingelte, um sich als ihr neuer Nachbar vorzustellen. Wenige Worte, die durch die geschlossene Tür zu ihr drangen, aber genug, um dem Zauber seiner Stimme zu erliegen. Aledis fühlte sich sofort zu ihm hingezogen.
Von diesem Tag an besuchten sie einander häufig »auf ein Glas«, unterhielten sich und lachten oft die halbe Nacht durch, nachdem Nyah eingeschlafen war. Dabei waren ihre Themen so vielseitig und intensiv, dass Aledis bald das Gefühl bekam, Gregor bereits seit Jahren zu kennen. Er zeigte besonders viel Interesse an ihrer Familie und dem Schmerz, den sie erleiden musste. Darüber zu sprechen, tat Aledis gut, obwohl manchmal der Eindruck entstand, ausgehorcht zu werden. Ungewöhnlich viele Fragen betrafen ihre Mutter und die Umstände ihres Todes. Woher wusste Gregor eigentlich, dass auch sie olivgrüne Augen gehabt hatte?
~
Nachdem die erste Schicht, die wegen der vielen Frühstücksgäste anstrengendste, hinter ihr lag, fuhr Aledis zu ihrer Schwester.
»Hey, hast du einen Saft für mich? Ich bin im Café zu gar nichts gekommen«, sagte sie statt einer Begrüßung und ging an Nyah vorbei zur Küchenecke. »Ich dachte, wir könnten spazieren gehen«, rief sie über die Schulter, während sie den Kühlschrankinhalt untersuchte. »Warst du gestern draußen? Ich jedenfalls könnte jetzt frische Luft vertragen.«
»Bring mich ans Meer.«
O je, so schlimm ist es mal wieder, dachte Aledis und bemühte sich, ihre Schwester nur beiläufig anzusehen. Manchmal ertrug sie den Blick aus diesen glanzlosen Augen nicht. Ohne Leben. Sie wusste, dass hinter dem Wunsch ihrer Schwester gefährliche Suizidzwänge standen. Das Meer half. Also war es gar keine Frage, wohin der Ausflug gehen würde. Wieder stieg in ihr die Gewissheit klar und deutlich auf, dass sie Nyah von diesem schrecklichen Gefühlschaos befreien musste. Aber wo sollte sie bloß anfangen, nach einer Lösung zu suchen? Sie fühlte sich so hilflos.
Die Fahrt ans Meer dauerte nur etwa eine Stunde. Schon von Weitem bot sich ihnen der vertraute Anblick auf endloses Wasser, und als Aledis den Wagen abschloss, floss ihr die Ruhe der rauschenden Wellen direkt in die Glieder. Sie schloss die Augen für einen Moment, sog den salzigen Geruch von Algen und Tang ein, lauschte dem Gelächter der Möwen. Dann legte sie den Arm um ihre Schwester, schob sie leicht vorwärts zur Wasserkante und wandte sich nach rechts, dem schwachen Wind entgegen. Nyah ging schweigend neben ihr und sammelte hin und wieder einen Stein auf.
»Sie müssen blau sein«, sagte sie mit Nachdruck. »Blau, rund und glatt. Sonst haben sie keine Kraft, meint Gregor.«
»Wofür denn Kraft?«
»Lebensfreude. Sie bewahren sie in sich, und wenn du sie mit der Hand umschließt, kann die Lebensfreude auf dich übergehen.«
Aledis runzelte ungläubig die Stirn. Eine Frau kam ihnen langsam entgegen. Ihr nach unten geneigter Kopf hob sich, als sie auf einer Höhe waren, aber sie schien die Schwestern nicht wirklich wahrzunehmen.
»Die sucht auch«, sagte Nyah unvermittelt.
»Woher willst du das wissen?«
»Der Ausdruck ihrer Augen «, erklärte Nyah tonlos. »Es ist nur noch wenig Lebensfreude in ihr. Wenn die Steine ihr nicht helfen, wird sie bald gehen.«
Aledis blieb erschrocken stehen.Wieso gehen? Und wohin? Sie traute sich nicht, die Frage laut auszusprechen. Denn ihr wurde sofort klar, was Nyah meinte. Oh, nein! Bitte nicht das! Ich will dich nicht verlieren! Innerlich schluchzte Aledis auf.
»Was hat Gregor dir da bloß für einen Quatsch eingeredet«, versuchte sie, das Thema zu wechseln und von ihrer inneren Furcht abzulenken. »Ich finde auch, dass die Blauen besonders schön sind. Aber Lebensfreude speichern ..., also wirklich! Ich werde mit Gregor reden müssen.«
»Du darfst nicht mit ihm schimpfen!« Nyahs Protest kam mit hoher, ganz aufgeregter Stimme. »Gregor erzählt nicht einfach mal etwas. Er braucht das nicht. Er muss sich nicht wichtig machen.« Sie stampfte mit dem Fuß auf. Der weiche Sand verschluckte das Geräusch. »Was er sagt, ist richtig und voll tiefer Bedeutung«, verteidigte sie ihren Spielgefährten, Ersatzvater, Freund und Lehrer.
Aledis registrierte insgeheim glücklich, wie stark die hellblauen Augen plötzlich wieder blitzten und mit wie viel Enthusiasmus sie für »ihren« Gregor eintrat. Ihr Blick ruhte mit tiefer Liebe auf Nyah. Diese unverhoffte Erkenntnis gab ihr neue Hoffnung. Es war noch nicht zu spät. Sie würde noch Zeit haben, eine Lösung zu finden.
~
Die Glocke ertönte. Gelangweilt, eher automatisch, schaute der rothaarige Mann zur Tür und musterte die zwei Frauen, die auf der Schwelle des Cafés standen. Eine von ihnen deutete hinaus zu der anderen Straßenseite. Eine junge Frau ging dort gemächlich an den Geschäften vorbei. Sie schlurfte beinahe. Ein kleiner Junge neben ihr weinte und zog sie am Rockzipfel, doch die Mutter ging einfach weiter. Beachtete ihn nicht.
Mittlerweile ließen sich die beiden Frauen an dem benachbarten Tisch nieder und bestellten Kaffee. Auf dem Gesicht der Brünetten lag ein ängstlicher Ausdruck und sie schien verwirrt, während die andere versuchte, sie zu beruhigen. Der Mann tupfte mit einer Serviette seinen geflochtenen Bart entlang und wollte sich schon wieder abwenden, als die Brünette zu sprechen begann.
»Hast du die Frau mit dem Jungen nicht gesehen? Glaubst du mir jetzt? Man konnte die Traurigkeit in jedem ihrer Schritte sehen! Es werden immer mehr ...«
Normalerweise hätte Gregor das Gespräch zweier Frauen im Café wenig interessiert, doch dieser scheinbar bedeutungslose, unvollendete Satz weckte seine Aufmerksamkeit.
»Du bildest dir das ein, Rose. Diese Frau ist bestimmt einfach nur müde. Das hat sicher nichts damit zu tun, was deiner Mutter passiert ist.« Das Kinn ihrer Freundin begann zu zittern.
»Doch, meine Mutter sieht jetzt immer genauso aus wie diese Frau. Derselbe Gesichtsausdruck, dieselben leeren Augen.« Ihre Stimme klang brüchig vor Kummer, sie schlug die Augen nieder. Der Kaffee wurde gebracht und ihre Freundin schob Rose die Tasse hin.
»Trink einen Schluck, dann geht’s dir besser, glaub mir.« Beruhigend lächelte sie Rose an.
»Nein! Es wird nicht besser werden. Bestimmt nicht. Der Nebelmann hat sie hinabgezogen, ich weiß es. Jeden Tag geht es ihr schlechter und ich weiß nicht, was ich noch tun soll.« Eine Träne rann über ihr blasses Gesicht. »Ich habe seitdem jede Nacht Angst zu schlafen.« Sie schluchzte jetzt. »Am liebsten würde ich gar nicht mehr schlafen. Es geschieht etwas und es geschieht nachts.«
Damit verstummte sie und schaute Hilfe suchend zu der Freundin, doch auf deren Gesicht lag dieselbe Ratlosigkeit.
Gregor fuhr sich mit einer Hand über die roten Stoppelhaare, dann sprang er auf.
3.
Laurin malte sich aus, wie es sein würde, mehr und mehr, ja vielleicht sämtliche Menschen dieser Stadt in seine Gewalt zu bekommen. Er kostete diesen Gedanken aus, konnte ihn förmlich auf der Zunge schmecken. Und doch – der anfängliche Genuss ließ nach. Auch verlangte es ihm von Mal zu Mal mehr Anstrengung und Kraft ab, weshalb er seine Streifzüge nur noch in größeren Abständen unternahm.
Er fragte sich, ob das Gefühl nie zuvor gespürten Glücks sich noch steigern lassen würde. Das Erlebnis mit dieser jungen Frau, die er in ihrem Traum aufgesucht hatte, ließ ihn zweifeln. Fast überwältigt, kam sie beinahe schon an in seiner Welt. Ihre glücklichen Gefühle für ihn schon zum Greifen nahe, er spürte bereits, wie sie ihn zu stärken begannen. Doch plötzlich riss ihn etwas fort von ihr. Er vermochte nicht zu deuten, was es war. So etwas war zuvor noch nie geschehen.
Seit Jahren schwebten alle anderen Menschen problemlos zu ihm hinüber, gaben ihm all ihre Glücksgefühle und lebten danach in ihrer Welt nur noch als triste Hüllen.
Die Stirn in Falten gelegt saß er lange in dem prunkvoll ausgestatteten Raum, der keinerlei Wärme ausstrahlte, weil dazu Eigenschaften nötig waren, die Laurin nicht besaß, und suchte nach Gründen für die Opferbereitschaft der Menschen. Oft nahmen sie ihn gar nicht wahr, manchen kam er auch sehr nahe. Alle blieben wie gebannt stehen und machten sich zum leichten Ziel für seinen Angriff. Besonders Frauen. Dabei fand er sich weder schön noch sonst irgendwie anziehend. Gewiss, er war hochgewachsen und sein muskulöser Körper nicht antrainiert.
Er strich sich das Haar aus dem Gesicht, die schwarzen Wellen fielen auf die Schultern. Genervt bemerkte er die Spiegelung im silbernen Weinkrug: Im Fackellicht schimmerten kaum sichtbar feine Strähnen in einem für Haare ungewöhnlichen Farbton von feurigem Orange. Sie interessierten ihn nicht. Als er die Strähnen vor Jahren zum ersten Mal im Spiegel entdeckte, fand er sie ebenso abstoßend wie seine gesamte Erscheinung. Was also brachte in seinen Opfern diese lähmende Faszination hervor?
Hart stellte er das Kristallglas ab und stemmte sich mit beiden Händen aus dem antiken Lehnstuhl. Er musste wieder in die Stadt.
~
Drei Monate!
Drei Monate voll von Eindrücken, Erlebnissen und hoffentlich noch viel mehr lagen vor ihr. Im Alter von neunzehn Jahren zum ersten Mal zu fliegen, mochten manche belächeln. Aber in Aledis breitete sich von ganz tief unten ein Strahlen aus wie eine Welle, glitt hoch zu ihrem Gesicht, wo der Platz nicht auszureichen schien. Die junge Frau stand am Laufband und wartete auf ihre Koffer. Sie war weder ungeduldig noch genervt wie die übrigen Fluggäste. Sie war angefüllt mit Vorfreude auf diese Reise, während der sie vollkommen frei sein, nur genießen und alles in sich aufnehmen würde, was dieses Land ihr anbot.
Sie kontrollierte zum hundertsten Mal die kleine Tasche unter dem T-Shirt. Geld, Kreditkarte, alles noch da. Bevor sie sich diese Reise nach Amerika leisten konnte, musste sie hart arbeiten, zeitweilig sogar vier Jobs gleichzeitig erledigen. Trotz Abiturstress. Beim letzten Job hatte sie es so weit gebracht, siebenundzwanzig Büros in nur zweieinhalb Stunden gründlich zu putzen, meist bis drei Uhr in der Nacht.
Und jetzt war es endlich soweit. Drei Monate auf der anderen Seite des Ozeans lagen vor ihr. An das normale Leben danach, mit Zukunftsplänen, Studium und Beruf dachte sie nicht. Nicht hier. Hier pausierte alles, was zu Hause noch kommen würde.
Sie fuhr.
Die Landstraße führte schnurgeradeaus, soweit das Auge blicken konnte. Keine Häuser. Keine Menschen. Nur Landschaft in einer Schönheit, wie Aledis sie nicht kannte. Gerade kam sie an einer Felsgruppe vorbei, deren Steine sich weiß und glatt übereinander türmten. Wie Sahnehäubchen, fuhr es ihr durch den Sinn. Im Radio trällerte der Refrain eines Liedes: »I don’t want you to worry. This is my life!« Ja!, dachte Aledis breit lächelnd und sang laut mit.
Nach zwei Stunden Fahrt näherte sie sich dem Punkt, an dem sie ihrer Karte zufolge abbiegen musste. Sie gelangte auf eine wesentlich kleinere Straße, deren Verlauf die Karte nach einer weiteren halben Stunde nicht mehr verzeichnete.
Aledis drosselte den Motor und hielt an. Der Himmel hatte inzwischen eine sanfte Lavendelfarbe angenommen, die den Übergang ins tiefe Blau der Nacht ankündigte. Es wurde höchste Zeit, sich einen Platz zum Schlafen zu suchen.
Nach einem Blick auf den Plan lenkte Aledis ihr Auto auf einen kleinen Fluss zu, den wenige Baumgrüppchen säumten. Im Innern dieses kleinen Waldstückes fand sie mehrere abgegrenzte Plätze, wie es sie in den Nationalparks dieses Landes oft gab. Gerade groß genug, um ein Fahrzeug darin zu parken, wiesen sie im hinteren Bereich meist eine mit Steinen umrundete Feuerstelle auf.
Sie fuhr die schmalen Schotterwege entlang und sah sich um. Einige Nischen besetzten uralte, rostige Geländefahrzeuge oder Zelte und Motorräder, aber sie konnte keine Menschen sehen, wusste also nicht, ob erhöhte Vorsicht ratsam war. Schließlich wählte sie einen Platz, der unmittelbar an das Flüsschen grenzte und genügend Abstand zu den bereits belegten Nischen bot.
Die vordere Begrenzung zum Schotterweg bildete ein Felsbrocken von etwa einem Kubikmeter, den sie als Tisch zu nutzen beschloss. Sie arrangierte darauf ein Stilleben aus einer Dose Bier, einem Stück hellen Brotes und einer ganzen Salami, in die sie ihr Messer so tief steckte, dass nur noch der Griff siegreich herausragte. Dann kramte sie nach ihrer Kamera, um diese Idylle für immer festzuhalten.
Während sie noch suchte, hatte eine kleine Eidechse die Köstlichkeiten offenbar gerochen. Sie saß jetzt direkt neben der Salami und schnupperte interessiert an dieser unverhofften Beute. Aledis traute ihren Augen kaum, denn der gesamte Körper der Kleinen war von heller lindgrüner Farbe, der Kopf aber leuchtete kirschrot. Eine solch ungewöhnliche Färbung hatte sie zuvor nicht einmal auf Bildern gesehen. Vorsichtig hob sie ihre Kamera an und drückte ab.
»Das glaubt mir ja sonst keiner«, murmelte sie vor sich hin, während sie zaghaft nähertrat, um das Tier genauer zu betrachten. Aber schneller, als ein Atemzug dauerte, huschte die Eidechse fort und verschwand. Aledis’ gute Laune trübte sich dadurch allerdings nicht. Mit dem Lächeln, das nicht von ihrem Gesicht gewichen war, seit sie ihren Koffer auf dem Laufband entdeckt hatte, nahm sie neben ihrem steinernen Tisch Platz, genoss ihr rustikales Abendessen und sog die Musik des neben ihr plätschernden Wassers auf. So konnte das Leben also auch sein, dachte sie zum wiederholten Mal. Was für ein Glück, dass sie sich verfahren hatte, sonst hätte sie dieses Fleckchen, das in keinem Touristenführer stand, niemals gefunden.
Zwei Männer näherten sich.
Sie trugen ein paar Bierdosen im Arm und boten Aledis eine davon an, als sie sie freundlich lächelnd begrüßten.
»Woher kommst du?«, wollte der eine Mann wissen. Aledis wusste inzwischen, dass hierzulande mit dieser Frage fast jedes Gespräch begann, und blieb entspannt. Zwar hätte ihre Mutter sicherlich gesagt, dass die äußere Erscheinung der beiden geeignet war, sämtliche Alarmglocken in einer Frau zum Läuten zu bringen. Tatsächlich waren beide wohl schon länger nicht in der Nähe einer Dusche gewesen und auch ihre Kleidung wirkte dringend austauschbedürftig, aber ihre Mutter war ja nicht hier. Dies alles hier gehörte ihr allein und so lauschte sie gebannt der Geschichte, die ihr zur Erklärung ausreichte:
Jacob und Gary waren Brüder indianischen Ursprungs, die ihr Haus verkauft hatten, um nur noch auf Reisen zu sein. Im Unterschied zu diesem hier kosteten Campingplätze mit Dusche Geld, deshalb wurden sie nur im Abstand mehrerer Tage angefahren. Das konnte Aledis verstehen.
Jacob, dem jüngeren der beiden, sah man seine Vorfahren deutlich an. Das in der Mitte gescheitelte schwarze Haar reichte ihm bis zu den Ellenbogen, und ebenso schwarze Augen glänzten sie an. Sein einnehmendes Lachen gefiel Aledis besonders. Die strahlenden Zähne, die zwischen schräg gezogenen Lippen zum Vorschein kamen, wirkten irgendwie weißer, als Zähne es eigentlich sein konnten. Ob das bei allen Indianern so ist, überlegte sie, oder ob es nur an dem Kontrast zur rostbraunen Haut liegt?
Sein Bruder schien erheblich älter. Die genauso langen Haare waren schon stark von Grau durchzogen. Aber auch seine schwarzen Augen strahlten nichts als Freundlichkeit und ehrliches Interesse aus. Es droht keine Gefahr, befand sie.
Als die Dunkelheit dichter wurde, luden die Brüder Aledis zu ihrem eigenen Platz ein, weil dieser weiträumiger und daher für ein größeres Lagerfeuer geeignet war. Dort saß bereits eine Gruppe weiterer Männer um ein flackerndes Feuer herum. Es wurde viel erzählt und in einer für Aledis fremden Sprache gesungen. Sie erfuhr eine Menge über Beschützer des Stammes, dem all die Männer angehörten, und über eine Bedrohung, die seit etwa zwei Jahren um sich griff. Damals waren einige Angehörige ihres Stammes aus dem Nichts heraus angegriffen worden und ohne sichtbare Verletzungen schwer erkrankt. Ihre Seelen seien vernebelt worden, sagte der ältere Bruder.
Vor Bestürzung verschwand das Lächeln in ihr zum ersten Mal seit ihrer Ankunft in Amerika. Jacob, der am Feuer neben ihr saß, blickte versonnen in die Flammen, sodass sie nur sein Profil sehen konnte. Kräftige Wangenknochen, gerade Nase, gefurchtes Kinn. Er gefiel ihr. Zu vorgerückter Stunde erzählte er Aledis leise, dass auch er zu den Beschützern gehörte.
»Die Reisen, die Gary und ich unternehmen«, raunte er ihr zu, »dienen nur der Tarnung. In Wirklichkeit fahren wir durch das Land, um Informationen zu sammeln.«
»Das verstehe ich nicht«, sagte Aledis nach einer Weile. »Wie kann man jemanden durch das schlichte Sammeln von Informationen beschützen?«
Jacob öffnete die Lippen zu einem breiten Lachen, das leicht schief wirkte. Er schien erfreut, ihr Interesse geweckt zu haben.
»Wir versuchen alles über diese merkwürdigen Angriffe herauszufinden, die so plötzlich begonnen und dann ebenso unvermittelt aufgehört haben.« Er öffnete eine neue Bierdose und reichte sie ihr. »Das Verstörende daran ist, dass niemand den oder die Angreifer je gesehen hat.« Für einen Moment schwieg er, als müsse er über den letzten Satz noch weiter nachdenken. »Als ich erfuhr, dass sich solche Attacken auch in anderen Gegenden, sogar in weit entfernten Ländern ereigneten, war ich schockiert«, fuhr er dann in ernstem Ton fort. »Es ist ein Gefühl schrecklicher Ohnmacht einer Kraft gegenüber, gegen die man nichts auszurichten vermag.« Diese eher an die Flammen als an seinen Gast gerichteten Worte flüsterte er beinahe. Seine vorhin noch so ansteckende Fröhlichkeit war verflogen.
Das Feuer knisterte und Funken sprühten in die schwarze Nacht, mischten sich mit den Sternen. Auch Aledis wurde still, lauschte dem Schweigen, das Jacobs letzte Worte hinterlassen hatten.
»Versprich mir«, sagte er unvermittelt mit sehr eindringlichem Tonfall, »dass du mir Bescheid gibst, falls du mal von solchen Ereignissen hörst oder selbst Hilfe brauchst.«
Unter zusammengezogenen Brauen musterte sie ihn verwirrt.
»Du sagst, ihr seid auf der Suche nach dem Angreifer. Aber habt ihr denn schon herausgefunden, was gegen die Krankheit hilft? Eine Medizin oder so?«, Die Frage zauberte ungewollt das Lachen auf Jacobs Gesicht zurück.
»Die Menschen unseres Stammes arbeiten selten mit Mitteln der klassischen Medizin. Wir setzen alte Heilkräfte ein, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Die Schwester meiner Mutter zum Beispiel kann durch den bloßen Einsatz ihrer Hände fast alles heilen. Also, bitte melde dich, wenn du mich mal brauchst.«
Aledis senkte bei diesen Worten nachdenklich den Kopf. Ihre Kontaktdaten hatten sie schon vor Stunden ausgetauscht. Allerdings nahm sie diese Geste nicht besonders ernst. »Komm vorbei, wenn du in der Gegend bist.« Das sagte sich hierzulande leicht. Würde sie je davon Gebrauch machen? Und wie würde sie reagieren, wenn eine der Personen, denen sie hier ihre Adresse gegeben hatte, plötzlich vor ihrer Tür stand?
Sie wischte diese Gedanken weg. Der Umgang miteinander in diesem Land war so leicht, so freundlich. Sie fühlte sich wie von einem Daunenkissen getragen. Ist doch egal, ob sie es ernst meinen, dachte sie. Es ist eine Einladung, die den Moment erhellt, das reicht.
Sie bedankte sich mit einem Nicken, bevor sie sich von den Männern verabschiedete, und schlenderte hinüber zu ihrem Platz, wo sie es sich in ihrem kleinen blauen Toyota zum Schlafen gemütlich machte. Morgen würde sie nach Westen fahren. Den Nationalpark aus der Zigarettenwerbung musste sie unbedingt sehen!
~
»Da ist er wieder.« Lorell, die gerade zu ihrer Schicht eintraf, zwinkerte Aledis zu. »Wann erhörst du ihn endlich? Er kann einem ja fürchterlich leidtun und es muss ihn ein Heidengeld kosten, dauernd hier aufzukreuzen.« Lorell trug ihre Empfehlung so eindringlich vor, dass ihr halb schwarz, halb pink gefärbtes, in alle Richtungen abstehendes Haar bei jedem Wort mitwippte.
Aledis lachte. »Gib es auf, Lorell, und gewöhn dich daran, dass wir die dicksten Freunde sind – aber nur das!« Mit diesen Worten bereitete sie einen Latte macchiato und schlenderte damit hinüber zu dem Tisch, an dem Mo saß.
Mo stand für Maurice, aber diesen Namen mochte er noch nie. Inzwischen kannte ihn niemand mehr unter seinem wahren Namen.
»Hey, Mo, schön, dass du da bist. Hast du heute Abend Zeit? Ich könnte starke Schultern gebrauchen.«
»Na, das ist ja mal ganz was Ausgefallenes.« Grinsend stand Mo auf, um sie zu umarmen.
»Ach ehrlich, Mo.« Sie gab ihm einen liebevollen Klaps auf die Schulter. »Nyah geht es wieder schlechter und ich hatte einen schrecklichen Traum und überhaupt ... das viele Nachdenken macht mich ganz kirre.«
Mo behielt sein Grinsen trotz der schlechten Nachrichten. Aledis mochte dieses Grinsen. Es gab seinem Gesicht etwas Jungenhaftes.
»Ich gehe wohl nicht fehl in der Annahme, dass die Empfehlung, mich endlich zu heiraten und damit alle Sorgen loszuwerden, wieder mal ins Leere geht?«
»Ach Mo, mein lieber, lieber Mo!«, strahlte sie ihn an. »Du weißt doch, du bist der wichtigste Mann in meinem Leben, aber du weißt auch, dass ich niemals heiraten werde. Ich bin für so was nicht geschaffen.«
Mo glaubte ihr kein Wort. Er würde einfach weiter für sie da sein und ab und zu einen neuen Versuch starten. Eines Tages würde Aledis erkennen, dass sie sich selbst etwas vormachte.
Er beobachtete sie, während sie mit zwei Tassen frischem Kaffee auf einen Tisch zuging, an dem zwei junge Frauen saßen. Es war einfach so, dass Mo sie gerne ansah, und zuweilen konnte er damit Stunden zubringen. Im Sonnenlicht, das durch die breite Fensterfront in das Café fiel, schimmerten ihre glatten Haare wie frische Kastanien.
»Du starrst mich schon wieder so an!«, raunte Aledis ihm im Vorbeigehen zu.
Wieder am Tresen angekommen, wechselten die Augen, die ihn eben noch mit einem weichen Ausdruck beschenkt hatten, schnell zu einem von Kontrolle beherrschten Blick, der über die besetzten Tische schweifte. Der kräftige, olivgrüne Farbton ihrer Iris verdunkelte sich. Mo kannte diesen raschen Wechsel des Ausdrucks in ihren Augen. Er wusste, dass dies keine Missachtung seiner Person bedeutete. Aufmerksamer Beobachtung – und Mo betrachtete sich, wenn es Aledis betraf, als deren Meister – konnte die Sanftmut dieser Frau ohnehin nicht verborgen bleiben. Sie war in ihren zu dem Hauch eines Lächelns aufgeschwungenen Mundwinkeln eingepflanzt, wie von einem Bildhauer in einer Statue verewigt. Aledis bemühte sich nur ständig, die entschlossenere und härtere Seite von sich zu zeigen. Ihre dichten dunklen Brauen, die sie oft über der Nasenwurzel zusammenzog, halfen ihr dabei. Mo durchschaute und liebte dieses Zusammenspiel, das ihrem Gesicht eine sowohl irritierende als auch ansprechende Gegensätzlichkeit verlieh.
Hinter dem Tresen polierte Lorell ein Glas und beobachtete das Verhalten der beiden gespannt, aber ohne jedes Verständnis. Wie konnte man einen solchen Mann nicht anbeten? Sie betrachtete (zum wievielten Mal eigentlich?) Mos leicht kantiges Gesicht mit den hohen Wangenknochen und dem Dreitagebart, der seinem leicht nach oben geschwungenen Kinn noch mehr Sinnlichkeit verlieh. Die stets ungekämmt aussehenden, roggenblonden Haare trug er auch heute wieder im Nacken zusammengebunden.
Dieser Mann besaß eine Attraktivität, wie man sie unter seinen Geschlechtsgenossen nur selten fand, schmachtete Lorell. Ihn umgab eine Aura, die ihre Hormone hochkochen und nach mehr verlangen ließ. Es war die reine Verschwendung, all dies für ihre Chefin in Warteposition zu belassen.
Die Muskeln in Mos Unterarm spannten sich nur ganz leicht an, als er nach seinem Latte macchiato griff, aber Lorell bemerkte es. Sie würde wer weiß was dafür geben, anstelle dieses Glases zu sein.
Gerade, als sie noch mal zu Mos Tisch hinübergehen wollte, schlangen sich Gregors Arme plötzlich von hinten um Aledis.
»Willst du schon gehen?«, fragte sie, nachdem sie sich von dem Schreck erholt hatte. Eben noch hatte er doch die beiden jungen Frauen an seinem Nachbartisch beobachtet.
»Ja. Es eilt. Es werden mehr. Ich muss rasch ein paar Dinge überprüfen.«
»Was ist denn los? Wer wird mehr? Ist etwas passiert?«
»Mach dir keine Sorgen«, antwortete Gregor ausweichend. »Ich erkläre dir alles, wenn es soweit ist.« Er drückte ihr einen hastigen Kuss auf die Stirn. »Immer den Hals schützen!«
Verwirrt schaute sie ihm nach, als er mit energischen Schritten das Café verließ.
Gregor benutzte diesen Satz ihr gegenüber nun schon jahrelang zum Abschied, ohne auf ihre Fragen eine Erklärung abzugeben. Sie versuchte, das als Schrulligkeit eines kauzigen alten Mannes abzutun, aber verwirrend fand sie den Satz trotzdem immer noch, fast beunruhigend ...
Am Abend saß sie mit Mo zusammen auf ihrem Sofa und versuchte alles, was sie in den letzten Tagen bedrückt hatte, abzuladen. Sie kam sich dabei sehr egoistisch vor.
»Schau dir meine Schultern an, die können viel tragen. Sie sind geradezu froh, wenn sie dir Lasten abnehmen können«, beteuerte er wie schon so oft.
Ihr wurde bewusst, dass sich unter seinem T-Shirt tatsächlich ein muskulöser Oberkörper abzeichnete, der sehr einladend wirkte. Selbstverständlich nur, um sich anzulehnen oder auszuweinen. Davon, dass die Einladung durchaus auch andere Bereiche in ihr ansprach, wollte Aledis nichts wissen.
»Glaub mir, es schien alles total wirklich zu sein!« Sie wollte Mo unbedingt verdeutlichen, wie sehr dieser Traum sie immer noch aufwühlte.
»Das sind Albträume doch immer.«
»Diesmal war es anders, irgendwie intensiver und stark nachhallend«, beharrte Aledis. » Als würde ich von einem Sog erfasst, ohne mich wehren zu können.« Sie bekam hochrote Wangen.
»Aber das ist doch nun wirklich das Paradebeispiel eines Albtraumes, dass man sich nicht wehren, nicht weglaufen kann.«
»Aber ich konnte den Mann sogar deutlich sehen, er hat lange, ganz dunkle Haare.« Sie selbst hörte Triumph in ihrer Stimme.
»Na, das bringt uns jetzt echt weiter. Ich denke, dieses herausragende Merkmal trifft höchstens auf zwei Drittel der Männer unserer Stadt zu, da haben wir ja leichtes Spiel.«
Bei diesen Worten fing Aledis an, Mo mit ihren Fäusten zu attackieren, obwohl sie genau wusste, dass sein Sarkasmus ihr gegenüber nie böse Absichten enthielt. Es war eben seine Art. Sie kannte ihn schon zu lange, um verletzt zu sein.
Außerdem genoss sie diese Momente, in denen sie herumalberten wie Kinder. Da gab es so viel Ungezwungenheit, so viel Nähe und Wärme zwischen ihnen. Manchmal ging sie in Gedanken noch einen Schritt weiter. Dann stellte sie sich vor, dass das Gerangel in einer Umarmung endete und sie sich küssten. Wie es sich wohl anfühlen mochte, seine Zunge zu spüren? War sie warm oder eher kühl? Sanft oder fordernd?
Aber solche Gedanken schob sie stets schnell beiseite. Ihre Mutter war auch immer alleine gewesen. Sie hatte keinen Ehemann und die Mädchen keinen Vater gebraucht. Zwar hatte ihre Mutter nie über den Vater sprechen wollen. Deshalb wussten die Mädchen nicht, ob er gestorben oder weggelaufen war. Fest stand jedoch, dass ein Mensch mit dieser Rolle von keiner der drei vermisst wurde. Deshalb trug Aledis die Überzeugung, auch so veranlagt zu sein, dass es gewissermaßen in ihren Genen verankert war, einen Mann weder zu brauchen noch zu wollen. Unabhängig davon schätzte sie das, was sie mit Mo verband, als tausendmal wertvoller und wichtiger ein, als es ein kurzer Moment der Lust oder eine Nacht je sein könnte.
»Ich hab drüber nachgedacht«, platzte Gregor auf einmal ins Zimmer. Seit Nyahs Betreuung besaß er eigene Schlüssel. »Wir können das nicht länger hinnehmen. Es muss etwas geschehen!«
»Man kann seine gute Erziehung auch dadurch verbergen, dass man ohne anzuklopfen in fremde Wohnzimmer stürmt«, sagte Mo statt einer Begrüßung. Die beiden auf der Couch rückten auseinander.
»Ich werde nicht mehr tatenlos mit ansehen, dass mein Mädchen den Bach runter geht«, redete Gregor unbeirrt weiter. »Als ich ein kleiner Junge war, gab es in unserer Stadt ähnliche Vorfälle.« Er stockte. Als er weitersprach, wirkte seine Stimme schwer vom Gewicht der Vergangenheit. »Ich bin dem seither nachgegangen. Jahrelang. Jetzt mehren sich diese seltsamen Erkrankungen auch in dieser Stadt. Ihr müsst euch im Café mal umhören, wie besorgt die Leute sind. Ich sag euch, wir müssen uns wehren. Aber dagegen kann man sich nicht mit bekannten Mitteln verteidigen.«
»Halt, halt«, warf Mo ein. »Pass auf, was du anrichtest. Aledis ist doch sowieso schon völlig fertig wegen Nyah, da helfen ihr Schauergeschichten und Tipps, die so gar nicht greifbar sind, überhaupt nicht. Was sollen ›bekannte Gegenmittel‹ denn deiner Meinung nach sein? Schwert oder Revolver? Lass uns doch erst mal logisch vorgehen. Woran kann es liegen, dass Nyah sich so schlecht fühlt? Am Essen vielleicht? Hat jemand Drogen daruntergemischt? Ich werde überprüfen, was sie in den letzten Wochen gegessen hat.«
Auf Gregors Stirn bildeten sich Unmutsfalten.
»Da musst du wohl eher das ganze Jahr durchforschen. Schon vergessen? Die Süße ist seit fast einem Jahr nicht mehr bei uns. Und die Anderen? Willst du bei der halben Stadt überprüfen, was die gegessen haben?«
Was ist denn in den gefahren?, fragte sich Aledis. So aggressiv kannte sie Gregor gar nicht. Und das auch noch Mo gegenüber, den Gregor so sehr mochte, dass er ihn ihr ständig als Ehemann andiente. Während sie den beiden verständnislos zuhörte, drehte sie unbewusst den schmalen goldenen Armreif, den sie von ihrer Mutter zu Nyahs Geburt bekommen und seither kein einziges Mal abgelegt hatte. Seine feinen Linien tanzten leicht im sanften Schwung der Umdrehungen.
4.
Eine Gestalt huschte durch die Schatten, vergewisserte sich, dass niemand ihr gefolgt und sie unbeobachtet war. Über ihrem Kopf rauschte das düstere Geäst der Bäume wie das Flüstern vieler Stimmen. Die Vorsicht war überflüssig, denn die Bewohner der Stadt trauten sich ohnehin nicht, und schon gar nicht während der Dunkelheit, in die Nähe der Ruine, die von Bäumen verborgen auf einer Anhöhe im Wald schlief.
Dieser Ort war alt, sehr alt. Er steckte voller Geheimnisse. Die wenigsten der Bewohner aus der nahen Stadt trieben Mut oder Neugier dazu, ihn aufzusuchen. Außer ein paar alten moosbewachsenen Steinen und Mauerresten, die hier mannshoch, dort dann mit schwindelerregender Höhe aus dem Boden ragten, hatte hier seit Jahren niemand irgendetwas gefunden. Vielleicht aber konnten sie davon nur nicht mehr erzählen. Meist kehrten die wenigen Abenteurer völlig verändert heim. Still und abwesend, mit leeren Augen und kraftlosen Gliedern. Manchmal murmelten sie vor sich hin, von spitzen oder kargen Mauern, die sich bedrohlich bis in den Himmel erhoben, die sich bewegten und flüsterten, und von einem schattengleichen Ritter, der allein über sie alle gebot.
Keiner hörte ihnen ernsthaft zu.
Tatsächlich gab es in keinem bekannten Verzeichnis irgendwelche Aufzeichnungen über diese Ruine. Die Gestalt hatte das überprüft. Anhand der steinernen Reste ließ sich nicht mit Sicherheit sagen, aus welcher Zeit sie stammte oder auch nur, was sie einst darstellte. Die Säule dort rechts wies ephesische oder attische Merkmale auf, während der ornamental reich verzierte Bogen an der Westfassade Rückschlüsse auf die apulische Baukunst des dreizehnten Jahrhunderts bot. Die sichtbaren Mauern gaben nicht preis, ob sie einmal eine Burg bewehrt, ein Kloster beschützt oder das Dach einer Kathedrale getragen hatten.
Die unsichtbaren Mauern jedoch verbargen ein unversehrtes riesiges Gewölbe, das einem ganzen Dorf Zuflucht bieten könnte. Dieses geheime Versteck in der Unterwelt war vollkommen. Unsichtbar und uneinnehmbar. Ein Panic Room, eine Engelsburg, ein Kerker – ganz nach Bedürfnis des jeweiligen Bewohners.
~
Nichts geschah. Sie wartete. Dass der Tag verging, dass die Nacht verging. Nyah saß an ihrem Schreibtisch und starrte auf die Patience, die vor ihr auf dem Bildschirm zum nächsten Lösungsschritt drängte. Diese Beschäftigung war ihr verblieben. Dabei spürte sie fast noch so etwas wie Spaß. Das sagten doch immer alle: Das Leben soll Spaß machen, sonst ist es nichts wert. Gleichzeitig lenkte das Spiel sie von ernsten Überlegungen und Reflexionen über das ganze Geschehen ab. Das half ihr, denn sobald sie sich auch nur einen kurzen Moment lang nicht ablenkte, füllten sich ihre Augen mit Tränen und sie fiel wieder in die tiefe dunkle Schlucht. Von dort tauchten dann die Stimmen auf.
Nyah wusste nicht, ob sie die Stimmen als bedrohlich oder vertraut bezeichnen sollte. Sie kamen mit beiden Bedeutungen zu ihr, der Wechsel willkürlich. Aber wenn sie kamen, dann jedes Mal laut. Sehr laut. Oft setzten sie ihr Fragen in den Kopf. Fragen, die nach einer Antwort schrien. Manchmal nur etwas so Harmloses wie: »Warum gehst du jetzt nicht spazieren? Tageslicht lässt Glückshormone entstehen und es geht dir besser! Nun los! Zieh dich an! Geh!«
Sie hasste solche Bemerkungen und Fragen. Sie setzten sie unter Druck. Das tat ihr nicht gut. Aber sie wusste auch, dass die Stimmen recht hatten. Sofort war dann das schlechte Gewissen zur Stelle und sie fühlte sich noch verlorener und schuldiger.
»Alle müssen sich auf meinen komischen Zustand einstellen, und ich tue nichts, um wieder gesund zu werden«, warf sie dem verwässerten Spiegelbild hinter der Pik-Harfe vor. Nicht einmal so etwas Leichtes wie nach draußen zu gehen. Wenn es nur so leicht wäre!
Seit sie sich so merkwürdig traurig fühlte, quälten sie nicht nur die Stimmen mit Bemerkungen zu ihrem Zustand, sondern auch wohlmeinende Freunde. Das waren die Schlimmsten. Kommentare, die vorgaben, gute Ratschläge zu sein.
»Spazieren gehen hilft, Bewegung hilft. Verabrede dich doch mal!«
Keiner konnte akzeptieren, dass weder ein Spaziergang noch sonst eine Aktivität ihr wirklich half. Keiner erkannte oder glaubte ihr auch nur, dass sie viele Ratschläge durchaus befolgen wollte. Aber sie konnte es nicht schaffen. Sie konnte einfach nicht. Sie fühlte sich wie an ihrem Stuhl festgeklebt. Schon aufzustehen und sich für einen Spaziergang fertigzumachen, bedeuteten unüberwindliche Hürden für sie. Sie verstand es ja selbst nicht. Sie wollte doch! Warum konnte sie nicht?
Nur Aledis und Gregor gaben sich Mühe zu verstehen und hielten sich mit Anregungen zurück. Bei allen anderen hatte Nyah aufgehört, ehrliche Antworten zu geben oder etwas erklären zu wollen. Rechtfertigungen, zu denen sie gedrängt wurde, oder Missverständnisse, bei denen Worte nichts ausrichten konnten, kosteten sie zu viel Kraft. Da fand sie es leichter, leere Absichten zu beteuern: »Guter Gedanke, werde ich gleich morgen ausprobieren.«
Das häufige falsche Lächeln bei solchen Worten hatte links von ihrem Mund eine ausgeprägte Falte entstehen lassen, die ihrem jugendlichen Alter heftig widersprach.
Die Stimmen waren um vieles hartnäckiger als die unwissenden Menschen in ihrer Nähe. Sie akzeptierten nie, dass sie vor lauter Trübsinn an den meisten Tagen ihre Wohnung einfach nicht verlassen und daran nicht das Geringste ändern konnte. Dann kauerte sie sich noch kleiner zusammen und fühlte sich unendlich schuldig, weil sie nicht fähig war, zu tun, was die Stimmen von ihr verlangten. Es würde ihr doch guttun und es schien doch so einfach zu sein. Es waren ganz schlichte, leichte, ganz normale Aktivitäten, über die sie früher nicht einmal nachgedacht hatte.
Warum? Warum nur konnte sie das alles nicht mehr schaffen? Wer hatte ihr die Kraft dazu genommen? War sie vielleicht doch selbst schuld an allem? Aber es kam doch so plötzlich, so unerwartet. Damals. Auf dem Boulevard. Konnte so etwas wissenschaftlich oder medizinisch überhaupt möglich sein?





























