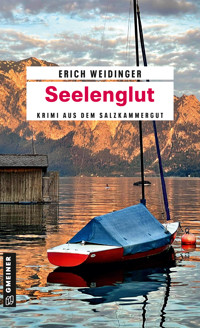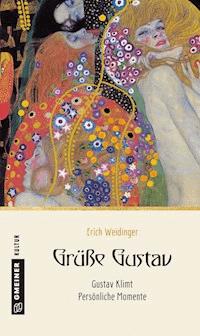Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: GMEINER
- Kategorie: Krimi
- Serie: Landpolizist Werner Adler
- Sprache: Deutsch
Ein verhängnisvoller Einbruch, ein folgenreicher Ausflug in die Kaiserstadt Bad Ischl und eine stürmische Rettungsaktion - dies alles erwartet den Landpolizisten Werner Adler nach seinem Urlaub. Und als wäre das noch nicht genug, hat er zusätzlich auch noch die Verantwortung für den Sohn seiner Lebensgefährtin und den Nachbarshund, da sie in Griechenland zurückbleiben musste. Selbst an seinem Lieblingsort, auf dem Boot am See, findet Werner nicht die Ruhe, die er dort sucht. Zwei Tage, zu viele Ereignisse …
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 262
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Erich Weidinger
Seelensturm
Krimi aus dem Salzkammergut
Zum Buch
Stürmisches Paradies Landpolizist Werner Adler kommt ohne Lebensgefährtin, dafür aber mit deren Sohn aus dem Urlaub in Griechenland zurück. Nicht nur, dass er die Verantwortung für den Jungen trägt, zusätzlich kommt auch noch der Nachbarshund dazu. Ein gemeinsamer Ausflug mit seiner Tante Vera in die Kaiserstadt Bad Ischl endet mit einer dramatischen Rettungsaktion, Leichenfund – Werners größer Albtraum – inklusive. Und auch am nächsten Tag, als er auf dem Polizeiboot seinen Dienst bei der alljährlichen Atterseeüberquerung versieht, kommt er nicht zur Ruhe. Einer der 400 Schwimmer überlebt den Wettkampf nicht und wird von Werner geborgen. Zu allem Übel veranstaltet seine Tante am gleichen Tag eine Demonstration direkt am See. Und das in der Hochsaison im August. Aber damit nicht genug, verknüpfen sich Geschehnisse und Verbrechen, die eigentlich niemand miteinander in Verbindung gebracht hätte, wäre da nicht der Zufall, der ständig Werners Begleiter ist. Und das alles an nur zwei Tagen …
Erich Weidinger wuchs am Attersee im oberösterreichischen Salzkammergut auf – dem Lieblingsrefugium vieler Künstler. Nach einer Friseurlehre und einer pädagogischen Ausbildung arbeitete er mehrere Jahre mit benachteiligten Kindern. Wegen der Liebe zur Literatur wechselte er in den Buchhandel und begann selber zu schreiben. Die Leseförderung ist ihm sehr wichtig, deshalb hat er mehrere Anthologien für Kinder und Erwachsene herausgebracht. „Seelensturm“ ist nach „Seelenfriede“ und „Seelenblick“ sein dritter Kriminalroman aus dem Salzkammergut.
Impressum
Personen und Handlung sind frei erfunden.
Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen
sind rein zufällig und nicht beabsichtigt.
Immer informiert
Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie
regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.
Gefällt mir!
Facebook: @Gmeiner.Verlag
Instagram: @gmeinerverlag
Twitter: @GmeinerVerlag
Besuchen Sie uns im Internet:
www.gmeiner-verlag.de
© 2023 – Gmeiner-Verlag GmbH
Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch
Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0
Alle Rechte vorbehalten
Lektorat: Susanne Tachlinski
Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht
Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart
unter Verwendung eines Fotos von: © Erich Weidinger
ISBN 978-3-8392-7760-7
1.
Anfang August – Samstag, früher Vormittag
Oberhehenfeld, Schörfling am Attersee
Der weiße Peugeot Partner hatte die Einfahrt verlassen und war in die Straße nach Schörfling eingefahren. Laute Musik aus dem Autoradio war zu hören. Ein Oldie, »Mister Postman«. Die geschlossenen Seitenwände des Lieferwagens wiesen keinerlei Beschriftung auf. In die andere Richtung wäre das Fahrzeug nicht weit gekommen, da es auf einem Forstweg holprig und bergwärts weiterging, wo die Marktwaldstraße in Geinberg mündete. Das wusste Rudi bereits von vorherigen Auskundschaftungen. Die Luft war rein. Von seinem Versteck aus hatte er ausmachen können, dass der Fahrer jener Gesuchte war, wegen dem er auf den weitverzweigten Straßennetzen von Sicking unterwegs war. Er hatte ihn gefunden, den Verdächtigen, den Bewohner eines veraltet wirkenden Hauses hier am Rande des Waldes. Der hagere Mann trug an diesem Morgen eine grüne Schildkappe mit einem Werbeschriftzug, den Rudolf auf die Schnelle nicht hatte ablesen können, als das Fahrzeug an ihm vorbeigefahren war. Die hellbraune Ballonmütze, die er vor zwei Tagen auf dem Kopf des Fremden wiedererkannt hatte, befand sich wahrscheinlich im Haus.
Rudi schob sein erst kürzlich neu erstandenes und kostspieliges Mountainbike aus dem Schatten der Bäume und Sträucher. Die Nachbarhäuser waren weit genug entfernt, um sich dem Gebäude nähern zu können, ohne aufzufallen oder verdächtig zu wirken. Ein kleiner Teil des Grundstücks war von der schmalen Straße aus einsichtig. Von Gras durchwachsener Schotter führte zu einer seitlich angebauten Garage. Es kam dem jungen Mann nicht in den Sinn, dass dies der zweite Einbruch in seinem bald 21-jährigen Leben werden sollte. Der erste vor einem Jahr hatte unauslöschliche Folgen hinterlassen. Zum Glück war er mit einer Verwarnung der hiesigen Polizei davongekommen. Heute wollte er einem verdächtigen Dieb auf die Schliche kommen, weshalb ihm nicht bewusst war, dass sein Vorhaben trotzdem illegal und kriminell sein könnte.
Hier hinten, kurz vor dem Ende der asphaltierten Straße, sagten sich Fuchs und Hase gute Nacht. Von den Einheimischen am Attersee wurde diese weitläufige Ansammlung von Häusern umgangssprachlich Sicking genannt, statt des auf jeder Landkarte eingetragenen Dorfnamens Oberhehenfeld. Selbst die Bewohner erhielten als Beweis einer lebendigen und sesshaften Verortung die Bezeichnung »die Sickinger«.
Seit einigen Jahren entstanden hier viele neue Wohnhäuser durch Neu- und Umbauten sowie einige Betriebsansiedlungen. Für die Zugezogenen war der Terminus »Sickinger« nicht mehr zutreffend, da die wahren, alten, teils verstorbenen Bewohner dieses Landstreifens seit Jahrzehnten von vielen Seebewohnern des nördlichen Attersees als komisch, seltsam und verschroben bezeichnet wurden. Zumindest behauptete das zeitlebens sein Großvater, der vor unvorstellbar langer Zeit als Zugezogener eine Sickingerin geheiratet hatte und stets über den durch die Umfahrungsstraße abgenabelten Ortsteil von Schörfling spottete, obwohl er dort viele Jahre gewohnt hatte.
Doch das war Rudi egal, er kannte in Sicking lediglich ein paar lebende Verwandte, die genauso waren wie die Schörflinger, Seewalchner oder Auracher. Jede Region hatte ihre Eigenheiten und ein Dorf schimpfte auf das andere. So hatten sich in alten Zeiten die Spitznamen der Ortschaften gebildet. Rudi hatte davon in einem Buch gelesen und fand es witzig, dass zum Beispiel die Schörflinger »Rindsüppler« genannt wurden, da sie auf Reisen immer eine Suppe mitnahmen, um nicht unterwegs Geld für Essen ausgeben zu müssen. Die Nußdorfer waren die »Pudelkreuziger«, die Steinbacher die »Schimmelhänger« und die Weyregger die »Schlägflicker«. Für Rudi galten die über 30-Jährigen als alt, angepasst und langweilig – und nicht irgendwelche Ortsansässigen.
Er vergewisserte sich, dass die Straße frei war, und fuhr mit dem Rad rasch in die Einfahrt, die links und rechts von hohen verwilderten Sträuchern gesäumt war. Sein Gefährt versteckte er hinter zwei violett und weiß blühenden Hibiskusstauden; eine der wenigen Gewächse, die er benennen konnte, da seine Mutter vor einigen Jahren in ihrem Garten solche hatte pflanzen lassen, was sein Interesse an der Botanik aber auch nicht hatte wecken können. Sehr zu ihrem Leidwesen, da sie ihren Sohn in Zukunft gerne als Gärtner oder promovierten Botaniker gesehen hätte.
Vorsichtig, als wären auf dem Boden Fallen versteckt, bewegte er sich mit dem dunkelgrauen Rucksack am Rücken auf das Haus zu und versuchte herauszufinden, wie er am besten in das Gebäude von Leopold Riegelhofer eindringen konnte. In das alte Anwesen des Postlers. Des Mannes, der im Besitz einer Kopfbedeckung war, die Rudi als sein Eigentum betrachtete. Die er bestellt und mit seinem hart erarbeiteten Lohn bezahlt hatte und die er sich nach Kammerl ins Elternhaus hatte senden lassen, wo sie nie angekommen war.
Rudolf Alexander Lehner, wie er laut Geburtsurkunde und Taufschein hieß, hatte im Dezember des Vorjahres als ausgelernter Tischler einen Job in einem bekannten Möbelhaus in Vöcklabruck angenommen. Die geregelten Arbeitszeiten bescherten ihm mehr Freizeit als vorher in der Tischlerei, wo er die Lehre abgeschlossen und bis zu dem Jobwechsel gearbeitet hatte.
Mit seiner ersten Freundin, Natascha, hatte er im Vorjahr Furchtbares erlebt und war für eine neue Liebschaft deswegen noch nicht bereit. Die Angst eines erneuten Versagens saß tief in seinem Inneren. Um die jugendliche Energie und Kraft sinnvoll zu bündeln, hatte er das Mountainbikefahren für sich entdeckt. Durch die neu erweckte sportliche Begeisterung und tägliche Ausübung konnte er überflüssige Kilos abspecken und seine Kondition sowie körperliche Verfassung enorm steigern.
Vor zwei Tagen war Rudi an einem freien Nachmittag mit dem neuen Bike nach Dienstschluss losgefahren. Zu den nahe gelegenen Flüssen Vöckla und Ager, die sich unweit seiner Arbeitsstelle in malerischer, naturbelassener Kulisse vereinigten. Angelegte Rad- und Wanderwege führten zum kilometerweit entfernten Lambach. Beide Gewässer waren an manchen Stellen beliebte Gebiete für Fliegenfischer. Oftmals sah Rudolf bei seinen Ausfahrten Hobbyfischer jedes Alters. Mehrmals auch eine stets fröhlich wirkende Fliegenfischerin, mit der er hin und wieder ein paar Worte wechselte. Er meinte, sie als Kundin des Möbelhauses wiederzuerkennen.
An besagtem Nachmittag entdeckte er einen dürren, großgewachsenen Kerl, der mit Angelgerät bewaffnet des Weges kam. Ungewöhnlich war die Kopfbedeckung, die er trug: eine hellbraune Ballonmütze mit den eingestickten Initialen RAL. Genau so eine, wie Rudi sie bei einem Onlineshop bestellt und nie erhalten hatte. Er lag seither mit der Firma im Clinch. Es hieß seit drei Wochen, dass die Sendung zugestellt worden sei – eine Trackingnummer zur Nachverfolgung hatte das kleine Päckchen allerdings nicht gehabt. Und plötzlich entdeckte er das begehrte Stück auf dem Haupt eines Hobbyfischers. Dem es überhaupt nicht stand, im Gegenteil, er sah damit dämlich aus. Der Mann kam ihm bekannt vor. Unauffällig war er ihm gefolgt, um mit dem Smartphone Fotos zu schießen.
Kaum zurück auf dem Radweg, begegnete ihm die Fischerin. Er zeigte ihr das Bild, mit dem Hinweis, dass er gerne fotografiere und zufällig einen Angler auf einem Foto entdeckt habe, der ihm bekannt vorkäme. Nichts ahnend gab sie ihm Auskunft, da sich die meisten Fischer hier gegenseitig kannten. Der abgelichtete Angler sei Briefträger am Attersee. Sie fügte hinzu, dass er immerzu freundlich, doch trotzdem etwas komisch sei und dass er in Seewalchen oder in Schörfling wohne. Zumindest meinte sie sich zu erinnern, dass er dies einmal erwähnt habe.
Viele männliche Briefträger, die im Norden des Sees wohnten, gab es sicherlich nicht mehr. Er sah vermehrt Frauen mit den gelb-grünen Elektroautos fahren. So hatte Rudi mithilfe einiger Bekannten rasch herausgefunden, wo er seinen Verdächtigen finden konnte und dass dieser in einem alten Haus in Sicking wohnte.
»Ein komischer Typ, der lebt dahinten ganz allein … Nicht einmal eine Frau hat er … Na ja, vielleicht mag er keine …«
So gaben seine Verwandten in Oberhehenfeld Auskunft über ihn. Höchstwahrscheinlich fanden die Sickinger ihn komisch, da er keiner von ihnen war.
Wenn Rudolf Alexander Lehner die gestickten Buchstaben RAL auf der Mütze tauschte und sich das A wegdachte, ergaben sie die Initialen des Namens Leopold Riegelhofer. Das vorhandene A in der Mitte hatte ihn verraten. Selbst wenn Riegelhofer einen zweiten Vornamen besaß, wäre die Bestellung der gleich ausgearbeiteten Mütze absolut unwahrscheinlich. Das konnte kein Zufall sein.
Es gab sicherlich verschiedenste Möglichkeiten, wie der Kerl zu der Kopfbedeckung gekommen sein konnte. Der verdächtige Briefträger war, soviel Rudi wusste, nicht für den Ortsteil Kammerl zuständig, wo er mit seinen Eltern wohnte. Ihre Zustellerin war eine lustige und nette Frau, die ihm jünger vorkam, als sie tatsächlich war. Sein Vater lobte sie in den höchsten Tönen, bezeichnete sie als »unsere Postperle« und meinte, sie verschwende bei der Post ihr Talent. Jeder Arbeitnehmer würde sich ihrer glücklich schätzen.
Auf das fehlende Packstück angesprochen, gab sie an, dass sie in der betreffenden Woche Urlaub gehabt habe und verschiedene Springer für ihr Gebiet eingeteilt gewesen seien. Dass nicht getrackte Sendungen verloren gingen, geschehe leider immer wieder.
Rudi versuchte erst gar nicht, den Haupteingang zu nehmen, da jeder normale Mensch beim Verlassen des Hauses die Tür verschloss. Hintereingänge und Fensterflügel boten anderweitige Gelegenheiten zum Eindringen.
Er trat hinter das Gebäude, wo er die vermutete Hintertür entdeckte. Leider nicht aus Holz, sondern aus Metall. Sein geschultes Tischlerauge sah sofort, dass dieser Eingang nur mit roher Gewalt zu knacken wäre. Eine erhoffte alte Tür hätte er auszuhebeln verstanden.
Auf der anderen Längsseite des Gebäudes, wo die Zufahrt bei der Garage endete, bemerkte er an der Mauer einen schrägen Holzverbau mit zwei verwitterten Flügeltüren, die durch ein angerostetes Vorhängeschloss zusammengehalten wurden. Sich nähernd, entdeckte er, dass das Schloss nicht eingerastet war. Nochmals vergewisserte er sich, dass sich niemand in Sichtweite befand, der ihn hätte beobachten können. Er zog den Bügel des Schlosses aus den Ösen und öffnete einen Flügel der Tür. Ein Schacht, eine Art Betonrutsche, führte dahinter nach unten zu einem Fenster. Durch zeitgeschichtliche Filme sowie die Ausführung von Tischlerarbeiten in und an vielen Privathäusern wusste er, dass diese Rutsche früher zum Befüllen des Kohlenkellers genutzt wurde. An alten Bauwerken waren manchmal solche Kohlenrutschen zu sehen. Meist aber zugemauert, mit einem Fenster oder Verschlag im Keller abgedichtet, so wie hier.
Behutsam stieg er in den Schacht und ließ sich langsam abwärtsgleiten, was mühelos gelang. Das gerippte Profil seiner roten Bikerschuhe verhinderte ein ungewolltes Abrutschen. Da er den Verschlag über sich wieder geschlossen hatte, fiel kaum Licht in die Kohlenrutsche. Hinter dem verschmutzten Fensterglas war es stockfinster. Er zog in unbequemer Stellung den Rucksack von seinem Rücken, um sein Smartphone daraus hervorzuholen. Die aktivierte Taschenlampen-App gestattete ihm, sich zu orientieren. Neben seinen an der Mauer verkanteten Füßen entdeckte er zwei Versandkartons, die vermutlich ein Paketbote hier eingeworfen hatte. Eine sinnvolle und sichere Ablagestelle. So eine sollte er zu Hause ebenfalls installieren. Seine Eltern ärgerten sich oftmals, wenn sie erwartete Briefe und vor allem Pakete nicht erhielten, obwohl sie laut Angaben der Post angeblich zugestellt oder an der Tür abgelegt worden sein sollten. Jetzt war das Gleiche ihm passiert – mit dem Unterschied, dass er eine Vermutung für den Grund der Nichtzustellung seines Paketes hatte.
Das Licht des Smartphones war zu schwach, um die Schmutzschicht des Glases zu durchdringen. Er machte sich daran, die Scheibe einzuschlagen, war versucht, seinen Ellbogen einzusetzen, wovon er jedoch abließ, da er ein Kurzarm-Shirt trug. Um sich nicht zu verletzen, wollte er das Glas stattdessen mit einem der beiden Päckchen zum Zersplittern bringen. Er streckte den Oberkörper über seine Knie, um einen der Kartons zu ergreifen, und übte dabei mit der Schulter ungewollt Druck auf den Fensterrahmen aus, der unvermutet nachgab. Der gesamte Flügel schwang lautlos nach innen und gewährte dadurch allem von außen Kommendem Einlass.
Ein Päckchen sowie das Telefon flogen voraus. Das Gerät beleuchtete mehr die Decke als den Boden des ehemaligen Kohlenkellers, der tiefer lag, als Rudolf vermutet hatte. Des Gleichgewichts beraubt, folgte er halb springend, halb fallend seinem Smartphone, das mit einem scheppernden Hall und mit flackerndem Licht auf dem harten Boden unter ihm aufknallte. Sein Aufschrei bei der unkontrollierten Landung war lauter als alle dadurch entstandenen Geräusche. Ein höllischer Schmerz durchfuhr ihn und ließ kurz seine Sinne schwinden.
2.
Samstag, früher Vormittag
Oberhehenfeld – im Keller
Um nicht voller Wucht mit dem Kopf aufzuschlagen, ging seine rechte Hand reflexartig Richtung Boden und konnte zumindest das Schlimmste verhindern. Durch die Fallgeschwindigkeit, das dadurch verstärkte Eigengewicht und das unkontrollierte Aufstützen wurde extremer Druck auf das Handgelenk ausgeübt, was zu einer überschießenden Dorsalextension führte. Diese Überdehnung des Gelenks, weit über die normal auszuführenden 70 Grad hinaus, rief unvermittelt starkes Schmerzempfinden hervor. Dem nicht genug, hielt das Ende der Speiche der Belastung nicht mehr stand. Kurz oberhalb des Handgelenks brach der distale Radius.
Dieser Bruch mit all seinen Folgen sollte nicht die einzige Verletzung des Fallenden bleiben. Denn im Augenblick der Extensionsfraktur schlug die Hüfte, ohne sich abrollen zu können, auf dem harten Untergrund auf. Den Namen »großer Rollhügel« des zuerst aufprallenden Stücks des Hüftknochens hätte Rudi sich als Kind spielerisch zu eigen gemacht und wäre mit seinem 30 Zentimeter hohen Plastikpferd durch das Wohnzimmer geritten, ausrufend: »Ich bin Häuptling großer Rollhügel!«.
Der Trochanter Major, eine laterale Knochenstruktur am Oberschenkelknochen – also kein Indianerhäuptling –, dient als Ansatzpunkt des Gesäßmuskels, des Musculus gluteus medius, ohne den keine Abduktion möglich ist. Und ohne den der junge Mann sein sportliches Hobby nicht ausführen hätte können. Dieser Knochen, überzogen vom Periost, dem mit Nerven durchsetzten Gewebe, wurde samt Muskel und umliegenden Weichteilen durch den Sturz traumatisiert.
Die Kombination von allem und die Wucht des Aufpralls bescherten dem Eindringling zusätzlich eine Rissquetschwunde an der Stirn und eine kurzzeitige geistige Abwesenheit.
3.
Samstagfrüh
Kaiserstadt Bad Ischl
Den vielen Sommersonnentagen im Juli zum Trotz fing dieser Augusttag mit reichlicher Bewölkung an. Der Jahreszeit entsprechend warm, würde der Himmel in den nächsten Stunden Abkühlung und Nässe bringen. Die Natur dürstete seit Wochen danach. Der Polizist Werner Adler hätte die für heute angesagte Schlechtwetterfront allerdings gerne um zwei bis drei Tage verschoben. Der ungeplante Bad-Ischl-Ausflug drohte regelrecht ins Wasser zu fallen, und am nächsten Tag, an dem schöneres Wetter vorausgesagt wurde, stand Dienst mit dem Polizeiboot am Attersee auf dem Programm. Noble Bräune, dem Urlaub in Griechenland geschuldet, eine Leinenhose, ebenso von dort, ein gelbes Hemd und extra für seine Füße angefertigte hellenistische Ledersandalen verliehen Werner ein südländisches Aussehen.
Er öffnete die Heckklappe des Wagens und ließ den Golden Retriever herausspringen, nicht ohne vorher Alexandros, dem Sohn seiner Lebensgefährtin, die Leine in die Hand gedrückt zu haben. Ungeduldig herumschnüffelnd eilte der Rüde mit dem femininen Namen Gerda zu einem der wenigen Bäume am Parkplatz der Kaiservilla, um ein Hinterbein zu heben. Werner beobachtete ihn und überlegte, ob Hunde beim Pinkeln immer denselben Fuß hoben. Im Grunde genommen war ihm das egal, da er sich selbst nie ein Haustier zulegen würde. Der zehnjährige Sohn Helenas wartete, bis der Hund und die weiblichen Erwachsenen bereit waren, um über eine kurze Wegstrecke zum ältesten Kaffeehaus der Stadt zu gelangen. Seine Mutter war leider noch in Griechenland bei ihren Verwandten, und deshalb musste er den Tag mit Werner, dessen Tante Vera und ihrer um viele Jahre jüngeren Freundin Natascha verbringen.
Den beiden Männern – jung und alt – stand die Müdigkeit ins Gesicht geschrieben. Erst seit dem Vortag wieder in Österreich, ohne Helena, hatten sie die halbe Nacht in ihrer Wohnung vor dem Fernseher verbracht. Der geplante gemeinsame Rückflug vom Donnerstag war gecancelt worden, für eine Maschine am Freitag hatte es lediglich zwei Plätze gegeben und der dritte Passagier war auf Sonntag gebucht worden. Da Werner an diesem Tag wieder Dienst hatte, war er mit Alexandros vorausgeflogen.
Er hatte von Griechenland aus bei seiner Tante Vera angerufen und sie gebeten, den Jungen samt Hund von Samstagnachmittag bis Sonntagabend zu sich nach Palmsdorf zu nehmen. Alexandros war nicht begeistert von der Aussicht, bei einer alten Dame einzuziehen – wenn auch nur für eine Nacht. Vera hatte unter der Bedingung zugesagt, dass ihr Neffe am Vormittag den Chauffeur spielen und sie bei ihrem Ausflug in die Kaiserstadt begleiten solle. Sie hatte ihrer Freundin Natascha zum 21. Geburtstag – der erst im September sein würde – ein Frühstück in Ischl und den Besuch einer Ausstellung im Marmorschlössl im Kaiserpark versprochen. Nach dem Ausflug könne Werner sie alle zu ihrem Haus zurückfahren. Sie bot ebenso an, Helena am Sonntagabend vom Flughafen in Salzburg abzuholen.
Werner blieb nichts anderes übrig, als zuzustimmen. Erschwerend war hinzugekommen, dass Helena, die weiterhin von ihrer griechischen Familie bekocht und umsorgt wurde, ihrer alten Nachbarin versprochen hatte, sich um den Hund Gerda zu kümmern. Denn am Samstagfrüh musste die nette Dame ins Krankenhaus nach Wels zu einer Operation »einrücken«, wie es Werner im Militärjargon auszudrücken pflegte. Er wusste, dass seine Tante, so wie er, keine Hunde mochte. Deshalb hatte sich Natascha entschieden, die Nacht in Palmsdorf zu verbringen und die Obsorge des Tieres zu übernehmen. Allein die Ausgangslage für dieses Wochenende bedeutete für den 37-jährigen Polizisten eine komplexe Verquickung von fremdbestimmten Ereignissen. Er hasste solche Situationen in seinem Privatleben, denen er jedoch im Beruflichen Tag für Tag ausgesetzt war.
Aufgedreht von der Reise, dem Wegbleiben der Mutter beziehungsweise der Liebhaberin, der Frau also, die sich um alles sorgte, und dem plötzlichen tierischen Zuwachs, hatten die drei bis nach Mitternacht die Zeit vor dem TV-Gerät verbracht. Als jahrzehntelanger Star-Wars-Fan war Werner den neuen Serien auf einem Streaming-Kanal verfallen. In den wenigen Monaten der Partnerschaft mit der 33-jährigen Griechin, welche deutschen Migrationshintergrund besaß, hatte er ihren Sohn ebenso mit dem Star-Wars-Virus infiziert. Ein Virus, dessen Langzeitfolgen sich lediglich in erklärbarer Müdigkeit bemerkbar machten und in Fanfare-Handyklingeltönen und Tragen von mit Star-Wars-Motiven bedruckten Boxershorts gipfelten. Werner hatte einige davon. Abgesehen von einer umfangreichen Comicsammlung und verschiedenen Merchandises dieser Kultserie, die in den 70er-Jahren des vorigen Jahrhunderts ihren Welterfolg als Film in den Kinos gestartet hatte.
Mann, Kind und Hund waren während der fünften Folge der ersten Staffel nach Mitternacht auf der Couch beziehungsweise auf dem Boden liegend eingeschlafen. Die Spuren davon konnten die beiden Frauen am Morgen in ihren Gesichtern ablesen. Bei Gerda war das nicht möglich, er schlief immer und überall. Die Weltraumhelden und Bösewichte waren ihm egal, Hauptsache, er erhielt Futter, Auslauf und Streicheleinheiten.
Natascha freute sich seit Langem auf diesen Vormittag. Vor allem auf den Besuch des Marmorschlössls, einem im Kaiserpark befindlichen Pavillon, der 1860 auf einer Anhöhe zu Ehren Kaiserin Elisabeths errichtet und ursprünglich als Frühstückssalon sowie später als privater Rückzugsort der Monarchin genutzt wurde. Während der Fahrt vom Attersee durch das Weißenbachtal hatte sie über den historischen Hintergrund des Gebäudes ausführlich referiert. Ehrfürchtig war sie auf die ausgestellten Flaggen gespannt, welche 1854 extra für den Aufenthalt der kaiserlichen Braut in Linz angefertigt worden waren und die sie angeblich sogar berührt haben sollte. Die 17-jährige Elisabeth hatte eine Nacht in den Repräsentationsräumen des Linzer Landhauses verbracht, bevor sie und ihre zahlreiche Gefolgschaft die Reise mit dem Schiff weiter nach Wien zu ihrer Hochzeit antraten.
Natascha ereiferte sich: »Ich sage euch, alleine die Zeitungsberichte aus dieser Zeit … Ich könnte stundenlang daraus vorlesen … Solche Berichte sind wahre Schätze. Die Tagespost von damals beschreibt rückblickend die Reise der jungen Braut als einen weiblichen Siegeszug durch das habsburgische Land. Die Szenen aus dem Sisi-Film mit Romy Schneider kamen sicherlich an Kitsch und Pomp in keiner Weise der Realität nahe.«
So schwärmte sie allen minutenlang vor und ergänzte voll wissenschaftlichen Ernstes und historischen Wissens ihren Vortrag mit weniger bekannten Details, als wäre sie damals persönlich dabei gewesen. Auf ihrem Smartphone ließ sie ein klassisches Musikstück abspielen, das angeblich bei der Hochzeitsfeier gespielt worden war, ein »Melodisches Scherzo«. Beim Erreichen der Traun hatten die Mitfahrenden im weißen Ford Fiesta das Gefühl, dass sie an diesem Tage alle vor den Fahnen – den kaiserlichen Berührungsreliquien – ehrfürchtig niederknien müssten. Sogar Alexandros meinte, heute Bedeutendes zu sehen oder zu erleben. Und er sollte recht behalten.
Auf dem Fußweg zum Kaffeehaus passierten sie ein Haus, an dessen Vorderfront zwei verwitterte, schräg gestellte Holzverschalungen angebracht waren. Gerda schnüffelte daran herum und wollte auch hier seine Markierung anbringen, was der Junge mit einem heftigen Zug an der Leine verhinderte.
»Was ist da dahinter?«, fragte er, und Vera erklärte ihm im Weitergehen Begriff und Sinn eines Kohlenschachtes. Einige Hausfassaden weiter überquerten sie die Straße und standen vor einem gelben Gebäude mit einem von vier Säulen eingerahmten Eingang.
»Lehar Filmtheater«, las Alexandros die Schrift über dem Portal ab. »Ist das eine Mini-Akropolis oder wirklich ein Kino?« Er blickte fragend zu Werners Tante.
Diese winkte mit einer verächtlichen Geste ab. »Das war ein altes Theater und zugleich ein Kino, ist aber seit einiger Zeit anscheinend wegen statischer Probleme geschlossen. Franz Lehár, nach dem das Haus benannt wurde, war ein berühmter Komponist, der sich im Zweiten Weltkrieg nicht rühmlich benommen hatte. Das ist der Grund, warum ich keine Operette von Lehár besuche. Ich hoffe, die Besitzer renovieren das Haus und benennen es um, vielleicht in ›kaiserliches Hoftheater‹, so wie es früher geheißen hat.«
Natascha fügte hinzu: »Ja, das wäre schön, da ja selbst der Vater vom Kaiser Franz Josef –«
»Hört auf«, unterbrach Werner die beiden. »Der Junge wollte nur wissen, was das für ein Gebäude ist. Die geschichtliche Abhandlung könnt ihr euch sparen. Wer sich dafür interessiert, sollte einen Führer über Bad Ischl lesen. Ich bin sicher, mein Vater hat einen, den er euch gerne leiht. Und ich möchte jetzt ins Kaffeehaus, da es bereits nieselt.«
Die drei Erwachsenen blickten auf den Minderjährigen, als würden sie von ihm eine Stellungnahme erwarten, was ihm sichtlich unangenehm war. Er drehte sich zu Gerda um, und es entfuhr ihm ein: »Metaxy ton theon!«
Werner wusste, dass dies ins Deutsche übersetzt »bei den Göttern« bedeutete. Und er konnte sofort den überraschten Aufschrei des Jungen deuten.
Der Golden Retriever hatte sich während des Gesprächs, nicht nur schnüffelnd, der vor dem Theater angebrachten Büste des Bad-Ischl-Sohnes und Schauspielers Helmut Berger angenommen.
»Hat jemand von euch ein Hundesäckchen dabei?«
Alle blickten sich schulterzuckend an, Vera spannte den Minischirm auf, Natascha legte einen Arm um den erschrockenen Knaben und bewegte ihn samt Hund von der weißen Skulptur weg.
»Dreh dich nicht um, es hat uns keiner gesehen. Zum Glück ist der Sockel schwarz. Es wird bald regnen und die Spuren verwischen. So sagt man doch als Detektiv, oder nicht?«
Mit verschmitztem Lächeln und gespielter Verschwörung verschwanden die vier in der Kaiser-Franz-Josef-Straße.
Vera hakte sich bei ihrem Neffen ein, der seinen Hals verrenkte, um zumindest den Kopf unter dem Schirm zu halten. »Verfolgen Sie mit mir unauffällig die beiden jungen Verdächtigen da vorne. Sie haben mit ihrem Hund sicher etwas Schlimmes im Sinne.«
Alexandros, der das hörte, drehte sich kurz zu Vera um. Er schien vergnügt zu sein und zog die Hundeleine straffer an.
Sie spielten die unauffällige Flucht vom Ort des Verbrechens bis zum Kaffeehaus, das in dieser Straße einen unscheinbaren Eingang aufwies und mit angebrachten Schrifttafeln versehen war. Ein junges Paar erhob sich von einem an der Fassade aufgestellten Tischchen und entfloh mit dem Kaffeegeschirr dem Nieselregen ins Innere des Hauses.
Das »Café Ramsauer«, bereits zur Hälfte gefüllt, empfing sie mit einem im Raum vorherrschenden dunkelroten Grundton. Stühle, Bänke, Teppiche und sogar die Samtvorhänge, die aussahen, als hingen sie seit dem Gründungsjahr 1826 hier, verliehen dem Lokal den Charme eines Alt-Wiener Kaffeehauses. An den Wänden zeugten viele Bilder und Fotos von den historisch bedeutenden Gästen, die im Laufe von über einem Jahrhundert hier Platz gefunden hatten.
Vera übernahm sofort das Regiment. Sie bugsierte ihre Schar gleich neben der Mehlspeisenvitrine zu einem runden Tisch mit ebenso geschwungener Sitzbank, deren Reservierung sie am Vortag telefonisch vorgenommen hatte.
»Das ist mein Stammplatz, wenn ich in Ischl bin. Alexandros, du sitzt hier am Rande, damit du Gerda im Auge behalten kannst.«
Die beiden Frauen nahmen den Rest der Bank in Beschlag, Werner ließ sich auf dem gepolsterten Fauteuil gegenüber nieder. Gerda war mit der Platzsuche überfordert. Er schnüffelte herum, versuchte, unter dem Sitzmöbel zu verschwinden, was seiner Größe wegen nicht möglich war. Nach mehrmaliger Aufforderung durch Alexandros nahm er schließlich auf dem Parkettboden neben ihm Platz. Der Hund schien sich an sein neues Herrchen zu gewöhnen.
»Guten Morgen, die Damen. Meine Herren. Darf’s ein Frühstück sein?«
Der weißbehemdete Kellner trug eine kleine schwarze Fliege und legte mehrere Klarsichtmappen ab, in denen auf bedrucktem Kopierpapier die Getränke und Speisen abzulesen waren. Während die vier sich gegenseitig austauschten, für welches Frühstück sie sich entscheiden sollten, wurde Gerda ohne Aufforderung mit einem Wassernapf bedient.
Alexandros meinte fröhlich: »Gerda bekommt vor allen anderen sein Frühstück!«, und sah zu dem Kellner auf, der sich soeben wieder aufrichtete.
»Haben Sie sich für etwas entschieden?«
Werner und Natascha wählten das Salzbaron-, Vera das Wiener Frühstück – ohne Schinken, da sie kein Fleisch aß. Der Junge bestellte den »Strammen Max«, da ihm der Name der Schinkensemmel mit Spiegelei gefiel, und dazu eine Tasse heiße Milch.
Nach der Bestellung ergriff die Älteste am Tisch das Wort.
»Wenn ich schon dem jungen Herrn hier«, sie stieß ihn dabei sanft mit der Schulter an, »samt Hund in meinem Haus Zuflucht gewähre, möchte ich wissen, warum Gerda Gerda heißt, obwohl sie oder er ein Männchen ist.«
Alexandros grinste und blickte zu Werner, der ihn mit einem Kopfnicken aufforderte, das Geheimnis zu lüften.
»Die alte Betti – das ist die Nachbarin von uns –, die hat keine Kinder … nein, Blödsinn, die wollte Töchter haben … und da hat sie den Hund bekommen.«
Lautes Lachen seiner Tischgesellschaft unterbrach die stockende Erzählung des Jungen und machte ihn auf die falsche Formulierung aufmerksam, die allgemeine Heiterkeit auslöste. Beinahe alle anwesenden Gäste im Lokal sahen zu ihnen hin, manche mit einem Lächeln auf den Lippen, andere wiederum grimmig, da sie sich bei der Lektüre der Tageszeitung gestört fühlten.
Alexandros senkte beschämt den Kopf, da er nicht beabsichtigt hatte, die Aufmerksamkeit der anderen Gäste im Lokal auf ihren Tisch zu ziehen.
Werner ergriff das Wort: »Ungefähr stimmt es ja. Es war so, dass die Nachbarin drei Söhne in die Welt setzte und sich immer ein Mädchen gewünscht hatte. Sollte jedoch nicht sein. Irgendwann wurde ihr ein Welpe, ein Golden Retriever, angeboten, in den sie sich sofort verliebt und ihn aufgenommen hatte. Und um sich in irgendeiner Form ihren Wunsch zu erfüllen, nannte sie ihn Gerda. Hab ich es so richtig erzählt, Alexandros?«
Der Junge nickte und nahm die Milch entgegen, die ihm eine hübsche Kellnerin brachte. Aus der Hosentasche nestelte er ein kleines Päckchen mit Kakaopulver, welches er sogleich mit dem Inhalt der Tasse verrührte.
»Ich mag nur diesen Kakao. Darum nehme ich ihn immer selber mit«, kam er der Frage der zwei Frauen zuvor, die in ihren Gesichtern zu lesen war.
Auf drei metallenen Tabletts wurde der Häferlkaffee gereicht, passend zum Interieur mit den gerippten hohen Meinl-Tassen, die Werner noch von der Großmutter im Mühlviertel kannte. Zwei solcher Häferl standen nun in seiner Küche, die er sich in einem Männerhaushalt in Weyregg mit dem Vater teilte.
Obwohl die Bediensteten in dem altehrwürdigen Kaffeehaus viel zu tun hatten, hielt Natascha den Kellner mit einer Frage auf. »Entschuldigen Sie, war der Kaiser oder die Kaiserin damals auch zu Gast hier in diesem Haus?« Sie war sich bewusst, dass er das sicher schon tausendmal gefragt worden war.
Nicht ohne Humor in der Stimme antwortete er: »Nein, mein junges Fräulein. Der Kaiser hat nie unser Haus betreten. Seine Freundin, die Schratt, war Stammgast und ist immer draußen im Gastgarten gesessen. Der Franz-Josef ist oft vorbeigegangen und hat sie wie eine Bekannte von Weitem begrüßt, obwohl ganz Ischl wusste, dass da mehr war zwischen den beiden. Die Kaiserin Elisabeth war sicherlich nie hier. Hätte sich nicht geziemt in ihrer Position. Sie können an den Wänden hier entdecken, welch prominente Gäste uns sonst besuchten. Wie zum Beispiel Robert Stolz, Franz Lehár und der Walzerkönig Johann Strauß. Um nur einige zu nennen. Entschuldigen Sie, wir sollten Ihnen noch das Frühstück kredenzen.«
Er kehrte sogleich mit der Kollegin zurück, um das Bestellte, teilweise aufwendig vorbereitet, zu servieren.
Alexandros und Natascha waren überrascht ob des ungewöhnlichen Services. Drei Teller in einem Metallgestänge übereinander, Etage genannt, auf dem untersten Marmelade mit Butter, in der Mitte Schinken mit Tomatenscheiben und oben Schnittkäse mit Basilikum-Blättern.
Der »Stramme Max«machte dem Jungen offensichtlich Vergnügen, da das angestochene Spiegelei sich über dem Belag der Semmel und den Teller ausbreitete. »Eine schöne Sauerei, würde Mamá dazu sagen.« Belustigt werkte er unbeholfen mit Messer und Gabel herum.
Werners Abneigung gegen diesen Ausflug war einer Zufriedenheit gewichen. Er sah den Sohn seiner Lebensgefährtin selten so fröhlich.
Tante Vera wies mit dem Buttermesser auf die zwei alten Fotos an der Wand hinter ihnen. Zu ihrem Neffen gewandt sagte sie: »Wie ich dich kenne, hast du keine Ahnung, wen der Kellner mit Schratt gemeint hat. Hier, auf dem linken Foto, kannst du sie sehen. Katharina Schratt war Schauspielerin am Hoftheater in Wien und lange Zeit die Freundin von unserem Kaiser. Übrigens, hier rechts siehst du die Maria Jeritza, eine weltberühmte Opernsängerin, die in Unterach eine Villa besaß.«
Mit vollem Munde nickte Werner und erklärte etwas unverständlich, dass er die Jeritza-Villa durch die Fahrten mit dem Polizeiboot kenne. Alexandros beobachtete Verhaltensweisen, die seinen beigebrachten Tischmanieren nicht entsprachen.
Natascha beteiligte sich mit weiteren historischen Details an Veras Ausführungen und wies darauf hin, dass Kaiserin Elisabeth noch zu ihren Lebzeiten über die Verbindung ihres Ehemannes zur Schratt Bescheid gewusst und ihr nichts entgegengehalten habe. Ja, sie sogar anscheinend unterstützt hatte.
Die beiden Männer sahen sich gegenseitig an. Augen rollend verständigten sie sich, dass ihnen die Schratt, die Jeritza, die Elisabeth, und wie sie noch alle hießen, schnurzegal waren. Alexandros prustete los, verstreute Semmelbrösel über seinen Teller und hustete.
Vera klopfte ihm auf den Rücken: »Langsam essen, mein Kleiner.«
Sie wies mit dem Kopf auf den gegenüberliegenden Tisch, über dem ebenso Fotos an der Wand hingen. »Dorthin setz ich mich nicht. Unter Bildern von Franz Lehár nehme ich nicht Platz.«
»Tante Vera, lass das bitte! Du musst uns nicht jede deiner Eigenheiten und Spleens ausführlich erörtern.« Das war typisch für sie: Alles, was sie ablehnte oder befürwortete, verfolgte sie mit einer Kompromisslosigkeit, die Werner immer wieder aufs Neue nervte.