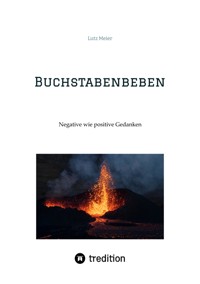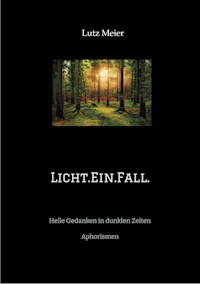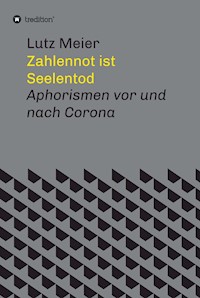5,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ein psychisch vorbelasteter Student wächst im Studium über sich hinaus. Er mausert sich zu einem Musterschüler eines bedeutenden Professors für Literaturwissenschaften in Bielefeld. Gleichzeitig gerät sein Leben aus der Kontrolle und es folgt eine psychiatrische Odyssee, als er eine Femme fatale kennenlernt. Ein fesselnder Romanbericht, nicht nur über Schizophrenie und Depression, sondern auch eine Dokumentation über die Schwierigkeit in den 90er Jahren ans andere Geschlecht zu kommen und über das Ende der Geschichte als Lebensgefühl. Der erste Roman über eine schizophrene Minussymptomatik.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 651
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
„So mancher Mann wurde zum Genie, dadurch, dass er das Mädchen, dass er haben wollte, nicht bekam.“ (voraussichtlich Kierkegaard)
Lutz Meier
Seelensturz
Ein Fall
© 2025 Lutz Meier
Website: www.gedankenmeier.com
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, Heinz-Beusen-Stieg 5, 22926 Ahrensburg, Deutschland
ISBN
Paperback
ISBN 378-3-384-11169-2
Hardcover
ISBN 378-3-348-11170-8
e-Book
ISBN 378-3-384-11171-5
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: Lutz Meier, Brandenburger Ring 13, 32339 Espelkamp, Germany.
Kontaktadresse nach EU-Produktsicherheitsverordung:
Inhaltsverzeichnis
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
I Die Vorgeschichte
II Nachtgänge und andere Erlebnisse
III Irmela, Ironie und die Lage spitzt sich zu
IV Der Ausbruch oder die Umarmung eines Pferdes
V Tagesklinik I
VI Zwischenspiel: Besserung. Studien
VII Erneutes Aufflackern. Danach: Stille
VIII Tagesklinik II
IX Der lange Gang über die Stationen
X Ein Rehaversuch
XI Der Fall ins Kristall
XII Tagesklinik III
XIII Und so lebte er dahin
Seelensturz
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
I Die Vorgeschichte
XIII Und so lebte er dahin
Seelensturz
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
I Die Vorgeschichte
Erstes Bohèmeleben
Das möblierte Zimmer, in das ich einzog, war erneut ein Fremdkörper für mich. Das Unwirtliche eines abgenutzten Teppichs und das Braune der Möbel kannte ich aus meinem Jugendzimmer. Mit dieser Bude begab ich mich aber erst recht in die Hölle der Spießigkeit, die aus einem Plüschsofa, einem Ohrensessel und einem Wohnzimmertisch aus Eiche bestand. Ich setzte mich in dem „Opasessel" und dachte: „Lesen kannst du überall." So zog ich die Bettwäsche auf das Bett, das in einer Nische untergebracht war, räumte die Bücher in das Pressholzregal ein, las kurz im „Mann ohne Eigenschaften" und fiel bald darauf in einen traumlosen Schlaf.
Am folgenden Montag im März 1993 war mein erster Unitag. Ich besuchte die Vorlesung eines Althistorikers. Er referierte eine Sozialgeschichte der Antike frei aus dem Kopf. Ich war beeindruckt. Erst verwundert, dann verstohlen, sah ich mich um: Niemand zeigte eine Regung, niemand staunte. Alle notierten etwas und schauten erwartungsvoll, wenn eine Sprechpause entstand. Also machte ich es ihnen nach. Was war Routine, was nicht, was schrieb man mit und: Über was konnte man geflissentlich hinweghören? Begierig, um in den Gesichtern zu lesen, spähte ich in die Runde. Doch alle setzten ein cooles Pokerface auf. Gefühle waren kaum in ihren Mienen auszumachen.
Mittags traf ich mich mit Lexus, Ulrich und Wolfgang in der Mensa. Wie scherzten wir lachten. Mein erstes Bohèmeleben begann.
Die erste Berührung mit der Literaturwissenschaft hatte ich am darauffolgenden Mittwoch. Ein sportlicher und kahlköpfiger Dozent betrat den Raum, Herr Dr. Kremer. Auch hier bewunderte ich die freie und unaufgeregte Rede, sein Balancieren über dem Abgrund, ohne Netz oder doppelten Boden. Er erzählte mit maliziösem Schmunzeln, wie viele von uns das Studium abbrechen würden. Er zählte die Reihen ab. „Jeder Dritte wird das Studium nicht zu Ende führen.", dozierte er. Zu Beginn der Sitzung wirkte er wie ein Dirigent, der darauf wartete, dass es endlich still genug sei, um mit dem Dirigieren anzufangen.
Dann besuchte ich zum ersten Mal den Grundkurs Geschichte. Dieses Mal waren es gleich drei akademische Redekünstler, die mich beeindruckten: So als ob es das Selbstverständlichste der Welt sei, sprachen sie über die kompliziertesten Sachverhalte einfach; gelangweilt übergaben sie das Wort in bester Ankermanmanier. Frei zu sprechen und überhaupt die Sprache war und ist ja ein Wunder, ein Wunder, das zerstört werden kann, wie ein Atomkraftwerk: selten, dann aber heftig. Wenn das AKW der Seele in die Luft fliegt, wächst keine Sprache mehr. Sie hingegen redeten cool und routiniert vor sich hin, so, als ob es eine Tätigkeit sei wie das Radfahren oder Zähneputzen.
Den Kopf voller Gedanken der Welt entfliehend, fuhr ich aufgewühlt und mit glühenden Wangen heim in mein Plüschreich und las den „Mann ohne Eigenschaften" und dann wissenschaftliche Texte, über deren Unsinn ich mich damals noch ereifern konnte.
Das Treppenhaus meines Spießerheims war in den 50er-Jahren in einen Dornröschenschlaf gefallen. Es war mit einem roten Teppichläufer ausgelegt. In jeder Ecke lauerte ein Kaktus. Der Teppich überdeckte einen grässlichen Linoleumbelag. Er wurde mit goldenen Stangen an die Treppe gehalten. Von außen ragten die Balkone mit Plastikgeländern versehen hervor. „Scheußlich spießig", dachte ich, und das bedeutete schon in den frühen 90ern das Gegenteil von „cool".
Bei den Historikern meldete ich mich sofort eifrig für ein Referat, das ich in meiner Stube angekommen, fiebernd vorbereitete. Ich dachte: „Wie krieg ich das hin!" Worte waren etwas Kostbares für mich. Immer, wenn sie kommen sollten, kamen sie aber nicht und wenn sie kamen, sollten sie nicht kommen. Nur unter der Bedingung, dass mein geistiger Motor „vorgeglüht" hatte, kam ich an den Kern einer Sache heran. Mit Lexus schaffte ich es, stundenlang zu diskutieren. Wenn ich aber vor einer Gruppe stand, vermochte ich keine Gedanken zu entwickeln. „Vorlesen oder freihändig Referate halten?", diese Frage beschäftigte mich damals. Noch zweifelte niemand daran und ich zuletzt, dessen Selbstbewusstsein von Tag zu Tag wuchs, dass ich ohne das Sicherheitsnetz auf dem Zarathustraschen Hochseil der freien Rede zu balancieren verstand.
Den Alltag hielt ich draußen, so gut es ging. Fast jeden Abend rief ich den Pizzaservice herbei. Die Küche ließ ich Küche sein. Hier stapelten sich die Pizza-Kartons. Die Unordnung wuchs und spross wie der Efeu an den weißen Balkonen des ebenfalls weißen Miethauses hervor. Wo ich war, war das Chaos nicht fern. Die Wohnung samt Inhalt und Pizzakartons drohte mich zu überwuchern und zu erdrücken. Haare, die wie im Zeitraffer wuchsen.
Im Einführungskurs Literaturwissenschaft bei Herrn Dr. Kremer wurde „Der Sandmann" von ETA Hoffmann gelesen. In einer „veranstaltungsfreien Minute" (Ich dachte: „Welch' schönes Beamtendeutsch!"). Begann ich mit der Lektüre. Ich fing unwillkürlich an zu lachen. Ich fühlte mich wie ein Künstler, unverstanden von der Welt. Ich vermochte es nachvollziehen, wie man sich in einen Puppenautomat namens Olympia, die für die Kunst stand, vernarren, wie man sich also in die Kunst anstatt in eine Frau verlieben konnte. Seit meiner Zivildienstzeit schrieb ich Gedichte. Ich kam, las, verstand und lachte. Eine Partnerin hatte ich mir bis dato nicht angelacht. Und da war ich kein Sonderling in den jungen, scheinbar befreienden 9Oer-Jahren, dem Beginn der Coolness, auch im Sinne von Distanz und Reserviertheit.
ln der Wohnung angekommen, stellte ich ein ums andere Mal fest, dass ich meine Schlüssel vergessen hatte. Es war häufig ausweglos, den Schlüsseldienst kommen zu lassen. Jemand den Zweitschlüssel zu überlassen aus diesem „ehrenwerten Haus", hätte eine „unzulässige Feindberührung" bedeutet, die weder von mir noch von den Hausbewohnern gewollt war. Das mit dem Schlüssel passierte mir noch einige Male. Zerstreut und kopflos und gleichzeitig in Gedanken ließ ich morgens die Tür hinter mir ins Schloss fallen. Nur wenn ich mich an den nächsten Tagen vom letzten Mal gewarnt konzentrierte, vergaß ich ihn nicht. Eine Woche später war es dann wieder so weit: Der Schlüsseldienst rückte an. Sobald ich die Bücherwelt verließ, stürzte ich kopflos für die Welt und gedankenvoll dahin.
Eine Nachbarin, die das mitbekam, sagte nur „Strotzend dumm! Und wie ein Hering dünn!", drehte sich auf dem Absatz herum und schloss feindselig und rasch die Tür hinter sich zu, ohne Anstalten zu machen, zu helfen. Auch da musste ich lachen. War das nicht das Waschweib aus ETA Hoffmanns „Der goldene Topf"? Ich erzählte alles brühwarm Lexus, dem Mathematiker. Wenn er nicht mit seiner Freundin unterwegs war und mit ihr stritt, diskutierten wir in seiner WG-Küche. Große Themen standen an. Was ist Erkenntnis? Wie lässt sich das Schöne definieren? Ist der Mensch gut oder schlecht? Er lachte, wenn ich von meinen Scherereien im Umgang mit der alltäglichen Welt berichtete. Ich und der geordnete Kosmos von Campingplatzbesitzern, das waren zwei Vorstellungen, die nicht zueinander passten. ETA Hoffmann wurde zu meinem stillen Begleiter, zu meinem Mondschein in der reglosen Nacht.
Das Tutorium, das die sogenannte „Veranstaltung" zur Einführung in die Literaturwissenschaft begleitete, war ein weiteres Pfingsten. Hier saßen die Ahnungslosesten gleich im Dutzend nebeneinander gereiht. Ich meldete mich zunächst in der Gruppe der Lehramt-Studenten an „Die wollten also Lehrer werden!", dachte ich flüchtig und skeptisch in die Runde blickend. In der anderen Lerngruppe für Magisterstudiengänge, zu der ich später stieß, war es nicht besser. Fast erzürnt ging man nun in der Lehramtsgruppe mit ETA Hoffmann ins Gericht. „Vielleicht wollte er uns sagen, dass er nichts zu sagen hatte!", spekulierte einer. „Ja genau", pflichtete ein anderer eilfertig bei. Dann kam ich an die Reih'. Ich redete eine Viertelstunde lang ohne Punkt und Komma.
„Es machte mir also nichts aus vor brennenden und missgünstigen Augenpaaren etwas vorzutragen! ", dachte ich erleichtert. Wenn ich über Literatur redete, brannte ich und vergaß die Welt. Meine Wortmeldung lief darauf hinaus, dass hier die Künstlerproblematik angesprochen sei. Der Künstler, der in dem toten Material Dinge sieht, die für andere unsichtbar sind und der auf verständnislose Blicke der bürgerlichen Welt trifft. Stille trat ein nach meiner Performance. Ich war umgeben von „klarsichtigen Klaras", die mich gelangweilt anglotzten. Das sollte die Lösung sein? „Vielleicht würde mich das gerade sehr beschäftigen", sagte tröstend wie ermahnend die Nebenfach-BWLerin, die das Tutorium leitete. Wer seine Stifte vorwiegend dazu benutzte, um kalligrafische Vorlesungsmitschriften anzufertigen, und wer in der Welt der Ratio lebte, der war genötigt, bei diesem Text zu stutzen. Wer hingegen diesen Widerspruch zwischen Bürger und Künstlerwelt täglich auszubalancieren musste, für den war es einfach so einen Text über Kunst und Wahnsinn zu begreifen. Für die Studienanfänger ohne eigene literarische Ambitionen wurde es schwer, eine kleine, aber harte Nuss, die die meisten der Kommilitonen nicht zu knacken vermochten.
Die angehenden Lehrer würden nie, wenn sie es könnten, ETA Hoffmann auf den Unterrichtsplan setzen. Hier mussten Werke herhalten, die etwas moralin-sauer waren, die auf soziale Missstände verwiesen, aus soziologischer Sicht „richtig" oder „falsch" gelesen werden konnten. Die Armut, die geknechtete Existenz. Büchner, den armen Büchner, stutzten sie sich zurecht. War das nicht der Autor des „Sozialdramas" „Woyzeck"? Je politisch engagierter die Einstellung des jeweiligen Lesers, desto unempfänglicher war er für die Bücher, die ich goutierte. So wurde der Verfasser des Hessischen Landboten zu einem Robin Hood stilisiert. Der aggressive Nihilismus und fröhliche Pessimismus fiel so durch die groben Maschen der Augen der linken Weltverbesserer und Gesinnungsethiker, die gemeinhin in Bielefeld das Lehramt anstrebten.
Aber die konservativen Leser gaben dabei nicht eine bessere Figur ab. Sie vergötterten und Theodor Fontane und Stefan George, hatten bisweilen einen Spleen fürs L' Art pour L' Art, verwechselten den Sinn für das Schöne aber mit einer politischen Position. So liefen sie herum wie „Dandys" im C & A-Sakko und glaubten, in der Politik, das Bestehende konservativ verteidigen müssen. Der Kampf kontra Hässlichkeit wurde für sie zu einem Kampf gegen alles, was links ausschaute und lilagefärbte Haare trug und auf roten Socken davonschlich.
Ich erfreute mich mit solchen monologischen Alleingängen nicht an Beliebtheit bei meinen Kommilitonen. Das Meiste jedoch behielt ich für mich. Manchmal platzte der Hohn aber aus mir heraus. Ich schalt den Dozenten Kremer, ließ mich auf vergebliche Diskussionen ein. Das Abwarten und entspannte Gespräche bei Kerzenlicht zu führen, waren meine Sachen nicht.
Heillos hetzte ich herum. Zuviel vergaß ich auf der Strecke. Schon in der Schule vergaß ich in den Sommerferien, was wir in dem jeweiligen Schuljahr im Unterricht gelernt hatten. Für mich galt das Schnellschussverfahren aus der Hüfte von Intuition geleitet aber mit rationalem Fadenkreuz.
So legte ich mich hin und wieder mit den Dozenten an. Besonders mit denen, die alles im Offenen und Vagen beließen, die hier mal klopften und dort mal die Nase in einen Roman steckten, dort an einem Gedicht schnupperten und hier über die Hermetik von Texten schwadronierten den tauben Elefanten im Porzellanladen also, zu denen auch Herr Dr. Kremer, der „Einführungskurskrämer", wie wir ihn nannten, ebenfalls gehörte.
Nach der Uni fuhr ich immerzu aufgewühlt, kopflos in der Welt und den Kopf voll Gedanken, das Gelesene nachklingend in die schauerliche Bude. Ich setzte mich in meinen Ohrensessel und las Bücher der Kunstphilosophie um 1800 Texte zu einem Seminar, das vom „Einführungskrämer" abgehalten wurde. Hier erwies sich Herr Dr. Kremer als souveräner Meister, der auf philosophischem Terrain weit weg von jeglicher Unbestimmtheit und Vagheit blieb. Es war auch hier nicht die Aufgabe, Literatur zu erhellen.
Hier war es nützlich, ein elefantöses Gedächtnis zu haben. Ein großer Arbeitsspeicher war in der Philosophie ebenfalls zweckdienlich, der andersherum aber die Kreativität und Subtilität einengte.
Auch in diesem Seminar meldeten sich immer wieder die gleichen Verdächtigen zu Wort. Zwei, drei Leute fielen in der Sitzung auf, die anderen, wie es den Eindruck machte, waren Staffage. Unter den Redenden war ein blonder Student mit nervös-unruhigem Blick, der immer wieder Schopenhauer ins Spiel brachte. Er hieß Wulf. Er schien belesen zu sein und hatte keine Scheu, etwas Aneckendes zu sagen. Im Fahrstuhl kamen wir miteinander ins Gespräch. Der Gesprächszünder war dann hier Schopenhauer. Er teilte seinen Pessimismus und war, wie sich bald herausstellte, auch sonst ein Menschenhasser. Von Humanität war hier keine Spur. Zu oft war er von Menschen enttäuscht worden. Manche, die klug erschienen, hatten sich doch als dumm oder gewöhnlich herausgestellt. Ich war einer der seltenen Fälle, der unter seinen strengen Augen ein wenig Gnade fand. Die Uni war und ist ein Haifischbecken. Die Haifische belauern sich und wenden sich, wenn sie sich nicht zerfleischen, irgendwann enttäuscht voneinander ab. In dem Maße taten sie dies, wie sie anfangs euphorisch davon überzeugt waren, einen Mitstreiter in der konservativen Sache und einen Freund des Geistes gefunden zu haben. So böse wie die Menschen waren aber die Haifische nicht.
Wulf und ich trafen uns immer wieder in der Uni. Zumeist war Klaas ein Zeuge dessen, der sich, wie er es nannte, „ausklinkte" und nicht an den „heiligen Gesprächen" beteiligte.
Dann saß ich wieder in meinem Plüschreich und las dicke und schwere Bücher. In dieser Hinsicht war ich der bücherhievende Elefant, für den ein Baumstamm kein Problem war, der aber eine Maus nicht zu greifen vermochte und vor ihr weglief, wenn sie sich schreckhaft näherte: die Realität.
Wie ich so einmal wieder in dem Biedermauerwinkel saß und zufällig aus dem Eckfenster meines Zimmers hinaussah, erkannte ich, wie sich Polizisten an einem Auto zu schaffen machten. Ich stieg die Treppe hinab und sah, wie einer der Beamten einen Zettel ausfüllte. „Ist das ihr Auto?". Ich überlegte kurz und sagte dann „Ja". „Sie haben es offenstehen lassen, Herr …" Die Nachbarn hätten sich daran gestört. „Dies ist eine Aufforderung zum Diebstahl!". Wie ich erst jetzt sah, steckte auch noch der Schlüssel in der Seitentür. Ich schämte mich dafür. „Wie konnte das passieren?", fragte ich entsetzt in Gedanken.
Manchmal konnte ich nicht verstehen, wieso ich im Leben so nachlässig war, wo ich in der Bücherwelt so gewissenhaft und genau zu sein vermochte. Doch froh, nicht länger mit den Realitätspolizisten zu verkehren, sprang ich glücklich, mir größere Scherereien erspart zu haben, nochmals die Treppe hoch, nahm ein Buch zur Hand, um mich wieder runterzubringen und bei einem ruhigen Gedankenfluss quasi den Nachweis zu führen, dass ich doch nicht so „dumm" war, wie es für die Nachbarn und „normale" Menschen den Anschein hatte. Ein roter Faden zog sich durch mein Leben. Immerzu schwankte ich zwischen Hochmut und Kleinmut, zwischen Kopflosigkeit und Gedankenkonzentration, zwischen Tiefsinn und Blödsinn hin und her. Mein Kopf war entweder voll, oder aber er war leer.
Fast beträchtlicher als ein gestohlenes Auto erschien mir hingegen die Rechtfertigung meinen Eltern gegenüber und der bürokratische Aufwand, den es mich gekostet hätte, es wiederzubeschaffen, der Weltkontakt. Schlimmer als ein Gedicht zu schreiben war es mir, es abzutippen und in eine fehlerfreie, endgültige Form zu bringen. Die Hauptsache war das Wühlen, die Idee, die korrekte Ausführung und der letzte Schliff, das war meine Sache nicht. Wie ein König lief ich umher und die Brosamen, die ich fallen ließ, sollten andere aufpicken. Klaas sträubte sich gegen diese Säkretärrolle und die Funktion eines Brosamenauflesers, der mir stets mit einem Stift aushalf, wenn ich einen zum wiederholten Mal vergessen hatte, weil ich in dem Wohnungschaos auf die Schnelle keinen gefunden hatte. Ich staunte immer wieder über das Schreibzeug in meiner Hand. Nicht selten hatte ich anstelle eines Hausschlüssels einen Kugelschreiber in den Fingern, wenn ich das Zimmer verließ. Entweder Schlüssel oder Stift, beides kannte ich nicht.
Abends stürzte ich mich ins Nachtleben. Das, was mir in der Kleinstadt so gefehlt hatte, wollte ich hier nachholen: Wein, Weib und Gesang. Es war aber die Zeit, die schon in den Anfängen von Coolness verwickelt war. Es war nicht so sehr der Ort Espelkamp, in dem ich die meiste Zeit des Lebens gelebt hatte, der, wie ich glaubte, mein Unglück beschied. Die längste Beziehung zu einem Mädchen hatte ich einmal mit fünfzehn, dann noch einmal mit siebzehn, ansonsten war ich immer leer ausgegangen, ein trauriger Hagestolz, ein Waisenknabe in Sachen Liebe, der seine Zeit auf dem Tennisplatz verbummelte, und statt dem Eros zu folgen, ihn mit Sport in Schach zu halten.
Hier in Bielefeld, so hoffte ich und erwartete ich dasjenige, was mir in meiner Heimatstadt so gefehlt hatte: eine Literatenszene, Lesungen, Literaturstammtische, Lesekreise, ein Café Griensteidel. Auf Studentinnen hoffte ich. Die traf man überall auf den Partys und in den Diskotheken und Seminaren. Nur: Wie kam man an sie heran im Zeitalter der Distanz, in dem die Geschlechter durch unsichtbare Mauern voneinander getrennt schienen? Ich war der Seismograf, an dem man die Ausschläge der Gegenwart ablesbar wurden.
Klaas wurde in dieser Zeit zu meinem besten, ja einzigen Freund. Er war acht bis zehn Jahre älter als wir jungen Spunde und wegen seiner beträchtlichen Anzahl an Lenzen und seiner schon angegrauten Haare, aber auch aufgrund seines stillen und zurückhaltenden Wesens eher ein Außenseiter. Mit ihm besuchte ich häufig die Studentendisco „Pappelkrug". Dort diskutierten wir stundenlang. Das war unser Gesang. Am Nachbartisch saßen Studenten und sangen ebenfalls und prosteten sich zu. Auch Tanzen war dort möglich. Zu einer Gruftiemusik bewegten sich ein paar Gothics auf und ab. Die Musik gefiel mir nicht. Ich war ein Soulman, der in seiner Jugend einen ganzen Schrank voll Blackmusicscheiben gehortet hatte. Blackmusic war damals ein zartes Pflänzchen. Man hörte in Studentenkreisen eher Independent, Rock oder Pop. Was nicht darunter fiel, wurde vage unter dem Rubrum Techno oder Hip-Hop geführt. Ich war ein guter Tänzer. Wenn ab und zu mal ein Dancefloor-Klassiker gespielt wurde, blühte ich nachgerade auf. Die sonstige Distanziertheit und Verkopftheit stand dann in grellen Kontrast zu der Fröhlichkeit und Ausgelassenheit beim Tanz, auch zum Scherzen und Unsinn reden währenddessen, wenn ich sang. Manchmal kam Herr Grünwald mit in die Studentendisco. Wir saßen herum und anstatt nach Mädels zu schauen, „Mädchen gucken" nannten wir das intern, sprachen wir über Nietzsche, Kafka und Thomas Mann, der mir so spießig erschien wie das Haus, in dem ich wohnte. Herr Grünwald, war der Überflieger im Grundkurs Geschichte. Sein Ziel stand hier schon fest. Er wollte eine akademische Laufbahn einschlagen. Damit erreichte er freilich keine Beliebtheit bei uns anderen Studenten. Dennoch verstanden wir uns auf Anhieb ausgezeichnet. Ein bisschen waren wir beide in dem Geschichtsgrundkurs „außen vor". Ich, ein bilderschwärmender Lyriker der „Genauigkeit der Seele", der sich aber an den Durchschnitt anpasste und Niels, so sein Vorname, der mit seiner Altklugheit aus dem Rahmen fiel und zu jedem geschichtswissenschaftlichen Thema etwas Fundiertes und gar Druckreifes zu sagen verstand. Ich war einer der wenigen, der es wagte, das Wort „privat" an ihn zu richten. Er war ein Biedermann und Thomas Mann-Verehrer, aber ein netter, dem nur seine hohe Intelligenz etwas Unmenschliches einflößte. Dabei war ich im Fach Geschichte prima vista kein Außenseiter. Nur im Tutorium schlug sich meine Renitenz durch. Hier begehrte ich auf gegen Hans Ulrich Wehler und die Bielefelder Schule der Sozialgeschichte, freilich ohne eine Alternative vorzuweisen, was der beleidigte Tutor mir mit wutrotem Kopf ankreidete.
Ein Grüppchen um den nicht auf den Mund gefallenem Ferdinand Klostermann, der heute über Fußballkultur schreibt, begann sich zu formieren. Er war einer der ersten realexistierenden Comedians, den ich kannte, bevor sie das Fernsehen in Scharen eroberten, und scharte eine Gruppe von ebenfalls witzelnden Kommilitonen um sich. Ich war dabei stets zu zartbesaitet. Immer schlug ich mimosenhaft ernste Töne an. Entweder suchte ich ein Gespräch mit geistigen Inhalten oder aber ich neigte dazu, Unsinn zu reden. Normal drauf war meine Person nie. Meistens hingegen gab ich den Heidegger. So hatte ich bald den Ruf weg als „Lucy", als derjenige, der nicht mitspottete, sondern unmännlich in Untiefen fischen und den Pegasus zu reiten beabsichtigte, während sich die anderen Historiker gerne bei einem sorglosen Kartenspiel vergnügten. Wer sich nicht zu behauptete und nicht mit Worten um sich schlug und somit ungesellig war, der wurde unter den nassforschen Geschichtsstudenten schnell als Sensibelchen abgestempelt. Die Historiker klopften Karten. Ein Bierchen wurde nicht verachtet, was ich beides zutiefst ablehnte: Zum einen vertrug ich keinen Alkohol. Zum anderen ist das Biertrinken eine Verirrung der Menschheit wie das Rauchen. Es schmeckt nicht und jeder tut es, da es andere tun, aus Geselligkeitsgründen und weil man als Mann den Mann spielt. Ich war schon von einem kleinen Schluck Bier benebelt und ich hätte spucken und würgen können angesichts des herben Beigeschmacks, so als hätte man eine Handvoll Hundefutter gegessen. Hundefutter schmeckte deliziös gegen pures Bier, das ich schon als Jugendlicher verabscheut hatte, was zu meiner damaligen „Waldeinsamkeit" mitbeigetragen hatte. Zum anderen fand ich das Kartenspielen geistlos und unnötig, sich im Skat zu behaupten und zerstreuen, wo man sich doch so ausgezeichnet hätte verbal austauschen können.
Die Zeltfeste in der ländlichen Heimat Ostwestfalen hatte ich daher so gut wie ausgelassen. Schon deshalb galt ich in meiner Provinz als Sonderling. Jedoch die Entwicklung der Vernunft schreitet heute weiter, wenn auch leise und unmerklich und auf Taubenfüßen, wenngleich sie nicht mehr durch großartige Ideen vorangetrieben wird. Es wird indes auf dem Land weniger getrunken und ebenfalls gegen das Rauchen meldet sich nicht nur Protest, sondern es wird gesetzlich dagegen vorgegangen. Die Vernunft marschiert weiter, aber nicht mehr mit Soldatenstiefeln. Das brachte einige Probleme mit sich, sodass so etwas wie ein Wille zum Leben in den 90ern erlahmte und uns das Böse abhandenkam, sei es im Umgang mit Kindern oder an der Wursttheke. Man sagte jetzt freundlich und nonchalant „Hallo", wenn man auf Fremde traf. Jeder gab sich distanziert und harmlos und der praktische Verstand ließ ohne „Willen zum Leben" nach.
Ich wurde trotz meines Staus als Sonderling doch in einer dieser sich formierenden Historikergruppen integriert, die sich außerhalb des Seminarraums immer wieder trafen. Ferdinand Klostermanns Vater war Prof. an der Uni, an der wir Teigkrümel anfingen, erst geistige Kekse zu werden, was mich daher beeindruckte, sodass er eher dem Realismus und dem Banalen zuneigte, als vermeintlich geistige Höhen zu erklimmen. Der eigentliche Grund, warum ich mir aber die Sticheleien gefallen ließ, war allerdings weiblich, hatte lange blonde Haare und hieß Anna.
Anna
Anna dachte, ich sei ein Dummkopf. Das hatte sie sich wiederum in ihren Dummkopf gesetzt. Bei allem, was ich sagte, versuchte sie eine Gegenposition aufzubauen. Im Seminar meldete sie sich als einziges Mädchen fleißig und plapperte artig drauflos. Vielleicht war es diese Ablehnung und Unnahbarkeit, die mich an ihr so faszinierte, neben der Tatsache, dass sie hübsch war. Ich suchte mir mit traumwandlerischer Sicherheit immer diejenige aus, bei der es schwer werden würde zu landen. Die Frauen, die mich anzogen, fuhren nicht auf mich ab. Selbstbewusste Menschen des anderen Geschlechtes duldeten „keinen Gott über sich" und verhuschte Wesen interessierten mich wiederum nicht. Sie fanden mich äußerlich ansprechend, was eher hingegen ein Grund mehr war, umso vorsichtiger zu sein. Annas Bestreben schien es zu sein, sich immer wieder darin zu bestätigen, dass ich gut aussah, aber nichts in der Birne hätte. So konnte sie mir nicht auf den Leim gehen. Sie war ziemlich klug, konnte, wie sich herausstellte, allerdings kein noch so kleines Licht in ihrem strahlenden Scheinwerferaugen ertragen. So suchte sich dann instinktsicher den einfachsten Kerl unserer Klicke aus. Ich hingegen redete nur Unsinn in ihren Augen, die denen der „klarsichtigen Klara" aus dem „Sandmann" entsprachen.
Mein Lieblingsort
Derweil sich so erste Freundschaften anließen, verbrachte ich die Tage meistens in der Bibliothek. „Ich habe ein gewaltiges Defizit an Wissen aufzuholen ", sinnierte ich. Verglichen zu Niels Grünwald, den ich ebenso spöttisch wie respektvoll immer „Herrn Grünwald" nannte, war ich, was ein historisches Grundwissen anbelangte, nahezu unwissend. Hin und wieder sah ich in der Bibliothek eine hübsche Studentin neben mir sitzen. Die Studentinnen schrieben mit sicherer Hand etwas aufs Papier. Nur: Wie kam man ohne feste Regularien, ohne Drehbuch der Verführung an sie heran? Einfach einen Zettel mit Telefonnummer hinterlassen? Früher hatten manche Restaurants Tischtelefone, Paartanz, Flirtautomaten, aber heute? Jede Annäherung wird uns peinlich. Es ist nicht mehr geregelt. Es herrscht im Gegenteil paralysierende Regellosigkeit. Was hier vorherrscht, ist das geschäftige Nebeneinander, wie auf Schienen laufend, ohne einen Blick nach rechts und links zu werfen und wenn, dann nur verschämt und schüchtern und dabei wie ein Eisenbahnsignal aus der Ferne zu leuchten.
In der Bibliothek saß ein „ewige Doktorand", mit dem ich hin und wieder ins Gespräch kam, weil er so oft da war wie ich. Er schien sehr einsam zu sein. Hin und wieder stapfte ein etwas älterer Kommilitone mit langen Storchenschritten durch die Bücherei. Es war Settembrini, den ich nach der gleichnamigen Figur aus Thomas Manns „Der Zauberberg" so nannte, weil er gebildet schien und zu allem, womit ich mich ich befasste, etwas halbwegs Profundes zu sagen hatte.
Heute noch schreitet er stets wie ein Wolf sein Revier ab in der Bibliothek, mit einem immer mehr gramgebeugten Gang. Settembrini war damals schon ein Zirkuspferdchen, das aus lauter Gewohnheit nichts anderes in seinem Leben vermochte, als durch diesen Uni-Zirkus zu traben und die Fassade des ewigen, aber reifen Studenten aufrecht zu halten.
In den ersten Semesterferien befasste ich mich dem Simplizissimus von Grimmelshausen. Jeden noch so schönen Nachmittag saß ich in der Bibliothek und verschanzte mich dort hinter meinen Büchern. Ich versuchte mir gar einen Tischapparat einrichten zu lassen, um nicht immer die Schinken mitschleppen zu müssen, was aber spöttisch und höflich von dem Bibliothekar abgelehnt wurde, der lächelnd kundtat, „dass dies nur für Abschlussarbeiten möglich sei."
So packte ich wie Kien in Canettis „Die Blendung" immer abends, wenn nichts mehr aus mir herauszupressen war, die Bücher zusammen und stapelte sie quasi in dem Kopf übereinander und fuhr nach Hause in mein ungeliebtes Heim, wo ich die Bände gleichsam im Zimmer ausbreitete. Geld für eine eigene Zimmereinrichtung hatte ich nicht.
Auf dem Nachhauseweg war ich darauf angewiesen, bis zum Jahnplatz mit dem Bus zu fahren. Hier tobte das Leben, vor dem ich mich herumdrückte und in das ich nicht hineinkam wie ein ungeübter Springer in ein armkreisendes Seil.
Es war damals schon für alle, ob dumm, ob klug angesagt, durch die Einkaufszone zu schlendern. So war es für einen angehenden Intellektuellen durchaus üblich, sich an dem Glanz der Waren zu erfreuen und im Meer des Wohlbehagens dort zu schwimmen. Die Bahnhofsstraße rauf und runter, das machte auch den intellektuellen Kopf munter.
In der Uni hingegen fühlte ich mich wohler. Das Lesen war ja ohnehin die angenehmste Existenz, seit ich mit dem Sport aufgehört hatte. War ich dumm oder klug? Oder beides? In der Schule war ich bei äußerst schlechten Noten, immerhin von zwei Personen als intellektueller Gespiele gefragt: Bei Wolfgang und Lexus, denen ich 1993 nach Bielefeld, einer der nächstgelegenen Unistädte, gefolgt war.
Schule des Lebens
Nach der Schule setzte sich die Serie der Erfolglosigkeit fort. Ich hatte ein Praktikum in der Lokalredaktion der Neuen Westfälischen ergattert. Hier schien es, als hätte meine Bestimmung gefunden. Das Schreiben war das Einzige damals, was mir erstrebenswert erschien und vor allen Dingen: das Veröffentlichen. Aber meine krakelige Schrift, eine gewisse Menschenscheu und ein jugendlicher Leichtsinn und Hochmut machten mir hier einen Strich durch die Rechnung. Ich schrieb hin und wieder Namen falsch, was immer wieder zu kleinen Palastrevolutionen führte, wenn der „Bürgermeister höchstpersönlich" anrief. Ich war zu passiv, zu höflich und fragte nie hartnäckig genug nach. Der Schopenhauersche Wille fehlte. Es interessierte mich nicht in ausreichendem Maße, was der Vogelzuchtverein oder die Kyffhäuserkameradschaft so trieben. Jedenfalls nicht dasjenige, was man in der Zeitung über sie zu lesen bekam. Das Schludern kam nicht immer vor, aber es führte dazu, dass das Vertrauen in mich allmählich schwand. Als ich dann irgendwann über eine Kirchenveranstaltung schrieb, „dass das Kirchendekret des Indie-Hände-Klatschens nicht durchbrochen wurde", ohne die Veranstaltung abzuwarten, war ich fällig. Denn es hatte durchaus Applaus, wenn auch zaghaft, leise, verschämt und nur am Schluss gegeben. Die Realität, das Faktische muss man transzendieren, um die Wahrheit heranzukommen. Dieses literarische Prinzip war aber nicht der klügste Ratgeber für einen Lokalreporter. Etwas anderes kam hinzu: Selbst für einen schablonenhaften Text hatte ich zu wenig an Allgemeinwissen. Beim Schreiben erst fiel mir damals auf, wie ungebildet und dumm ich trotz (oder wegen des Abiturs?) war. Dabei weiß der Lokalreporter immer zu wenig angesichts der Vielfalt der Themenkomplexe, in denen er sich auskennen müsste. Deshalb lobt er stets alles, da er eben für eine fundierte Kritik gegebenenfalls fast zwangsläufig zu ungebildet ist. Dieses „Problem" nahm ich zum Anlass, verstärkt zu lesen und erst mal ein Studium anzustreben. Wenn etwas schlecht war, wollte ich es auch sagen können.
Erst während des Zivildienstes las ich literarische Klassiker und entdeckte immer mehr das Lesen als mir angemessene Daseinsform. Ich war in der Lage, etwas mit Kant anfangen, nicht aber mit Mathematik, das war schon in der Schulzeit ein ewiger Konflikt, den ich nicht zu lösen vermochte und der mein Selbstbewusstsein schwanken ließ bzw. es an seiner Entfaltung hinderte. Dyskalkulie heißt dieses Brett-vor-Kopf-Haben neudeutsch. In Deutsch hingegen war ich ein Überflieger und vermochte immer wieder Glanzpunkte zu setzen, während ich in fast allen anderen Fächern, außer im Wahlpflichtfach Geschichte, wo Zeit-Artikel gelesen wurden, versagte. Hat man in der Schule erst einmal ein negatives Image, so kommt man bei höchster Anstrengung nicht auf einen grünen Zweig. Wie mir erst im Studium aufging, hing das aber mit der Art und Weise in der Schule zu denken oder eben nicht zu denken zusammen; das Gymnasium zu Espelkamp zeichnete sich zudem durch ein naturwissenschaftlich-beengendes Klima aus. Hier wurde nicht eine Sache von seinen Wurzeln aus erklärt, sondern in untypischer autoritärer 68er Manier von etwas ausgegangen, ob Naturwissenschaft oder Geisteswissenschaft, was dann richtig oder falsch zu sein hatte. Wissen wurde nicht über Bücher angeeignet (und nur so entsteht aber wahres Wissen), sondern mithilfe von kurzen Schulbuchtexten dekretiert, die aus dem Zusammenhang gerissen in die Schulbücher gelangten und auf lachhaftem Niveau angesiedelt waren. Meine Gedächtnisschwäche und eine Sehschwäche sorgten dafür einmal selbst verschuldet, einmal fremdverschuldet, nicht auf einen grünen Zweig zu kommen.
Die Sehschwäche war im Zeitalter von Fielmann und Kontaktlinsen auf meinem Konto zu verbuchen. Nie vermochte ich zu lesen, was auf der Tafel stand. Ich verbrachte fast die ganze Schulzeit so in einer Nebelwolke. Ich verließ mich immer auf den Sitznachbarn oder es gelang mir, durch ein gezieltes Zusammendrücken des linken Auges ein wenig Klarheit in den Blick zu bekommen. Ich war aber nie in der Lage, während der Lehrer sprach, nachzuvollziehen, was auf der Tafel stand, sondern brachte diese beiden Ebenen erst immer nachträglich zusammen. Das Wissen kam so unentwegt in einer Art Echoeffekt, wenn überhaupt, bei mir an. Und: Es gab keine schönen Brillen. Eine Sehhilfe zu tragen war ein Makel. Deshalb lehnte ich, der ohnehin seit der Pubertät seinen Marktwert das Aussehen betreffend verschlechtert hatte, es ab, ein Nasenfahrrad aufzusetzen. Das soll keine Entschuldigung sein. In Mathe hätte ich in der Oberstufe bei der größten Sehklarheit kaum zu folgen vermocht, was für alle naturwissenschaftlichen Fächer- und Themen galt, bei denen man überwiegend ohne konkrete Vorstellungen von der erlebten Welt auskommen musste, ohne unmittelbare Erfahrung.
Außerhalb des Unterrichts fiel ich durch meinen Witz auf. Während des Unterrichtes durch Begriffsstutzigkeit, aber auch durch Ironie und Überheblichkeit. Zerrissen war ich schon damals zwischen geistigen Ausfallerscheinungen und aufflackernden Geistesblitzen, zwischen Über und Unterforderung, gedanklicher Hypertrophie und Geistesleere. Die Lehrer konnten damit nichts anfangen und gaben es auf, auf mich Rücksicht zu nehmen. Es hagelte schlechte Noten, je näher ich der zehnten Klasse kam. So blieb ich dann ausgerechnet in der als leicht geltenden Jahrgangsstufe elf sitzen. Das verdankte ich vielen Faktoren, herausheben möchte ich aber mein ständiges Bestreben, endlich wieder mal eine Freundin zu bekommen und Sex zu haben, was dazu führte, die Schule komplett hintanzustellen, spätestens ab der neunten Klasse. Ohne Frau, keine Schulaktivitäten, das war der Deal, den ich mit mir und Gott abgemacht hatte. An dieser Situation änderte sich, da sich kein weibliches Pendant dauerhaft einstellte, nichts bis zum Abitur, das ich dann mit Ach und Krach baute.
Heute weiß ich, wer Lehrer wird. Es waren ganz gewiss nicht immer die begabtesten Studenten, sondern vor allen Dingen diejenigen, die auf Sicherheit setzten. Klaas und ich nannten sie zu Beginn des Studiums „die Schulfüchse". Kleinlich und streberhaft und abstrakt schrappten sie am Verständnis von Texten vorbei. Was sie nicht verstanden, versuchten sie (Sorry, alle begabten Lehrer!) durch Quantität (Hartnäckigkeit und Vielleserei) und Grandezza wettzumachen. In der Schule, so dämmerte mir nun, wurde nicht originär gedacht, sondern Wissen klein gehackt und dem verwöhnten Mund zur Speise dargereicht. In der Uni war genau im Gegenteil die eigene Meinung, die auch hier selten war, gefragt und wenn nicht das, dann wurde zumindest nicht mehr von einer absoluten Wahrheit in Geisteswissenschaften ausgegangen. Denken beginnt mit bei der Lektüre von Büchern und Aufsätzen. Diese Erfahrung machte ich jetzt zu Beginn des Studiums. Historische oder literarische Fantasie entzündet sich erst hier. Stück um Stück, Tür um Tür befreite ich mich von meinem Schulwissen und strebte dem Licht, das unter der jeweils nächsten Tür verführerisch hervorlugte, zu. Eine Tür nach der anderen wurde so geöffnet. Vor drei Jahren waren alle diese Türen noch verschlossen, ja ich wusste nicht von mal von deren Existenz. Langsam ging mir aber auf, was Denken heißt und jetzt erst lernte ich, meinen eigenen Verstand einzusetzen. Ich bekam zum ersten Mal ein besseres Echo, eine positive Response, ja Anerkennung dafür, dass ich es vermochte, in Büchern Bedeutungen aufzuspüren und Zusammenhänge zu entdecken und eigene Theorien zu entwickeln und wieder umzuwerfen wie Dominosteine. Dasjenige, was ich hingegen in der Schule in Schulbüchern las (von Lesen kann hier nicht die Rede sein, eher von Nachbuchstabieren), tangierte mich nicht. Im Unterricht saß ich immer ratlos da, achselzuckend, während die sogenannte Diskussion über meinem Kopf hin und herflog, die aufgeladen dahinwogte und aus Emotion und Wille und fingerschippender Parteilichkeit bestand.
Der Schleier zerreißt
So trottete ich nach der Uni meine Bücher schulternd, zumeist schon nach Ladenschluss in der U-Bahn-Station auf und ab und kniff die Augen zusammen angesichts der grellen Realität, die hier herrschte. Damals gab es noch kein Semesterticket. Studenten mussten noch direkt für den Nahverkehr bezahlen. Zu dieser Zeit war es „Mode", private Dienste, sogenannte „Schwarze Sheriffs" als Kontrolleure und Aufsichtspersonen für die U-Bahn einzusetzen.
Die U-Bahn bestand damals in Bielefeld bis heute nur aus wenigen Stationen, die unterirdisch verlaufen. Bielefeld ist eine der Mittelzentren, in der sich alle Menschen aus dem provinziellen Einzugsgebiet in der Fußgängerzone treffen, um so etwas wie Urbanität entstehen zu lassen und zu erfahren. An diesem Abend war ich gut gelaunt, ja fast übermütig. Ich pfiff eine Melodie vor mich hin, bis ich zwei private Ordnungskräfte erspähte. Alles, was mit Macht, die nicht allein auf Geist beruhte, zusammenhing, verabscheute ich. Wenn es nach mir ging, sollten nur die Überflieger an die Macht kommen und Macht ausüben.
Die beiden schwarzen Sheriffs gehörten nicht dazu. Sie machten mich mit einer herrischen Geste darauf aufmerksam, dass ich meine Füße, die ich erschöpft auf den Sitz platziert hatte, von demselben zu nehmen. In einem jugendlichen Übermut folgte ich zwar den Anweisungen. Anstatt die Füße mit einer Geste des Bedauerns herunterzusetzen, ließ ich sie kurzum in der Luft über dem Sitz schweben. Das war meine Art der Provokation und Revolution. Die Sheriffs nahmen das im Augenwinkel wahr und stürmten sofort in den Wagen, um nach dem Ticket zu fragen, dass ich zum Glück vorweisen konnte. Sie sagten, dass ich das nicht noch mal machen solle. Dabei hatte ich nichts Unrechtes getan. Meine Füße berührten den Sitz in gehobener Position de facto nicht mehr. Aus meinem Spaß mit der blendenden Realität war tierischer Ernst geworden und ein innerer Schleier, der aus Gelesenem bestand und mich vor der Realität schützte, wurde zerrissen. Eigentlich hatte ich ja gar nichts Unerlaubtes getan. Die Gesetze des Lebens funktionieren aber anders. Hier wird nicht jeder danach beurteilt, was er tatsächlich tut, sondern der Anschein genügt und der Stärkere verfügt über das Recht und setzt sich durch. Der Machtinhaber möchte den anderen verschlingen, so hat es Canetti in seinem Buch „Masse und Macht" beschrieben. Wer Macht auszuüben vermag, nutzt jede Gelegenheit, Gebrauch davon zu machen, sei es im Seminar oder in der U-Bahnstation.
So kam ich mit zerrissenem Literaturschleier an meinem Wohnhaus an. Ich las und versuchte langsam, wie einen sperrigen Reißverschluss zögerlich ins Rutschen kommt, in einen Text hineinzukommen, um so die geistige Haut wiederherzustellen, die mir die Realität entrissen hatte. Der Schutzfilm baute sich allmählich wieder auf.
Gern hätte ich mal eine Studentin in meiner Wohnung empfangen. Doch die „blendenden Möbel" à la Canetti genierten mich zu sehr. Mitten in einem grünen Ohrensessel vor dem braunen Wohnzimmertisch, saß ich zumeist allein in meinen viereinhalb Wänden, stöberte in meinem Buchregal und träumte davon, irgendwann einmal der Realität entfliehen zu können und in die Welt der blinkenden Schlangen und geheimnisvollen Türen einzugehen. Das erreichten nur, so glaubte ich damals, Professoren und Schriftsteller, die nicht putzen und kochen müssten und auf die zu Hause eine Frau mehr noch eine Muse, so mein sentimentales und antiquiertes Traumbild wartete, die ihnen den Rücken freihielt. Ein Mensch des 19. Jahrhunderts hatte sich in die Moderne verirrt.
Hagestolz
Ich haderte indes mit dem Singletum. Irgendwann musste mir doch mal eine über den Weg laufen, was ja täglich geschah, nur allein das Zugreifen war meine Sache nicht. So gescheit wie ich im Umgang mit Büchern war, so dumm war ich im Umgang mit der Welt und somit den Mädchen. So wie ich meiner intellektuellen Fähigkeiten damals nicht vollends bewusst war, so war ich, der eine deftige Brille trug, meiner Attraktivität nicht sicher. Warum landete ich bei keiner Frau? Das, was der Dümmste und Hässlichste hinbekam, war mir nicht beschieden? Ich blieb ein stummer und höflicher Pantau. Die Mädels witterten aber immer sofort meine dahinterstehende Zerrissenheit und Unausgeglichenheit! Was sie zu Gesicht bekamen, war ein arroganter Brillenträger, der sie zum Widerspruch reizte und eine fast weiblich anmutende, fast bartlose Visage und ein feminines Nietzschegesicht hatte. Hin und wieder traf ich auf eine voluptuöse Schwäbin in der Uni, mit der ich hie und da ein paar Worte wechselte, die bei einem gewissen Herrn Bohrer an einem Kolloquium teilnahm. Ich gab in den Zwiegesprächen, die meist in der Bibliothek zustande kamen, Antworten auf so manche Frage, die in diesem Elitezirkel zur Diskussion standen: Was ist Ironie? Ist Nietzsche ein Ironiker? Gibt es nach Friedrich Schlegel nur Vertreter eines espritslosen Ernstes in der Geistesgeschichte? Auf all das hatte ich knappe, aber passende Antworten parat. Das waren freilich nur gedankliche Skizzen. Was mir an Problembewusstsein mangelte, kompensierte ich durch jugendliche Unbekümmertheit und Spontanität. In der Uni geht es aber nicht darum, Antworten auf Fragen zu finden, sondern dies und das ergebnislos anzusprechen, das heißt Fragen zu stellen und sie staunend in den Raum verklingen zu lassen. Die Schwäbin hatte mich gewiss als unendlichen Großsprecher wahrgenommen. Ich schaffte es nie, eine platte, banale Gesprächsebene ohne „Pathos der Distanz" zwischen mir und einer Frau herzustellen. Immerzu entwand sich der Spatz aus meiner linkischen Hand. Entweder kommunizierte ich hochtrabendes Zeug. Oder aber ich reagierte wie eine Muschel, die sich plötzlich schließt und dann kaum ein Wort nach draußen findet. Den Schatz hütete ich innen. Einer Frau gegenüber, die mir gefiel, sprach ich so nur Unsinn (die Muschel schloss sich). Ich konnte mir selber dabei zusehen, wie ich der Unsinn seitlich aus dem Spalt wie bei einer Tauchmaske aus mir heraussprudelte, so als ob ich jeden guten Eindruck verwischen wollte, den meine äußere inzwischen trotz Brille durchaus einnehmender Gestalt hätte machen können.
Früher hatte ich immer: „Nein" gesagt, wenn ich etwas haben wollte. Verschämt senkte meine Seele den Blick und gab mir vor, mein Ich möglichst klein zu halten. „Ich" könnte ja gemeint sein. Es war meine Intention, mein Ich zurückzunehmen. Dieses erschien mir nicht so wichtig. „Nichts wie hinaus aus dem Scheinwerferlicht", dachte ich selbstvernichtend.
Dabei gab es ja Frauen genug in meinem Umkreis. Ich schwärmte für so einige Damen damals. Da war die Blonde mit den Engelslocken, die mich kannte, weil wir aus dem gleichen Ort stammten. Nur ich wusste nichts von ihr, was ich meiner brillenlosen Jugend und mangelnden Selbstbewusstsein zu verdanken hatte, das mich nicht in die Augen, sondern nur zu der Silhouette der Frauen hinschauen ließ. Die meisten hatten außerdem schon einen Freund. Auf einer Uniparty tanzten wir und lächelten uns an. Später saßen wir zusammen im Latinumkurs. Hier waren wir Leidensgenossen, wobei sie sich als die hier viel Begabtere in Latein herausstellte. Ich war nur in der Lage, entweder einen Satz grammatikalisch zu analysieren oder zu übersetzen, der Schritt zwischen beidem gelang mir fast nie. Mit meiner Begabung für Literatur wähnte ich mich auf einer ziemlich einsamen Insel des Könnens. Für mathematisch-formale Logik war ich zu dumm, für lateinisch-rhetorische Prosa zu klug. In mir tobte ein Möglichkeitssinn, der mich um einen Sinn betrog.
Professor Bohrer
Damals besuchte ich zum ersten Mal eine Vorlesung von Professor Bohrer. Alle Veranstaltungen von Karl-Heinz Bohrer waren immer mehr oder weniger Vorlesungen. Zuerst musste ich über seine gelehrsame Gestalt ein wenig lächeln. Er schien einer Wilhelmbuschzeichnung entstiegen zu sein und dem Klischee eines zerstreuten Professors aufs Äußerste zu entsprechen. Zerstreut und genialisch stand er im Hörsaal und dirigierte die Später-Kommenden hemdsärmelig wie ein Verkehrspolizist herum. Immer mehr Leute strömten in den Hörsaal 3, sodass bald nur in dem großen Hörsaal 1 Platz für alle war. Auch hier wurde ETA Hoffmann gelesen. Thema war das Phantastische in der romantischen Literatur. Bohrer hielt sich am Rednerpult fest und war in seinem Element. Die immer wieder eintretenden Ausfälle des Mikrofons bemerkte er erst gar nicht. Mit Technik hatte er freilich nichts am Hut. Das durfte ein Germanistikprof auch nicht. Wild gestikulierend und immer wieder die Arme in die Hüfte gestemmt, stand er dort unten und erschien so kontinuierlich den Eindruck eines vor einem Gemälde versinkenden Kunstliebhabers zu imitieren. Fortwährend las er längere Textpassagen vor, die er leidenschaftlich und immer wie aus dem letzten Loch pfeifend deklamierte. Er interpretierte ETA Hoffmann und seinen Wahnsinn so wie ich als Tragödie des fantasiebegabten Menschen. Blinkende Schlangen sprachen zu dem Studentus Anselmus, die für die Normalsterblichen nicht sichtbar waren. Bohrer schien selber so eine Figur aus Hoffmanns Märchenwelt zu sein, die immerzu und hier hatte ich die Meinung eines geachteten Literaturwissenschaftlers auf meiner Seite das Künstlerleben angesichts einer rationalen oder ignoranten Bürgerwelt thematisierte. Nur um die Vorlesung zeitlich zu füllen, schlich Bohrer schwadronierend um das Wesentliche herum und zelebrierte den Kontext, das Drumherum, die Paraphrase, die für den typischen Germanisten aber schon das rerum centrum ist. Der Kern, den Bohrer aber intendierte, wäre schnell herausgeschält. So zeigte er zwar zunächst alle geistesgeschichtlichen Zusammenhänge auf. Zitierte den Widersacher der Ironie Hegel, der gegen das Kranke in der romantischen Kunst „anstänkerte" und von der Reinheit der Antike träumte. Irgendwann kam er aber dann zum Punkt. Ans Eingemachte. Zur Message. „Wenn es krank ist, mit Fantasie geschlagen zu sein, so will ich gerne krank sein ", dachte ich begeistert. Bohrer sprach mir aus der Seele. Wie verfehlt war eine reine, auf Wortbedeutungen und Verweisungszusammenhänge kaprizierende Lektüre (Derrida und Co), wie sie Herr Dr. Kremer als tentatives intellektuelles Spiel betrieb. Denn man konnte in den meisten Fällen schon genau angeben, woraus bei dem jeweiligen Kunstwerk die Kernaussage bestand. Kunst war nicht etwas Sakrales, angesichts dessen wir auf die Knie rutschen und verstummen müssten. Sie war klar, wie etwas, das wir vor uns sehen und nach Ausdruck schreit, eine Sensation, die wir aufgrund von Komplexität nicht immer sofort mit Worten fassen können, aber dennoch augenblicklich verstehen. An einem Punkt angekommen warf Bohrer alles, was er bisher gesagt hatte, über Bord und fragte nachdrücklich und insistierend „Was ist die Aussage, was ist die Botschaft?". „Whats the Message?". Das war mein Kairos: Mein Finger schnellte so rasch hoch, als wolle ich eine Fliege erschlagen. Erleichtert erteilte er mir das Wort, froh, einen der wenigen Mitstreiter gegen links und rechts und für das Ästhetische gewonnen zu haben.
Klaas und ich pilgerten seit diesem Pfingsten in Hörsaal 3 fast nur zu Bohrer und schlossen uns ihm an auf seinem Feldzug gegen bornierte Kleingeisterei und Spießertum und dem Votum für die Fantasie und Intelligenz. Dabei gab es genügend Schulfüchse und von keinerlei Begabung getrübte Zwischenrufer vor allen Dingen das Justemilieu vertretend, die das Leben von Bohrer und uns nicht leicht machten. Er war froh um jeden „Mitstreiter". Wie ein Suppenkasper wirkte er manchmal in seiner genialischen Pose, immerzu auf dem Kriegsfuß mit sich selbst produzierenden Studenten ab 60, den von uns sogenannten „Stricktanten" und argumentierenden Weltverbesserern mit Rasterzöpfen und der Vorstellung schwanger gehend, Literatur sei ausschließlich Sozialkritik und als Indikator für empörende gesellschaftliche Zustände anzusehen. Bohrer hatte die Moderne in die Literaturwissenschaft eingeführt. Vor der läuft sie gewöhnlich davon, da sie zu radikal und in manchen Fällen auch intellektuellenfeindlich ist, selbst den Gelehrten keine Identifikationsmöglichkeiten oder Halt bietend. Bis zu einem Punkt vermochte man wissenschaftlich vorzudringen, von da an war man gezwungen, selbst zu schwimmen. Nur wer schwimmen konnte im Meer extremer Literatur, war geeignet genug für das Bodenlose der modernen Kunst, von der man weggetragen wurde wie von einer Welle ins Dunkle. Dankbar nahm Bohrer Wortmeldungen entgegen, die in seine Richtung zielten und den „ästhetischen Kern", wie es in seinen Schriften hieß, trafen. Wer sie nicht sah, die Schlangen, war blind für Kultur, was Bohrer das Ästhetische nannte. Und wer sie sah, sagte die Wahrheit und kokettierte bisweilen mit dem Wahnsinn.
Immer wieder thematisierte Bohrer Zeiterfahrungen in der Kunst. „Stimmungen, Zustände, in denen die Zeit stillsteht" und Kontemplation ausgedrückt wird. Nach den Entbehrungen der Schulzeit und dem verpatzten Journalistenversuchen blühte ich hier regelrecht auf. Bohrer und ich funkten auf der gleichen Wellenlänge. Ich wuchs dabei über mich gar über Bohrers Kopf hinaus. Bald war ich als „der junge Student" ein bekanntes Gesicht und in so manchen Sitzungen hatte ich die Ehre, eine oder gar „die" Lösung zu präsentieren, auf die Bohrer hinzielte und vor der so einige der Mitstudenten wie ein Hornochse vor dem Scheunentor stehen blieben. Ich war auf einmal gefragt und schwebte so die ersten beiden Studienjahre auf einer Wolke des Erfolges, wobei ich meinen Intellekt überschätzte, so wie ich und andere ihn vorher unterschätzt hatten. Ich bin nicht intelligent, aber begabt, was nicht das Gleiche ist, was Friedrich Schlegel in seine Aphorismen notierte, ein Savant in Sachen Geisteswissenschaft, aber ansonsten und in der technischen Welt ein grobmotorischer Einfaltspinsel. Möglicherweise kann jemand nur etwas mit moderner Literatur anfangen, wenn man über das Technische erschrickt und es mit Entsetzen aufnimmt. Ich aber schätzte mich, als dass ein, was ich seit meiner Schulzeit zu sein schien: ein verkanntes Genie. Dabei war es mehr eine Begabung, die mindestens ebenso auf einer gewissen Psychopathologie aufruhte.
Lediglich für Geisteswissenschaften galt aber dieser Genieverdacht, der sich nicht nur dadurch zeigte, dass ich einen unmittelbaren Zugang zur Literatur hatte, sondern kontrastiv auszeichnete, dass die Studenten in geisteswissenschaftlichen Fächern so durchschnittlich begabt waren und sind (mochten sie noch so intelligent sein). Die literarisch Begabten fallen da schon auf und besonders die Literatur nicht nur speichern und mit drei griffigen Worten, so wie eine Kosmetikerin einen Duft beschreibt, zusammenfassen und nicht Literatur nur als erbaulichen Zitatenschatz mit sich herumtragen, sondern als Medium der Welterschließung und als Erkenntnisweg begreifen. Worauf es aber in der Uni ankam, war ein präzises Gedächtnis. Das dämmerte mir schon damals. In diesem Punkt sah ich mich nicht als künftiger wissenschaftlicher Stern. So gut das Pingpong-Spiel mit Bohrer funktionierte, so identifizierte ich mich doch eher mit dem Künstler, genauer Lyriker und dachte mit Vorliebe in Bildern, so wie es, wie ich später erfuhr, quasi von Musil gefordert wurde, um an die Wahrheit im Chaos der Moderne heranzukommen oder zumindest „an sie heranzuspielen".
Ich schaffte es aber nicht vor Publikum wie ein Wissenschaftler auf Kommando zu reden, sondern es musste sich entwickeln in einem Gespräch. Dann konnte ich dort zu längeren „Referaten" ausholen. Im Grunde war ich aber ein Lyriker, der etwas schnell und assoziativ erfasste und immer wieder in die Bildsprache der Poesie verfiel und wo ich kein Bild fand, verstummte und die Wahrheit verdampfen ließ. So fiel es mir freilich leicht, Literatur über Literatur oder über Bewusstseinsvorgänge zu verstehen. Ich behandelte in meinen Gedichten immer wieder den „Augenblick des ästhetischen Scheins". Ganz allein und mitten in der Provinz hatte ich mir quasi eine Poetologie der Moderne zusammengestrickt. Ganz ohne Strickzeug der fleißigsten Leser, den sogenannten „Stricktanten“.
„Über was kann man mit Gewissheit noch sprechen?", fragte ich mich in Descartescher Manier in meinen Gedichten. „Über was kann man noch schreiben?" Das Einzige, wovon ich genau wusste, dass es nicht sofort von der Wirklichkeit widerlegt und verschluckt sein würde, war der Produktionsvorgang von Gedichten selbst. In unermüdlichen neuen Anläufen umkreiste ich dieses Thema. Immer wieder übersprang ich die Logik einer sprachlichen Aussage, indem ich ein Bild zur Aussageform erhob. Immerzu war mir die „Normalsprache" und das bloße Argumentieren unzureichend, da sie uns von der Wahrheit wegführte. Im Grundkurs Geschichte zum Beispiel gab ich mich nur ungern mit den herkömmlichen Erklärungsmustern zufrieden. Wie ist der Erste Weltkrieg entstanden und ausgebrochen? Eine Antwort auf diese Frage vermochte man meiner damaligen Bilderschwelgerei folgend nicht mit einer Auflistung von sachlichen Gründen erfassen, sondern es gab die eine essenzielle Antwort, die auf ein Denkbild zurückführbar war. Auch in diesem Fall stellte ich mir eine Person vor. Stellt man sich in Geschichte nicht immer Personen vor und abstrahiert dann? Ich imaginierte mir Europa als einen Dandy, der, um nur irgendwas zu erleben und einen vitalistischen Impuls zu erfahren, sich von einem Krieg eine „Reinigung" erhoffte. Eine Reinigung von was? Eine Purifikation, wie sie sich Thomas Mann im Zauberberg literarisch umgesetzt hatte: eine Reinigung von einem endlosen Streit der Ideen im Zeichen einer zivilisationsmüden Kultur. Musil, der Antipode zu Thomas Mann, war da ein wenig feiner gestrickt: Alte Ideen des 19. Jahrhunderts haben nach ihm keine Erklärungskraft mehr angesichts der komplexer werdenden Moderne. Nur poetisch vermag man jede Idee in einer Art Bildsprache auflösen, mithilfe derer man hinter die Begriffe zurücksteigt und sich so vor einem blinden Aktionismus feit, aber in Ironie verharren lässt, da diese Utopie praktisch nicht umsetzbar ist. Musil wurde damals zu meinem großen Meister. Die Lektüre von Robert Musil aber machte sprachlos. Man konnte nur auf die Dinge hindeuten und wittgensteinisch nach der Lektüre „zeigen". Und auch der Lord Chandos-Brief von Hofmannsthal hinterließ deutliche Spuren.
Studentenleben
Das waren alles schöne Ideen, die jeweils in der Summe dazu führten, dass der Konflikt zwischen dem, was ich geistig erlebte und einer planen Realität immer größer wurde. Nicht selten stolperte ich nach einem Seminar aus dem Seminarraum und fand mich im brodelnden Lärm und dem blendenden Licht der Unihalle wieder. Was für ein Unterschied war es, im Halbdunkel des Seminars in Gedanken zu sein und dann die Unihalle zu betreten, in der das Leben tobte oder zumindest eine Band spielte und das Gemurmel der Bielefelder Campusuni, die sich in ihrem Hauptgebäude ausnimmt, wie ein Flughafenbau zu mir hinaufstieg wie überkochendes Wasser. Hier war die Challenge, dass der weitverzweigte Baum der Gedanken nicht von den Fluten und dem Treiben der Unihalle wie von einem Strom weggerissen wurde. Der Kontrast zwischen Stille und andächtiger Kontemplation und arglos-fröhlichem Gelächter des Lebens hätte nicht größer ausfallen können als hier in der Campusuni von Bielefeld, die mir in den Seminarpausen erschien wie das Wuseln eines Großstadtbahnhofes. Ich war gewiss nicht der Einzige, der hier immer wieder diesen Realitätsschock erlitt. Die Gruppe von nassforschen Historikern hingegen war gegen die Sensibelchen, die durch die Halle schlichen und huschten und stolperten, ein Löwe mit einem ebenso dicken Fell.
Die Geschichtsstudenten rekelten sich auf der „Historikertreppe", die hinauf zur Empore und Bibliotheksteil S der Geschichtswissenschaft führte, und insbesondere die weiblichen Studentinnen plapperten dort munter drauflos über alles Mögliche, Gott und die Welt darüber, wer mit wem welche Stelle mit wem besetzte und warum. Uni-Klatsch eben. Nur selten kam das Gespräch auf wissenschaftliche Themen. Ich versuchte, total uncool, immer wieder das Ruder hin zu Bücherthemen zu lenken, was als streif und streberhaft angesehen wurde. „Diese Leute blieben immer hinter einer sicheren Stadtmauer, die sie nie überwanden", dachte ich. Sie zogen einen strikten Trennungsstrich zwischen Uni und Leben, was die einzige gesunde Umgangsform mit dieser Institution war und ist, wenn es hier überhaupt eine gesunde Umgangsform geben mag. Ich und einige andere Beflissene nahmen die Uni anstatt eines Partners mit ins Bett und ins Leben wie SpongeBob seine „Kumpelblase". Ihre Inhalte beschäftigten mich in der sogenannten Freizeit, die es für einen wie mich von an nicht mehr gab, seitdem ich Bücher las und Bohrer folgte.
Kopfflüssigkeit
Ich hatte damals wie heute kein Hobby, keine Ablenkung, keine Zerstreuung. Das Tennisspielen hatte ich mit Beginn des Studiums fast vollständig aufgegeben. Fragte ich mich jetzt, wie ich jemals ohne geistige Inhalte ausgekommen war, so war es mir vor nicht mal drei Jahren undenkbar gewesen, ohne Tennisspiel auszukommen. Ich spielte nicht das erfolgreichste Tennis. Meine Technik war besser und geschliffener als der Erfolg im Wettkampf. Schon siebenjährig fing ich damit an und mein Untalent im Vergleich zu meinem Bruder zeigte sich sofort, wie alte V8 Filmaufnahmen belegen. Ich hielt mich an die Anweisungen des Tennislehrers, der uns eine fixe Fußstellung vorgab. So wie im Lateinischen war das quasi die Grammatik des Spiels. Im Spiel, so wie bei einer Lateinübersetzung, sah es dann doch ganz anders aus. Es war ratsam, nicht so beim Bestehenden statisch stehen zu bleiben, sondern man war gezwungen, auf den Ball zuzugehen und zugleich prozessual die schräge Fußstellung einzunehmen. Ich konnte damals immer nur eines: Entweder den linken Fuß vor zu stellen oder zum Ball laufen. Entweder Grammatik (Fußstellung) oder das Spiel. Nein, ein Ass war ich weder im Lateinischen noch im Tennis. Bei beidem fehlte es an Spielwitz und Koordination. Ich aber blieb stehen, beim Grammatikalischen, wie ein Böckchen steif blieb ich stehen. Was ich erst später vermochte, war, den Ball immer wieder nach bewegungstechnischen Vorgaben ins gegnerische Feld zu befördern, wobei sich meine Technik langsam, aber stetig verfeinerte. Überraschungsmomente und ein letzter Siegeswille meinerseits blieben aber aus. Ich spielte schön, quasi für die Galerie. Ich konnte nicht anders und hatte keinen Killerinstinkt. Der Wille entfleuchte mir so rasch wie einem Übergewichtigen der Atem auf einer Treppe. Das war nicht weiter schlimm. Ich hätte mich zwar über Erfolge nicht beschwert, sie standen aber nicht im Vordergrund, zumindest redete ich mir dies jahrelang ein.
Und das Lateinische wurde ebenfalls nicht mein.