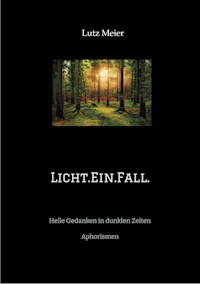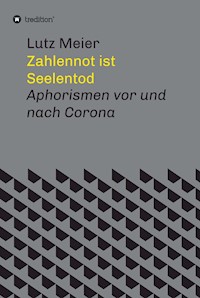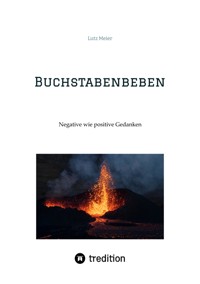
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Der inzwischen fünfte Gedankenband von Lutz Meier bietet eine gewohnt pointierte Mischung aus philosophischem Essayismus, genauer Alltagsbeobachtung sowie eine Lust an Sprache und ihrem Spiel. Die Bandbreite reicht auch dieses Mal von Gesellschaftsthemen, Phänomenologie, über Moral- und Religionsphilosophie, bis hin zu philosophischen Klassikern. In dem bis zu 168-seitigen Werk wird eigengedacht und weitergedacht. Ein Kaleidoskop auf den Spuren von Friedrich Schlegel, Karl Kraus und Friedrich Nietzsche.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 110
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Lutz Meier
Buchstaben
Beben
Negative wie positive Gedanken
© 2024 Lutz Meier
ISBN Softcover: 978-3-384-20261-1 ISBN Hardcover: 978-384-20262-8 ISBN E-Book: 978-384-20263-5
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, An der Strusbek 10 22926 Ahrensburg Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
1.
Kontemplative Verzögerung. - Es dauert einen Moment, bis man in einem Text „drin“ ist. So wie ein nasses Stück Holz, das sich nicht entzünden will, erst nach ewigen Pusten und Rauch anfängt zu glühen, so wie der Klebstoff erst nach einer Weile anzieht, so ist es auch beim Lesen.
2.
Nach dem Post ….. - Ist die eine Seite endlich geschrieben, so wartet auch im Wordprogramm von Microsoft der Cursor ungebärdig blinkend schon wieder mit der nächsten leeren Seite darauf, beschrieben zu werden. So geht es vielen kreativen und pseudokreativen Menschen heute. Nach dem Post ist vor dem Post. Ganz besonders ausgeprägt ist die Notwendigkeit des Neuen heute in den sogenannten sozialen Netzwerken, wo eine viel kürzere Halbwertzeit besteht und man sich keine Sekunde zurücklehnen kann, um sich bei seinen verdienten Lorbeeren auszuruhen.
3.
Bis zu einem Punkt immer klarer. - Hans Robert Jauß hat auf den rezeptionsästhetischen Faktor der Zeit hingewiesen. Demnach hat jede Zeit ihre eigene Interpretation von Literatur. Ich setzte dagegen, dass sich mit der Zeit, die vergeht, sich der Nebel lüftet und man immer klarer sieht, was gemeint war. Der Schein des Scheins fällt weg, das Kontemporäre, das die Wahrnehmung und Rezeption verzerrt. Immer klarer sichtbarer wird die Kernaussage eines Textes, wie ein Bild bei Dalliklick in der Kultshow „dalli, dalli“ mit Hans Rosenthal immer deutlicher erkennbar wurde. Am Ende braucht man nicht mehr raten. Es gibt aber einen bestimmten Zeitpunkt, an dem der Kairos auch wieder vorbei ist. Zunehmendes und abnehmendes Licht.
4.
Gewohnheitswissen und Vernunftwissen. – Wie leichtfertig setzen wir Gewohnheitswissen (wir machen etwas nur deshalb, weil wir es immer so machen) mit Vernunftwissen gleich. Ersteres kommt selten auf den Prüfstand des Letzteren.
5.
Musik und Irrtum. - Mit und nicht ohne Musik ist das Leben ein Irrtum. Die Wahrheit liegt wohl in der Mitte.
6.
Verschmähter Lorbeerkranz. - Es gibt kaum einen Menschen, der nicht in irgendeiner Weise an den Produkten eines Schriftstellers positiv partizipiert. Man ist auch als leseresistenter Mensch stolz, in einem Land von „Dichtern und Denkern“ zu leben. Will aber für geistiges Eigentum nichts ausgeben oder investieren. Ähnlich ergeht es Friseuren. Alle sind stolz auf einen guten Haarschnitt; nicht aber auf den Friseur, der die Frisur geschnitten hat.
7.
Vom Handicap ein schmales Buch zu veröffentlichen. - Je dicker ein Buch, desto toleranter ist man seinem Inhalt und seiner mangelnden Qualität gegenüber. Es gilt schon als Leistung, es gelesen zu haben. Bei schmalen Büchern spricht man auch gering schätzend von einem „Büchlein“. Auch wenn es hoch konzentrierte Lyrik oder Gedanken enthält, schätzt man den Wert von einem tausendseitigen Roman höher ein und stimmt mit dem Geld ab, das man bereit ist, dafür mehr zu zahlen. Das Volumen birgt ein Qualitätsurteil.
8.
Links und rechts. - Wenn die Ideologie des Linksalternativen der Kommunismus ist, so ist es der Nationalsozialismus für den Rechtseingestellten.
9.
Verstehen Sie Spaß?. - Die Sendung ist so ziemlich alles, was uns vom Samstagabend geblieben ist. Wir brauchen so ein „Lien social“ offenbar nicht mehr, da sich die Konsum- und Arbeitsgepflogenheiten verschoben haben. Man macht keine so scharfe Differenz mehr zwischen Arbeit und Nichtarbeit mehr, und man kann von einem riesigen Fernsehprogramm ausgehend, sich eine Nische suchen und finden, ganz abgesehen von Streamingangeboten. Man braucht den Samstagabend scheinbar nicht mehr und dennoch ganz ohne wollen wir auch nicht sein. So schauen wir nolens volens samstags in die Programmzeitung rein. Wenn man sich darauf einlässt, hat „Verstehen Sie Spaß?“ seine unzweifelbar komischen Momente. Die Ratingskala des Komischen reicht vom signifikant Komischen bis zum absolut Komischen (nach Baudelaire). Lachen hat immer etwas Hämisches. Hier zeigt sich dieser Umstand ganz unverdeckt. Lachen ist einem ausgeschlossenen Dritten die Zähne zu zeigen und zu sagen „Du bist des Todes!“ Oder: „Du gehörst nicht mehr dazu!“ Im Spaß lässt sich die (kapitalistische)Welt derangieren, um sie sogleich wieder zu rearrangieren. Es war ja nur Spaß. Der Zusammenbruch war ein simulierter. So erleben wir voll freudiger Schreckangst fiktional den Zusammenbruch (des Kapitalismus), der aber sogleich als Schein und böser Gedanke ausgewiesen und wieder zurückgenommen wird.
10.
An den Bildungsbürger. - Man muss Blumen nicht benennen können, um sie schön zu finden.
11.
Sehnsuchtsgefühl. - Die Sehnsucht nach dem Anderen wächst aus der Entfremdung.
12.
Konservatismus. - Nicht immer wissen Akteure, was sie sind und ausmacht, und kleiden ihr Sosein in eine abstrakte Formel, wie zum Beispiel, wenn jemand von sich sagt, er sei konservativ. So spricht der Rechtsgesinnte von seinem „inneren Kompass“, einer „schwarzen Seele“, eben seiner „Konservativität“, ohne zu wissen, was er eigentlich genau meint. Er spricht diffus von „Werten“ , wie sie als letzter von Max Scheler ernsthaft untersucht wurden. Wofür und wogegen ist der Konservative de facto nun? Der Konservativismus ist zunächst einmal nicht für etwas, sondern dagegen (das Neue, die moralische Forderung, den Schwarzen, die berufstätige Frau). Sein „Markenkern“ ist also ein skeptischer, idiosynkratischer Blick auf die Dinge, die sich so eigentlich gar nicht politisieren lassen: Er ist gegen das Fremde, das ihn nur irgendwie dumpf missbehagt, genauso gegen Homosexuelle, gegen links, gegen arbeitende („emanzipierte“) Frauen. Man ist ebenso diffus für den Unternehmer, Wirtschaftswachstum und Kapitalismus, also für Dinge, die von im Zweifelsfall Arschlöchern supponiert werden und vom Arschlochtum tangiert sind. Aus dumpf gefühlter Ablehnung kann man freilich keine politische Agenda machen. Der Konservative macht es trotzdem. So ist er gegen die eingeschlechtliche Ehe, gegen das sogenannte Gendern, gegen Ausländer, die zu uns kommen sollen, für einen ungezähmten Kapitalismus, allesamt keine Res Politica oder zumindest nur randständige. Das sieht bei dem Widersacher, dem Sozialdemokrat da schon viel konkreter aus. Hier werden ganz konkrete Forderungen formuliert wie ein Mindestlohn oder ein Bürgergeld, also gegen menschliches Leiden, woraus sich glasklare Politica ableiten lassen, die manchmal aber an der Realität scheitern, was wiederum das Lebenselixier des Konservativen ist. Der Konservative ist meistens ein kapitalistischer Profiteur. Schon aufgrund dessen ist er für den Kapitalismus. Ein kleines Korrektiv bildet die Religion, die er verlogen herbeiredet, wenn das unbarmherzige System des Kapitalismus, das auch noch sehr vulnerabel ist, wie wir im Augenblick erleben, wieder mal zugeschlagen hat.
13
Ahnung und Moderne. - Früher als Kind, wenn meine Eltern sich aus dem Haus geschlichen hatten, um einen Geburtstag zu feiern, und ich und mein Bruder allein zu Hause schliefen, bin ich, wenn ich wach wurde, in den Garten gestiefelt und habe in die Nacht gehorcht, ob sie sich nicht mit ihrem Auto nähern würden und sie wiederkämen. Aus diesem Horchen wurde in meinem späteren studentischen Leben ein Horchen nach Sinn in der Nacht der Moderne.
14.
Ein feiner Unterschied. - Auf dem PC-Monitorbildschirm wird ein Text nur überflogen. Nur wenn man ihn in der Hand hält (also auch mithilfe eines Readers) wird er haptisch erst tatsächlich gelesen und nicht nur überflogen.
15.
Schock des Kulturfernsehens. - Nachdem ich gestern Abend „Das literarische Quartett“ geschaut hatte, konnte ich am nächsten Tag nicht mehr schreiben. Die unbefangene Intuition war aus- und die Manier war übrig geblieben. So wie SpongeBob sein Künstlertalent einbüßte, da er in den How-to-do-Arts-Büchern gelesen hatte, so fühle ich mich beim Schreiben vom „großen Bruder“ namens Thea Dorn verfolgt, die mir bei jedem Wort und jeder Zeile auf die Finger schaute.
Wenn wir uns selbst beobachten, produzieren wir nur Müll.
16.
Es will nicht Winter werden. - Es will einfach nicht Winter werden. Die innere Uhr stimmt so nicht mehr mit seiner naturhaften Umwelt zusammen, da Mitte Oktober 2023 Temperaturen um die Zwanziggradmarke herrschten. So als sei man aus dem Naturzyklus, dem Zeitgeist oder einer Handlung herausgefallen, in deren Takten wir voranschreiten, so empfinden wir einen ausbleibenden jahreszeitlichen Wetterwechsel als Synkope. Eine neue Eis-Zeit bricht an.
17.
Narzissmus als Antreiber. - Der Narzissmus treibt das Talent vor sich her. Er darf nur nicht schneller werden als das Talent, das er vor sich her treibt oder es gar überholen.
18.
Entwicklung des Lesers. - Nur wer liest, macht eine Entwicklung durch. Der Nichtleser bleibt ein Stein (oder gar unter demselben).
19.
Plötzlichkeit. - Jedes Blatt ist eine Seele. Erst wird sie welk. Dann fällt sie plötzlich ab.
20.
Geistiger Atem. - In-der-Welt-Sein heißt häufig: den geistigen Atem auf Sparflamme zu halten. Richtig Durchatmen geschieht erst im gleichmäßigen, klappernden Rhythmus, dem Auf und Ab der Mühle des Leseflusses bei der Lektüre von klugen Büchern.
21.
Was der Aphorismus sein kann. - der Aphorismus ist ein Kompromiss aus dionysischer Poesie und apollinischer Genauigkeit.
22.
Geistreich I. - Es gibt kaum etwas Schwierigeres für einen Autor, als in einem fließenden Prosatext unentwegt geistreich zu sein. Entweder man ist geistreich, oder aber man erzählt etwas, wobei hin und wieder geistreich zu sein durchaus möglich ist. So wie man beim Zählen nur alle zehn Zahlen einen Zahlenwert ändern kann, so kann einem nur alle fünf Absätze einem etwas Esprihaftes gelingen.
23.
Keine Unschuldsvermutung. - Man kann nichts für die Krümelreste, die beim Frühstück nun einmal entstehen und auf den Boden fallen. Dennoch neigt man genervt als derjenige, der die Rolle des Saubermanns innehat, dazu, dem Verursacher eine gewisse Schuld aufzubürden.
24.
Verzeihung. - Man verzeiht dem Autor nur durchschnittlich geistreich zu sein, wenn er gut erzählt, wie Hemingway.
25.
Geistreich II.- Weil es eben so schwer ist, geistreiche Eingebungen beim Schreiben zu haben, werden jene auch in einem Prosatext mehr bewundert, als wenn sie nicht in einen Romanprosatext eingewoben wären.
26.
Ohne Gefühl. - Ohne Gefühl zu schreiben, ist wie Beischlaf ohne Kondom. Schwanger wird man davon nicht.
27
Rückseite des Euphemismus. - Hinter so manchem Euphemismus steckt eine verharmlosende Schweinerei. Man denke an „Fleischsalat.“
28.
Wissen und Erosion. - Wissen wird durch die Lektüre von Büchern mehr in Erosion gebracht als vermittelt. Aus dieser Erosion heraus (dem Aufschlagen von Sahne), muss man dann selbst Wissen fix machen und statuieren, sich das Wissen selbst vermitteln (bis die Sahne steif ist) und für sich herausfinden. Je mehr wir strampeln, desto heller das Licht.
29.
Die Hölle des erotisch Anderen. - Unangenehm ist es, wenn man ein Blickgegenstand wird. Noch unangenehmer ist es, wenn man ein erotischer Blickgegenstand wird (eine Gruppe kichernder Mädchen). Die Steigerung davon ist ein erotisch-lächerlicher Blickgegenstand zu sein (exzessives Kichern, kombiniert mit dem Urteil, eventuell vom anderen Ufer zu sein). Verärgert über das Blickfehlurteil und vom Lachen übergossen, senkt man den Blick.
30.
Die Wichtigkeit des Buches. - Die wichtigsten Bücher der Welt sind die Kochbücher.
31.
Wider die Metaphysik. - Wir sträuben uns gegen metaphysische, also alleserklärende Gedanken und Ansätze in der Politik wie in der Kosmologie. Wir sperren uns erstens deshalb dagegen einen über alle Erklärungsgrundsätze gehenden Ansatz, der eine Alleserklärung anbietet, da er von Neunmalklugen vorgebracht wird. Woher wollen sie das wissen, was nach dem Tode kommt? Woher wollen sie wissen, dass ein Wille uns stets antreibt? Und zweitens sträuben wir uns dagegen, da diese oftmals eine Sehgewohnheitsänderung implizieren, der mit der irdischen und alltäglichen-prosaischen Sachlogik nichts zu tun hat. Drittens bietet so eine alleserklärende Position keinen Raum für eine Widerlegung. Vielmehr heißt die Devise: „Friss oder stirb!“ Solche Gedanken berauben uns den Atem zum Selbst-Denken. Und viertens wollen wir alles zerstören, was über den Wolken wie Ikarus schwebt, dem wir einen mächtigen Absturz wünschen, je höher es hinausgeht.
32.
Wahrheit und Gefühl I. - Ohne Gefühl kann man selbst etwas Wahres nicht mit Nachdruck glaubhaft vermitteln, sozwar, dass das Wahre ins Unwahre umkippt, wenn es mit weniger Nachdruck vertreten wird als notwendig. Das Wahre kommt als unzulässig und gar Lüge zum Vorschein, wenn es nicht mit Verve vorgetragen wird. Wer nuschelt oder leise oder verzagt spricht, dem glaubt man die Wahrheit nicht, selbst wenn sie wahr ist.
33.
Wahrheit und Gefühl II. - Es wird nicht nur das Wahre zur Lüge, auch der Zweifel wird sich einstellen wie ein ungebetener Gast, wenn man ohne affektiven Nachdruck und Überzeugungskraft spricht. Man glaubt plötzlich selbst nicht mehr an das Gesagte, auch wenn es schon mal niedergeschrieben wurde. Das Gesagte vaporisiert das Geschriebene, wenn man es mündlich in eine Disputation einbringen und verteidigen muss.
34.
Gedankenlosigkeit. - Man kann in meinem Fall nicht von einer Arbeit an einem Buch sprechen, als vielmehr als einem Warten auf Gedanken. Ist der Stift bereit, sind die Gedanken nicht weit. Manchmal ist es auch andersherum. Sind sie nah, ist der Stift fern.
35.
Ausbleibende Anerkennung. - Wenn man sich aus dem Fenster gelehnt hat und eine steile These aufgestellt hat, sich spreizt in Erwartung eines anerkennenden Lobes und dieses ausbleibt, so fühlt derjenige sich gekränkt und fängt als Spielverderber an demjenigen, der die Anerkennung verweigert, rüpelhaft zu kommen. Der Diktator fängt in so einem Fall einen Krieg an. Der Normalo verprügelt seine Frau oder beleidigt sie, macht sie zur Sau.
36.
Was Geist ist. - Geist ist eine reflektierte Niederlage in Schrift gebracht.
37.