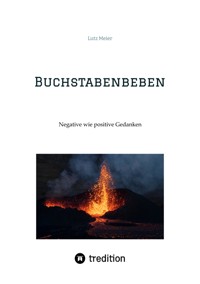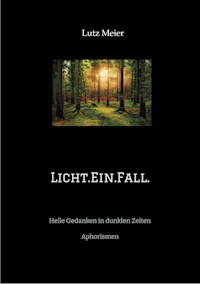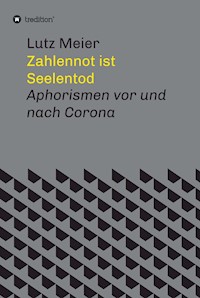
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Die Weltarmut und die Dekadenz der Gesellschaft, ihre mangelnde Diversität, ihr Schwelgen in Konsum, ihre Weltarmut, ihr Narzissmus, ihre Entwicklung hin zur Lebensstilgesellschaft, der tiefere Sinn von Mode, ihr Rechtspopulismus, all das treibt Lutz Meier um und veranlasst ihn täglich ganz altmodisch zu Stift und Papier zu greifen. Herausgekommen ist der 3. Aphorismenband des Autors. Philosophische Epigramme stehen neben längeren theoretischen Skizzen und beiläufigen Notaten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 85
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Lutz Meier
Weltenarmut
Aphorismen vor und nach Corona
© 2020 Lutz Meier
Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg
ISBN
Paperback:
978-3-347-09958-6
Hardcover:
978-3-347-09959-3
e-Book:
978-3-347-09960-9
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
1.
Der Teich lag in der Stille,
nur die Vögel waren noch wach.
Da kamen ein paar Jugendliche an die Oase.
Nur der Mensch macht Krach.
2.
Es gibt kaum etwas Langweiligeres, als jemandem beim Lesen zuzusehen. Leser sind die langweiligsten Menschen, die man sich denken kann und die Interessantesten, wenn sie mal nicht lesen.
3.
Reden tun die Leute nicht miteinand`, vermeiden das Gespräch.
Nur der Hund löst das Schweigeband.
4.
Im Frühling tummeln draußen sich die Menschen. Da sie mit sich nichts anfangen können, halten sie ein Eis in ihren Händen.
5.
Beobachtung beim Blätterfegen. Vier übriggebliebene Blätter verderben einem die Arbeit von einer Stunde. So ist es auch bei Lyrik und Kurzprosa oder überhaupt bei aller Mühe, die man sich macht.
6.
Durch das Geistige zerbrechen mehr Freundschaften, als durch es geschmiedet werden.
7.
Je genauer ein Mensch denkt, desto unwohler fühlt er sich in einer Fremdsprache. Lieber gar nichts denken als alles falsch.
8.
Und: Je genauer ein Mensch denkt, desto weniger sprachlich gebunden und verziert ist sein Denken.
9.
Wir können beim Denken einen Gartenschlauch in eine bestimmte Richtung halten. Ob dann auch das Wasser der Kreativität läuft, liegt nicht in unserer Reichweite.
10.
Schreiben ist eine rückwärtige Bestätigung von Arroganz.
11.
Ein nicht unbeträchtlicher Teil der alltäglichen Konflikte geht aufs Konto des Aufeinandertreffens des Widerspruchs von Vita activa und Vita contemplativa zurück. Der Geistesarbeiter trifft auf den Macher, der Flowmensch auf den Willensmensch. Ersterer neigt zur Ruhe, während Letzterer auch, wenn er kurz Ruhe hält, schon die nächste Tat ersinnt und andere mit ins Boot nimmt.
12.
Das eigentlich Triviale an der Literatur ist nicht nur eine eventuell banale Aussage, sondern die Literatur ist trivial, die nur auf sich selbst verweist, weswegen Hofmannsthal bei weniger phantasiebegabten Duchschnittsprofessoren so beliebt ist.
13
Mode kommt, Mode geht.
Was bleibt, im Buche steht.
14.
Manche Leute sortieren ihre Gedanken, indem sie sie bei anderen in Unordnung bringen.
15.
Ich muss es nehmen, wie es kommt, wie ein Löwe, dem man in seinem Käfig ein Stück Fleisch zuwirft; so schwer und so einfach komme ich an meine Beute heran.
16.
Scham und Stolz sind weitere „Existenzialien“ des Nationalismus, die rudimentär im Sport fortleben.
17.
Wider eine Stigmatisierung der Schizophrenie. Jeder durchlebt nachts seine ganz private Psychose. Wenn die Menschen tagsüber nur halb so viel Phantasie hätten wie im Schlaf, wäre die Welt eine bessere.
18.
„Normale“, also gesunde Menschen müssen sprechen, um sich ihrer Intelligenz zu vergewissern. Bei mir sackt das zu Sagende im Gespräch zusammen wie Spaghetti im kochenden Wasser.
19.
Nietzsche war ein verrückt gewordener Altphilologe. Ein revolutionärer Spießbürger also, der zum Walzer tanzte, während er Gift und Galle gegen Wagner und auch seinen eigenen Wagnerianismus spie.
20.
Wie schön ist es und mit welchem Schwung werden wir erfüllt, wenn wir ein kleines Zeitfenster für eine geistige Aufgabe haben. Knappheit setzt kreativen Atem frei.
21.
In der Fußgängerzone: Die Einzigen, die sich hier Konsum verdienten, sind die Straßenmusiker und die Arbeiter hinter dem Bauzaun, wo quasi Arbeit aufscheint wie in einem Zoogehege.
22.
Die Zeit ist wie ein Anzug von der Stange: Man zieht ihn sich jeden Morgen an, obwohl er nicht richtig passt.
23.
Wir berauschen uns am Möglichen, das für uns verheißungsvoll wie ein Weihnachtsglöckchen erklingt. Das Wirkliche hingegen lässt uns kalt. Obwohl es den größten Teil unseres Lebens auszumachen pflegt.
24.
Wir erreichen immer wieder den Beckenrand des Wochenendes, beim ewigen Hin-und-her-Schwimmen der Wochen und Jahre. Erleichtert steigen wir aus dem Becken und verlassen das Bad.
25.
Nietzsche, stellvertretend für die Geisteswelt des 19. Jahrhunderts, fand die Musik nur als so befreiend wichtig, da sie selten, also nicht allgegenwärtig verfügbar und nicht ohne weiteres „technisch reproduzierbar“ (Walter Benjamin) war. Heute gilt genau das Gegenteil.
26.
Das Schicksal wirft uns blinden Hühnern die Möglichkeiten hin. Wir bräuchten sie nur aufzupicken. Zumeist geht der Schnabel aber daran vorbei.
27.
Im Alter wird man langsam unsichtbar, während die erotische Blickerwartung anhält, ehe man zu einer grauen Maus mutiert und von der Erwartung nur noch Gott Eros übrigbleibt, während man zunehmend den religiösen Gott anbetet.
28.
Was wir an Gedanken zu viel haben, wird uns an der Kasse des Alltagsgesprächs wieder abgezogen.
29.
Jedes Gespräch als Versuch einer seelischen Annäherung hat die Tendenz zu verkümmern, läuft am Ende rasend schnell auf sein Ende hinaus. Ein sozialer Kontakt dauert nur so lange wie der Gesprächsstoff, den wir mobilisieren können. Der Witz öffnet und schließt das Gespräch.
30.
Das Handy hat das Nützliche abgestreift wie eine Schlange die alte Haut. Es dient heute vorwiegend der Unterhaltung im zweiten Sinne. Früher haben die Menschen in der Lebenswelt miteinander gesprochen. Heute haben sie dafür „keine Zeit, keine Zeit“ mehr. Das Handy ist ein uns an den Alltag kettendes Vehikel der vorwiegend stummen Kommunikation geworden. Jede freie Sekunde wird so zur Unterhaltung im Sinne von Entertainment.
31.
Früher ordnete man, wenn ein kluger Mensch ohne Grund plötzlich verblödet war, ihn der Dementia preacox (Eugen Bleuler) zu. Heute braucht man nur den Fernseher einschalten, um festzustellen: Die Verblödung ist der Normalfall geworden. Die Intelligenz bildet heute die Ausnahme, bei gleichbleibender genetischen Disposition.
Dummheit wurde zur Leitkultur.
32.
Wir machen uns über das Abweichende lustig, um uns zu vergewissern, dass wir nicht zur Gruppe der psychisch Kranken, Obdachlosen oder sonstigen Außenseitern gehören. Wer lacht, macht den Schritt ins Licht und spricht: „So einer bin ich nicht!“
33.
Bildung ist der Fallschirm des Daseins im Sturzflug des Lebens.
34.
Wer nicht mitmacht beim Flirten und sich nicht vermehrt, hat Zeit fürs Schreiben, ob er`s kann oder nicht.
Die Hauptsache ist:
Man lebt nach innen gekehrt.
35.
Nur das misslingende Leben kann poetisch erklingen.
36.
Gott zu denken und über ein neues gesellschaftliches Zusammenleben sind wohl die vordringlichsten Denkaufgaben, die einem Philosophen heute gestellt werden sollten.
37.
Die Fülle der Einsamkeit findet sein Ende zumeist in der Verarmung des folgenden Zwiegesprächs.
38.
Die Sinnlosigkeit des Daseins zu erfahren macht uns unbewusst zu garstigen Menschen.
39.
Aphoristik ist die Grundlagenforschung des Daseins.
40.
Landluft stinkt, Stadtluft macht frei. Spätestens seit Corona bricht diese Weisheit entzwei.
41.
Mal sehen, wie lange die Boulekugel rollt. Irgendwann stößt sie an, rollt weiter und bleibt dann unweigerlich stehen. Es ändert sich nichts mehr daran. Äußeres Kennzeichen: Man macht das Modetheater nicht mehr mit. Trägt immer noch Koteletten wie in den 90er Jahren.
42.
Edel ist der Mensch nur in Gefahr,
in der bekanntlich „das Rettende“ naht.
43.
Mit dem Lachen will so mancher Dummheit zerstreuen und erreicht nicht selten genau das Gegenteil davon. Siehe: Boris Becker.
44.
Die Jugend lacht, o Graus, Erwachsene aus. Alleine unterwegs sind die Erwachsenen für sie ein Augenschmaus. Wenn sie in der Gruppe sind, sie nicht für Moral und Dezenz zu haben sind. O Ross, o Ross, reite geschwind, halt mich fern von diesen Menschenkind'.
45.
Die Jugend lacht in einer Mischung aus Übermut, Überlegenheitsgefühl und Entsetzen, vollends im triumphalen Bewusstsein, dem Tode nicht nahe zu sein und schon deshalb hämisch gegen alles, was älter ist als sie. Das Hämische im jugendlichen Lachen hat zugenommen.
46.
Das Lachen der alten Menschen entschlägt sich hingegen jeglicher Häme. Es ist zumeist ein gütiges, dankbares und sentimentales Lachen, das manchmal in ein Lachen über das Lachen und in Tränen übergeht.
47.
Die Mode hat, mehr als in früheren Zeiten, keine Diversität mehr. Wer nicht zum alten Eisen gehören will, gehört für alle Modeträger sichtbar, entgegen seines Willens, gerade dann erst recht zum alten Eisen. Plötzlich schlägt der Regenschirm der Mode um und alle Hipster tragen die Haare möglichst wuschelig lang nach vorne, nachdem zuvor jahrelang der Undercut und „threatend“ und Haartollen vorgeherrscht haben. Brechen magere Zeiten für die Barbershops an? Auch hier können wir Scheinindividualität diagnostizieren: Mit dem Gefühl, anders oder divers zu sein, geht man zum Barbershop. Je mehr es aber tun, desto gleichförmiger ist die Erscheinung, die Modeerscheinung.
48.
Wenn wir so viel in die Frage, wie ein gesellschaftliches Miteinander funktionieren soll, investieren würden wie in Maschinen und Technik, wäre die Gesellschaft heute eine bessere.
49.
Kommunikation hat wenig mit Denken zu tun. Ein anderer bringt alles solange in Unordnung, bis man es selbst nicht mehr versteht (Heidegger nannte es „Zweideutigkeit“). Man trifft selten auf einen Gesprächspartner, der sich eines Werturteils enthält. Immer ist hier in die Farbe des Objekts die Farbe des Betrachters gemengt. Wer rot sieht, dessen Urteil färbt sich ebenfalls rot. Die von Husserl und Max Weber geforderte Enthaltung bzw. Objektivität kann man nur selten bei einem Gesprächspartner antreffen.
50.
In Situationen des Ankommens und Gehens betreten wir die soziale Bühne, auf der das Spiel der nach außen gekehrten Gleichgültigkeit und der nach innen gekehrten Peinlichkeit aufgeführt wird.
51.
Viele Nichtschreibende sind oftmals zu klug (und gesund) und haben schließlich zu wenig Muße zum Schreiben. Heute gehört man als Schreibender schon fast zur dilettierenden Mehrheit.
52.
Die Blicke auf mich gerichtet, setzt das Denken aus. Stellt es sich wieder ein, bin ich längst schon wieder allein.
53.
Eine Lebensaufgabe gefunden zu haben – darum wird man durchaus beneidet. Der Neider würde seinen Neid aber niemals zugeben. Wenn man keine Lebensaufgabe gefunden hat als die, sich selbst zu erhalten, erklärt man dann den Lebensvollzug kurzerhand zur Lebensaufgabe, die aber in Zeiten, in denen dem postindustriellen Menschen die Arbeit ausgeht, nicht mehr trägt, wodurch Langeweile und ein Sinndefizit droht. Das kann wiederum den in Arbeit versinkenden Schriftsteller nicht anfechten, wofür er wiederum unterschwellig beneidet wird.
54.