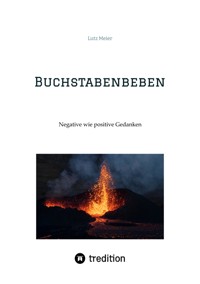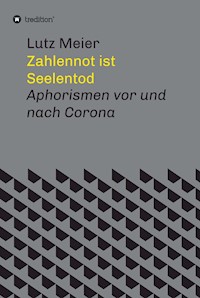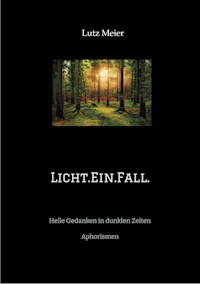
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es geht um pointierte philosophische Aussagen zum Weltgeschehen, die um die Themen Langeweile, das Böse, Sprache , Technik, Genialität, Gedächtnis, Zivilisation , Medien, Coolness, Geschichtsphilosophie, Leib, Bildung , den Zerfall des Sozialen, Dummheit, Politik, Trump, Putin, das Geschlechterverhältnis usw. kreisen. Die Haltung ist kulturkritisch, aber dennoch links und das Buch sieht sich in der Tradition Lichtenbergs , Nietzsches, Carl Kraus, Giacomo Leopardis, Adornos ist aber nicht allein pessimistisch , sondern lässt einem Licht am Ende des Tunnels erblicken, soll neben der kritischen Bestandsaufnahme ein Mutmacher für ein utopisches Denken sein, das uns heute fehlt. Das Buch enthält sprachspielerische Elemente und ähnlich wie Nietzsches Aphorismen ergänzen gedichtete Verse das "Programm". Am ehesten trifft die Formel "Linker Nietzsche" zu.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Licht.Ein.Fall.
Helle Gedanken in dunklen Zeiten Aphorismen
LUTZ MEIER
© 2022 Lutz Meier
Lektorat: Barbara Jochum
Buchsatz von tredition, erstellt mit dem tredition Designer
ISBN Softcover: 978-3-347-59950-5
ISBN Hardcover: 978-3-347-59951-2
ISBN E-Book: 978-3-347-59952-9
Druck und Distribution im Auftrag der Autorin:
tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Germany
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist die Autorin verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne ihre Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag der Autorin, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", Halenreie 40-44, 22359 Hamburg, Deutschland.
1.
Geburt eines tanzenden Sterns.- Manchmal will ein Wort nicht ans Licht kommen. Man würgt es lautlich heraus. Aus der Lautfolge wird das Wort und erst ganz zum Schluss, steht es da auf wackeligen Beinen und muss nicht selten erst das Valet eines anderen bekommen, damit es eine feste Form annimmt.
2.
Danken.- Wer sich drei Mal für eine Sache bedankt verrät sich: Für ihn oder sie ist das Gute nicht selbstverständlich, da die Welt böse eingerichtet scheint.
3.
Wer im trockenen…- Wer im Trockenen sitzt, der kann leicht seine Hände in Unschuld waschen.
4.
Ohne Widerstand.- Bricht ein Widerstand weg, so bricht auch der Pfeiler weg, der das Haus getragen hat.
5.
Kategorischer Imperativ.- Der kategorische Imperativ gehört „noch“ zur überwiegenden Norm im Umgang mit anderen Menschen. Die Ausnahme war, vor und während der Weltkriege, dessen Nichtvorhandensein. Auch in heutigen Kriegszeiten scheint er gefährdet zu sein wie die Wahrheit selbst.
6.
Ärger.- Ärger kann man nicht erlernen oder sich aneignen. Dennoch gehört er zu den unverzichtbarsten Affekten in der Kindererziehung. Der Wille tobt sich aus, oder eben nicht. Jegliche Form von Aggression ist nicht erwerbbar. Man kann sich nicht ärgern, wenn man diesen nicht verspürt, es sei denn man ist ein guter Schauspieler. Deswegen erziehen wir unsere Kinder nicht (im Sinne von unverzichtbarer Willensbekundung) mehr. Der Mensch ist zu zahm geworden, um Kinder aufzuziehen.
7.
Die Großstadt als ein Ort der Disziplin.- Die Stadt ist ein Ort, in der die foucaultsche Disziplinargesellschaft noch eher waltet, als auf dem Lande. Freilich scheint prima vista das Gegenteil der Fall zu sein: Das Individuum ist in der Stadt seinen Entfaltungsmöglichkeiten näher. Hier wird man zudem nicht unentwegt von dem „Man“(Heidegger) überwacht. Die Kehrseite der Individualität ist aber die Einsamkeit. Einsamkeit führt zu Rückzug und Distanz, dass man nicht auf die Leute zugeht und dass man sich kontaktlos nach Hause schleicht. Zudem hat Corona gezeigt, dass in der Stadt eine Panik gravierender ausgeprägt ist, man also zu noch größerer Einsamkeit und Distanzverhalten „gezwungen“ ist. Schon vor Corona und schon bei Georg Simmel taucht diese Distanziertheit als „Blasiertheit“ des Großstadtmenschen auf, zu der sich eine zwischengeschlechtlich-erotische Distanz gesellt. Diese Distanzformen lassen sich ebenfalls mit Foucault interpretieren. Unter dem Einfluss der Corona-Epidemie von 2020 bis heute, hat sich die Stadt somit als Ort der gesteigerten Disziplin erwiesen. Man ist zu noch größeren Disziplinzwang genötigt, die Coronaregeln einzuhalten. Die Corona-Regeln einzuhalten ist man, da die Personendichte hier größer ist, zu noch größerem Disziplinzwang genötigt. Auch der Modedruck ist in der Stadt (also die Erwartung sich modisch zu kleiden) größer und erfordert mehr Zwänge und Disziplin (Konformität), um ja nicht aufzufallen; paradoxerweise bedarf es der Sichtbarkeit, um unsichtbar zu bleiben Es herrschte eine allgemeine Gereiztheit und im Gegensatz zum verträumten Heimatort, war ich über die Konsequenz der Umsetzung der (mehr oder weniger) sinnvollen Coronaregeln überrascht (es wurde tatsächlich, wie in den USA in Restaurants üblich, ein Tisch zugewiesen). Es herrschte bei meinem einzigen Besuch in Bielefeld seit der Pandemie eine heitere Endzeitstimmung. Die Clubs und Diskotheken waren immer noch geschlossen und hatten vor der 2. Welle ab Oktober erst gar nicht wieder öffnen dürfen. Die konvulsierende, erotische Energie, die nicht absorbiert wurde, ergoss sich also in die Fußgängerzone. Wie ein Bauernlümmel torkelte ich von Eindruck zu Eindruck, stieg in die Bahn und mühte mich, trotz Maske, den Inhalt eines Buches zu entziffern.
8.
Nation und Fußball.- Warum sollen andere Länder nicht auch gute Fußballer haben? Warum freut man sich nur über Siege der eigenen Nation und erfreut sich nicht etwa an schönem und vor allen Dingen gutem Fußball? Warum ist die Nation oder Region als Identifikationszentrum so wichtig? Es kann uns doch egal sein, wer von den frisch frisierten Fußballhanseln nun gewinnt! Aber zu solcher Objektivität ist der Fußballgucker nicht in der Lage. Das Fan-Verhältnis ist wie das Verhältnis von Eltern zu ihren Kindern: man ist stolz auf sie, auch, wenn sie etwas gewonnen oder enttäuscht-mitleidend, wenn sie in Mathe eine Fünf geschrieben haben. Man bleibt ihnen ein Leben lang treu ergeben, liebt sie in guten und in schlechten Zeiten und unterstützt sie pekuniär, so gut es geht. Kinder hat man aber, in der Regel, selber fabriziert. Beim Fußball ist es die Zugehörigkeit zur Großgruppe (Stadt, Land), die die Nibelungentreue schmiedet.
9.
Moralische Nachträglichkeit.- Auch Moralität, also moralisches Handeln, konstituiert sich erst dann und wird aus dem Dornröschenschlaf geweckt, wenn wir durch eine “Störung“, im Sinne Heideggers, aus unserer Passivität herausgerissen werden. Die meiste Zeit handeln wir in einer Dauerschleife pragmatisch „gut“. Wir tun nichts Schlechtes, aber auch nicht unbedingt bewusst etwas Gutes. Wir umgehen das Bösesein, so wie das Herz und die Lunge für Sauerstoff sorgen: unmerklich und als ein kontinuierlicher Prozess. Erst sobald diese Homöostase gestört wird, emergiert das Böse oder das Gute kommt disruptiv als Differenzphänomen zum Vorschein. Gleiches gilt für moralische Urteile. Zunächst und zumeist urteilen wir weder „gut“ noch „schlecht“, es sei denn, wir werden dazu gezwungen „böse“ oder bewusst „gut“ zu urteilen. Ansonsten gehen wir in der Regel im Alltag unseren Geschäften nach, die ohne Intentionen moralisch auf neutralen Boden stehen. Moralisch oder amoralisch wird unser Tun erst dann, wenn wir uns bewusst dazu entscheiden (müssen), also eine ethische Entscheidung ansteht. Das Moralische kann ganz plötzlich und unvorbereitet als Forderung an und in uns auftauchen. Erst dann kann man von einer bösen oder guten Tat sprechen, wobei man, wie erwähnt, konzedieren muss, dass die moralische Latenz eher unagressiv und „im Grunde gut“ konfiguriert ist. Man ist tendenziell im Automatikbetrieb des Alltags also eher gut als böse eingestellt, weil es mehr Vorteile einbringt und es vielfach einfach klüger ist, sich moralisch und sittlich gut zu verhalten.
10.
Rechts und Links. - Rechtssein heißt Wahrheit zu verleugnen, eine Snobhaltung zu pflegen und auf ein rückwärtsgewandtes Weltbild zurückzugreifen, um seine Superiorität (gegenüber dem Schlechtverdiener und der Frau) zu begründen. Zum Rechtssein gehört eine Emotionspolitik oder Symbolpolitik, zumeist reduziert sich das Programm auf eine Erhaltung des Status quo im Gewand einer wirtschaftsfreundlicher Agenda. Das heißt, solange die Wirtschaft brummt, sind alle gesund und das scheint bei näherem Licht das Hauptargument des CDU/CSU/AFD/FDP-Clans zu sein. Die Unionsparteien und die FDP haben es geschafft, dass sie mit einer florierenden Wirtschaft assoziiert und die linken Parteien als wirtschaftsfeindlich stigmatisiert wurden. Zudem soll man auf den ganzen Wirtschafts- und Wohlstandszug aufspringen, weil man stolz auf Deutschland zu sein beansprucht. So fischt man im trüben Wasser des faschistoiden Gedankengutes. Überhaupt machen rechte Parteien ein Angebot auch für eher schlichte Gemüter, wenngleich es auch einen intellektuellen kulturkonservativen Zweig gibt, der sich aus der Faszination des Bösen speist. Spiegelbildlich verkehrt zum Konservatismus zeigt sich das Bild des Linksseins als wahrheitsliebend (und wohltuend in der Pandemie der Wissenschaft aufgeschlossen), eine Antiarschlochhaltung pflegend (gegenüber Machtmenschen und Regierenden nach Gutsherrenart), seine Solidarität mit dem Inferioren und dass man konkrete politische Ziele verfolgt und nicht nur emotional, quasi durchregiert und nicht zur Symbolpolitik neigt. Die Linke ist dem Wirtschaftssystem des Kapitalismus eher zweifelnd und skeptisch gegenüber eingestellt und entsprechend, da man den Kapitalismus nicht mag, wird ihm so jegliche Wirtschaftskompetenz abgesprochen. Entsprechend wird der Linke auch nicht mit
Wohlstand und brummender Wirtschaft assoziiert. „Der“ Linke hat es nicht geschafft, mit diesem Zustand der Saturiertheit in Zusammenhang gebracht zu werden. Eher tendiert die Intelligenzia zum Linkssein, da dieses enger an so etwas wie Vernunft im Sinne von Moral gekoppelt ist. Freilich kann, und das ist der Verdacht des rechtskonservativen Intellektuellen, Linkssein auch mit Dummheit korrelieren, im Sinne von Naivität und „Herdentiermoral“, wie sie Nietzsche insinuierte, wobei da mehr Arroganz und Ressentiment mit im Spiel ist, als Argumente. Zusammenfassend kann man festhalten: Der Linke ist ein Sympathieträger aus moralischen Erwägungen heraus, der Konservative (und schlimmer) ist hingegen ein charakterlich zweifelhafter und moralisch unvertretbarer Zeitgenosse und (mir) eher unsympathisch. Pragmatisch hat er mehr Realismus im Gepäck, weswegen man ihn wählt, wenn es einem finanziell gutgeht, nicht weil der Unionspolitiker ein so großes Herz und einen unbestechlichen Charakter hätte. Der Mensch ist schlecht, so die rechte Prämisse, also müssen wir mit dem Schlechtem leben, so gut es geht und nicht einen gesellschaftlichen Entwurf einbringen, den die Linke so sehr vermisst und ohne den sie immer dastehen wird, wie ein nachtragender Spielverderber.
11.
Bachelor als Trost.- Der Bachelor ist der Trost der Schwergeliebten als Norm.
12.
Ex post.- Erst töten die Menschen Gott und dann beklagen sie sich, dass er tot ist. Gleiches gilt für die Klimakatastrophe, die manchmal als unfassbare Wetterkapriole belustigt zur Kenntnis genommen wird.
13.
Hochzeitskleider.- Hochzeitskleider sind offenbar dazu da, Problemzonen der Frau zu kaschieren und die Reize (üppiger Oberbau) zu betonen und das Nichtreizvolle zu überdecken (dünne oder dicke Beine).
14.
Mode und Faschismus.- So wie besonders groteske Moden (z.B. die Schlaghose in den 70er Jahren des 20.Jahrhunderts), die längst im Kuriositätenkabinett aufbewahrt wurden, wieder Mode werden (und somit nach Marx zur Komödie werden), so wird der Faschismus in der Gegenwart wieder zeitgemäß. Vor der AFD hätte man nie gedacht, dass solche schrillen und rechtsradikalen Töne wieder im Parlament möglich seien. Man hat im Zuge eines Rechtsruckes den Rubikon überschritten, ohne von den Feinden niedergemetzelt zu werden und so ist die AFD immer weiter nach rechts gerückt. Man ist durch eine verbotene Tür gegangen und siehe da, es ist nichts passiert. So wurde der Tabubruch, mit rechtsradikalen Ansichten durch die verbotene Tür zu schreiten, zum Normalfall, zur Mode.
15.
Mode und das Interregnum der Orientierungslosigkeit.- Phasen der Mode folgen solchen der Orientierungslosigkeit. Das kann sehr schön an den Frisuren von Fußballprofis verdeutlicht werden. Mit der Barbershop-Frisur hatte man ein modisches Paradigma und einen Haltepunkt gefunden Nach diesem Megatrend herrschte eine Zeit der Orientierungslosigkeit, aus der heraus man einen kleinen Paradigmenwechsel zu initiieren trachtete: New Cäsar, Buzzcut, Zopffrisur, die aber alle nicht zu einem neuen Modeshift taugten. Der nächste Megatrend scheint der Wuschelig-nach-vorne-Look zu sein, der aber nur die schluffige Schülerschaft vollends erreicht. Ähnlich wie in der Wissenschaft folgt nach einem Trend kreative Orientierungslosigkeit, in der die Gleichzeitigkeit von Modetrends zu konstatieren sind, bis sich ein neues, tragendes Paradigma auftut.
16.
Mode und Hässlichkeit.- Lieber mag man es hässlich, als unmodisch zu sein.
17.
Fortschrittsglaube und Sinnvakuum.- Unsere Eltern (der Generation Golf) haben noch den Schreck des Krieges in ihren Gliedern. Von Angst und Überlebenswille getrieben, haben sie sich ins Leben gestürzt, bzw. stürzen müssen. So sind sie häufig gläubige Technokraten und/oder Fabrikarbeiter geworden bei einer Unschuld der Liebe, die vor allen Dingen anschmachtend daherkam. Der Glaube an große Sinnsysteme, wie sie auch die Religion darstellt, war im 2. Weltkrieg erschüttert worden und so ertränkte man Sinnfragen in Arbeit und Aufbau und der Steigerung des Bruttosozialproduktes. Erst bei Arbeitslosigkeit oder im Ruhestand brach der Arbeitssinn zusammen und erwies sich als Chimäre und Ersatzform des Sinnhaften. Jetzt brach auch, nachdem der Arbeitssinn wegfallen war, die frühe, nie verarbeitete Kindheitsangst wieder auf. Schwere seelische Krankheiten waren vorprogrammiert. Diese
Generation war die erste, die vollends ohne Gott auskommen „musste“. Außerdem hatte sich jegliche Ideologie als irrig erwiesen; jeder Glaube an Gott wurde durch Kriegsgreuel- und NS-Verbrechen erschüttert. Jede Ideologie war verdächtig. Der Gott, dem man noch über den Weg traute, war der Gott Hedon, der Luxus und Freizeit-und Sparkassengott. Man hatte keinen Gott außer dem Goldenen Kalb, das man umtanzte.
18.
Automatikbetrieb des Gutseins.- Man verbringt wohl die meiste Zeit des wachen Lebens in einer Art Automatikbetrieb des Gutseins hatten wir festgestellt. Nur in Ausnahmefällen schaltet man auf das Böse, das bei psychisch Kranken verstetigt sein kann, weswegen man nur die Aggrovariante der Schizophrenie „kennt“, da nur sie offensichtlich ist. Das Böse tritt aber bei einer Störung des Gutseins als verloren gegangener Gleichgewichtszustand in der Lebenswelt ein. Wir gewärtigen ein aggressives Gebaren einer Jugendlichengruppe und sind sogleich grimmig und verstimmt, so dass das Böse als Abwehrreflex in uns aufsteigt. Wir werden herumkommandiert und erfahren dabei keine Umsicht und Wertschätzung und schon ballt sich in uns eine Faust. Werden wir in Ruhe gelassen und können kommod unseren Gedanken nachgehen, so sind wir die ausgeglichensten Menschen. Wehe aber wir werden durch die laute Musik des Nachbarn gestört, so werden wir sogleich unserer Bosheit gewahr, die in uns aufsteigt wie das HB-Männchen auf die Leiter.
19.
Kategorischer Imperativ und NS-Zeit.- Man soll nach Kants berühmter Formel die Maxime seines Handelns zu einer allgemeinen Gesetzmäßigkeit machen. Was ist aber, wenn jemand das Böse, wie in der NS-Zeit geschehen, zu einer allgemeinen Maxime machen will? Man kann das Böse wollen, was den kategorischen Imperativ zu einem zahnlosen Tiger macht.
20.
Möglichkeit und Wirklichkeit.- Es macht uns eine diebische Freude, angesichts einer langweiligen Wirklichkeit, etwas Sensationelles zu beobachten und möglichst ungestört von der Wirklichkeit zu verlachen. So geschehen auf dem Spaziergang mit meiner geheingeschränkten Mutter in unserer Siedlung. Zwei kichernde Teenager kommen uns entgegen und sehen einen hochgewachsenen, gutaussehenden Mann mit einer Frau, die seine Mutter sein kann, eingehakt, so löst dieses Bild ein unvermeidliches, nur unzureichend verdecktes, gezischeltes „Voll-schwul-Gelächter“ aus. Das nur Angenommene hat dabei den Charakter einer unumstößlichen Wahrheit, von der die beiden Backfische, einmal ein Lachurteil gefällt, nicht mehr abrücken wollen, da sie sich so schön in den warmen Schauer des Glückes eingesponnen haben. Man kann sich in eine Annahme so hineinsteigern, dass sie (scheinbar) wahr wird. Es wäre so schön, also ist es. Ich nehme den nur notdürftig verborgenen Spott und die Häme mit steigendem Überdruss und genervt wahr. Die Fantasie ist in den Backfischen ausgebrochen wie ein nichtberittenes Jungpferd. „Nein, ich bin nicht schwul!“ möchte ich den Mädchen zurufen, die nun hinter uns aus der gesteigerten Spottlaune kaum noch herauszufinden vermögen. Aber, es wäre verlorene Liebesmüh. Die Mädchen glauben nur dem, was sie sehen. Selten ist eine Generation wie die YouTube-Jugendlichen derartig frappierend und aus Lachlust an der Wirklichkeit vorbeigeschrappt.
21.
Der Leib als Resonanzraum.- Der Leib fungiert auch als Resonanzraum des Denkens und Wiedererinnerns des Gedachten. Wir denken und wiedererinnern mit dem Leib qua leiblichen Hineinspürens, innen wie außen. Wir nehmen das Störende in der Atmosphäre wahr, sowie an anderen Personen wahr. So kann es bei Menschen mit einem sensiblen Resonanzraum dazu kommen, dass man „Falsches“ oder „Inkohärentes“ als seelischen Schmerz wahrnimmt. Wir bewerten die Welt da draußen leibhaft, erst darauf basiert unser „denken“. Wir machen beispielsweise eine Beobachtung in-der-Welt, die leibhaft-emotional gespeichert wird und an diese leibhaft markierte Situation erinnern wir uns, in uns hineinspürend, wenn wir denken, so dass sie dann wiedererinnernd vor unser geistiges Auge tritt.
22.
Mitleid.- Wer selbst viel leidet, kann auch umso leichter Mitleid empfinden. Der leidenschaftslose Philister ist emotional-moralisch eingeschränkt und/oder eindimensional im Denken. Er spürt und sieht beispielsweise nicht, wenn der Hund leidet und endlich Gassi gehen will. Wer sich noch nie existenziell gelangweilt hat, kann sich gar nicht vorstellen, wie sehr eine Kreatur an einem Zuwenig an Reizen zu leiden vermag. Ich verbrachte einige Jahre in geistiger Umnachtung. Ich weiß seitdem, dass die schlimmste Geißel bei körperlicher Unversehrtheit, die Langeweile ist, die mich heimsuchte, da ich nicht mehr zu denken in der Lage war, auch nicht einfache Gedanken. Gar nichts mehr. Totale Funkstille. Geistige Windstille. Wie sehr haben wir Gedanken auch deshalb, um das Gefühl des Langweiligen nicht verspüren müssen!
23.
Zeit gerinnt.- Zeit gerinnt, Zeit gewinnt. Nur beim Lesen ist sie nicht Dein Feind. Manchen nichtlesenden Menschen möchte man, angesichts des heillosen Aktionismus, der daraus erwächst, zurufen: „Such Dir eine geistige Aufgabe und lass Deine Umwelt in Ruhe! Lies ein Buch!“ Und beschäftige Deine Menschen nicht mit alltäglichen Forderungen und Krimskrams. Darin liegt der ethische Mehrwert des Lesens und nicht so sehr in seinen Inhalten. Hauptsache lesen, egal, was!
24.
Auf den Hund gekommen.- Ein Hund müsste man sein. Sorglos in den Tag hineinleben, zur gewohnten Zeit eine Mahlzeit, viel Liebe, Hinwendung und ja: Zärtlichkeit, einer Aufgabe, nämlich der Revierverteidigung nachzugehen, Spuren zu suchen und setzen und so mit anderen Hunden zu kommunizieren und sich fetzen. Ein sanfter Tod wartet auf sie, in einem zumeist kurz-glücklichen Hundeleben. Der Nachteil: Langeweile und ein Bewegungsapparat, der zumeist nicht ausgelastet wird. Manchmal haben die Hunde auch zu wenig Sozialkontakte, wenn sie einzeln gehalten werden. Hunde sind die wahren Stoiker. Wenn ein Leerlauf droht, schalten sie ganz pragmatisch auf Kontemplationsbetrieb um (was dem Lesen beim Menschen entspricht). Besonders die intelligenten Hunde, sind damit aber nicht zufrieden, sondern bedürfen der besonderen Beschäftigung mit einem Spiel oder mehrfaches Gassigehen. Hunde sind die wahren Buddhisten. Sie meditieren den größten Teil des Tages.
25.