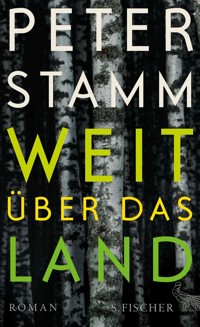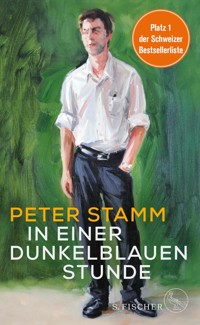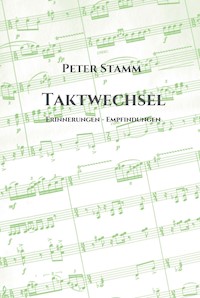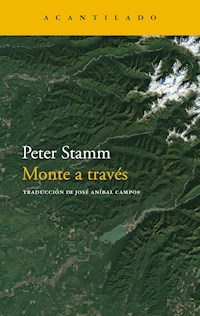8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
»Ein brillanter Erzähler.« Der Spiegel »Was das Scheitern anbelangt, das leise Scheitern im Alltag, dem kein dramatisches Leiden folgt, darin ist der 1963 geborene Schweizer Peter Stamm ein literarischer Meister. (...) Auf geradezu prekäre Weise sind die Erzählungen auch darin stimmig, dass sie die Verzagtheit zum natürlichen Lebenszustand der Menschen erklären.« Karl-Markus Gauss, Die Zeit Peter Stamm erzählt ungeheuer kunstvoll und scheinbar so einfach von Leben, die nicht gelebt, die aufgeschoben, erinnert und schließlich verpasst werden. In lakonischen Sätzen und unauffällig stimmungsvollen Szenen findet er – leicht lesbar, aber schwer verdaulich – die kaum spürbaren Eruptionen, die sich im Rückblick als Erdbeben erweisen. Die Einsamkeit im gemeinsamen Urlaub. Ein verlassenes Hotel in den Bergen. Ein Mädchen im Wald. Ein Pfarrer, der die Vögel füttert. Die erste Liebe mit Gewicht. Peter Stamm zeigt sich auch in »Seerücken« wieder als Meister der Kurzgeschichte.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 194
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Peter Stamm
Seerücken
Erzählungen
FISCHER E-Books
Inhalt
Sommergäste
Sie kommen allein?, fragte die Frau am Telefon noch einmal. Ihren Namen hatte ich nicht verstanden, ihren Akzent konnte ich nicht einordnen. Ja, sagte ich. Ich suche einen Ort, an dem ich in Ruhe arbeiten kann. Sie lachte etwas zu lang, dann fragte sie, was ich denn arbeiten würde. Ich schreibe, sagte ich. Was schreiben Sie? Eine Arbeit über Maxim Gorki. Ich bin Slawist. Ihre Neugier ärgerte mich. Ach?, sagte sie. Sie schien einen Moment lang zu zögern, als wäre sie nicht sicher, ob sie das Thema interessiere. Gut, sagte sie schließlich, kommen Sie. Sie kennen den Weg?
Ich hatte im Januar eine Tagung besucht, es ging um die Frauenfiguren in Gorkis Stücken. Mein Vortrag über die Sommergäste sollte in einem Sammelband erscheinen, aber im täglichen Unibetrieb war keine Zeit gewesen, es zu überarbeiten und fertigzustellen. Ich hatte mir die Woche vor Christi Himmelfahrt dafür freigehalten und einen Ort gesucht, an dem niemand und nichts mich erreichen oder ablenken konnte. Ein Kollege hatte mir das Kurhaus empfohlen. Er hatte als Kind viele Sommerferien dort verbracht. Irgendwann sei der Besitzer des Hauses in Konkurs gegangen, aber er habe gehört, das Hotel sei vor einigen Jahren wiedereröffnet worden. Wenn du einen Ort suchst, an dem nichts los ist, bist du da oben genau richtig. Als Kind habe ich es gehasst.
Die Busse zum Kurhaus fuhren nur im Sommer. Sie könne mich leider nicht abholen, hatte die Frau am Telefon gesagt, ohne einen Grund zu nennen, aber ich könne vom nächstgelegenen Dorf aus zu Fuß heraufkommen, der Marsch sei nicht lang, eine Stunde allerhöchstens.
Der Bus wand sich eine enge Straße hoch durch eine terrassierte Landschaft. Er war spärlich besetzt, und an der Endstation stiegen außer mir nur noch ein paar Schüler aus, die sich sofort zwischen den Häusern verloren. Ich hatte nur das Nötigste an Kleidern eingepackt, aber mit den vielen Büchern und dem Laptop war der Rucksack wohl an die zwanzig Kilo schwer. Was haben Sie denn dabei?, fragte der Busfahrer, der mir beim Ausladen half. Papier, sagte ich, und er musterte mich misstrauisch.
Vor der Post standen ein paar Wegweiser, die in unterschiedliche Richtungen zeigten. Ich folgte einem Sträßchen und später einem Pfad, der quer durch eine steile Wiese führte und dann in eine schmale, bewaldete Schlucht hinunter. Am Waldrand wuchsen Lärchen und vereinzelte Eschen, im Inneren Rottannen. Überall lagen umgestürzte Bäume, vertrocknete Tannengerippe, unter denen noch letzte Reste Schnee zu sehen waren. Der Boden war nass, und meine Füße sanken tief ein in der schwarzen Erde. Immer wieder verklebten mir unsichtbare Spinnweben Gesicht und Hände. Spuren von anderen Wanderern fand ich nicht, vermutlich war ich der Erste in diesem Jahr.
Nach einer Weile fiel mir auf, dass ich schon länger keine Wegmarke mehr gesehen hatte, kurz darauf verlor sich der Pfad zwischen den Bäumen. Ich hatte keine Lust umzukehren und ging den Abhang hinunter, der zunehmend steiler wurde. An manchen Stellen musste ich mich an Wurzeln oder Ästen festhalten, einmal glitt ich aus, rutschte ein paar Meter weit und zerriss mir die Hose. Das Rauschen des Baches unter mir wurde immer lauter, und als ich ihn schließlich erreichte, fand ich auch den Weg wieder. Es war ein reißender Bergbach mit grauem Wasser. Er floss in einem breiten Bett aus hellen Felsen und Geröll, das wie eine offene Wunde wirkte in der dunklen Waldlandschaft. Ich kam jetzt leichter voran und erreichte nach ungefähr einer halben Stunde einen kleinen Holzsteg. Die Pfeiler waren unterspült, und ein Baum, der mit dem Wurzelballen umgekippt war, lag quer über der Brücke. Er hatte das Geländer abgerissen, und einige der Bodenplanken waren unter seinem Gewicht zerborsten. Vorsichtig kletterte ich hinüber. Auf der anderen Seite der Schlucht stieg der Weg steil an, und ich schwitzte, obwohl es kühl war im Wald.
Ich brauchte fast zwei Stunden, bis ich durch die Bäume hindurch das Kurhaus auftauchen sah. Fünf Minuten später stand ich vor dem riesigen Jugendstilgebäude. Der Talgrund lag schon im Schatten, aber das Haus, das etwas erhöht stand, leuchtete weiß in der Abendsonne. Alle Fensterläden bis auf einen im Parterre waren geschlossen, kein Mensch war zu sehen, und nur das Rauschen des Baches war zu hören. Die Eingangstür stand offen, und ich trat ein. Im Foyer war es schummrig. Durch die farbigen Scheiben der inneren Tür fielen ein paar Sonnenstrahlen auf den abgetretenen Perserteppich, der auf dem Steinboden lag. Die Möbel waren mit weißen Tüchern zugedeckt.
Hallo, rief ich leise. Niemand meldete sich, und ich trat durch eine Schwingtür, über der in altertümlicher Schrift Speisesaal stand. Ich kam in einen großen Raum mit vielleicht dreißig Holztischen und umgedrehten Stühlen darauf. In der hintersten Ecke des Saals war ein Tisch im Licht. Dort saß eine junge Frau. Hallo, rief ich etwas lauter als vorher und ging durch den Raum auf sie zu. Noch bevor ich sie erreicht hatte, stand sie auf, kam mir mit ausgestreckter Hand entgegen und sagte, willkommen, ich bin Ana, wir haben telefoniert.
Sie musste ungefähr in meinem Alter sein. Sie trug einen schwarzen Rock und eine weiße Bluse wie eine Kellnerin. Sie hatte schwarzglänzendes, schulterlanges Haar. Ich fragte, ob das Hotel geschlossen sei. Jetzt nicht mehr, sagte sie und lächelte. Auf dem Tisch stand ein halbvoller Teller mit Ravioli. Einen Moment bitte, sagte die Frau. Sie setzte sich wieder hin und aß auf. Sie schlang das Essen hinunter, es schien sie nicht zu stören, dass ich ihr dabei zuschaute. Ich hatte seit dem Mittag nichts gegessen und bekam langsam Hunger, aber ich wollte erst mein Zimmer beziehen, duschen und mich umziehen. Ich setzte mich der Frau gegenüber, sie lud mich mit einer verspäteten Handbewegung dazu ein und sagte, erzählen Sie mir von Ihrer Arbeit. Ich erklärte ihr noch einmal, weshalb ich hier sei. Sie wischte sich den Mund mit der Serviette ab und fragte, weshalb interessiert Sie das? Ich zuckte mit den Schultern und sagte, ich sei zu der Tagung eingeladen worden. Gender Studies seien im Moment in Mode. Und warum immer die Frauen?, fragte sie. Ich weiß nicht, sagte ich, Männer sind weniger interessant. Mit einem Schluck Wein spülte sie den letzten Bissen hinunter. Ich zeige Ihnen jetzt das Zimmer.
Im Foyer trat sie hinter die Rezeption und kramte in den Schubladen des Möbels. Nach einer Weile schob sie einen Block über die Theke und bat mich, das Formular auszufüllen. Ich trug mich ein. Als ich zurückblättern und die letzten Einträge lesen wollte, nahm sie mir den Block aus der Hand und verstaute ihn. Würde es Ihnen etwas ausmachen, gleich zu bezahlen? Ich sagte, das sei in Ordnung. Sieben Tage Vollpension, rechnete sie, das macht vierhundertzwanzig Franken inklusive Kurtaxe. Sie steckte die Geldscheine ein und sagte, das Wechselgeld gebe sie mir später. Und eine Rechnung, bat ich. Sie nickte, kam hinter der Rezeption hervor und lief mit schnellen Schritten die breite Steintreppe hoch. Erst jetzt fiel mir auf, dass sie barfuß war. Ich nahm meinen Rucksack und folgte ihr.
Sie wartete im ersten Stock auf mich am Anfang eines langen, düsteren Flurs. Haben Sie einen besonderen Wunsch?, fragte sie. Als ich verneinte, öffnete sie die erste Tür und sagte, dann nehmen Sie doch gleich dieses hier. Ich trat ins Zimmer, das ziemlich klein war und spärlich möbliert, außer einem unbezogenen Bett, einem Tisch und einem Stuhl gab es eine Kommode, auf der ein altes Porzellanbecken stand und darin ein mit Wasser gefüllter Krug. Die Wände waren weiß gekalkt und leer bis auf ein Kruzifix über dem Bett. Ich ging zur Glastür, die auf einen winzigen Balkon führte. Den sollten Sie besser nicht benutzen, sagte Ana vom Flur aus. Ich fragte, wo sie schlafe. Weshalb wollen Sie das wissen? Einfach so. Sie schaute mich ärgerlich an und sagte, nur weil sie allein hier sei, heiße das nicht, ich könne mir Freiheiten erlauben. Ich hatte an nichts Böses gedacht und schaute sie überrascht an. Ich fragte, wann ich essen könne. Sie machte ein Gesicht, als denke sie angestrengt nach, dann sagte sie, ich solle herunterkommen, wenn ich mich frischgemacht hätte. Dann verschwand sie und tauchte kurz darauf noch einmal in der Tür auf und warf, ohne ein Wort zu sagen, Bettwäsche und ein Handtuch auf den Tisch neben mir.
Das Bad und die Toiletten waren am Ende des Flurs. Ich zog mich aus und stellte mich unter die Dusche, aber als ich den Hahn aufdrehte, war nur ein leises Röcheln zu hören. Auch die Toilettenspülung funktionierte nicht. Nur in Unterwäsche ging ich zurück in mein Zimmer und wusch mich mit Wasser aus dem Krug und zog frische Sachen an. Dann ging ich hinunter, aber Ana war nirgends zu finden. Gegenüber vom Speisesaal war ein etwas kleinerer Raum, über dessen Tür Damensalon stand. Darin gab es einige ebenfalls mit Tüchern bedeckte Sessel und einen großen Billardtisch. Auf dem grünen Filz lagen eine rote und zwei weiße Kugeln, an den Tisch gelehnt stand ein Queue, als habe eben noch jemand hier gespielt. Der nächste Raum war mit Fumoir angeschrieben und schien als Bibliothek zu dienen. Die meisten Bücher waren alt und verstaubt und von Autoren, deren Namen ich noch nie gelesen hatte. Nur wenige Klassiker waren dabei, Dostojewskij, Stendhal, Remarque. Dazwischen standen ein paar zerlesene Bestseller von amerikanischen Autoren.
Ich ging zurück ins Foyer und von da in den Ballsaal, den größten Raum, der bis auf einen aufgerollten Teppich leer war. An der von falschen Marmorsäulen getragenen Decke hing ein alter Kronleuchter aus Messing. Es war kühl in den Räumen, durch die geschlossenen Läden drang nur wenig Licht. In der Küche im Untergeschoss war es noch düsterer. Dort stand ein riesiger Kochherd aus Gusseisen, der offenbar mit Holz beheizt wurde, und auf einer Anrichte Dutzende von gebrauchten Weingläsern und Stapel von schmutzigen Tellern, als habe im Hotel vor kurzem ein Bankett stattgefunden. Ich ging wieder ins Erdgeschoss und nach draußen.
Die Schatten der alten Tannen, die in einiger Entfernung um das Kurhaus standen, waren inzwischen länger geworden und griffen schon nach den weißen Mauern. Ich ging um das Gebäude herum. An einer Seite war ein kleiner Kiesplatz, auf dem ein paar Blechtische und Klappstühle standen und einige Liegestühle. Erst als ich näher trat, sah ich Ana. Ich setzte mich neben sie und fragte, ob sie die letzten Sonnenstrahlen genieße. Es war ein langer Winter, sagte sie, ohne die Augen zu öffnen. Ich betrachtete sie. Ihre Augenbrauen waren ungewöhnlich breit, ihre Nase ziemlich markant. Die schmalen Lippen gaben ihrem Gesicht etwas Strenges. Sie hatte die Beine angewinkelt, und ihr Rock war ein wenig hochgerutscht. Die obersten Knöpfe ihrer Bluse waren geöffnet. Ich wurde das Gefühl nicht los, sie habe sich für mich so hingelegt. Da öffnete sie die Augen und fuhr sich mit der flachen Hand über die Stirn, als wolle sie meine Blicke wegwischen. Ich räusperte mich und sagte, die Duschen funktionieren nicht. Habe ich Ihnen das nicht gesagt? Und die Toilettenspülung. Improvisieren Sie, sagte sie mit einem freundlichen Lächeln, jetzt liegt ja wenigstens kein Schnee mehr. Wann fängt denn die Saison hier an?, fragte ich. Sie sagte, das hänge von verschiedenen Dingen ab. Eine Weile lang saßen wir schweigend nebeneinander, dann stemmte sie sich hoch, brachte ihre Kleider in Ordnung und sagte, Sie wollten doch in Ruhe arbeiten. Da bin ich mir nicht mehr so sicher, sagte ich, und als sie mich irritiert anschaute, ich würde gerne etwas essen. Sie sagte, das Abendessen sei um sieben, stand auf und verschwand.
Ich ging zurück auf mein Zimmer und versuchte zu arbeiten. Der Hunger lenkte mich ab, und ich trat auf den Balkon, um eine Zigarette zu rauchen. Da fiel mir ein, dass Ana mir abgeraten hatte, ihn zu benutzen. Aber er sah stabil aus, nur das Eisengeländer war von Rost zerfressen und an einigen Stellen ganz durchlöchert. Direkt unter mir war die Schlucht, und ich hörte das laute Rauschen des Bachs. Als ich mich umwandte, sah ich Ana wieder im Liegestuhl auf dem Kiesplatz.
Um Punkt sieben war ich im Foyer. Kurz darauf kam Ana von draußen herein. Ach, Sie, sagte sie, kommen Sie mit. Sie ging voraus in die Küche, zündete eine Petroleumlampe an und führte mich in einen kleinen Vorratsraum, in dem Kartons voller Konservendosen standen. Ravioli?, fragte sie. Gibt es nichts anderes? Sie drehte sich schnell um die eigene Achse, als wolle sie schauen, was alles da sei, dann zählte sie auswendig auf: Apfelmus, grüne Bohnen, Erbsen mit Karotten, Thunfisch, Artischockenherzen, Mais. Ich sagte, ich nähme die Ravioli. Sie griff sich eine Dose vom Regal und drückte sie mir in die Hand. Zurück in der Küche zeigte sie mir, wo Geschirr und Besteck zu finden waren, und reichte mir einen Dosenöffner. Nicht verlieren, den brauchen wir noch. Und wo kann ich die Ravioli aufwärmen? Sie runzelte die Stirn und sagte, soll ich vielleicht wegen einer Dose den Herd einheizen? Außerdem weiß ich nicht, wie das geht. Ich bat sie um Wein. Sie verschwand und kam kurz darauf mit einer Flasche Veltliner zurück und stellte sie vor mich hin. Der wird separat berechnet, sagte sie, guten Appetit, ich bin oben.
Sie ließ die Lampe stehen und verschwand mit sicherem Schritt in der Dunkelheit. Ich kippte die kalten Ravioli auf einen Teller und ging hoch in den Speisesaal. Das Essen schmeckte scheußlich, aber wenigstens war mein Hunger gestillt. Den leeren Teller brachte ich in die Küche und stellte ihn zum schmutzigen Geschirr. Ich überlegte mir, gleich wieder abzureisen, aber inzwischen war es zu spät. Also setzte ich mich mit meinem Laptop und der Flasche Wein in die Bibliothek, um zu arbeiten. Ich fand eine Steckdose, aber es gab keinen Strom. Auch das elektrische Licht funktionierte nicht. Glücklicherweise war der Akku des Computers voll. Ich las meinen Vortrag noch einmal durch und merkte schnell, dass weniger daran zu tun war, als ich gedacht hatte. Ich versuchte, mich auf den Text zu konzentrieren, aber ich war müde von der langen Wanderung, vom Wein und von der ungewohnten Höhe und nickte immer wieder ein. Um zehn ging ich durch das stockdunkle Gebäude nach oben und ins Bett, ohne Ana noch einmal gesehen zu haben.
Ich traf sie am nächsten Morgen im Speisesaal, vor sich einen Teller mit Apfelmus. Bedienen Sie sich, sagte sie und zeigte auf ein großes Glas, das auf dem Tisch stand. Ich sagte, ich hätte keine funktionierende Steckdose für meinen Laptop gefunden und auch das Licht gehe nicht, ob irgendetwas mit den Sicherungen nicht in Ordnung sei. Wir haben keinen Strom, sagte Ana, als sei es das Selbstverständlichste auf der Welt. Während ich noch aß, stand sie auf und verließ den Raum. Kurz darauf sah ich sie draußen mit einem Handtuch und einer Rolle Toilettenpapier zwischen den Bäumen verschwinden.
Mein Akku war leer, und da ich keinen Ausdruck meines Textes dabeihatte, konnte ich nicht viel tun. Ich las ein wenig in den Sommergästen und in der Korrespondenz von Gorki und machte mir ein paar Notizen, aber es hatte keinen Sinn. Am besten wäre es, gleich wieder abzureisen. Aber statt zu packen und nach Ana zu suchen, ging ich in den Damensalon und spielte Billard. Am Mittag war im Speisesaal ein Tisch für zwei gedeckt. Kurz nachdem ich mich hingesetzt hatte, kam Ana mit einer Dose Ravioli. Ich habe sie in die Sonne gestellt, sagte sie, um sie ein wenig aufzuwärmen. Das Essen war kaum wärmer als am Tag zuvor. Schmeckt es nicht?, fragte Ana.
Ich sagte, ich könne nicht arbeiten ohne Strom. Sie schaute mich an wie einen Schwächling und sagte, Sie werden schon etwas finden, um sich zu beschäftigen. Ich muss diesen Text in zwei Wochen abliefern, sagte ich. Wozu schreibt man überhaupt solche Sachen, sagte sie, wen interessiert das schon? Darum geht es nicht. Ich habe einen Termin, und den muss ich einhalten. Sie lächelte spöttisch und sagte, Sie wollen ja gar nicht abreisen. Ana hatte recht. Ich wollte hierbleiben, ich wusste selbst nicht, weshalb, vielleicht ihretwegen. Machen Sie sich keine falschen Hoffnungen, sagte sie, als habe sie meine Gedanken erraten.
Das Wetter war gut in den folgenden Tagen, und ich lag oft draußen auf einem Liegestuhl und döste. Ich las viel, spielte Billard oder legte Patiencen. Ana war nie weit, aber wenn ich sie fragte, ob sie mit mir Karten spielen wolle oder Karambolage, schüttelte sie den Kopf und verschwand. Wenn ich in die Bibliothek trat, saß sie schon dort und schaute aus dem Fenster. Ich zog irgendein Buch aus dem Regal und begann zu lesen. Wenn mir eine Stelle gefiel, las ich sie laut vor, aber Ana schien nicht zuzuhören.
Nachdem die Wasserkanne in meinem Zimmer leer war, wusch ich mich wie Ana jeden Morgen am Bach. Ich wartete im Speisesaal, bis ich sie zurückkommen sah, dann erst ging ich los. Ich hatte eine schöne Stelle gefunden, an der das Ufer flach war und das Wasser ruhig floss. In der weichen Erde entdeckte ich Spuren von nackten Füßen, ich nahm an, es sei dieselbe Stelle, an die auch Ana kam. Wenn ich den Kopf in das eiskalte Wasser steckte, war es mir, als explodierte er, aber danach fühlte ich mich den ganzen Morgen lang frisch. Nur das Rauschen des Baches fing an mich zu stören. Man konnte ihm nicht ausweichen, sogar im Inneren des Hotels war es leise zu hören. Ich musste dauernd an Ana denken, die ganzen Tage lang umkreisten wir uns ruhelos, und mir war oft nicht klar, wer von uns beiden den anderen verfolgte.
Sie putzte nicht und kochte nicht, sogar mein Bett musste ich selbst machen. Ihr einziger Dienst bestand darin, Dosen zu öffnen und den Tisch zu decken. Ein einziges Mal machte ich eine Bemerkung, ich bekäme für mein Geld nicht sehr viel. Anas Gesicht verfinsterte sich. Sie sagte, ich solle mir besser über mein eigenes Frauenbild Gedanken machen als über jenes von Maxim Gorki. Das hat doch damit nichts zu tun, sagte ich, aber wenigstens Strom und Wasser dürfe man in einem Hotel erwarten. Sie bekommen viel mehr, sagte Ana barsch. Ich wusste nicht, was sie damit meinte, aber ich hütete mich, das Thema noch einmal anzuschneiden.
Ich versuchte mir vorzustellen, wie es sein würde, wenn sich die Gäste hier im Sommer versammelten, wenn der Speisesaal voller Menschen wäre, jemand am Flügel säße und Kinder durch die Flure rannten, aber es gelang mir nicht.
Die Stapel mit dem schmutzigen Geschirr in der Küche wuchsen. Einmal zählte ich die Teller. Wenn Ana jeden Tag drei benutzt hätte, müsste sie den ganzen Winter hier verbracht haben. Ich fragte sie, ob sie eine Art Hausmeisterin sei. Wenn Sie so wollen, sagte sie. Ich glaubte ihr nicht, aber es war mir längst egal, weshalb sie hier war.
Am Mittag aßen wir meist Thunfisch und Artischockenherzen, am Abend machten wir draußen ein Feuer und wärmten auf einem Stein eine Dose Ravioli auf. Die Sonne verschwand früh aus dem Tal, und es wurde schnell kühl, trotzdem saßen wir jeden Abend lange am Feuer und tranken Wein. Wir hatten den ganzen Tag lang kaum ein Wort gewechselt, und auch jetzt war Ana nicht viel gesprächiger, aber wenigstens hörte sie mir zu. Ich hatte keine Lust, über mich zu reden, ich wollte nicht an mein Leben zu Hause denken, das weit entfernt schien und ohne Belang. Also fing ich an, ihr die Sommergäste nachzuerzählen. Sie reagierte auf die verschiedenen Figuren, als seien sie lebende Menschen, ärgerte sich über die ewig klagende Olga und nannte den Ingenieur Suslow ein Schwein. Mit Warwara und ihrer Schwärmerei für den Schriftsteller Schalimow konnte sie nicht viel anfangen. Wie konnte sie nur auf den hereinfallen, sagte sie empört, er ist wirklich ein schlechter Verführer. Was müsste denn ein guter Verführer machen?, fragte ich. Ehrlich müsste er sein, der Geliebten und vor allem sich selbst gegenüber, sagte Ana und schüttelte unwillig den Kopf. Am liebsten war ihr Marja Lwowna. Ich konnte ihren berühmten Monolog aus dem vierten Akt einigermaßen auswendig und musste ihn Ana mehrfach wiederholen. Wir sind Sommergäste in unserem Land, irgendwelche Zugereisten. Wir irren geschäftig umher, suchen nach einem bequemen Plätzchen im Leben, tun nichts und reden abscheulich viel. Ja, sagte Ana, wir alle müssen anders werden. Wir müssen es um unsretwillen, fuhr ich fort, damit wir nicht mehr diese verfluchte Einsamkeit fühlen. Ana schaute mich misstrauisch an und sagte, ich solle nicht auf falsche Gedanken kommen. Sie würden gut in das Stück passen, sagte ich. Gorki hat in einem Brief geschrieben, alle seine Frauenfiguren seien Männerhasserinnen und die Männer Halunken. Dann passen Sie auch gut in das Stück, sagte Ana. Ich schaute sie an, aber im flackernden Licht des Feuers konnte ich ihren Gesichtsausdruck nicht erkennen.
Ich fand nie heraus, wo Ana schlief. Wenn wir nachts zurück zum Haus gingen, jeder mit seiner Lampe, sagte sie, ich solle vorausgehen, sie komme gleich nach. Einmal wartete ich im Flur vor meinem Zimmer. Ich hatte die Lampe gelöscht und lauschte lange Zeit in die Dunkelheit, aber ich hörte keinen Ton, und schließlich ging ich ins Bett.
Halb im Traum stellte ich mir vor, wie Ana in mein Zimmer käme. Mitten in der Nacht erwachte ich und sah im schwachen Mondlicht ihre Silhouette. Sie zog sich aus, schlug die Decke zurück und setzte sich auf mich. Alles geschah völlig geräuschlos, nur durch die dünnen Scheiben war das entfernte Rauschen des Baches zu hören. Ana behandelte mich grob oder, besser gesagt, wie einen Gegenstand, den man zu einem bestimmten Zweck verwendet, aber der einem sonst gleichgültig ist. Als sie ihren Hunger gestillt hatte, ging sie, ohne dass wir ein Wort gewechselt hätten.
Am Morgen saß Ana wie immer schon am Frühstückstisch, als ich in den Speisesaal kam. Ohne viel zu überlegen, strich ich ihr, bevor ich mich hinsetzte, kurz mit der Hand über das Haar. Sie zuckte zusammen und duckte sich. Ich versuchte ein Gespräch zu beginnen, aber Ana gab keine Antwort und schaute mich nur finster an, als wisse sie, wovon ich in der Nacht geträumt hatte. Wie immer schlang sie ihr Essen hinunter und verließ den Tisch, sobald ihr Teller leer war.