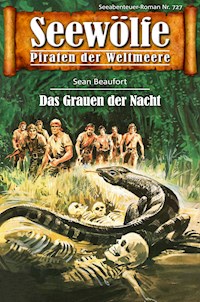34,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pabel eBooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Seewölfe - Piraten der Weltmeere
- Sprache: Deutsch
"Feuer frei!" rief Philip Hasard Killigrew. Al Conroy, der Stückmeister, wartete einen Atemzug lang, bis sich die Lage des Rumpfes stabilisiert hatte, dann senkte er die Lunte auf das Zündloch. Das Pulver brannte blitzesprühend ab, dann zuckte die mehr als halbarmlange Flamme aus der Mündung. Rohr und Lafette wurde zurückgeworfen, eine graue Wolke Pulverdampf stieg auf und wurde bugwärts davongetrieben. Al Conroy sprang zum nächsten Geschütz und zündete es, ohne sich um die Flugbahn des ersten Geschosses zu kümmern, aber dann blieb er stehen und schaute aus zusammengekniffenen Augen hinüber zu der Karavelle. Jawohl, Treffer! Und da zündete der Stückmeister die beiden nächsten Culverinen...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 2413
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Impressum© 1976/2020 Pabel-Moewig Verlag KG,Pabel ebook, Rastatt.eISBN: 978-3-96688-108-1Internet: www.vpm.de und E-Mail: [email protected]
Inhalt
Nr. 661
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 662
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 663
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 664
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 665
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 666
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 667
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 668
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 669
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 670
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 671
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Nr. 672
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 673
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 674
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 675
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 676
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 677
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Nr. 678
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 679
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Nr. 680
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
1.
Philip Hasard Killigrew setzte das Spektiv ab. Die Abendsonne war von den dichten Wolken geschluckt worden, aber der Regen zog weiter in nördliche Richtung. Vor einigen Minuten hatte der Wind seine Richtung geändert, jetzt herrschte nahezu Windstille.
Ben Brighton warf einen langen, wütenden Blick auf die killenden Segel, dann schaute er über das ruhige Wasser rechts voraus und sagte: „Der Kerl hat noch mehr Glück, als ich befürchtet habe.“
„Nicht mehr lange, Ben.“ Hasard hob die Schultern. „Er weiß es und wird alles versuchen, um zu verschwinden.“
Die Arwenacks hatten, nachdem die „Ghost“ von Surat den Tapti-Fluß abwärts an ihnen vorbeigesegelt war, sofort die Verfolgung aufgenommen. Bisher war noch nicht ein einziger Schuß abgegeben worden. Die „Ghost“ nahm vor der Flußmündung mit günstigem Monsunwind Kurs nach Norden und schien einen kleinen Vorsprung herausgesegelt zu haben.
Die Wut an Bord der Schebecke war nicht geringer geworden; nach dem Erlebnis des Kerkers, nach der vorbereiteten öffentlichen Hinrichtung und dem Freikämpfen ihrer unersetzlichen Schebecke hatten sie nur wenig anderes im Sinn, als es diesem verdammten Ruthland zu zeigen, und zwar gründlich.
Hasard junior trat zu seinem Zwillingsbruder, der auf der Back stand, und sagte bekümmert: „Ich hoffe nur, daß unser kleiner Doglee keine Schwierigkeiten bei seinen Leuten kriegt.“
„Daran dachte ich auch“, sagte Philip. Der Junge hatte ihnen viel geholfen. Aber er war pfiffig genug, möglichen Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen, davon war Philip junior überzeugt. „Surat ist keine kleine Siedlung. Er wird sich in Sicherheit gebracht haben. Schade, ich hätte ihm vielleicht etwas Geld geben sollen.“
„Dann hätte er es leichter gehabt“, pflichtete ihm sein Zwillingsbruder halblaut bei. „Jetzt können wir nichts mehr ändern.“
Sie schauten sich an und nickten sich zu. Das Kapitel Surat war beendet. Der Versuch, dort als Abgesandte der Königin den Handel mit England einzuleiten oder vorzubereiten, war fehlgeschlagen. Der hinterlistige Kapitän der „Ghost“ hatte ihnen das eingebrockt.
„Nein“, stimmte Philip zu, „zu ändern ist nichts mehr.“
Zwischen den Wolken wurde die Abendsonne wieder sichtbar. Die Regenwand war nach Nordosten weitergezogen oder hatte sich aufgelöst. An Steuerbord nördlich der Tapti-Mündung. Geradeaus, an der Kimm, wechselten im Dunst unterschiedliche Uferlandschaften ab. Es schienen Inseln oder Landzungen zu sein. Jedenfalls war die „Ghost“ in diese Richtung verschwunden.
Jan Ranse rief vom Achterdeck: „Achtung! Es gibt wieder Wind!“
Er stand an der Pinne und ärgerte sich ebenso wie die anderen Arwenacks über die Flaute. Erfahrungsgemäß war sie beim Monsunwind nicht von langer Dauer. Trotzdem hatte sie bei der Verfolgung vorläufig den kürzeren gezogen.
„Wie schön“, sagte der Seewolf wütend. „Es geht weiter.“
Der feuchte und warme Wind blies meist gleichmäßig und kräftig. Aber hin und wieder, in Gewittern beispielsweise, wurde er von einer meist kurzen Flaute unterbrochen, drehte völlig unvermittelt oder entwickelte sich zu einem kurzen, heftigen Sturm. Die Sonne überschüttete das Meer, das Schiff und die Küste mit blutigrotem Licht.
Die Wellen kräuselten sich, einzelne Schaumkronen zeichneten sich im Südwesten ab. Die Rahruten knarrten und die Schebecke legte sich nach Steuerbord über, als sich die Dreieckssegel füllten. Leise zischte und gurgelte die Bugwelle, als sich Jan Ranse gegen die Pinne stemmte.
Der Erste sagte zu Hasard: „Wenn wir ihn heute noch stellen, dann wäre das ein Wunder.“
„Ich rechne nicht damit“, entgegnete Hasard. „Aber irgendwo dort im Norden holen wir ihn uns vor die Mündungen.“ Es klang wie ein Schwur, und das war es auch.
Die Schebecke nahm Fahrt auf und richtete ihren Bug nordwärts. Einige halblaute Kommandos für die Deckscrew, und kurze Zeit später segelte die Schebecke raumschots wieder ihrem unsichtbaren Gegner hinterher.
Hasard holte tief Luft und warf einen prüfenden Blick zu den Culverinen. Sie waren geladen, aber noch nicht ausgerannt.
„Und wenn es einen Monat lang dauert“, sagte er grimmig, „wir finden diesen feinen Mister Ruthland.“
Im letzten Licht des Tages war auch ohne Spektiv die Küste deutlich zu sehen. Die Wellen des Golfes von Cambay gingen höher, die weiße Brandung brach sich vor sandigen Stränden und zwischen den bizarren Hochwurzeln der Mangroven.
Der Seewolf wandte sich an Dan O’Flynn. „Was sagen unsere Karten über den Norden dieses herrlichen Golfes, gibt es wenigstens ein gutes Fahrwasser?“
„Weiter nördlich mündet ein Fluß. Auf der Karte steht, daß er Narmada genannt wird. Wahrscheinlich gibt es dort auch ein ähnliches Mündungsdelta wie beim Tapti. Die Eingeborenen konnten mir nicht viel erklären, das hängt auch mit den Sprachschwierigkeiten zusammen. Aber sie sagten, daß wir dort mit Sandbänken und Felsen rechnen müßten, mit Inseln und großen Unterschieden von Ebbe und Flut. Und mit Untiefen, wechselnden Strömungen und vielen anderen schönen Einzelheiten.“
Hasards eisblaue Augen richteten sich auf die Kimm, an der alle diese versprochenen Schönheiten warteten und sich vorläufig noch versteckten.
„Klingt vielversprechend“, sagte er sarkastisch.
„So schlimm wird es nicht werden“, meinte Dan O’Flynn und winkte ab. „Außerdem hat die ‚Ghost‘ mit genau den gleichen Tücken zu kämpfen.“
„Stimmt.“
Dan berichtete, daß eine weitere Bucht tief in das Land am nördlichsten Ende des Golfes führe. Dort münde ein anderer Fluß, der als „Mahi“ bezeichnet würde. Die Küsten entlang der zerklüfteten Flußmündungen, so hätten die Eingeborenen versichert, seien bewohnt. Es solle viele Fischer geben, aber größere Siedlungen kenne niemand, und auch die Karten zeigten keine weiteren Einzelheiten.
Aber nicht nur die „Ghost“ und die Schebecke, sondern jedes andere Schiff würde die gleichen Schwierigkeiten haben. Ben Brighton und Hasard hatten dem Bericht schweigend zugehört.
„Sind die entsprechenden Karten in deiner Kammer?“ fragte der Seewolf.
„Ja, natürlich. Wie gesagt: von den Eingeborenen war trotz Doglees Übersetzungen nicht viel mehr zu erfahren. Spätestens morgen oder übermorgen sehen wir selbst, wohin uns Ruthland gelockt hat.“
„Ich denke, er wird dort auch nicht froh werden“, meinte Ben Brighton.
„Und das Lachen wird ihm ganz vergehen“, Al Conroy streichelte liebevoll das Metall einer Culverine auf der Kuhl, „wenn ich ihm ein paar eiserne Grüße hinüberschicke.“
Hasard hatte den größten Teil der Crew unter Deck entlassen. Die Köche bereiteten das Essen zu, und die Deckswache hielt Ausschau nach Ruthlands verdammter „Ghost“. Eine Hetzjagd während der Monsunzeit und in diesen unbekannten Gewässern zählte nicht gerade zu den dringenden Wünschen der Arwenacks. Trotz allem, was sie zu erwarten hatten – nicht einer dachte daran, Ruthland und seine Crew entwischen zu lassen.
Vier Stunden später hatte der Wind sämtliche Wolken vom Himmel gefegt. Auf den weiten Wogen der Dünung lagen das Licht der Sterne und das silberfarbene Leuchten des Mondes. Im Nordosten wetterleuchtete es, und an Steuerbord waren inmitten der Mangrovenwälder und der Sandküste winzige Feuer zu erkennen, vier Stück insgesamt.
Die Schebecke segelte weitab der Küste, und jeder hoffte, daß das Fahrwasser von Untiefen frei war. Im letzten Licht war Dan in den tonnenförmigen Ausguck im Großmast aufgeentert und hatte die See voraus mit seinen scharfen Augen und dem Kieker abgesucht.
Er kehrte zurück und sagte zufrieden, daß sie bis zum ersten Tageslicht den Kurs halten könnten.
Trotzdem stand er auf der Back und versuchte, Hindernisse schon zu erkennen, bevor sie gefährlich wurden, bis ihn Don Juan ablöste.
Leise unterhielten sich die Mitglieder der Deckswache.
„Es ist doch besser“, sagte Batuti, „daß wir heute keine Lichter gesetzt haben.“
„Meinst du allen Ernstes“, fragte Dan, der bei ihnen saß und einen letzten Schluck trank, ehe er sich in seine Koje verholte, „daß dieser Bastard Ruthland nach uns Ausschau hält?“
„An seiner Stelle würde ich nichts anderes tun. Er kann sich vorstellen, wie der Seewolf zubeißt“, murmelte Blacky.
„Diese Feuer an Steuerbord“, fragte Batuti, „gehören die zu Fischerdörfern?“
Dan gähnte und erwiderte: „Fischerdörfer, Holzfäller, Leute, die in den Wäldern Tiere jagen und die Häute verkaufen, was weiß ich. Für uns sind sie nicht gefährlich. Vielleicht können wir von ihnen Proviant einhandeln, wenn die Köche Abwechslung brauchen.“ Er nickte den anderen zu. „Ich lege mich aufs Ohr.“ Dan stand auf und verzog sich unter Deck.
Mit dem vertrauten Knarren und Knarzen, mit dem Summen des Windes in der Takelage und dem ziehenden Gurgeln des Bugwassers segelte die Schebecke durch die klare Nacht, fast genau auf Nordkurs.
Die Ruhe würde spätestens in einigen Stunden vorbei sein. Entweder sichteten sie die „Ghost“, oder sie gerieten in gefährliche Fahrwasser. Wahrscheinlich trafen beide Ereignisse zusammen, wie sooft.
Schon in der kurzen Morgendämmerung konnten die Seewölfe erkennen, daß sich die Umgebung verändert hatte. An Steuerbord breitete sich hinter der Brandungslinie noch immer Wald aus, unterbrochen von kleinen Stränden und Mangrovendickichten.
„Ich kann kein Segel erkennen, keinen Mast, keinen Rumpf“, sagte Hasard und packte das Spektiv wie einen Knüppel. „Wahrscheinlich gibt es ein paar hundert Schlupfwinkel, in denen die ‚Ghost‘ stecken kann.“
„Genauso wird’s sein“, antwortete der Erste.
Steuerbord voraus erstreckte sich eine lange Sandbank, die in der Mitte bewachsen war. Ein Schwarm Vögel flog mit trägem Flügelschlag auf und umkreiste den langgestreckten Wall aus Schwemmgut und bleichem Treibholz, zwischen dem sich Büsche und niedrige Bäume erhoben. Die Schebecke fiel nach Backbord ab.
„Ebbe?“ erkundigte sich Ferris Tucker und schirmte seine Augen ab, als er nach Osten blickte. „Scheint so, Sir.“
„Nach Dans Berechnungen und dem, was wir sehen“, erwiderte der Seewolf etwas unwillig, „ist da eine Menge trocken gefallen.“
Er peilte zum Bug. Dort stand Hasard junior und beobachtete das Wasser vor dem Schiff. Es hatte seine Farbe geändert. Gestern hatte es tiefes Blau gezeigt, jetzt war es von dünnen gelben Schlieren durchzogen, als habe der Fluß, dessen Mündung nicht zu erkennen war, Staub oder Sand mit sich geschwemmt.
Auch Big Old Shane suchte die Kimm mit dem Kieker ab. Über dem Wasser lag ein fahler Dunst, der sich in der Kraft der Helligkeit der Sonne nur zögernd auflöste. Trotzdem waren voraus und an Steuerbord Buchten und die Mündungen kleiner Wasserläufe zu erkennen. Die Ufer waren dicht bewachsen, jetzt wirkte das Buschwerk und das Gestrüpp drohend und schwarz. Nur wenige dünne Rauchsäulen stießen durch den rötlichen Nebel. Feuchtigkeit schlug sich auf den Planken und den Segeln nieder.
„Von der ‚Ghost‘ ist nichts zu sehen“, sagte Big Old Shane und zauste seinen struppigen grauen Bart. „Die Masttopps müßten höher sein als die meisten Bäume.“
„Ich habe nicht erwartet“, erwiderte Hasard grimmig, „daß wir den Hundesohn schnell entdecken.“
Die Uferlandschaften glitten langsam vorbei.
Hin und wieder konnten die Seewölfe in eine Bucht sehen. Auf Pfählen standen kleine Hütten, von denen Leitern hinunterführten zu den schmalen Booten, die im Wasser schaukelten. Zwischen den Matten, aus denen die dünnen Wände bestanden, schwelten Feuer, deren Rauch durch die löchrigen Dächer abzog.
Schweigend und gegen die Sonne blinzelnd, starrten die Seewölfe hinüber. Aber es gab nicht das geringste Zeichen dafür, daß sich die Karavelle dort versteckte.
Hasard winkte zu Ben Brighton hinüber. „Nehmt die Fock weg. Wir sind zu schnell.“
„Aye, aye, Sir“, erwiderte der Erste.
Die Schebecke wich etwas nach Nordwesten vom bisherigen Kurs ab. Am Ende der langen Sandbank ragten einige abgestorbene Bäume aus dem trüben Wasser.
Jung Philip wandte sich an seinen Vater. „Soll ich in den Großmast?“
„Ja“, entgegnete der Seewolf zerstreut, ohne das Spektiv zu senken.
„Ein Strich nach Westen abfallen!“ rief Ben Brighton.
Entlang der Grenzen, die das Meer und das Wasser der Buchten bildeten, standen Fischer in den Booten und warfen Netze aus. Andere hielten lange Speere in den Händen und holten unterarmlange, zappelnde Fische aus dem Wasser. Ab und zu winkten sie zum Schiff hinüber und riefen unverständliche Worte.
„Ob sie uns was mitteilen wollen?“ rätselte Roger Brighton.
Hasard zuckte mit den Schultern. Er beobachtete die Fischer, aber sie kümmerten sich nur um ihre Boote und ihren Fang. Wenn einer von ihnen in eine bestimmte Richtung gezeigt hätte, würde er es bemerkt haben. Aber die Fischer schienen die „Ghost“ nicht gesehen zu haben.
„Glaube ich nicht“, murmelte der Seewolf, aber er ließ die wenigen Boote und braunhäutigen Männer nicht aus seinen Augen. „Warum sollten sie uns auch helfen?“
Es war für alle so gut wie unvorstellbar, daß Francis Ruthland die Sprache dieser Fischer beherrschte, ebensowenig wie die Seewölfe, von den wenigen Worten abgesehen, die Doglee den Zwillingen beigebracht hatte.
Wieder verschwand eine Ausbuchtung der Küste hinter dem Heck der Schebecke. Vor einem hügeligen Abschnitt an der Steuerbordküste erstreckte sich der trockengefallene Meeresboden, zwischen dessen Pfützen Krabben und Wasservögel zu sehen waren.
„Wir suchen weiter!“
Hasards Befehl war eigentlich überflüssig. Keiner der Arwenacks dachte an etwas anderes als daran, in den nächsten Stunden die „Ghost“ zu sichten und die Mündungen der Geschütze auf sie zu richten.
Immer wieder stoben Vogelschwärme aus den Baumkronen. Das gellende Geschrei der Tiere ließ die Seewölfe argwöhnisch zusammenzucken. Vielleicht lag hinter dem nächsten Vorsprung oder im folgenden Einschnitt der Mangroven der Verfolgte.
Aus der Tonne im Großmast rief Philip junior: „Anluven, Piet! Untiefe voraus!“
„Aye“, antwortete der Rudergänger und stemmte sich gegen die Pinne.
Die Segel killten, Tauwerk knarrte, Schritte polterten auf den Planken, als die Schoten dichter geholt wurden. Die Schebecke legte sich etwas über und richtete den Bug nach Nordwesten. Die Färbung des Wassers ändert sich wieder, als das Schiff eine Kabellänge zurückgelegt hatte.
Knapp eine halbe Seemeile weiter schrie Philip wieder auf die Kuhl hinunter: „In Ordnung! Freies Fahrwasser voraus!“
„Verstanden!“ brüllte Piet Straaten zurück.
Die Küstenlinie schien, abgesehen von den vielen Buchten und Vorsprüngen, einigermaßen geradlinig von Norden nach Süden zu verlaufen, wie es auch die Karten zeigten. Möglicherweise erreichte die Schebecke in den letzten Stunden des Tages das nördliche Ende dieses Ufers. Dort mündete von Osten der Fluß, und, wenn die Karten zuverlässig waren, erstreckte sich dort auch ein Mündungsdelta von beträchtlicher Größe.
Wahrscheinlich gab es mittendrin, ein paar hundert Verstecke für Ruthland.
2.
Zwei Stunden nach dem Glasen, in der größten Mittagshitze, überzog sich der Himmel im Süden mit grauen Wolken. Von der Kimm aus baute sich eine Wand auf, die überraschend schnell in die Höhe wuchs und sich näherte. Der Wind wehte mit gleichbleibender Kraft aus Süden oder Südwesten.
„Vielleicht kommt ein Sturm auf“, sagte Dan O’Flynn. „Wäre keine wirkliche Überraschung, Sir.“
„Damit müssen wir tagtäglich rechnen“, entgegnete der Seewolf. „Nur können wir nicht riskieren, daß uns der Sturm hier stranden läßt. Wir dürfen nicht auf Legerwall geraten.“
Dan deutete nach Steuerbord voraus. Dort schien sich ein niedriges Kap – nicht mehr als eine Ansammlung von Dünen oder langgestreckten Felsen – weit ins Meer vorzuschieben. Noch waren keine Einzelheiten zu erkennen. Das einsame Fischerboot mit einem kleinen Segel, das in zwei Spitzen rechts und links des niedrigen Mastes auslief, blieb zurück.
„Also, weiter nach Westen drehen, wenn’s zu pfeifen anfängt“, sagte der Rudergänger.
Dunst und Nebel, sowohl an Land als auch über dem Wasser, hatten sich längst völlig aufgelöst. Im Licht der senkrecht einfallenden Sonnenstrahlen erstreckte sich das Meer. Im Norden und Osten bildeten sich über dem Land, das nicht deutlicher als ein vager Schatten über der Kimm war, dünne, aufwärts geschwungene Wolken.
Der Seewolf nickte, schaute in die Gesichter der Crew und erkannte, daß sie ebenso enttäuscht waren wie er selbst.
„Richtig. Auf Westkurs, wenn es nötig werden sollte“, erwiderte er halblaut.
Sie Spektive hatten ihm und der Crew gezeigt, daß es entlang des Ufers, an dem sie länger als einen halben Tag gesucht hatten, weder einen größeren Hafen noch eine Siedlung gab, die diesen Namen verdiente. Nur Fischerhütten, einzelne oder in winzigen Gruppen, hatten sich durch den Rauch ihrer Feuer verraten.
Die Dächer der Pfahlbauten verschwammen bereits aus geringer Entfernung mit dem grünen Hintergrund der Uferwälder. Querab der Schebecke ging der Wald stufenartig in riesige Zonen von Uferschilf über. Die Flut hatte das trockengefallene Land wieder bedeckt, und die Wellen zum Ufer hin wurden grau und kabbelig.
Dan O’Flynn schwang sich auf das Achterdeck, hielt sich am Want fest und sagte: „In spätestens drei Stunden ist der Sturm da. Wahrscheinlich Regen und Starkwind, aber sicher kein Orkan, Sir.“
„Schätze ich auch“, erwiderte der Seewolf. „Dann sind wir vielleicht hinter der Huk dort vorn in größerer Sicherheit.“
„Wird sich zeigen“, brummte der Erste.
Al Conroy hatte wieder mal seine Geschütze inspiziert und schien mißmutig zu grinsen. Er hatte sie zwar mit der gewohnten Sorgfalt geladen, aber wenn sie nicht in absehbarer Zeit abgefeuert wurden, konnte das Pulver feucht werden. Diese Aussicht schmeckte ihm gar nicht. Aber noch war es nicht nötig, sich ernsthafte Sorgen zu machen.
Die gleiche Unruhe, Anspannung und Erwartung hatte auch alle anderen Seewölfe gepackt. Sie segelten hinter dem Hundesohn Ruthland her und fanden ihn nicht, obwohl er sich mit seiner Karavelle nicht in Luft aufgelöst haben konnte.
„Verdammter Monsun“, sagte Dan und runzelte die Stirn.
Hasard junior deutete zu der Wolkenwand, die von Osten bis Westen reichte und mehr als ein Drittel des Himmels bedeckte. „Du weißt, warum diese Wind- und Regenzeit so genannt wird?“
„Wenn ich’s nicht wüßte“, antwortete Dan und lachte kurz auf, „dann würdest du es mir sicher genau erklären, Schlaukopf.“
„Wahrscheinlich stammt das Wort aus der Muselmanensprache“, schaltete sich der Profos ein.
„Richtig, Ed“, sagte Jung Hasard. „Bei den Muselmanen spricht man von ‚Mausin‘, und das bedeutet ‚Jahreszeit‘. Also werden wir es noch länger mit diesem Wetter zu tun haben.“
„Das glaube ich auch“, meinte Dan und musterte die Grenze zwischen Brandung und Land durch das Spektiv.
Nicht die Langeweile ärgerte die Crew, sondern die erzwungene Untätigkeit und die erfolglose Suche nach Ruthlands „Ghost“. Die Stimmung der Crew wurde, je mehr Zeit ereignislos verging, schlechter und mürrischer.
Edwin Carberry fluchte leise in sich hinein, reckte sein kantiges Kinn nach Lee und stierte schweigend zur Küste. Aber dort war nur wenig mehr zu sehen als auf dem offenen Meer. Nicht ein Segel, nur die vielen Vögel, die ihren ewigen Heißhunger nach Fisch stillten.
Einmal trieb ein blattloser Baum mit aufgequollener Rinde und weißen Wurzeln eine Kabellänge an Backbord vorbei, auf dem ein paar Reiher hockten und ihre Schnäbel in die Richtung der Schebecke drehten.
Als die Landzunge fast querab lag, lehnte ein Dutzend Seewölfe am Schanzkleid und versuchte, jede noch so kleine Einzelheit an Land zu erkennen.
Philip rief von der Back her: „Eine große Bucht, aber höchstwahrscheinlich keine Flußmündung. Oder hat jemand von euch mehr gesehen?“
Von Deck aus war eine annähernd dreieckige, riesige Bucht zu sehen. Ein Strich östlicher als Nord war das andere Ende der Bucht zu erkennen. Die Sonne, der sich die Monsunwolke bis auf eine geringe Entfernung genähert hatte, lag voll auf dem Land, das aus Felsen und Wald zu bestehen schien.
„Nein“, erwiderte Jung Hasard und enterte die Großmastwanten auf. „Aber gleich werden wir etwas klüger sein.“
In sicherer Entfernung, mehr als eine Meile, schob sich die Schebecke auf Nordkurs an der Landzunge vorbei. Recht voraus und an Steuerbord erstreckte sich blaues Wasser. Nur in den Spektiven zeichnete sich die östliche Küste ab. Mit bloßem Auge war nur ein dunkler Saum zu erkennen.
„Wo steckt dieser Höllenhund Ruthland?“ brüllte Carberry unbeherrscht. „Wenn ich den zu packen kriege …“
„Leere Versprechungen.“ Sven Nybergs Gesicht verzog sich zu einer abschätzigen Grimasse.
Hasard drehte sich um und rief: „Ruder Steuerbord! Wir gehen in die Bucht und suchen weiter, solange wir noch etwas sehen.“
Zweifellos, so dachten sie alle, war Ruthland nach Norden geflohen. Er mußte im aufkommenden Starkwind und Regen kreuzen, wenn er sich aus seinem Versteck wagte und sich wieder nach Süden wandte. Er konnte ihnen also während der Nacht wieder entwischen, aber die Entfernung zwischen Verfolger und Verfolgtem konnte nicht groß sein. Sie betrug nur wenige Stunden. Wahrscheinlich suchten sie nur an den falschen Stellen.
„Aye, aye, Sir!“ tönte es aus der Gruppe auf dem Achterdeck.
Die Schebecke gehorchte dem Ruder und führte eine weite Halse aus. Der Wind wehte jetzt von Steuerbord achtern. Die Seewölfe trimmten die Segel. Wieder gab es wenig anderes zu tun, als das Wasser und das Ufer zu beobachten, während die Helligkeit Schritt um Schritt abnahm. Der obere Rand der Wolkenbank berührte die Scheibe der Sonne. Riesige Strahlenbündel zuckten über den fahlblauen Himmel.
Hasard hatte wenige Minuten später einen Entschluß gefaßt, wandte sich an den Ersten und sagte: „Wir versuchen, so weit von den Ufern entfernt zu segeln, daß wir genau sehen können, ob sich die ‚Ghost‘ in dieser Bucht versteckt. Wenn es sein muß, gehen wir näher heran.“
„Aye, Sir.“ Ben Brighton nickte.
„Wahrscheinlich müssen wir in dem Regen, wenn’s zu schlimm wird, vor Anker liegen. Ich würde in der Nacht lieber weiter nach Norden verholen.“
„Ich auch, Sir“, entgegnete Ben. „Wir alle, denke ich.“
„Wir werden sehen, wie weit wir kommen.“ Hasards Augen richteten sich wieder der Küste zu.
Vier Fischerboote wurden in verdächtiger Eile in die Richtung der nächsten Bucht gepaddelt. Die Eingeborenen, zwei oder drei in jedem Boot, zeigten immer wieder mit aufgeregten Gesten zur Sonne. Sie war zur Hälfte von der Wolke verschluckt worden. Die riesige Wand färbte sich blaugrau und schwarz.
„Also weiter nach Osten?“ fragte der Rudergänger. „Und erst später nach Westen, im Sturm oder wann?“
„Wenn du die ‚Ghost‘ irgendwo achtern siehst, gehen wir sofort auf Gegenkurs!“ rief Edwin Carberry und hob die Faust.
„Alles klar.“
Das Schiff lag nach Steuerbord über. Al Conroy musterte die sich nähernde Wand aus Wolken und Regen und schielte nach seinen Geschützen. Dann entschloß er sich und sagte: „Besser, wenn ich die Persenninge hole. Mit nassem Pulver kann der beste Stückmeister kein Gefecht gewinnen.“
„Ein guter Einfall, Al“, lobte der Profos.
Der Wind nahm an Stärke zu, blieb aber noch gleichmäßig. Die letzten Sonnenstrahlen spielten auf den kleinen Schaumkronen. Dann änderte sich binnen weniger Minuten das Licht. Das Wasser schien schwarz zu werden die Wälder am Ufer wirkten plötzlich drohend. Die Schebecke begann zu stampfen und zu gieren, als von Steuerbord die ersten größeren Wellen heranrollten und sich an den Planken brachen.
„Jetzt wird’s ungemütlich“, sagte Carberry, obwohl die Luft nach wie vor warm und feucht, der Wind keineswegs kalt war.
„Keine Karavelle, Dad. Nichts. Nur Fischerboote und ein winziges Segel voraus!“ schrie Jung Hasard aus dem Ausguck am Großmast. „Langsam wird es hier ungemütlich.“
„Dann enter ab!“ brüllte Hasard und ließ das Spektiv in die andere Hand gleiten.
Sein Sohn blieb noch einige Minuten oben und spähte in alle Richtungen.
Die kleinen Buchten des Ufers waren leicht einzusehen. Es gab nur wenige Hütten auf Pfählen, aber die Anzahl der zerfasernden Rauchfahnen zeigte, daß weiter landeinwärts einzelne Häuser stehen mußten. Es handelte sich mit großer Wahrscheinlichkeit um kleinere Siedlungen, weitaus kleiner als Surat.
Zwischen den Einkerbungen der flachen, langgestreckten Uferlinie tauchten immer wieder weite Strecken auf, die aus Schilf bestanden und wahrscheinlich morastig waren. Daran schlossen sich die undurchdringlichen Mangroven an. Und dahinter schob sich immer wieder eine Bucht ins Blickfeld, in der sich Eingeborene zeigten.
„Hier gibt es keine Verstecke für ein größeres Schiff“, murmelte Jung Hasard vor sich hin, während er über die Steuerbordwanten abenterte. „Wir suchen wirklich an den falschen Stellen.“
Aber woher sollten sie wissen, wo die Suche erfolgversprechend war?
Während es dunkler wurde und über dem Land an Steuerbord die ersten Regenschauer niedergingen, schob sich die Schebecke durch das aufgewühlte Wasser nach Osten tiefer in die Bucht. Der scharfe Bug schnitt durch die gischtenden Wellen. Das hochspritzende Wasser wurde nach Backbord weggerissen, während Al Conroy und die Zwillinge die wasserdichte Leinwand über die langen, schlanken Bronzerohre bändselten.
Plötzlich riß der Regenvorhang auf. Ringsum schien das Wasser zu dampfen. In der Wolkenmasse zeigte sich ein riesiges Loch, durch das die gelbrote Sonne strahlte. Sie hing mehr als eine Handbreite über der Kimm, ihre Strahlen ließen das östliche Ende der Bucht deutlich und überaus scharf hervortreten.
„Wird ein schöner Abend, Sir“, scherzte der Profos. Ihm troff wie allen anderen das Wasser aus dem Haar. Der Regen hatte kaum Abkühlung gebracht.
„‚Abendrot – Schlechtwetterbot‘, wie jedermann weiß“, zitierte der Seewolf. „Seht ihr die Karavelle?“
In dem sonderbaren Licht und zwischen den dunklen Regenzonen an Backbord und an Steuerbord traten auch über dem Buchtende die fernen Berge deutlich vor die Augen der Arwenacks. Die Berghänge waren voller Wald. Dann wischte wieder ein Regenschauer vor dem Bild vorbei.
„Ruthland ist bei seiner Flucht nicht nach Ost abgebogen. Wir hätten ihn sonst längst entdeckt“, sagte Jung Philip und packte den Klöppel der Schiffsglocke. Er drehte die Sanduhr um und läutete. Vier Glasen, zwei durchdringende Doppelschläge hallten über die Länge des Schiffes. „Wir suchen an der falschen Stelle, Dad.“
„Das habe ich auch schon gemerkt“, knurrte der Seewolf. „Woher hätten wir das vorher wissen sollen?“
Die Schebecke war weit in den Sund gesegelt. Auch die Strände und Buchten im östlichen Teil waren gut einsehbar gewesen. Was die Seewölfe nicht mit bloßem Auge erkannten, zeigte ihnen das Spektiv. Das Wolkenloch schloß sich gerade wieder, als Hasard seine Kommandos gab.
„Ben! Wir segeln zurück nach Westen. Dabei sehen wir uns die Nordufer an. Ruthland muß sich irgendwo dort drüben versteckt haben.“
„Aye, aye, Sir.“
Als der Regen wieder einsetzte, halste die Schebecke in einem weiten Bogen auf den neuen Kurs. Sie wurde schneller und rauschte zuerst in nördliche Richtung, dann legte sie sich nach Steuerbord über und rauschte zurück nach Westen.
Der Profos schüttelte das Regenwasser aus dem Haar und hielt sich an einem Want fest. Sein Zeigefinger bohrte sich fast in Hasards Brust. „Ich sage dir, Sir, wo dieser Hundesohn steckt.“
Hasard zeigte nach Westen, ohne aber das Ufer aus den Augen zu lassen.
„Ich habe mir nämlich bei Dan die Karten angesehen. Ich sage dir, Sir, daß Ruthland erst gar nicht versucht hat, sich hierher abzusetzen. Er steckt dort drüben.“
Der Profos deutete zu den schrägen Bändern des Regens, die im schwindenden Tageslicht schwarz wirkten. Dahinter lagen unzählige Buchten und Inseln, wirr vorspringende Halbinseln und eine Vielzahl von Sandbänken.
„Dorthin segeln wir, Edwin“, erwiderte der Seewolf. „Länger als einen Tag brauchen wir nicht dazu. Aber mich drückt eine ganz andere Sorge, nämlich die, daß Ruthland heute nacht ankerauf geht und möglicherweise nach Goa zu fliehen versucht. Oder sonstwohin.“
„Davon rede ich ja seit Stunden!“ rief der Profos. „Und jetzt, in der Nacht, kann er tun, was er will. Wir bemerken nicht, wenn er abhaut.“
Hasard nickte. Die Schebecke segelte am Wind, der aus dem südwestlichen Sektor wehte. Noch hatte der Regen das Schiff nicht wieder erreicht, aber in weniger als einer halben Stunde würde das Wasser aufs Deck niederprasseln.
„Lieber Profos“, sagte der Seewolf geduldig. „Wir haben alle Überlegungen und Möglichkeiten seit Stunden durchgekaut wie ein Stück Stiefelleder. Wir können schließlich nicht fliegen wie diese verdammten Reiher oder Pelikane, oder wie die Vögelchen auch immer heißen mögen. Wir sind mit geladenen Culverinen und einer Mordswut in den Bäuchen unterwegs in den Westen dieser Gegend. Und jetzt stellst du dich hierher und erzählst mir, wo wir sind, was wir unternehmen, und was Ruthland möglicherweise tut. Wie kommst du mir vor?“
Carberry grinste breit und hielt seine riesige Pranke über den Kopf. Die ersten Tropfen lösten sich aus dem dunklen Himmel und schlugen auf die Planken. Es klang, als hüpften kleine Steine über das Holz.
„Hoffentlich komme ich dir wie ein besorgter Profos vor, der an alles denkt, Sir.“
„Genauso, Ed“, erwiderte der Seewolf. „Und jetzt spähst du mit deinen scharfen Augen dort hinüber und schreist laut, wenn du etwas anderes siehst als Regen und Landschaft. Verstanden, Mister Profos?“
Sie duckten sich unter dem ersten richtigen Regenguß, und Hasard hörte gerade noch Carberrys „Aye, aye, Sir.“
Der Regen rauschte, gleichmäßig warm und dicht, aus den Wolken. Die Sonne war nur noch ein winziger, undeutlicher roter Fleck hinter dem Regenvorhang. Wer nichts an Deck zu tun hatte, verholte ins Trockene. Von der Kombüse her wehte ein Geruch, der einem das Wasser im Mund zusammenlaufen ließ.
Hasard stand auf dem Quarterdeck, spürte den Regen im Gesicht und fragte sich, was zu tun sei. Weitersegeln oder einen Platz suchen, an dem die Schebecke vor Anker liegen konnte?
Voller Selbstzweifel entschied er sich, weitersegeln zu lassen.
3.
Das Tauwerk knarrte und knirschte, die Karavelle wiegte sich in den auslaufenden Wellen. Die Festmacher bröselten die Rinde von den dicken Baumstämmen. An den Masten und den Wanten lief das Wasser hinunter und über die Decksplanken. Von den großen Blättern der Bäume mit ihren weit überhängenden Ästen tropfte es unablässig auf das Oberdeck der „Ghost“.
Im dichten Regen sah Ruthland vom Quarterdeck aus gerade noch den Bug. Mit einem schnellen Schritt war er wieder an der Tür zur Kapitänskammer und schüttelte sich.
„Scheißwetter“, murmelte er. Aus dem dunklen Haar lief ihm das Wasser in den Kragen. „Aber ein ausgezeichnetes Versteck.“
„Du hast mal wieder in die richtige Ecke verholt“, sagte Hugh Lefray. „Aber ewig und drei Tage können wir uns hier nicht verstecken. Das weiß mittlerweile jeder an Bord.“
„Habe ich auch nicht vor.“
Ruthland und sein Kumpan hielten große Becher voll Wein in den Händen. Eine gewisse Unruhe stand deutlich in ihren Gesichtern geschrieben, aber in diesem Winkel der größeren Bucht war das Schiff so gut wie unsichtbar. Die Bäume überragten die Mastspitzen.
Als Ruthland diese Baumgruppe gesehen hatte, war sofort der Kurs geändert worden. Das Versteck war nur dreimal so groß wie der Rumpf der „Ghost“ lang.
„Außerdem“, sagte Ruthland mit rauher Stimme, „verstecken wir uns nicht. Wir warten nur einen besonders günstigen Moment ab.“
„Und dann?“ fragte Lefray lauernd.
„Dann sehen wir weiter.“
Sie lachten kurz, tranken einen Schluck und hatten nicht viel mehr zu tun, als auf das Essen zu warten. Die Geschütze waren geladen, genau wie die Culverinen auf der Seewolf-Schebecke, das war Ruthland und seiner Crew völlig klar. Gegen den Regen waren über den meisten Rohren Persenninge gespannt. Nur unter Deck und in der Kapitänskammer brannten kleine Lampen. Finsternis und rauschender Regen herrschten rund um das Schiff in der menschenleeren Ecke dieser verlassenen Gegend.
„Hör mal“, sagte Lefray nach einer Weile. „Was hast du eigentlich vor, ich meine, willst du wieder zurück zum Padischah nach Surat?“
„Unsinn!“ Ruthland fluchte. „Wir warten ab, wie sich die Lage morgen früh darstellt. Nach Surat können wir nicht zurück, das weißt du. Dort ist für uns nichts mehr zu holen. Auch für Killigrew nicht.“
„Stimmt, Kapitän.“
Lefray hielt den Kopf schief und hörte dem prasselnden Regen zu. Das Geräusch drang ungehindert durch die offene Tür der Kammer. Während des Regens blieb sogar der Dschungel hinter den Mangroven ruhig.
Der Kapitän fuhr fort: „In den nächsten Tagen treffen wir wieder aufeinander, verlaß dich drauf. Dann schicke ich den Hund zu den Fischen. Klar?“
„Völlig klar, Francis“, erwiderte Lefray und starrte Ruthland mit seinem toten Fischauge an.
Nachdem sie Surat so schnell wie möglich verlassen hatten, waren sie den Tapti-Fluß hinuntergesegelt und hatten sich nach Norden verholen wollen. Der achterliche Wind verschaffte ihnen im Regen einen Vorsprung vor dem Verfolger. Wo der Seewolf suchte – oder ob er überhaupt noch nach der Karavelle Ausschau hielt –, wußte Kapitän Ruthland nicht. Zuletzt hatten sie die Schebecke gesehen, als sie aus der Mündung des Tapti gesegelt und ebenfalls auf Nordkurs gegangen war.
„Der Kerl wird nicht lockerlassen, Francis“, sagte Lefray nach längerem Nachdenken. „Er hat gute Gründe für seine Wut.“
Mit kaltem Grinsen zuckte Ruthland mit den Schultern und warf einen Blick auf die Sanduhr.
„Vorläufig habe ich einen guten Grund, diesem Koch einen Tritt zu verpassen, dorthin, wo’s am meisten weh tut. Wo bleibt der Fraß?“ Die letzten Worte brüllte er. Der Essensgeruch war stärker geworden. Er packte den Krug und füllte die Becher erneut.
David Lean lief, die Jacke über dem Kopf, in dem schmalen Streifen des gelblichen Lichts aus der Kammer den Niedergang hoch.
„Gibt’s was, Kapitän?“ fragte er und fluchte, weil das Wasser in seine Stiefelschäfte lief. „Ich hab da was gehört …“
Ruthland winkte ab.
„Die Wache geht ihre Runden?“ fragte er. „Dein Pulver ist hoffentlich noch trocken? Und wo steckt der Koch mit unserem Essen? Wenn morgen früh der verfluchte Regen aufhört, gehen wir ankerauf.“
„Wir warten darauf“, sagte der Stückmeister. „Wir geben’s dem Seewolf, wie?“
Der Kapitän nickte. Seit sie in dieses Fahrwasser geraten waren, dachte er an die zahlreichen Buchten, die Untiefen und Sandbänke. Das Versteck war für seine „Ghost“ nicht ungefährlich – so wie für jedes andere Schiff dieser Art. Nur die flachgehenden Fischerboote manövrierten hier gefahrlos. Er tröstete sich damit, daß bei gutem Licht alles einfacher sein würde.
„Ja“, sagte er und lehnte sich im knarrenden Decksstuhl zurück. „Wir bringen das zu einem guten Ende, was wir in Surat angefangen haben. Verlaß dich drauf. Und jetzt schick uns den langweiligen Küchenmeister.“
„Aye, Sir.“
Der Stückmeister stapfte aus der Kammer hinaus ins nasse Dunkel und enterte auf die Kuhl ab. Ein lauter Stimmenwechsel war zu hören. Kurze Zeit später schleppten zwei Mann im Schutz eines Fetzens Leinwand die Schalen und Schüsseln in die Kapitänskammer.
Als Ruthland roch und sah, was der Koch zubereitet hatte, vergaß er vorübergehend seine schlechte Laune. Seine Worte waren undeutlich, weil er auf dem Fleisch herumkaute.
„Mit dem Proviant haben wir keine Schwierigkeiten. Eigentlich wollte ich hier im Wald nach Früchten suchen lassen. Aber daraus wird wohl nichts bei dem ständigen Regen.“
„Vergiß es. Wir haben genug in der Proviantlast.“ Lefray grinste in sich hinein. „Wenn wir mit unserem Vorhaben fertig sind, können wir noch nach Pilzen suchen.“
Es war ohnehin eine blöde Idee, zwischen den Bäumen und Sträuchern herumzukriechen und nach Beeren und Früchten zu suchen. Aber immer redete der Alte davon. Er selbst ging bestenfalls ein Dutzend Schritte weit in den Wald, lehnte sich gegen den Baumstamm und brüllte Befehle in alle Richtungen. Hugh kannte das zur Genüge.
„Ich übernehme die nächste Wache“, sagte er, als er satt war. „In der Nacht wird es wohl keinen Ärger geben.“
„Was weiß ich! Schon gut.“
Ruthlands Gesichtsausdruck ließ erkennen, daß er nachdachte. Er plante schon für den nächsten Morgen. Hugh Lefray war zufrieden darüber, denn bisher war ihnen fast alles geglückt, wenn es Ruthland genügend lange und gut vorbereitet hatte.
Bis auf die Sache in Surat. Da war mehr fehlgeschlagen, als sie vorausgesehen hatten.
Es regnete ununterbrochen bis drei Stunden nach Mitternacht.
Die Blätter der Baumkronen schüttelten sich, der Wind rauschte und gurgelte rund um die „Ghost“ im Dschungel. In die winzige Bucht hinter dem Geländevorsprung drangen nur die Ausläufer von Wellen, die sich über den trockenfallenden Sandbänken und dem Wall aus Treibgut brachen.
An den Baumstämmen rann das Wasser in breiten Rinnsalen hinunter. Die Wachen, die an Deck der Karavelle unter den Segeln und den ausgespannten Persenningen saßen und standen, hörten nichts anderes als die Geräusche des Monsunregens und des Windes.
Die „Ghost“ gierte, und die Festmacher, die zum Land geführt und an Deck wieder an den Klampen belegt waren, scheuerten an den Uferbäumen. Die Crew schlief ruhig, ebenso der Kapitän, doch durch seine Träume spukten die Schebecke und der Seewolf.
Die Menge des Wassers, das aus den schweren Wolken fiel, ließ von Stunde zu Stunde nach. Vereinzelt blinkten durch die Regenschleier undeutlich die Sterne. Schließlich tropfte Wasser nur noch von den Baumkronen. Pugh, der Schiffszimmermann, trat unter der triefenden Leinwand hervor und ging langsam am Steuerbordschanzkleid entlang.
Coughlan rief ihn an. „Alles ruhig? Alles in Ordnung?“ fragte er und schob den Kopf unter den Planken des Achterdecks hervor.
„Der verdammte Regen läßt nach“, erwiderte Pugh. „Endlich.“
Die Kerle blieben unter den Wanten stehen und starrten nach oben. Die wenigen Sterne wurden deutlicher und heller, an anderen Stellen rissen die Wolkenbänke auseinander.
„Der Alte will am Morgen ankerauf gehen?“
„Ja. Hat er gesagt. Wir werfen beim ersten Licht die Leihen los.“ Pugh wischte mit dem Ärmel über sein Gesicht. „Das Versteck ist gut, wie?“
„Hier könnten wir einen Monat lang liegen, und niemand würde uns entdecken, nur vielleicht die Fischer“, erwiderte Coughlan.
„Keiner will so lange warten“, brummte Pugh. „Wir wollen den Seewolf schnappen.“
„Wir müssen ihn finden. Oder er findet uns!“
Coughlan grinste in der Dunkelheit. Über dem Schiff strahlten jetzt die Sterne. An wenigen Stellen trockneten die Planken auf und färbten sich heller als die Umgebung. Auch mitten in der Nacht hatte die feuchte Wärme nicht nachgelassen. Zwischen dem Wasser und dem festen Ufer raschelten unsichtbare kleine Tiere.
„Wahrscheinlich sucht uns Killigrew ganz woanders. Aber in ein paar Stunden sind wir klüger.“ Pugh nickte, drehte sich um und ging vorsichtig hinüber zur anderen Seite der Karavelle.
Je länger die Männer auf die Morgendämmerung warteten, desto unruhiger wurden sie. Immer wieder starrten sie über das schwarze Wasser, als erwarteten sie, daß von dort ein riesiges Enterkommando lautlos nahte.
Die Schritte der Posten blieben leise. Wieder schüttelten sich die Bäume unter einer Bö. Tropfen prasselten auf die Planken hinunter. Das laute Schnarchen unter Deck riß plötzlich ab, es polterte dumpf, dann war wieder Ruhe.
Noch höchstens vier Stunden, bis die Sonnenstrahlen auch in diesen Winkel drangen.
4.
Auf der „Zuiderzee“ herrschte die Ruhe der Erschöpfung. Kapitän Willem van Stolk lag wie ein Toter in seiner Koje. Nur das Geräusch der tiefen, röchelnden Atemzüge verriet, daß van Stolk lebte.
Einunddreißig Seeleute an Bord der niederländischen Karavelle waren an diesem Abend genauso erschöpft wie der Kapitän. Drei Mann befanden sich als Wache an Deck, triefend naß, mit gesenkten Schultern und Köpfen und gähnend. Sie waren selbst zum Fluchen zu müde.
Antony Leuwen hockte auf der zweituntersten Stufe des Niederganges und hatte die Ellbogen auf die Knie gestützt. Sein Kinn ruhte auf den Handflächen. Aus seinem kurzen Kinnbart tropfte das Wasser zwischen seine Füße. Er fühlte sich, als habe man ihn gekielholt und ausgepeitscht. Jeder Muskel schmerzte. Der dreißigjährige Bootsmann wartete nur noch auf das Glasen und die Wachablösung, dann konnte er seine müden Knochen lang ausstrecken.
Swieten, der Schiffszimmermann, schleppte sich von Backbord herüber und ließ sich schwer auf die Stufe fallen. Sein schwarzes, kurzes Haar klebte an seinem kantigen Schädel.
„War knapp, Antony, nicht wahr? Ausgerechnet der Spant und die Beplankung.“
Die Planken und der Spant, von Trockenfäule reichlich befallen, hatten die leichte Ramming mit einer Mangrovenwurzel nicht überstanden. Die Wurzel unterhalb der Wasserlinie waren hart wie Eisen gewesen. Vor einer Stunde hatten sie das letzte Wasser aus der Bilge gelenzt.
„Das ist immer so“, erwiderte der Bootsmann und riß den Mund weit auf. Die Wangenmuskeln schmerzten schon vom vielen Gähnen. An die vielen Schnitte, Schrammen und blaue Flecken dachte er dabei nicht.
Das Schiff stank nach fauligem Schmodder und Gammel aus der Bilge, nach dem heißen Pech und nach vielen anderen wenig angenehmen Gerüchen.
„Immer unter der Wasserlinie“, knurrte der Schiffszimmermann. „Aber wir haben die gute alte ‚Zuiderzee‘ wieder sauber geflickt.“
„Das Unterwasserschiff ist dicht“, bestätigte Antony Leuwen und gähnte wieder.
Die „Zuiderzee“ und ihre holländische Mannschaft hatten Glück im Unglück gehabt. Seit Wochen segelten und kreuzten sie in diesen Gewässern, das Land in Sichtweite. Die Seiten des Logbuchs füllten sich mit Eintragungen, die wenigen Karten, die Willem van Stolk mitführte, wurden von Tag zu Tag genauer.
Die „Vereenigte Oast-Indische Compagnie“ hatte die Karavelle ausgerüstet und zu diesem fernen Ziel geschickt. Bis zu dem Augenblick, als van Stolk zu nahe an die Flußmündung herangesegelt und das Schiff von der Strömung mitgerissen worden war, hatte es nur wenige wirklich gefahrvolle Momente gegeben.
Greefken, der irgendwo neben dem Ruder im Dunklen saß, drehte die Sanduhr um. Das Glasen hallte über das nasse Deck. Der Bootsmann packte den Handlauf und zog sich ächzend in die Höhe.
„Hoffentlich muß ich die Ablösung nicht an Deck prügeln“, murmelte er und schlurfte zum nächsten Niedergang.
Swieten blieb sitzen und fühlte, wie ihm die Augen zufielen. Jetzt war er sogar zu schlapp zum Gähnen.
Die „Zuiderzee“ lag in einer Bucht, die nach Nordosten offen war. Der trockengefallene Boden bestand aus schlickigem Lehm. Bei höchstem Stand der Flut hatten sie dicht vor dem Ufer den Anker geworfen und das Heck zum Strand schwojen lassen.
Die drei Mann der Ablösung, Taesert, Geuze und Overleek, stolperten an Deck. Sie hielten freiwillig die Köpfe in den niederprasselnden Regen.
„Bringt Swieten nach unten“, sagte Antony halblaut. „Und zieht ihm die Stiefel aus. Brecht ihm aber nicht die Zehen.“
Er selbst war barfuß. Von den vielen Füßen der Crew war auch jede Planke des Decks gezeichnet. Nasser Schlick war überall verteilt und verschmiert. An einigen Stellen lagen Werkzeuge herum. Der lange Regen hatte Sand und Schmutz über das gesamte Deck verteilt.
„Verstanden, Bootsmann“, lautete die Antwort der Seeleute. Sie trugen den Schiffszimmermann, der mit seinen wenigen Leuten die meiste Arbeit geleistet hatte, unter Deck.
Die „Zuiderzee“ war bei einsetzender Ebbe auf den weichen Grund gesetzt worden. Die gesamte Mannschaft schuftete und half, ohne daß der Kapitän jemanden anzutreiben brauchte. Die Jakobsleiter wurde ausgerollt, und je mehr das Wasser fiel, desto besser konnte an der Außenbeplankung gearbeitet werden. Mit schmatzenden, gurgelnden Geräuschen sackte der Kiel tiefer in den Schlick.
Die morschen, gebrochenen Planken wurden, halb unter Wasser, herausgestemmt und ersetzt, während von binnen möglichst viele Platten, Leinwand und Stoff gegengehalten wurden. Ununterbrochen arbeitete die Pumpe und lenzte Wasser nach außenbords.
Die Holländer standen im warmen Wasser und arbeiteten. Schließlich konnte der Rumpf gekrängt werden, so daß das Leck über dem Wasserspiegel lag.
Jetzt drang kein Wasser mehr ein. Auch von innen, vom Laderaum aus, konnten die Männer arbeiten. Sie ersetzten eins der morschen Teile nach dem anderen. Der Kapitän stand an der Pumpe und lenzte, auch der Erste schuftete und war schweißüberströmt. Schließlich gurgelte der letzte dünne Wasserstrahl aus der Öffnung des Pumpenrohres.
Die Unruhe im Schiff weckte schließlich, jetzt, zwischen Mitternacht und Morgen, Martin Lemmer, den Ersten Offizier, auf. Barfuß schleppte er sich an Deck und versuchte, dem Regen auszuweichen. Schwach lag der Schein der blakenden Hecklaterne auf dem nassen Deck.
„Welch ein Saustall“, murmelte Lemmer. „Die Kerle müssen richtig zusammengebrochen sein.“
Er spürte seine eigene Schwäche und grinste. Langsam tappte er entlang des Schanzkleides und wich den Spänen, Plankenstücken und Pützen aus. Vor einer Culverine blieb er stehen und erinnerte sich daran, daß vor weniger als vierundzwanzig Stunden der Kapitän noch überlegt hatte, ob die Geschütze mitsamt den Lafetten an Land gebracht werden sollten.
Dieser Dries Versteeg, dachte der Erste zufrieden, fast bewundernd, er hat seine verdammten Geschütze sogar schußfertig. Aber Feuergefechte wird’s heute nacht wohl keine geben.
Er nickte der Wachablösung zu und blieb unter der Fock stehen, die als Regenschutz schräg über das Vorschiff gespannt war. In der Mitte hing sie schwer durch, dort hatte sich das Regenwasser gesammelt. An den fremden Küsten dieses unbekannten Teiles der Welt war es warm. Unter den Umständen der letzten Tage hatte diese Wärme das Schiff und die Mannschaft vor Schlimmerem bewahrt.
„Vorderindien“, sagte Lemmer leise vor sich hin und wußte, daß es die richtige Entscheidung war, die Crew so lange wie möglich schlafen zu lassen und dann mit einem kräftigen Essen zu versorgen, „eine schöne Begrüßung hält das Land für uns bereit.“
Sie waren den Portugiesen davongesegelt, hatten Piraten unbekannter Nationalität abgewehrt, kein Mann war ernsthaft krank geworden oder gar auf See geblieben. Die Stürme hatten die „Zuiderzee“ arg gezaust und gebeutelt, aber nicht wirklich in Gefahr gebracht.
Martin Lemmer fuhr mit der Hand über sein Kinn. Die Bartstoppeln kratzten. Er winkte ab, gähnte und verzog sich wieder in die warme Koje, in der es nicht weniger als im übrigen Schiff stank. Trotzdem schlief er binnen Minuten erneut ein.
Die Stunden schlichen dahin, und aus dem Wolkenbruch des frühen Abends wurde im Verlauf der Nacht ein dünnes Nieseln. Zwei Stunden vor Sonnenaufgang vertrieb der Monsunwind die Wolken und den Regen völlig.
Es merkte kaum einer der Männer unter Deck, wie die Flut das Wasser in die Bucht zurückbrachte und schließlich ein langes Zittern und ein stärkerer Ruck durch den Rumpf ging. Masten und Tauwerk schienen sich zu schütteln, aus der Fock schwappte klatschend das Wasser heraus und verbreitete sich auf den Decksplanken.
Als Kapitän van Stolk aufwachte, schwamm sein Schiff wieder. Unter dem Kiel waren fünf Handbreiten Wasser, die Ankertrosse hatte sich ebenso gespannt wie die beiden Leinen zum Land.
Zeeren und Samuel, die Köche, hatten ihr Geschirr auf die Kuhl geschleppt. Der Hunger und noch mehr das Aroma aus den Mucks des Ersten und des Kapitäns, feinster Rum nämlich, brachten einen nach dem anderen auf die Beine. Mit verschlafenen Augen, schweißverklebtem Haar und unrasiert erschien die Crew des holländischen Handelsschiffes auf der Kuhl.
„Hoffentlich seid ihr einigermaßen wach“, sagte Willem van Stolk und setzte sich auf ein leeres Wasserfäßchen. „Nach dem Freudenmahl wird erst mal das Schiff aufgeklart.“
„Schon gut, Willem“, antwortete Martin Lemmer in gemütlichem Tonfall. „Ich kümmere mich darum. Wir haben das Aufklaren genauso nötig wie unser alter Kasten.“
„Ich hab’s nicht eilig“, sagte der Kapitän und blinzelte in die Sonne. „Meint ihr, daß wir morgen früh weitersegeln können? Schließlich sind wir nicht nur zum Ausschlafen hier.“
„Das habe ich gemerkt.“
Martin Lemmer setzte sich neben den Kapitän und ließ es sich, ohne viel dabei zu reden, genauso schmecken wie die anderen Seeleute. Die zweite Portion Rum gluckerte in die Becher.
„Ist das Leck völlig dicht?“ fragte der Kapitän nach einer Weile.
Swieten legte die Hand an die Stirn und nickte. „Ich habe alle Planken kontrolliert, ebenso die Plankennähte. Leckstellen habe ich nicht mehr feststellen können.“
Die Sonne war höher geklettert und leuchtete über die Wipfel der Bäume in die kleine Bucht und auf die „Zuiderzee“. Aus der dumpfen Schwüle war trockene Hitze geworden. Willem van Stolk stand auf und ging zwischen den Männern der Crew hindurch bis zum Schanzkleid zwischen der Back und dem Galionsdeck. Schweigend musterte er das Ankertau und die kleinen Wellen, die sich am Bug der Karavelle brachen. Im klaren Wasser huschten Fischschwärme hin und her und führten gleichzeitige Wendungen aus.
„Gut so“, meinte der Kapitän zu sich und ging zu seiner Crew zurück. „Wir brauchen nicht zu verholen. Das Schiff liegt gut und sicher, denke ich.“
Er wandte sich an einen Koch und sagte: „Wir brauchen heißes Wasser. Ziemlich viel. Das Schiff sieht genauso verwahrlost aus wie wir alle. Die ‚Zuiderzee‘ ist schließlich kein Seelenverkäufer.“
„Verstanden, Schipper“, sagte der Erste. „Wir wollen ja auch bei den eingeborenen Fischern und Muschelsammlern einen guten Eindruck hinterlassen.“
Van Stolk lachte. „So ist es.“
Willem van Stolk, vierundvierzig Jahre alt, war weder ein Antreiber noch ein Kapitän von der Sorte, die es nicht vertragen konnte, wenn es der Crew gutging und die Seeleute sich ausruhten. Die Crew stammte fast vollzählig aus demselben Ort und segelte schon seit langer Zeit auf der „Zuiderzee“ zusammen.
Wenn es sein mußte, schufteten sie vierundzwanzig Stunden ununterbrochen und wie die Wilden. Das hatten sie während der beiden vergangenen Tage wieder einmal bewiesen. Jetzt wollte er es langsam angehen lassen, er brauchte ebenso Erholung wie seine Leute. Er lehnte sich gegen das Schanzkleid und hielt dem Koch auffordernd den leeren Becher entgegen.
„Noch einen Schluck“, schlug er vor, „dann fangen wir an, Leute.“
Nachdem die Köche das leere Geschirr eingesammelt hatten und der letzte Rum getrunken war, ging die Crew daran, das Schiff aufzuklaren. Sie holten eine Pütz nach der anderen voller Salzwasser an Bord, schrubbten die Decksplanken, schossen die Leinen auf und spülten den Schlick durch die Speigatten und die Öffnungen im Schanzkleid außenbords.
Ein paar enterten über die Wanten auf und brachten die Rahruten und die Schoten in Ordnung. Swieten, der Zimmermann, und der Kapitän packten zwei Lampen und stiegen in den Kielraum hinunter.
Mit dem Stiel des Kuhfußes prüfte Swieten die Planken. Das Geräusch klang vertrauenerweckend.
„Gute Arbeit, Swieten“, sagte van Stolk. Er fuhr mit der Hand über die neu eingesetzten und gegengenagelten Teile. „Hält das die Rückfahrt auch noch aus?“
„Das weiß ich nicht“, erwiderte der Zimmermann. „Hier jedenfalls sind die Planken dicht. Ich habe alles angeschaut und abgeklopft, auch von außenbords.“
„In Ordnung“, sagte der Kapitän. „Die Luken offenlassen und holt die Ballen zum Trocknen an Deck, solange es nicht regnet.“
„Habe ich schon angeordnet“, antwortete Martin Lemmer und deutete nach oben. „Luken und Grätings sind offen, die Grätings werden geputzt. Und dann hieven wir das nasse Zeug an Deck.“
„Gut. Dann kann ich mich also in Ruhe rasieren, wie?“ fragte der Kapitän und nahm die Lampe vom Haken.
„Selbstverständlich. Ich hab’s auch vor.“
„Dann hätten wir dieses Abenteuer auch wieder überstanden“, murmelte der Kapitän. Sein Tonfall drückte seine Zufriedenheit aus.
Er stieg vom Bug bis zum Heck durch alle Laderäume und inspizierte jeden Winkel zwischen und hinter dem Ladegut. Immer wieder klopfte er mit dem Messergriff gegen das Holz und lauschte auf den Klang. Schließlich enterte er wieder aus der stickigen Tiefe an Deck.
„Alle herhören!“ rief er. „Wir klaren auf und legen einen Ruhetag ein. Morgen früh gehen wir wieder in See. Beeilt euch mit der Ladung – keiner weiß, wann es wieder regnet.“
„Jawohl, Schipper!“ schrien die Männer voller Begeisterung.
Der größte Teil der Decksplanken war mittlerweile so sauber, wie es sich für ein gutgeführtes holländisches Kauffahrerschiff gehörte.
Bis Mittag hatten die Holländer in strahlendem Sonnenschein und der trockenen Hitze ihre „Zuiderzee“ auf Hochglanz gebracht. Kapitän, Erster und Bootsmann wuschen sich das Haar, stutzten die Bärte und schabten sich die Stoppeln vom Hals und von den Wangen.
Greefken war über die Wanten in den Großmasttopp aufgeentert und suchte die Umgebung mit dem Spektiv des Kapitäns ab.
„Was siehst du durch den Kieker?“ rief Antony Leuwen von der Kuhl. „Nur Wasser und Vogelschwärme, wie?“
„Und Fischerboote. Mehr als ein Dutzend. Dort drüben, an Backbord, muß ein Fischerdorf sein!“ rief der Ausguck, ehe er den Kopf drehte und über die Bäume des Ufers hinwegzublicken versuchte. Seit Sonnenaufgang kreisten die Vögel über der Bucht. An die verschiedenen Laute der Tiere, von denen sie nur selten eins sahen, hatten sich die Holländer inzwischen gewöhnt.
„Bewegen sich die Fischerboote auf uns zu?“ wollte der Erste wissen. Er trocknete mit einem leidlich sauberen Tuch sein Haar und wischte den Schaum aus dem Gesicht.
„Nein, Martin. Sie haben uns zwar gesehen, aber wir sind für sie nicht wichtig. Vielleicht wissen sie, daß keiner von uns gern Fisch ißt.“
Die Crew brach in Gelächter aus. Durch die Luken wurden feuchte oder nasse Ballen und Kisten aufwärts auf die trockenen Planken gehievt. Die Crew riß die Deckel auf, schlug die Leinwand um die Planken auseinander und zerrte das nasse Zeug in die Sonne.
Die Köche brutzelten und kochten unter Deck, nachdem sie das Essen im hellen Sonnenschein vorbereitet hatten. Um die Abfälle, die über das Schanzkleid flogen, versammelten sich die Fische.
„Ein guter, ruhiger Tag“, sagte der Kapitän schließlich. Er saß mit nacktem Oberkörper in der Sonne und schaute sich die Umgebung in aller Ruhe durch das Spektiv an. Er hatte das Schiff tatsächlich an eine kaum bewohnte Stelle der Küste gesegelt. Größere Siedlungen gab es wohl weiter im Osten oder mit Gewißheit an der Ostküste im Süden des Landes.
Ein paar Männer wuschen ihre Hemden, einige rasierten sich, drei Mann lagen auf der Back und dösten im Schatten. Der Rumpf der „Zuiderzee“ hob und senkte sich in den Wellen und zerrte an den Tauen. Martin Lemmer schaute nach den Wasserfässern und entschied, daß der Vorrat reichte.
Ohne Eile wurden die trockenen Kisten wieder in die Laderäume abgefiert. Durch die offenen Luken zog muffiger Dunst ab. Dries Versteeg, der Stückmeister, kümmerte sich schweigend um die Culverinen und putzte die Drehbassen, nachdem er die Rohre gesäubert und getrocknet hatte.
„Willst du die Fischerboote bekämpfen, Dries?“ rief Antony.
„Ganz bestimmt nicht. Aber Feuchtigkeit in den Rohren, das ist nicht mal für leere Geschütze gut.“
„Recht hat er. Laß dich nicht aus der Ruhe bringen“, sagte Greefken.
Am Schanzkleid, in den Wanten und überall im Tauwerk hingen die hassen Tücher und Kleidungsstücke. Die Sonne brannte fast senkrecht aus einem wolkenlosen Himmel herunter. Vermutlich würde der Regen nicht bis zum Abend auf sich warten lassen. In den zurückliegenden Tagen hatte es fast regelmäßig am späten Nachmittag zu regnen angefangen.
Die Mannschaft klarte auch unter Deck auf, die Kojen wurden ebenso gelüftet wie die Kammern. Der Erste und der Navigator überprüften die Karten, ließen sich nach dem Essen ein paar Becher Wein bringen und sagten sich, daß die Stunden des Nichtstuns ohnehin so selten waren. Viele Arbeiten, für die sonst keine Zeit blieb, wurden am Nachmittag zumindest angefangen.
Vier Stunden vor der Abenddämmerung hatte sich der Himmel mit dunklen Wolken überzogen.
„Wir müssen das Deck räumen!“ rief Willem van Stolk. „Und dann zurrt die Persenninge über die Grätings.“
„Verstanden, Willem.“
Der Erste stand auf und steckte das Messer, mit dem er die Fingernägel geputzt und geschnitten hatte, in den Stiefelschaft.
„Packt mit an“, sagte er. Ein Stück Ladegut nach dem anderen, leidlich trocken, wurde durch die Luken gehievt. „Das Deck wird gleich wieder von selbst gespült.“
Eine halbe Stunde danach sammelten die Holländer ihre trockenen Hemden und Tücher ein. Vor der Sonne, die über den Baumwipfeln des Uferwaldes hing, schob sich die erste graue Nebelwolke.
„Das war’s“, sagte Willem van Stolk und rieb einige Tropfen Öl zwischen den Handflächen. Dann verteilte er das Öl in seinem Gesicht. „Der Regen ist pünktlich.“
Die Helligkeit nahm ab, aus den treibenden Wolken wurde eine zusammenhängende dunkle Wand. Der Wind, der durch die Bäume fauchte, kräuselte die Wellen der Bucht und ließ die „Zuiderzee“ schwanken. Die Blicke der Holländer wanderten zum Himmel, aber noch regnete es nicht. Martin Lemmer teilte die Wachen ein und stellte das Kommando für den nächsten Morgen zusammen.
„Wir gehen ankerauf und steuern, solange der Wind nicht zu stark ist, nach Südosten“, sagte er. „Auf den Karten habe ich zwei Häfen ausgemacht: Bharuch und Khambhat. Je nachdem – einen laufen wir an. Also: zuerst einen Becher Tee, ein Stück Brot, und dann staken wir aus der Bucht.“
„So halten wir’s“, sagte der Stückmeister:
„So versuchen wir’s jedenfalls“, schloß der Kapitän und verschwand in der Kapitänskammer.
Es dauerte noch eine Stunde, bis die Monsunwolken den gesamten Himmel bedeckten und die Windstöße schwere Regentropfen heranwirbelten. Auf den trockenen Planken erschienen unzählige kleine Punkte, und schließlich folgten die Regengüsse in schrägen Bahnen. Binnen weniger Atemzüge waren die Ränder der Bucht hinter den graublauen Vorhängen aus Wasser unsichtbar geworden.
Die Mannschaft der „Zuiderzee“ verzog sich unter Deck und wartete, während das Rauschen und das Plätschern über ihnen immer lauter wurde.
Kapitän Philip Hasard Killigrew stand schräg hinter dem Rudergänger und hielt sich an einem Fall fest. Die Schebecke kreuzte gegen Wind und Strömung, Kurs Süden lag an. Die Sicht betrug nicht mehr als eine Kabellänge. Die Männer, die sich noch an Deck aufhielten, trugen die langen Segeltuchjacken und troffen, wie alles andere, vor Nässe.
Pete Ballie umklammerte die Pinne, die Schebecke krängte nach Backbord. Der Bug hob und senkte sich und setzte krachend in die See. Ein salziger Schauer wehte vom Bugspriet her und stob über die Decksplanken.
„Eine feine Segelei ist das aber nicht, Sir!“ schrie Pete und stemmte sich gegen das nasse Holz der Pinne. „Wo sind wir eigentlich?“
„Auf jeden Fall weit von Ufern und Sandbänken entfernt, Pete!“ rief der Seewolf zurück. „Du hast recht. Wir hätten irgendwo vor Anker gehen sollen.“
„Zu spät jetzt.“
„Stimmt“, antwortete Hasard. „Noch ein paar Stunden, dann ist alles vorbei. Dann sehen wir auch, wo wir sind.“
„Hoffentlich.“
Der Regen war warm wie immer in diesen Tagen und Nächten. Leichter Dunst zog auf, die Wellen waren weniger hoch als befürchtet. Wenn die Karten richtig gezeichnet waren, und bisher waren sie erstaunlich genau gewesen, dann befanden sie sich jetzt etwa querab der Narbada-Mündung. Der Seewolf überlegte, ob es Zeit für die nächste Kursänderung sei. Schließlich wollte er nicht weiter südlich, womöglich nahe Surat, nach Ruthland suchen, sondern im Westen der trichterförmigen Bucht.
„Wir fallen nach Westen ab!“ rief er.
Ben Brighton zeigte von der Kuhl her klar. Das matte Licht der Hecklaterne reichte gerade bis zum Großmast.
„Abfallen, Pete“, befahl Hasard.
Die Schoten wurden gefiert, während Pete Ballie Ruder legte.
Jeder, der in diesem scheußlichen Regen an Deck stand, starrte in die Dunkelheit hinaus und versuchte zu erkennen, in welchem Fahrwasser sich die Schebecke befand. Aber es gab nichts anderes zu sehen als dunkle Wellen mit winzigen Schaumkronen, und auch die Geräusche ließen nicht erkennen, ob Untiefen oder Riffe lauerten.
Der Bug der Schebecke hatte sich westwärts gerichtet. Die Dreieckssegel waren getrimmt, die Schoten belegt. Der Regen fiel jetzt von Backbord ein.
Der Seewolf fühlte sich noch immer unbehaglich wie seit Anbruch der Nacht. Längst hatte er eingesehen, daß es besser gewesen wäre, irgendwo in Ufernähe vor Anker zu gehen.
„Ich kann nur hoffen“, sagte er halb zu sich selbst, „daß die Sonne uns zuliebe etwas früher aufgeht.“
Die Schebecke schob sich weiter durch Regen und Dunkelheit. Die Männer hofften, am nächsten Tag auf die „Ghost“ zu stoßen. Und dann würden die Kanonen sprechen.
5.
„Alle Mann an Deck!“
Francis Ruthland beugte sich weit über das Schanzkleid. Der Bug der „Ghost“ driftete, Handbreite um Handbreite, durch das pechschwarz erscheinende Wasser. Die Männer stakten von der Kuhl aus mit den Riemen, stemmten deren Blätter gegen die Hochwurzeln der Mangroven und schoben das Schiff aus dem Versteck.
Die Enden der Rahruten schrammten an den Lianen entlang. Als sich der Bugspriet um die Krümmung schob, blinzelte Ruthland überrascht. Vor der Karavelle stand eine dünne Nebelwand, von der die Sicht auf das freie Wasser versperrt wurde.
Luftblasen platzten an der Oberfläche des ruhigen Wassers. An der Bordwand rieben sich federnd die Äste, die Halme von bambusartigen Gräsern raschelten.
„Gut so!“ rief Francis Ruthland. „Bringt das Heck mehr nach Backbord! Verdammter Dunst.“
Die Morgendämmerung war kurz, die Helligkeit nahm zu. Noch leuchtete die Sonne nicht durch den Nebel. Die Riemen polterten, das Wasser plätscherte, und die Vögel lärmten an Land und über den Masttopps.
Knarrend schwang das Heck herum. Eine Reihe nachdrücklicher Stöße der Riemen, teilweise gegen das Ufer, teilweise im Wasser und im schlickigen Grund, schoben die „Ghost“ in den Nebel und in Richtung des freien Wassers.
Hugh Lefray gab das nächste Kommando. Die Geitaue des Focksegels wurden gelöst, das Segel, noch naß vom nächtlichen Regen, sackte schwer nach unten und sprühte einen Tropfenregen nach allen Seiten. Wieder schoben die Ruderer an, die Karavelle kam gut frei und verschwand im Dunst. An Backbord erschien im Nebel ein hellerer Fleck, der anzeigte, daß die Sonne sich über die Kimm hob.
„Weiter draußen“, rief Ruthland, „löst sich der Nebel auf! Spätestens in einer Stunde. Und dann geht’s nach Süden!“
„Ich denke, wir gehen auf den Seewolf los?“ schrie Lefray vom Quarterdeck.
Giftig erwiderte der Kapitän: „Was meinst du, wo wir den Bastard treffen?“
„Na gut, im Süden. Und woher weißt du das so genau?“ fragte der einäugige Kumpan.
„Weil er uns im Süden sucht. Deswegen“, lautete die Antwort.