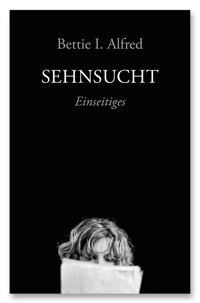
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: onomato
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sehnsucht ist eine Sammlung von den besten Tageseinträgen und Kurztexten aus Frau Alfreds Schaffen der letzten zehn Jahre. Wie schon in ihrem Hörspiel Zauderwut treffend beschrieben, geht es bei Alfreds Werken immer um das unfreiwillig wirkende Zurückhalten einer Kraft, die sich jedoch trotz Zauderei immerzu einen Weg in ihre Texte bahnt. Ihre Sprache ist dabei sehnsüchtig und voller aufrichtiger Melancholie, die jedoch durch ihren prägnanten Alfredhumor immer auch den Weg ins Triumphale haben kann. Das Innenleben muss das Aussen überbieten, ist die Überschrift des ersten Kapitels ihres ebenso ersten Buches namens Sehnsucht. Dieses Überbieten des Aussens gelingt, indem Frau Alfred ihre sensiblen, oft komischen und gerne auch mal grotesken Lebensbeobachtungen in Worte fasst und sie zu manch bitterer Praline des Glücks werden lässt. Frau Alfred`s Stil, bekannt aus ihren zahlreichen Hörstücken, die sie selbst schreibt und einspricht, ist auch in der Textsammlung Sehnsucht, irritierend kraftvoll zugegen und gibt Einblick in ein Schreiben, in dem jeder sich selbst sein darf und soll. "Die Faszination dieser Texte besteht darin, dass sie den Sinn finden im objektiv Sinnlosen und einem mit Gedanken unterhalten, auf die man selbst so nie gekommen wäre.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zur Autorin
Bettie I. Alfred, schreibt, hörspielt, spricht und collagiert. In den Arbeiten der Berliner Autorin geht es meist um eine empfundene kosmische Einsamkeit, die immerfort nach Überwindung schreit. Diese Überwindung scheint zu gelingen, in dem Alfred durch ihre genauen Beobachtungen, die immer mit einem tiefgreifenden Humor und einem analytischen Blick für das (Ur-) Menschliche einhergehen, Gedankenwelten erschafft, die sie wie Quietive oder Leitfäden durch ein immerzu vibrierendes Innenleben führen. Frau Alfred ist es ein Anliegen, die tristen Seiten des Lebens anzuerkennen und sie mit den durchaus ja auch ab und an erstaunlich schönen zu verbinden. Die Sprachlosigkeit zwischen den Zeilen interessiert sie dabei mehr, als die Tatsächlichkeiten in Worten. Der Wiederspruch, ein aufregendes Mitglied, in ihrem Ensemble.
Ihr Hörspiel Zauderwut wurde im Dezember 2020 von der Akademie der darstellenden Künste zum Hörspiel des Monats ausgewählt und Alfred vom SRF als die Meisterin des schwermütigen Humors im Auditiven bezeichnet.
Impressum
ISBN 978-3-949899-34-8
ISBN der Druckausgabe 978-3-949899-13-3
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie deutsch Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Dieses Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlages unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
onomato Verlag, Düsseldorf
© Bettie I. Alfred, 2023
Umschlag-Foto: © Matthias Fluhrer / www.flupix.de
Einbandgestaltung: Bettie I. Alfred
1. Auflage 2023
© onomato Verlag Düsseldorf 2023
Alle Rechte vorbehalten
onomato.de
Bettie I. Alfred
Sehnsucht
Einseitiges
Vorwort
Glück ist, wenn man am Schreibtisch sitzend, sein Leben verbringen kann. So habe ich es zumindest als Kind gedacht, wenn ich den Vater, immerzu mit einem Stift in der Hand, dort sitzen sah. Ich bekam dann auch irgendwann einen Schreibtisch und fand es großartig daran zu sitzen. Ich spielte dann manchmal „Schriftsteller“ und schrieb den Anfang eines Buches: Ich heiße soundso, bin dann und dann, dort und dort geboren und wollte schon immer Schriftsteller werden. „In echt“ wurde ich dann aber eine ziemlich schlechte Schülerin und konnte schließlich gar nichts gut, außer zaudern. Mit dem Hörspiel Zauderwut, das ich irgendwann aufschrieb und schließlich auch umsetzte, wurde ich dann unverhofft einmal mit der Auszeichnung Hörspiel des Monats ausgezeichnet und dachte im ersten Moment, dass das ein Missverständnis sein müsste, so sehr war die Zauderei mit meinem Ich verwachsen gewesen.
Dann kam ich ein wenig in Schwung und schrieb und produzierte ein Hörspiel nach dem anderen. Doch mit einem Buch hat es trotzdem lange Zeit nicht hingehauen, obwohl die Schubladen überquollen. Ich war immerzu nicht sicher, ob ich eins zum Lachen, oder eins zum Weinen schreiben wollte. Dachte es sei unmöglich, das Komische und das Traurige zu vereinen, wollte immerzu den Widerspruch beseitigt wissen. Meine Mimosenhaftigkeit wurde daraufhin immer schlimmer. Bei der Arbeit an den Hörspielen habe ich dann gemerkt, dass diese aber doch meist alles zusammen sind: komisch, tragisch, merkwürdig, schwerlebig und doch heiter. Sie gefielen dann sogar Menschen, die sich persönlich für sie bedankten. Das Zaudern war zwar weiterhin Teil meines Charakters, das Losrennen aber eben auch. Es gehört ja auch alles zusammen, wie im Hen Kai Pan (Einheit des Alles), und somit müsste gar nichts weggelassen oder abgetrennt werden.
Dieses Buch ist eine bunte Ansammlung von Alltagstexten, die ich aus Wahrem und Erdachtem, aus Echtem und Phantasiertem, mit dem wachen Blick auf das urmenschliche Hadern, mit großem Spaß an der Sprache, aber auch oft mit Hängen und Würgen, in den letzten zehn Jahren erschaffen habe.
Schreiben ist für mich zu einer Art Kur geworden und, wenn ich es schaffe darin zu versinken, ist alles gut. Man darf beim Lesen lachen und weinen, sich wundern und fragen, was das eigentlich soll. Manches in den Texten ist, wie bei einem meiner großen Vorbilder, Thomas Bernhard, maßlos übertrieben, anderes ist genauso passiert, wie beschrieben. Und doch sind Empfindungen, wie es Rainer Rabowski einmal gesagt hat, ja meistenteils doch auch Erfindungen.
Bettie I. Alfred, Berlin-Schöneberg, am 15. Mai 2023
1
„Es dauert lange, bis man sich an sich gewöhnt hat“
(B. I. Alfred)
Müde Freunde
Müde mit dem befreundeten und ebenso ruhebedürftigen Schriftsteller im Park herumgesessen und Menschen mit Hunden beobachtet. Dann den Brief eines Professor Doktor aus dem Jahre 1976 vorgelesen, den dieser dem Autor nach Erscheinen seines Erstlings geschrieben hatte, fast zwei Seiten eng mit der Schreibmaschine beschrieben. Die Kritik erbarmungslos und großspurig. Ich brach dann ab mit dem Vorlesen. Mit dem habe er sich später dann noch getroffen, so der Schriftsteller. Wir machten dann Witze über diesen hochnäsigen Professor und erfreuten uns an dem strahlenden Himmel und den grünen Blättern.
Die Farben nun das Wichtigste und die Natur. Auch die Hunde seien Natur, sagt er und ich gebe ihm recht. Danach mache ich ihm sein Allerlei-Essen warm. Nudelsalat mit Linsensuppe, Joghurt und Orangensaft in einem, er mag das und als er die Schokoladenkekse sieht, greift er diese und bröselt sie dazu. Ob ich probieren wolle, fragt er dann und ich verneine. Dann lese ich noch was aus seinen Zimmer-Zetteln vor, die überall herumliegen. Ein paar Sätze über die Liebe: Wer sich aufdrängt, erweist sich nicht. Von Bedeutung ist nur Verschwiegenheit.
Ich frage, ob er das befolgt hätte und er lacht: „Natürlich nicht!“ „Wir Quatschtanten sind restlos verloren!“ entgegne ich und er nickt. Ich lese einen weiteren Satz:
Ohne Zeugen, ohne Zeugnisse, ohne Bezeugungen - wenn Liebe darauf verzichten könne - was gäbe es mehr?
Ich schweige. Dann verabschiede ich mich, der alte Mann ist müde. Ich klopfe ihm auf die Schulter, wie immer und würde ihm gern etwas Schönes sagen. Ich halte mich dann an den Satz und sage nur: bis übermorgen.
Nur ein Veilchen
Ich entdeckte eines Tages bei einem Spaziergang durch den Volkspark eine riesige Veilchenansammlung. Es duftete, als ich mich zu ihr hinunterbeugte derart betörend, dass ich nicht mehr aufhören wollte, den Duft in mich einzusaugen. Ich grub ein Veilchen samt Wurzeln aus und setzte es in einen Topf mit Erde. Gleich am nächsten Tag war es hinüber. Hätte ich es lediglich gepflückt und anschließend gepresst, hätte ich es aufkleben und jemandem schicken können. So konnte ich es, nach wenigen Tagen vollends vertrocknet, lediglich zum Anheizen in den Ofen werfen.
Man hätte es, so trocken, auch als Tee aufbrühen können. Veilchentee. Normalerweise sind Veilchen nicht giftig. Es gibt jedoch eine Sorte, die giftig ist. Das am meisten verbreitete Veilchen, ist das wilde Veilchen; das ist angeblich nicht giftig. Es gibt etliche Sorten, sie unterscheiden sich rein äußerlich wenig voneinander. Der Mutter gefiel es ganz allgemein, wenn ich über Veilchen sprach. Sie mochte Veilchen sehr. Das Veilchen schien so eine Art Außenseitergewächs zu sein. Es wächst ja meist wild und gilt in Fachkreisen sogar als Unkraut. Die Mutter konnte sich gut mit einem solchen Veilchen identifizieren. Mir ging es ähnlich. Ich war ja schließlich auch die Tochter meiner Mutter. Die Mutter liebte trotz allem die Romantik, auch die eines Veilchendaseins, das ja im Grunde genommen eher ein ganz unromantisches Dasein zu sein scheint. Es wächst meist mitten im Tumult, oder in Zaungrenzbereichen. Ich selbst bin unsicher, ob ich romantisch veranlagt bin, denn ich stehe oft inmitten eines borstigen Lebens herum, ganz fern meist von elefantenhautweicher Romantik. Ich bin auch sehr kritisch gegenüber zu viel Träumereien, mag es, wenn etwas ohne Verschleierungen auskommt.
Mir leuchtet ab und an sogar ein, was der Radikalphilosoph E.M. Cioran sagte, z.B., dass alle Sicherheiten im Leben als Scheinsicherheiten enttarnt werden müssen. Das leuchtet mir nicht nur ein, ich mache mich sogar ab und zu an die Arbeit. Die Tendenz von Leuten, Dinge schön zu reden, stört mich manchmal ungemein und ich präferiere in diesen Augenblicken Menschen, denen das Herz auf der Zunge liegt.
Betrifft der Realismus jedoch mich selbst, falle ich schnell in ein Loch und sehne mich wieder nach den Menschen, die ihr Herz lediglich dort tragen, wo es gewachsen ist.
Dass eine Veilchensorte existiert die giftig ist, fand ich dann phänomenal. Ein giftiges Veilchen, das war ein derartig schöner Gegensatz, dass ihn sich keiner hätte besser ausdenken können als Mutter (oder Vater?) Natur.
Die Situation mit den Veilchenansammlungen ist dann jedes Frühjahr aufs Neue etwas überwältigend Schönes. Ich kann dann, wenn ich in der richtigen Stimmung bin, und wenn ich mich genügend in seine Lage hineinsteigere, sogar über ein Veilchen, das ganz allein am Wegrand steht, ins Schluchzen geraten. Gehe ich weiter, ist alles schnell überstanden. Verweile ich dagegen, weitet sich die Situation meist unweigerlich zu einer Art cathastrophe minime aus. Ich überlegte dann einmal, als es wieder soweit gewesen war, dass ich heulend an einem Veilchen stand, mein Leben endlich so zu leben, als sei ich die Tochter von einer Margaret Thatcher, anstatt die einer romantisch denkenden Malerin. Diese ewigen Rührungen am Wegesrand - auf Dauer eine Zumutung.
Es ging dann tatsächlich voran. Als eingebildete Tochter einer Margaret Thatcher fiel mir dann vieles leichter. Doch schien mir dann auch etwas Entscheidendes zu fehlen: Die Sehnsucht.
Weil dann Sonne und Schönwetter zu Thomas Bernhard, den ich wegen seiner Kompromisslosigkeit verehre, nicht passt, habe ich den Tag dann in der dunklen, aber gemütlichen Werkzeugkammer, anstatt im großen sonnendurchfluteten Vorlesezimmer verbracht, und in ihr klammheimlich eine Lesung für die Katz gemacht. Ich las ihr, der Katze also, eine Erzählung über Michel de Montaigne vor. Die Erzählung, in der er den Konflikt beschreibt, der entsteht, wenn Eltern ihre Kinder ablehnen und dann aber so tun, als hätten die Kinder damit angefangen die Eltern abzulehnen, ging mir nahe. Es war Karfreitag und ich pilgerte, nachdem ich die Montaigne-Geschichte wieder beiseite gelegt hatte und die Katze eingeschlafen war, erneut zu meiner kürzlich entdeckten Veilchenkolonie. Ich grub diesmal nichts aus, aß jedoch stattdessen eins auf (wollte wissen, ob man den Duft auch schmecken kann). Es schmeckte nicht gut, aber auch nicht schlecht, keinesfalls aber so wie es roch, weshalb ich dann auf den Verzehr eines weiteren verzichtete. Kurz danach drückte es mir dann am Schädel; ich wurde unruhig. Hatte ich etwa die giftige Variante erwischt?
Ich malte mir dann aus, wie man mich tot im Veilchenbeet finden würde. Das Schädeldrücken war aber lediglich dem zu eng anliegenden Bügel der Sonnenbrille geschuldet gewesen.
Textwand I (ein Hauch von Ich)
Ich sage was und sage nichts und sage etwas Dummes und etwas Neunmalkluges und dabei bin ich da und doch weg, und alles ist eine Illusion und ich selbst womöglich nur ein Geist, nein kein Geist, bin ja doch deutlich zu sehen, als Mensch und bin ja auch ein lebender Mensch, ein denkender zwar nur bedingt, doch fühlen, das tu’ ich schon ab und an und will dann fast schon mehr davon und dann bricht es aber wieder ab, denn es reicht ja ohnehin alles nicht. Das Glas ist dann wieder halbleer und ich trinke es dann gleich ganz leer und dann ist eben nichts mehr drin und ich bekomme sofort wieder Durst und trinke dann lediglich die Luft, die übrig blieb. Von Luft sich ernähren hält schlank, doch was nützt das, wenn die Hose doch groß ist und nun schlenkert, am Bein, am Bauch, am Hinterteil, überall, ganz generell. Dann der Punkt, dass man aufgeben will, sich hinlegen, einschlafen, entschwinden, wohin, das weiß man dann noch nicht so genau, am besten aber schnell. Dann aber schleunigst noch die grauen Bilder anschauen, die, wo einmal Glück herrschte, wo einmal Hoffnung war, Hoffnung auf mehr, auf das Große, das Gute, das Herrliche, das Prachtvolle, Ungezierte, Ungekünstelte, Ungequälte, Ungezwungene, Unaffektierte, Ungeschraubte, auf das Echte. Doch dann wieder nur der Kompromiss aus alledem und dann wieder gar nichts. Nur ein Hauch von etwas, was dann dasteht, ganz pur, ganz allein, ohne Stickereien, ohne Schminke, ein Hauch von Ich. Ein Ich, wie es zu sein hat, erbärmlich und lächerlich, wie eh und je: ein Gestell aus Gummibändern, saumselig das Leben vertrödelnd im Ausharr-Modus, um nicht einfältig zu wirken, sondern stabil. Eine Gummibandstabilität rückt sich dann heraus und tastet sich davon. Endend in einer vor Pseudofröhlichkeit strahlenden Leichenkapelle ohne Sinn. Das Flickwerk Leben, die Löcher immer nur mit Ausschussware zugestopft, um wenigstens den kalten Luftzug zu verhindern.
Im ungeheizten Zimmer (bei ca.11 Grad) mit "Eisfingern" geschrieben
Fragen
Besuch vom Nachbarskind. Es ist ein relativ frisches Schulkind. Wir, Kind, Kater und der Mann, sitzen am Küchentisch und essen trockenen Kuchen. Es ist Ostern. Warum man Ostern sagt und wie das früher mit dem Jesus gewesen ist, will das Kind dann plötzlich wissen. Ich gehe schnell an den Herd. Ich kann unvorbereitet schlecht etwas erklären, schon gar nicht etwas in religiöser Richtung. Der Mann holt dann ein Buch aus seinem Zimmer und guckt mit dem Kind sakrale Bilder an. Ein Bild zeigt Jesus am Kreuz. Der Mann versucht dann einen Anfang: „Also, der mit der Buxe, der ist immer INRI.“
Das Kind stutzt. Was eine Buxe sei, fragt es. Ich gehe dann aus der Küche, in der das interessante Gespräch stattfindet, denn ich befürchte, dass weitere Fragen aufkommen werden und sich diese schließlich nicht mehr nur an den Mann, sondern bald auch an mich richten könnten. Ich setze mich dann auf die Couch im Wohnzimmer, wo man lediglich wohnt und nicht schläft, wie im danach benannten Schlafzimmer, und entdecke in einem herumliegenden alten Kursbuch (die Literaturzeitschrift), zufällig beim Herumblättern, ein Poster zum Herausnehmen. Ich nehme es heraus und entfalte es. Eine bunte Grafik ist zu sehen. Ein Stammbaum oder etwas in der Art. Darunter steht: Der quabalistische Lebensbaum mit den zehn Sephiroth, den zweiundzwanzig Pfaden und seinen entsprechenden Emanationen. Drei Fremdworte hintereinander, die ich allesamt nicht kenne. Das Kind kommt dann herein und guckt interessiert was ich mache. Ich erinnere mich wieder an die Küchensituation vor wenigen Minuten und dass das Kind nicht gewusst hatte was eine Buxe ist. Will dann gerne wissen, ob es inzwischen weiß was eine Buxe ist. Doch scheint das Thema dann ein völlig anderes zu sein. Es starrt auf das bunte Poster und schon gibt es eine neue Frage: „Was ist das?“ „Ein Poster!“, erwidere ich und falte das rätselhafte Papier schnell wieder zusammen. „Warum faltest du das Poster denn wieder zusammen? Willst du es nicht mehr anschauen?“ fragt das Kind dann ein wenig engstirnig. Ich verneine und erinnere mich an des Vaters Antwort, als ich ihn einmal gefragte hatte, was ich für ein Kind gewesen sei: „Du warst eine ewig fragende Nervensäge!“ hatte er damals ehrlich geantwortet. Das hatte mich dann getroffen.
„Wieso darf eure Katze nicht raus?“ fragt das Kind dann. Ich erkläre, dass die Katze, ließe man sie hinaus, nicht zurückkommen würde, dass sie aber sowieso gar nicht rausgehen wolle. Dann sei sie wohl keine Wildkatze, sagt das Kind, dann mehr als dass es fragt. Ich lache und bin dann unsicher, weil die Katze sehr wohl wild werden konnte und manchmal durch die Wohnung raste, als gäbe es kein Morgen. Dann ruft die Mutter des Kindes von unten und das Kind ist fort. Ich mag es, denn es fragt und will eine Antwort. Auf einer Internetseite lese ich dann etwas über die mosaische Sittenlehre. Gerade als ich mich in diese vertiefen will, kommt der Mann ins Zimmer. Wir lachen dann noch ein wenig über seinen Ausspruch, dass der mit der Buxe immer INRI sei.
Fühliges
Wäre ich ein Vogel, dann wahrscheinlich einer aus der Reihe der Rakevögel. Zu ihnen zählt unter anderem der Eisvogel. Eine hervorstechende Eigenschaft dieses kleinen, aber sehr cleveren Vogels, ist die Liederlichkeit mit der er sein Nest baut. Ich bin zwar durchaus ein Mensch, der nicht im Dreck verenden will, doch sehne ich mich ab und an nach einer Art Liederlichkeit, die mich auf neue Gedanken bringt. Das Schöne allein, so meine Erfahrung, kann nichts bewegen. Ich bin nicht dogmatisch, zumindest meistens. Winde mich aber ab und an doch lieber um etwas Störendes herum, als es aus dem Weg zu räumen. Ich versuche mich auch eigentlich ganz gerne an anstrengende Umstände anzupassen.
Momentan ist es kalt, die Wohnung ebenso und, anstatt mich darüber zu ärgern, ziehe ich eine Wolljacke nach der anderen an, immer weitere übereinander, so viele, bis ich schließlich nicht mehr friere. Es liegt mir schon ab und an zu jammern, doch nicht allzu lange am Stück, lieber stelle ich mich dann schon bald tot. Manchmal hilft es, anstatt zu jammern, tätig zu werden. Handarbeiten zu verrichten ist immer gut. Leben ist Tätigkeit, muss Tätigkeit sein, aber nicht ausschließlich, sonst verkommen die Gedanken. Andererseits ist Leben ja fast nur denken. Vieldenkern fehlt dann oft das Handgreifliche, eben die Tätigkeiten.
Ich bedaure es im Frühling jedes Jahr aufs Neue, dass ich mich bis zu den Eisheiligen mit dem Erdeaufwühlen gedulden muss. Ich beginne aus Ungeduld dann meist aber doch Wochen zu früh mit der Sämerei, dann kommt erneut Frost und macht alles Feine wieder zu nichte. Nur das Grobe hält dann eventuell durch. Das Scheitern an einer Sache dann natürlich wieder Stoff für den Trauerkloß, der letztendlich zu diesem Buche führte.
Das ewige Romangespenst, ich schrieb eine Weile ganz fleißig daran, doch dann hatte ich es lieber wieder weggelegt. Das Gefühl war dann nämlich da, dass seine Fertigstellung mich nicht reicher, sondern nur ärmer machen könnte. Vieles wäre, im Falle dass es ein Ende geben würde, aufs Papier gebracht worden und somit für immer aus meinem Herzen heraus gewandert. Und dann stünde ich da, mit diesem vollen Buch zwar, doch zudem mit einem gänzlich leergeräumten Herzen. Von etwas Neuem, das angeblich ja von ganz alleine kommt, konnte man dann nur träumen, denn so viel Neues kommt dann meist nicht mehr, denn, wenn man die Kindheit und Jugend und das Jungsein überhaupt, hinter sich gelassen hat, ist man immerzu nur noch froh, wenn man seine Ruhe hat. Man sollte deshalb sein Herz keinesfalls zu früh bis aufs Letzte auspressen, sondern unbedingt noch etwas Fühliges darin übrig behalten.
Es wirkt im Moment ansonsten so, als befände sich der Mensch auch ganz jenseits von politischem Geschehen, immer mehr in einer Art Kriegszustand. Julien Gracq sprach übrigens vom Krieg als einem eigenartigen Fall von Freizeitgestaltung. Er verwendete dies betreffend auch das Wort ‹Depoetisierung›. Das ganze Leben – im Grunde immerzu nur eine einzige Depoetisierung.
Manch einen sticht das Petermännchen
Auf dem Weg zum Einkaufen treffe ich im Hausflur den betagten Nachbarn, aus dessen Mund mir, wie immer wenn ich ihm begegne, die Frage entgegen schießt, ob ich gedient hätte. Er lebt, man kann es wohl nicht besser sagen, in einer anderen Welt. Wie immer sage ich nein und gehe weiter. „Reine Routinefrage!“ ruft er dann meist hinterher. Auch diesmal tut er das.
„Ja, ich weiß,“ erwidere ich dann. Ein Erlebnis wie dieses, ist von meiner Gefühlswarte aus gesehen, dann ein Höhepunkt, von dem ich tagelang zehren kann. Ich mag den Mann und diesen ewig gleichen Vorgang. Ich habe eine Art, die kleinsten Erlebnisse als Mikroerlebnisse wahrzunehmen und diese so abzuspeichern, wie man besondere Filmszenen archiviert. Es gibt minimale Unterschiede im Ablauf. Das Wichtigste dabei ist mein Bedürfnis, in Kontakt zu treten.
Ich reise generell nicht am liebsten in die Welt, sondern in solche Begegnungen. Bleiben sie aus, in meine Bücher und ab und zu auch in alte Fotografien hinein (ich habe inzwischen an die 1000 Schwarzweißfotografien aus der Vergangenheit, meist von Menschen aus der Berliner Bevölkerung). Man schenkt sie mir in einem fort, da man weiß, dass ich sie, wenn man sie selbst schon nicht beachtet, sehr gerne anschaue. Ich also am liebsten zu Hause am Tisch sitzend, etwas anschauend und dabei in Zufriedenheit, die anderen um mich herum, umher reisend, um nicht vor Langeweile zu zergehen. Jeder so anders, egal wohin du auch wanderst. Und auch die Langeweile, eine gute Freundin, die ich gelernt habe zu mögen.
In ihrer Biografie berichtet die Künstlerin Mary Bauermeister, wie sie mit ihrem Freund Karl-Heinz Stockhausen einmal nach Sizilien reiste, um sich dort vor Begeisterung ins Meer zu stürzen und versehentlich auf ein sogenanntes Petermännchen zu fallen, von dem sie dann gestochen wurde. Sie berichtet weiter, dass auch Karl-Heinz Stockhausen wenig später gestochen wurde und beide daran gestorben wären, hätten sie nicht Anwohner des nahegelegenen Ortes mit einer enormen Geistesgegenwart schnellstens in ein Krankenhaus gebracht, wo man beiden erfolgreich ein Gegengift verabreichte.
Natürlich war diese Begebenheit, besonders von meiner Schreibtischwarte aus betrachtet, ein ganz erstaunlicher Bericht gewesen. So etwas Aufregendes würde ich, die ich lediglich sitzend Unruhe finden konnte, so in dieser, zumal lebensbedrohlichen Direktheit, niemals erleben können. Zumindest war mir danach, Erlebnisse solcher Art zu verhindern.
Ich gehe ab und an zu einem Bäcker, der sich ganz in der Nähe meines Hauses befindet, kein Vergleich zum Reisen mit dem Flugzeug in ein fernes Land. Dort erlebe ich dann manchmal aufregende Situationen. Gewöhnlich sitzen bei diesem Bäcker ganz normale Menschen herum und trinken Kaffee und essen Kuchen. Einmal fiel mein Blick auf einen riesenhaften Menschen. Er saß an einem Tisch und aß ein Gebäck. Obwohl er saß, war mir sofort klar, dass er riesig war. Er stand dann auf und stieß, schließlich aufgerichtet, fast an die Decke des Ladens. Er war wohl an die 2,50 Meter groß gewesen. Neben ihm saß ein Kind. Als es ebenfalls aufstand, erschien es, so neben dem Mann stehend, derart winzig, dass ich mich kurz in einem Fellini-Film wähnte. Die anwesenden Kunden, von all der Riesenhaftigkeit angezogen, hatten ebenfalls nicht schlecht gestaunt.
Im Vergleich zu der Petermännchenepisode war das Staunen über diesen Riesen natürlich nur ein Abenteuer in verzwergter Form gewesen, man war ja lediglich eine Zuschauende gewesen. Und doch reichte mir das Staunen über einen übergroßen Menschen aus der Distanz dann vollkommen aus, um innerlich in eine helle Aufregung zu geraten. Zu Hause schrieb ich das Erlebnis in ein Notizbuch und hatte umgehend die Befürchtung, dass, würde es dieses in ein Buch schaffen, mir es niemand glauben würde.
Auf ein Leben in Gefahrenzonen verzichtete ich also gern. Doch wie schön, dass andere anders waren und Abenteuer in großem Ausmaß suchten, um anschließend darüber zu schreiben. Somit konnte ich, in meiner Komfortzone sitzend, davon lesen.
In der Zeit meiner Minorennität, als ich also noch nicht recht erwachsen gewesen war, dachte ich allerdings noch, dass man als junger Mensch unbedingt erlebnishungrig sein müsse. Ich hatte damals das dringende Gefühl gehabt, dass es zumindest einmal notwendig sein würde, in die Anden oder gar in eine heiße Wüste zu reisen. Ich meinte damals, dass, wer dies nicht bewältigen könne, in den Augen der anderen eine persona non grata wäre. Man sollte also wenigstens ein einziges Mal, in einer unwegsamen Gegend unterwegs gewesen sein und seine Ferien komplett in Anspannung verbracht haben.
Ich fuhr dann also, trotz Schlotterknien, ins heißeste Land Europas und das war dann auch desaströs gewesen, denn ich wurde dort mit mir unerträglichen Umständen, wie Gluthitze, immensem Licht und kargen mit von Disteln verwucherten Zeltplätzen konfrontiert. Zudem waren dort Menschen gewesen, die sich plötzlich, meist am Abend, hemmungslos an Fremde schmiegten. Die Beobachtungen dieser Zärteleien hatte mich dann so in Stress versetzt, dass ich nicht mehr ruhig hatte schlafen können. Die Geräusche der Lüste – mich derartig belästigend, dass ich mir Brot in die Ohren stopfte. Doch es hinderte nicht, das lüsterne Juchzen weiterhin deutlich zu vernehmen.
Ich lag dann wach und sehnte mich nach meinem Zu Hause.
Die Erlebnishungrigen hatten schließlich, anstatt, wie geplant, wieder heim zu reisen, zu meinem Leidwesen, die Reise in die Länge gezogen und ein weiteres Reiseziel auserkoren, das noch weitaus näher als das ursprüngliche, das ja bereits in Hitze erglühte, am Äquator gelegen war. Die Reise wurde ungefragt verlängert, und ich musste mit, ohne es zu wollen. Ich fiel dann vor Angst und Verzweiflung eines Nachts, in der man in einem wackeligen Boot einen See überquerte, fast aus diesem heraus und in den dunklen See hinein, weil jemand unverhofft gegen etwas gerudert und ich aus dem Gleichgewicht gekommen war. Der Schreck saß tief, denn ich war in jenem Moment davon ausgegangen, dass ich in den See stürzen und ertrinken würde. Die Erlösung durch den Tod trat jedoch nicht ein, denn ich hatte mich hinreichend festgehalten. Aus Angst vor weiteren Zwischenfällen war ich die restlichen Tage bis zur Heimreise im überhitzten, aber überschaubaren Einzelzelt geblieben. Wieder daheim, schwor ich mir, ab jetzt, für immer im Bett zu bleiben
Da ich damals also eindeutig in die Kategorie - Mensch mit beklemmend dasigem Hasenherz - gehörte, bestätigte sich mir mein Grundgedanke, dass ich nicht fürs Reisen, und im Grunde nicht einmal für ein Leben außerhalb meines heimischen Bettes, gemacht war. In dieser Welt voller Gefahren weiter zu bestehen, das würde weiterhin einer Mammutaufgabe gleichkommen.
Manchmal träumte ich jedoch auch von Heldentaten. In einer Saalschlacht warf ich einmal einen Stuhl in eine sich prügelnde Menge und empfand danach großen Stolz. Doch kaum dass ich erwacht war, wurde mir umgehend klar, dass ich geträumt hatte und ich in einem wirklichen Tumult, höchstwahrscheinlich keinen Stuhl geworfen, sondern dem schwitzenden Anstifter der Unruhe, aus Angst von ihm bedroht zu werden, sogar noch ein Glas Wasser zur Erfrischung gereicht hätte.
Später – ich hatte jahrelang autosuggestiv trainiert – gab es dann weitere, wunderbar mutige Momente in meinem Leben. Beeindruckend, wie ich z.B. einmal einem riesigen Löffelbagger, der hinter mir her gewesen war, ein Schnippchen geschlagen hatte, indem ich vor ihm auf den Baustellanabort geflohen war. Eine traumhafte Situation.
Frontrauchen
Ich sitze beim Frühstück, kaue etwas und denke. Das geht ja alles zur selben Zeit. Sitzen, Kauen und Denken. Der Kater frisst auch, er denkt aber vermutlich nichts dabei. Esse ich etwas, macht er das auch, ganz automatisch, zumindest, wenn sein Napf gefüllt ist. Als es dann klingelt, ist es der Röhrchenableser. Er kommt ganz unvorhergesehen. Der Mitbewohner zeigt dem Fachmann dann umgehend das abzulesende Gerät, das gar kein Röhrchen ist. Sein Besuch war nicht angekündigt, weshalb ich mich gestört fühle. Der Röhrchenableser schaltet dann eine sehr grelle Taschenlampe an und leuchtet mir direkt in die noch müden Augen. Er sieht mich nicht, weil ich in einer dunklen Ecke der Küche sitze und das Gerät, das es abzulesen gilt, sich im Flur direkt vor der Küche befindet, und er sich lediglich auf dieses Gerät und sonst auf nichts konzentriert. Das Gerät heißt Gaszähler, ist eigentlich kein Gerät, sondern eine wuchtige Vorrichtung, die in der Wand verankert ist. Beim Warten darauf, dass der mir in jenem Augenblick gar nicht willkommene Gasmann, sich endlich den Zählerstand notiert, werde ich ungeduldig, denn dieser langsame Mensch lässt die enorm lichtstarke Taschenlampe beim Schreiben einfach angeschaltet liegen, sodass mir diese eine gefühlte Ewigkeit in meine müden Augen strahlt. Ich verhalte mich trotz Blendung aber ruhig; so wie ein schreckgeblendetes Murmeltier auch erst einmal ruhig bleibt. Denn ich will nicht bemerkt werden, zumal ich noch Schlafmode trage. Dann geht das Licht aus und der Eindringling verschwindet. Es ist Winter und er musste sich wohl beeilen mit dem Ablesen, die Sonne würde ja schon bald wieder untergehen.
So hatte mein Tag also mit einer enormen Störung begonnen, eine Störung, die mich griesgrämig hinterlassen hatte. Ein Tag wie viele, und doch einer, der sich in der Erinnerung hervorheben würde, denn der Besuch eines Gasmanns war doch eine Besonderheit. Wäre er nicht gekommen, hätte ich den Tag wohl in besserer Laune verbracht, jedoch hätte ich ihn schon bald wieder vergessen. So erinnerte ich auf ewig das Erlebnis mit der Taschenlampe.
Vor der Bankfiliale, die ich von meinem Fenster gut sehen kann, und die dem „Bestimmer“ wohl zu veraltet war, um sie so zu erhalten, wie sie seit Jahrzehnten war, und die man schließlich entkernt hat, um sie neu zu gestalten, um dann wieder eine Bank, aber eben keine altmodische, sondern eine ganz moderne Bank zur Verfügung zu haben – steht ein Trupp Bauhandwerker herum und raucht. Ich kann diesen gut von meinem Küchenfenster aus sehen, Ich kann diesen gut von meinem Küchenfenster aus sehen, und sah dann einmal, wie einer von ihnen seine Hand im Kreis geformt, so um seine Zigarette hält, dass die Glut fast an die Handinnenfläche stößt. Ich kenne diese Handhaltung aus meiner Jugend. Sie war den besonders gierig saugenden Rauchern zu eigen. Ich zeige die Art des Zigarettenhaltens lediglich pantomimisch dann dem Mitbewohner, der, nachdem das Röhrchenablesen überstanden war, unverhofft in die Küche trat. Er erklärte mir umgehend, dass diese Art zu Rauchen Frontrauchen heißt. Damit der Feind im Schützengraben die Glut nicht sehen könne, verdecke der Rauchende diese, indem er das verräterische Leuchten mit der rundgeformten Hand abschirmt. Der noch relativ junge, historisch ungemein informierte Mitbewohner … ich fragte mich in jenem Moment, woher er nun wieder diese Art von Spezialwissen hatte? Er war in meinem Alter und, soweit ich wusste, hatte er keinen Krieg oder gar einen Schützengraben erlebt. Wenn er etwas, wie das vom Frontrauchen, so genau wusste, und darüber sprach, klang es jedoch so, als sei er selbst in Schützengräben ein- und ausgegangen.
Ich bin dann merkwürdig stolz darauf, dass ich nun auch diese Art von Männerfachwissen habe. Gerade heutzutage, wo man als Frau auf keinen Fall mehr wehleidig daherkommen durfte, war so ein Wissen ja Gold wert.
Am Tage darauf genoss ich ein Frühstück ohne Blendung und ging dann, wie lange vorgesehen, zu einer Schriftstellerberatung. Auf dem Weg dorthin hatte ich einen dicken Kloß im Hals. Ich hatte Angst, Angst vor den Profis, die halb so alt waren wie ich und längst ihre Karriere bei der Schriftstellerberatung gemacht hatten.
„Hoffentlich bekomme ich ein Wort heraus!“, sage ich leise vor mich hin, denn Schriftsteller, die nicht sprechen können, sind sicher nicht sonderlich gefragt.
Flotte Luzie ist falsch
Die Resonanz sei so wichtig. Die Klicks. Im Grunde seien nur die Klicks wichtig. „Aber manche klicken doch nur und lesen gar nichts,“ entgegne ich. Das spiele keine Rolle, so die Literaturberaterin vom literarischen Institut. Die Präsenz durch Klicks sei das Wichtigste. Ich bedanke mich für die Beratung und gehe wieder nach Hause Richtung Schreibtisch. Auf dem Heimweg fällt mir ein, dass eine Frau einmal Unmengen Klicks bekam, weil sie schrieb, dass sie einen ihrer Handschuhe verloren habe. Viele Menschen hatten ihr daraufhin ein Mitgefühl "entgegen" geklickt und an ihrem Pech Anteil genommen, als habe es sich nicht um einen verlorenen Handschuh, sondern einen verlorenen Freund gedreht. Auch ich hatte reagiert und ihr das Anbinden ihrer Handschuhe an eine Schnur, die durch die Jackenärmel verläuft, empfohlen.
Ich war dann nicht mehr so sicher, ob die Schriftstellerei das richtige für mich sei. Der Mann, der in der Küche am Tisch sitzt als ich sie betrete, fragt mich zur Begrüßung eine typische Mannfrage: Ob ich wüsste, wie die schnellste Dampflok der Welt hieße. „Flotte Luzie“ witzelte ich. Nein, sagte er sehr ernsthaft, sie hieße Mallard und sei aus England gewesen. Ob ich wüsste, was Mallard bedeute? Ich antwortete, obwohl ich wegen der Literaturberatung weiterhin miese Laune gehabt hatte: freundlich mit: krank. Nein falsch, so er, Mallard hieße Stockente. Und – wie schnell eine Mallard wohl gewesen sei, fragte er weiter. Ich sage: 500. Er entgegnet: 225.
Auf dem Tisch liegt dann ein Notizzettel. Auf ihm steht das Wort ‹Brummschleife›. Die Schrift – die eines Besuchers. Warum es dort stand, und was es zu bedeuten hatte, war mir gleichermaßen unklar. Sicher ein Begriff aus der Akustik denke ich und merke, wie der Tag mich zu nerven beginnt. Menschen, wozu? Worte und Zahlen, wohin damit? Die Literaturberatung war gar keine richtige Beratung gewesen, denk ich dann. Die junge Frau, die das mit den Klicks gesagt hatte, hatte sich tatsächlich einen meiner Texte durchgelesen. Das sei Tagebuch, sagte sie dazu. Ich erinnerte mich dann sofort an das wunderbare TABU von Peter Rühmkorf und hatte kurz vermutet, dass hinter ihrer Aussage ein Lob versteckt sein könnte. Es war dann aber kein verstecktes Lob, sondern eine barsche Kritik. Ein Tagebuch sei keine Literatur…
Ich sitze dann da und frage mich, was das Leben nun noch soll. Dann bin ich plötzlich ungeheuer müde und erinnere mich, dass neulich ein Besucher da gewesen war. Der mit der ‹Brummschleife›. Es war mit ihm, ähnlich wie mit dem Mann und der Eisenbahn, um Fachthemen gegangen. Der Besucher – einer der ebenfalls oft Fachfragen besprechen wollte. Toll, wenn man sich auskannte mit diesen. Ich war dann plötzlich wieder enorm müde. Vielleicht die Folgen der nächtlichen Schlaflosigkeit. Ich hatte wegen der Literaturberatung die mir bevorgestanden hatte, kaum geschlafen. Hatte immer wieder überlegt, was ich sagen sollte wenn ich gefragt würde, warum ich da sei.
„Klicks!“, hörte ich wieder die ätzende Stimme der jungen Frau, das sei das Wichtigste. Das ich nicht lache, denk ich, plötzlich wieder ganz wach. Und dann fiel sie mir wieder ein, die ‹Brummschleife›. des Besuchers von neulich; er hatte mir das Wort notiert. Ich würde ihn einfach anrufen und nachfragen, was es mit diesem Wort auf sich habe. Nach jahrzehntelangem E-Mailkontakt mit Menschen, die ich fast nur noch als schrifterzeugende Gestalten wahrnahm, wollte ich sowieso seit einiger Zeit das Telefonieren einmal wiederaufleben lassen. Ich hatte es bereits ein paar Mal versucht und war erstaunt gewesen, denn tatsächlich hatte bei allen Anrufen, die ich tätigte, jemand abgenommen und unverhofft freundlich reagiert. Menschliche Stimmen, egal woher sie kamen – ich vermisste sie zunehmend. Der Besucher ging dran: ‹die Brummschleife› dann tatsächlich etwas aus dem Audiobereich. Und die Frage, wieso ich das nicht einfach im Netz recherchiert hätte? Eine nachvollziehbare. „Ich wollte einmal wieder telefonieren!“ meine Antwort. Ob er manchmal noch Leute treffen würde, also ›so in echt‹ und ob er eigentlich noch spazieren gehen würde? Ich damit weiter ins Thema Einsamkeit vorpreschend. „Du meinst in der Natur?“ fragte er. „Ja, in der Natur!“ Wir überlegten dann, wo es in der Nähe überhaupt noch Natur geben könnte und kamen auf einen Wald zu sprechen. Der Bayrische habe eine schöne Internetpräsenz, so der Besucher; und ich hätte ja auch inzwischen eine Seite. Einen sogenannten Blog. „Jaja, ich schreibe Tagebuch“, sagte ich leise und beendete schnell das Telefonat; aus Gründen, die ich dann selbst nicht weiß. Die Erschöpfung nach dem Telefonieren dann, trotz Freude am Sprechen; erheblich. Als ich dann noch nach meinen Klickzahlen schaue, steht da eine Null.
Selbstverwaltung
Der Schallschatten hat die Sicht auf die Innereien verdeckt. Ein schöner Satz, aufgeschnappt in einem Wartezimmer. Als ich vom Arztbesuch nach Hause komme, hört der Mann sogenannte Gastarbeitermusik, Musik aus dem Kreuzberg der 70er Jahre. Gastarbeiter singen über ihre Erfahrungen in deutschen Betrieben. Der Mann fühlt sich wohl wenn er diese Musik hört und singt sogar ab und zu mit. Er saugt alles auf, was ihn auch nur im Entferntesten an seine Kindheit erinnern könnte.
Er selbst – das Kind von bayrischen Studenten, doch aufgewachsen im Kreuzberg der 80er Jahre, wo er die Kultur der Gastarbeiterfamilien oft erlebte. Die Musik, die er als Kind schon gerne wahrgenommen hatte – ein Teil davon. Der Mann, gerne im Zustand der Kindheit verweilend. Ich verstand das, fand es auch phänomenal, dass man durch das Hören von Musik vollkommen regredieren konnte.
Ich hatte dann immer wieder das Gefühl, dass die Regression eine wichtige Eigenschaften des Menschen ist. Hätte er sie nicht, würde er schneller altern und ganz fix ein freudlos alternder Mensch werden. Obwohl ich, um ehrlich zu sein, auch schon das Gegenteil gedacht habe: Regression, immer ein Unglück. Denn ein Mensch, der etwa schlimme Erinnerungen an eine Zeit in der Kindheit hatte, Erinnerungen die so unangenehm waren, dass sie seine Lebensfreude gänzlich blockieren konnten, könnte doch eigentlich, im Fall dass er einen Unfall erleidet in dem sein Erinnerungszentrum ausgeschaltet wird, dann sogar von Glück reden. Das ewige Sich-zurück-in-die-Kindheit-Bugsieren dann endlich unmöglich, und das Leben im Hier und Jetzt die Lösung.
Ständig aber werden Aussagen in einer derartigen Eindeutigkeit gemacht und verbreitet, dass ich mich wundere, da doch nichts was den Menschen betrifft, einseitig betrachtet werden kann. Ich las beispielsweise einmal in einer Zeitung, wie gut das Zusammenleben von Kindern und Tieren für die emotionale und geistige Entwicklung von Kindern sei. Sie würden viel über die Sprache der Gefühle von Tieren lernen und dies auf ihr Verhältnis zu Mitmenschen übertragen. Sie lernten mit Tieren mitzufühlen und somit würden sie bessere Sensoren ausbilden als Kinder, die ohne Tiere aufwüchsen. Mir leuchtete das alles erst einmal ein, bin ja selbst ein Tierfreund und würde es immer sein, könnte auch gar nicht ohne ein Tier leben. Jedoch waren fast alle Kinder die ich kannte, und die mit Tieren – und das waren ja oft auch riesenhafte Bulldoggen – nicht unbedingt geworden, was man unter feinfühligen Menschen verstand. Mir fielen auch Familien ein, in denen riesenhafte Hundetiere mit in den Betten der Kinder schliefen und die immerzu anwesenden Hunde, die Kinder alles andere als sensibler gemacht hatten. Auch an zerzauste Kaninchen erinnerte ich mich, die gerne gejagt und als Zirkuspferdchen benutzt wurden, und an eines, das an einem Herzschlag verendet war, als man zu Beginn einer in einem Kinderzimmer inszenierten Show, auf einen Gong geschlagen hatte. Die Kinder, sie sehnten sich nicht immer nur danach, von einem Hund oder Hasen gestupst bzw. gebissen zu werden, sondern auch einmal herzlich von der Menschenmutter liebkost zu werden. Tiere, so schien es mir zumindest manchmal, waren als Sozialwesen überbewertet. Man sollte zudem bedenken, dass der Mensch das Tier als Freund oftmals benötigt, das Tier jedoch keineswegs ihn.
Es fiel mir dann schwer weiterzudenken; die Gastarbeiterlieder, enorm laut und der Mitbewohner aus vollem Halse mitsingend. Ich wollte Beschwerde einlegen, doch war ich lieber „mal ganz leise“ wie man so sagt. Hatte ihn, den Mitbewohner ja ebenso jahrelang mit Musik genervt, die ich beim Schreiben hörte, um in eine besondere Stimmung zu kommen. Er hatte es ausgehalten, obwohl es Musik war, die ihn rasend machte; Musik aus meiner Jugend, die die Themen des Erwachsenwerdens durch gewaltige Refrains in die Welt schrien. Nun versuchte ich also die Gesänge eines Achmed, der sich über seinen Chef beschwert, ebenso auszuhalten. Die Schreibarbeit stagnierte dann. Irgendwann gab es einen Bandsalat, die alte Cassette hinüber und ich hatte sie dann: die benötigte Stille. Ich schaute dann aus dem Fenster und wartete auf Schneeflocken. Auch das Innehalten im Nichts gehört ja zur Arbeit. Da winkte mir von unten jemand zu. Ich erkannte ihn nicht. Ich winkte trotzdem zurück, wie im Sommer, wenn die Dampfer am Kanal entlang schipperten und die Kinder nach Erwiderung ihres Gewinkes lechzten und man ganz selbstverständlich zurück winkte. Meine Winkbewegung, so merkte ich dann, genau wie die der Bartagame aus dem Echsenbuch. Bei diesen Tieren gab es eine ihnen typische Verhaltensweise: Das sogenannte ‹Ärmchendrehen› Man kann auch Beschwichtigungswinken dazu sagen. Das Tier bewegt dabei ein Vorderbein schnell hin und her. Damit signalisiert es, dass es unterlegen ist und, dass es keinen Anspruch auf Höherstellung erhebt. Das andere wird somit in seiner wohl ranghöheren Position akzeptiert und es muss gar nicht erst um eine Stellung gekämpft werden. Es handelt sich also um das Gegenteil eines klassischen Territorialverhaltens.
Territorialverhaltensweisen sind mir unangenehm. Ich denke dabei unweigerlich an das Verhalten von Mitschülern in den 80er Jahren auf dem Schulhof. Sie wollten mich nicht in ihrer Nähe haben und machten eindeutige Abwehrbewegungen mit den Armen, ähnlich dem Winken der Bartagame. Meistens waren es Drogenkonsumenten, die sich ohne den Stoff klein und hilflos, im Rauschzustand dagegen stark wie Herkulesse gefühlt hatten. In meiner Jugend waren viele Schulen einzige Drogenumschlagplätze gewesen. Im Rückblick bedauere ich es übrigens sehr, in die hässlichste aller Zeiten, die 80er Jahre hineingeboren worden zu sein. Am liebsten wäre ich auch nicht in den 80ern, sondern bereits in den 50er Jahren in Berlin in eine Oberschule gegangen. Natürlich ist dies ein naiver Gedanke, aber damals war Berlin mit der Schülerselbstverwaltungsidee ganz vorne gewesen. Es gab Bereiche, in denen ein Lehrer nichts zu melden hatte. Es gab sogar ein sogenanntes Schulfunkparlament. Die endlosen Tiraden der gewählten Schüler übertrug man in einem extra dafür eingerichteten Radiokanal.
Der Winker vor meinem Fenster war dann verschwunden und es roch dann plötzlich stark nach Faulgas. Das kam, weil es geregnet und der Kohlenofen schlecht gezogen hatte.
In den Kohlengruben hatte man übrigens immer einen Kanarienvogel im Käfig dabei, um, falls dieser tot von der Stange kippen würde, sofort zu wissen dass der Sauerstoff zur Neige ging. Mit einer Kohlenmonoxidvergiftung war nicht zu spaßen, weswegen ich schon oft überlegt hatte, diese Vogel-Methode zu übernehmen. Da ich aber Vögel in einem Käfig nicht ertragen kann, wurde nichts daraus.
Wenn ich morgens ins muffige Zimmer trete, schrecke ich manchmal heftig auf. Da liegt dann der Kater unbewegt am Ofen und schläft. Angeblich. Bis jetzt war es zum Glück so, dass er tatsächlich immer nur geschlafen hat.
Bald dann wieder kühler
Am Morgen wachte ich auf und fühlte eine troglodytische Enge in meiner Brust. Kein Wunder waren doch alle Wolldecken, die im Regal neben mir für die Winterzeit lagerten, auf mich herabgestürzt. Die Katze hatte wohl wegen der Kälte im ungeheizten Zimmer versucht, sich unter den Deckenhaufen zu wühlen. Ich war froh, die Ursache meiner Beklemmung beseitigen zu können.
Im Radio beim Frühstück dann, ein 80er Jahre Hit mit dem einfältigen aber eingängigen Refrain: Baby, it`s just the way it is, Baby. Ich saß dann da und fragte mich, was das alles solle? Immer wieder befremdlich, dass im Englischen die Männer über attraktive Frauen als Babys sangen. Es war ein Mittwoch. Der Tag, der mitten drin in der Arbeitswoche steckte. Wie gut, dachte ich als ich das Brot vor mir liegen sah, dass ich, trotz Gier auf Gebäck, keine Bäckerin geworden war. Täglich am heißen Ofen zu stehen, war eine schlimme Vorstellung, auch, dass man sehr früh dort stehen musste. Der Mann wünschte sich zum baldigen Geburtstag dann ein Kilo Buchteln. Ein Gebäck aus der Tschechoslowakei das er so liebte, dass er, wenn man es ihm in Mengen zugänglich machte, sich regelmäßig daran überfraß. Ich beobachtete dann das Katzentier. Es lag immer nur herum, und trank ab und zu etwas aus dem tropfenden Wasserhahn. Lange hatte ich nicht gewusst, dass der Bürger selbst für Kaltwasser bezahlen muss.
Not a barbiegirl
Ich wachte auf mit einem gewöhnungsbedürftigen Song im Ohr auf. I´m Barbiegirl, in a Barbieworld, world in plastic, it´s fantastic... Den hörte das Nachbarmädchen in voller Lautstärke. Diese Thematik, das Barbiemädchen in seiner geliebten Plastikwelt, gefiel ihr offensichtlich sehr. Endzeitatmosphäre machte sich breit.
Ich sah dann in den Spiegel und war mir fremd. Ich erinnerte dann den Film, den ich am Abend zuvor gesehen hatte. Eine Adaption von Knut Hamsuns Hunger aus dem Jahr 1966. Ein bewegend guter Film. Fast so hatte ich mir alles vorgestellt, als ich das Buch vor Jahren gelesen hatte. Ein Mann der gerne kochte und den das Thema sehr bewegt hatte, empfahl es mir. Es ist erschreckend, wie das Thema immer noch ein ganz aktuelles ist. Menschen hungern auf der Welt, und sogar auf der Straße vor meinem Fenster sind einige Bettler unterwegs. Manchmal vergesse ich mein Portemonnaie zu Hause und stehe plötzlich im Supermarkt oder beim Bäcker ohne Geld da. Es kam vor, dass ich mir schon etwas aus den übervollen Regalen genommen hatte und alles wieder zurücklegen musste. Ich ahnte in jenen Momenten immer, wie es einem Menschen gehen mag der Hunger hat und sich nichts kaufen kann, weil er kein Geld hat. Die Hamsun-Geschichte ist diesbezüglich unglaublich auf den Punkt und beim Filmschauen litt ich derartig mit, dass es kaum zum Aushalten war.
Beim Frühstück am Morgen darauf, esse ich dann eindeutig mehr als sonst. Auch der Kater haut an seinem Futterplatz tüchtig rein. Er hatte ja den Film, auf meinem Schoß liegend, mit angesehen.
Es herrschte dann den ganzen Tag über irgendwie eine allgemeine Nahrungsaufnahme-Stimmung. Sie hielt ungewöhnlich lange an. Die Angst kam schließlich auf, dick zu werden. Das Dickwerden, eine Art Urangst in der Familie, von der alle, nur der Vater nicht, immerfort betroffen waren. Es war ein merkwürdiges allzu menschliches Problem, dass die Nahrungsaufnahme immerzu mit einem Gefühl des Zuviel oder Zuwenig gekoppelt war. Komischerweise hatte das eine wie das andere nichts damit zu tun, ob jemand tatsächlich zu dünn oder zu dick war. Ganz spillerige meinten, dass sie zu dick seien und hielten streng Diät, und stark Beleibte aßen wie ihnen der Schnabel gewachsen war und sahen kein Problem darin, wenn alles aus der Form geriet.
Ich erinnerte mich dann daran, wie uns der Deutschlehrer in Schulzeiten einmal Das dicke Kind von Marie Luise Kaschnitz vorlas. Es bedrückt mich daran zu denken, obwohl ich die Geschichte für eine Herausragende halte. Der Lehrer konnte gut vorlesen. Obwohl er Asthmatiker war und bei einigen Konsonanten seine Lunge pfiff wie eine verstopfte Dampflok.
Das dicke Kind schildert eine von Abwehr und Ambivalenz gezeichnete Begegnung zwischen einer Frau und einem offensichtlich nur an Nahrungsaufnahme denkenden Mädchen. Nahrungsaufnahme und Kindererziehung, die schwierigsten Themen des Erdenmenschen. Oder, wer weiß, vielleicht war es bei den Außerirdischen ja genau so kompliziert. Auf jeden Fall stört ein Denkapparat zuweilen enorm und seine Existenz ist keineswegs immer nur zum Vorteil. So dachte ich zumindest, nach all diesen immens ausladenden Gedankenfetzen über den Hunger und das Dicksein wieder einmal. Ein Tier hatte es leichter in seiner triebhaften Dummheit. Es konnte sich nicht in Gedankenschleifen verfangen. Scheinbar. Man weiß es ja noch nicht genau, doch vermutet man inzwischen weitaus mehr Sensibilität und Klugheit beim Tier, als bisher gedacht. Vielleicht braucht es am Ende auch Psychoanalyse. Lustige Vorstellung: ein Tier in Psychoanalyse.
Die Abwesenheit von Jubel
Nachdem ich, wie oft nach stundenlangem Sinnlos-durch-die-Wohnung-Streifen, als Ausweichoption, sehr trockene Haferkekse gebacken hatte, um nicht der Marzipantorte, die der Mann sich wegen „Winter“ gekauft hatte zu verfallen und mich danach, wie immer nach dem Konsum von jener fetten Süßigkeit, wie ein Mola Mola (Mondfisch) zu fühlen, fühle ich mich dann auch nach Trockenkeksen wie ein Mola Mola. Ein Mola Mola kann bis zu mehrere Zentner schwer werden. Das Problem warum ich dieses Völlegefühl hatte, hing jedoch eindeutig mit dem ausladenden Genasche vom Teig der Kekse zusammen. Ich meinte beim Backprozess fast sekündlich testen zu müssen, ob genug Zucker verwendet worden war. Die Befriedigung die beim Teignaschen entstehen kann, ist erstaunlich, man bedenkt in diesen Stopfmomenten jedoch nicht, dass der Magen anschließend höchstwahrscheinlich leiden muss.
Bis zum späten Abend hatte ich keinen Appetit mehr und später, während des Schlafs, setzte dann eine Art Daueralbdruck ein. Die Mischung aus heftigem Völlegefühl und gleichzeitig auftretenden Albträumen dann – schwierig zu bewältigen. Ich träumte, dass ich in einem Omnibus voller menschengroßer Pantoffeltierchen sitze und dieser überfüllte Bus in einem unwegsamen Gebirge steckenbleibt. Er konnte nur befreit werden, indem alle, Tiere und Menschen zusammen, die Steinlandschaft, in der der Bus steckengeblieben war und die sich als süßes, aber enorm trockenes Teiggebirge herausstellte, frei fraßen. Ich wachte willensschwach und verstört auf. Neben meinem Bett sah ich das Buch von Gunda Werner liegen, das ich eigentlich am Abend hatte lesen wollen. Es ging darin um Bußgeschehen, was mich als Thema hochgradig interessierte. Es fiel mir unvermittelt der Neid ein, den ich seit einer Weile auf eine Nachbarin empfunden hatte, weil sie schon ihr drittes Buch herausgebracht hatte. Es ging darin zwar lediglich um das Einkochen von Marmelade, doch auch ein Buch über das Einkochen von Marmelade war ein Buch und man konnte es bestellen und es stand sogar schon zum Bestellen im Magazin der Gedenkbibliothek bereit. Marmelade, ein banales Thema, das mich so gar nicht zu packen vermochte. Doch ein Buch war ein Buch war ein Buch. Eines dann in den eigenen Händen zu halten, ein Traum bereits aus Kindertagen. Ich war wohl mit der großen Sehnsucht danach, ein Buch herauszubringen, geboren worden. Mit zwölf hatte ich es dann schon einmal mit einer Autobiografie versucht.
Ich begann meine Kindheit zu schildern, war aber verwirrt, denn so viel gab es noch gar nicht zu berichten, ich steckte ja noch mitten darin. In einer Mädchenzeitschrift wurde damals für ein Buch geworben, das angeblich eine Zwölfjährige geschrieben habe. Ich, ebenso zwölf Jahre alt, versucht es dann auch. Ich kam zwar nicht weit, behielt die Idee aber weiter im Hinterkopf.
Es hat sehr lange gedauert, bis es soweit war. Frau Schubert, die mit über 70 beim Bachmannpreis gewann, hatte mir Mut gemacht. Trotzdem es später soweit war, ich genug Seiten vollgeschrieben hatte um sagen zu können dass ich eine Schriftstellerin war, fiel ich immer wieder kopfüber in mein Bett hinein.
Nun also, das Marmeladenbuch der Nachbarin. Das Leben war eine Berg- und Talfahrt sondergleichen. Egal an welchem Punkt man auch stand, es konnte einen immerzu etwas aus den Angeln heben. Ich stieg, trotz eines oft mich übermannenden Prinzips Hoffnungslosigkeit, wieder aus meiner Koje heraus und betrachtete ein Weilchen mein deprimiertes Schriftstellerinnengesicht im Spiegel. Ohne Spiegel kann man sein Gesicht nicht sehen. Außer man hatte Stülpaugen, die man, an Antennen angebracht, ausfahren konnte. Ich konnte mich selbst betrachten, aber wie die Meisten, nur im Spiegel. Was ich da sah, war doch irgendwie beruhigend: Ich hatte einen Kopf und vorne an ihm dran war ein ganz normales Gesicht angebracht. Ich konnte sehen und hören, schmecken und riechen. Im Grunde war es die Ausstattung, die die meisten hatten und somit gab es nichts zu meckern. Und doch brach ich nicht in Beifall aus, als mich mein Selbst aufmunternd dazu aufzufordern begann. Mir fiel dann ein Zitat aus meiner absolvierten pädagogischen Ausbildung ein, dass ich mir einmal notiert hatte:
Fasziniert von seinem eigenen Bild, nimmt das Kleinkind sein Spiegelbild jubilatorisch auf. Ja, das war wohl der große Unterschied von einem Kind zu mir, als ausgewachsenem Subjekt: Die Abwesenheit von Jubel.





























