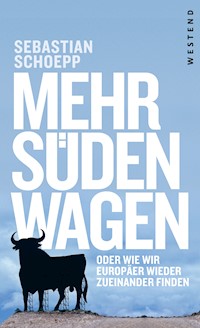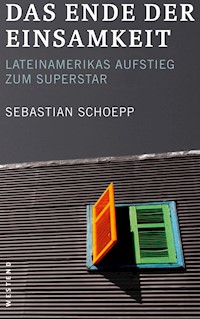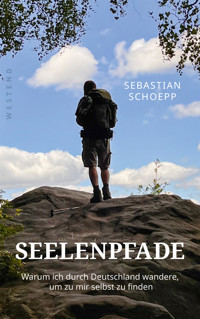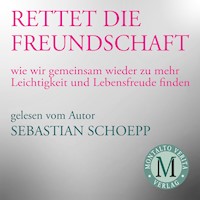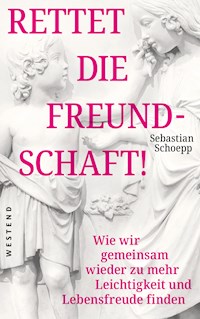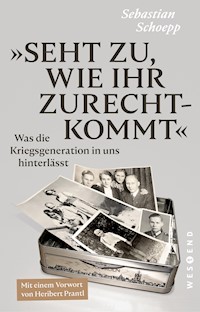
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Westend Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Die Sorge um die alt werdenden Eltern ist eine der großen Herausforderungen unserer Zeit. Familienstrukturen haben sich aufgelöst, das Leben in der globalisierten Welt fordert maximale Flexibilität und Mobilität. Die wenigsten von uns sind darauf vorbereitet, plötzlich für gebrechliche Menschen da sein zu müssen. Pflege reißt Lücken in unsere Lebensläufe und konfrontiert uns mit uns selbst. Dies umso mehr, wenn die Eltern den Zweiten Weltkrieg erlebt haben und in ihrer Seele unaufgearbeitete Traumata verbergen, die oft über Generationen nachwirken. Sebastian Schoepp macht sich auf eine Zeitreise ins Leben seiner Eltern, vom Russlandfeldzug bis ins Pflegeheim, und damit in die Vergangenheit Deutschlands. Je tiefer er dabei vordringt, desto stärker wird die Erkenntnis: Die Vergangenheit ist nicht tot, sie lebt in uns weiter.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Ebook Edition
Sebastian Schoepp
Seht zu, wie ihr zurechtkommt
Was die Kriegsgeneration in uns hinterlässt
Mit einem Vorwort von Heribert Prantl
Mehr über unsere Autoren und Bücher:
www.westendverlag.de
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
ISBN 978-3-98791-013-5
© Westend Verlag GmbH, Frankfurt/Main 2023
Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin
Satz: Publikations Atelier, Dreieich
Inhalt
Titel
Vom Russlandfeldzug bis ins Pflegeheim
Vorwort von Heribert Prantl
Hiergeblieben
Das große Verdrängen
Abwärts
Auf Distanz
Showdown vor der Klotür
Nur noch eine Last?
Ganz unten
Die Unfähigkeit zu reden
Letzte Entscheidungen
Neue Heimat
Der letzte Umzug
»So richtig gewöhnt man sich nie daran«
Displaced Persons
»Geschlagen kehre ich zurück«
Sieh zu, wie du zurechtkommst
»Es geschah überall«
»Alle ausgewandert«
Erziehung zur Unerbittlichkeit
»Was Praktisches«
Eine Notgemeinschaft?
Die Illusion vom Glück
Das Haus in Berlin
Schäfer, Bankrotteure und ein Rittergutsbesitzer
Die sieben Aufrechten
Ein Kriegsende
Dornröschens Villa
Warte nur! Balde ruhest du auch
Vater
Mutter
Der Höhepunkt des Lebens
Wir Kriegskinder
Geister der Vergangenheit
Das Erbe des Schweigens
Leben an der Bruchlinie
Das große UND
Nach Hause
Dank an
Literatur
Anmerkungen
Orientierungspunkte
Titel
Inhaltsverzeichnis
Vom Russlandfeldzug bis ins Pflegeheim
Eine Zeitreise ins Leben der Eltern
Vorwort von Heribert Prantl
Dieses Buch ist zartbitter; es ist ein fesselndes, ein verstörendes Buch. Es ist eine Lebensgeschichte, es ist die Familiengeschichte des Kollegen Sebastian Schoepp, Jahrgang 1964, der als außenpolitischer Redakteur bei meiner, bei der Süddeutschen Zeitung arbeitete, bei der Zeitung also, bei der ich lange Jahre Ressortleiter der Innenpolitik war. Eigentlich mag ich ja die Geschichten nicht, durch die sich von vorn bis hinten das Ich des Autors zieht, ich mag die Ego-Reportagen und die Ego-Bücher nicht; ich mag es nicht, wenn man seine Eltern und die Erlebnisse, die man mit ihnen gehabt hat, wenn man ihre Schwächen und Fehler ans Licht zerrt und seine Eltern zum Exempel, zum vermeintlichen Prototyp ihrer Generation und damit zum Forschungsobjekt macht; sie können sich gegen diese Art von Ausbeutung ja nicht mehr wehren.
Neuerdings greifen literarische Bücher noch weiter zurück, in die Großeltern-Generation, und erregen viel Aufsehen mit intimen Einblicken in alte Familiengeschichte. Alex Schuman, der schwedische Bestsellerautor, tischt in seinem Buch »Verbrenn all meine Briefe« eine Dreiecksgeschichte auf zwischen seiner Großmutter Karin, ihrem Ehemann und dem Schriftsteller Sven Stolpe. Er reist an deren Orte der Vergangenheit, sucht und findet in akribischer Kleinarbeit Briefe und Tagebucheinträge, aus denen sich ihm langsam die spannende und herzergreifende und zugleich grausame und gewalttätige Geschichte der drei zeitlebens aufeinander geworfenen Menschen erschließt, die sich gegenseitig so unglücklich machten und doch nie voneinander lassen konnten. Bei der Lektüre habe ich mich gefragt: Werden hier Grenzen überschritten, wenn der Enkel die intimsten Augenblicke und Aufzeichnungen der verstorbenen Großeltern den Augen der Öffentlichkeit vorlegt? Ich habe und hatte da ein Unbehagen und die grundsätzliche Frage: Darf man das?
Bei Sebastian Schoepp habe ich dieses Unbehagen nicht. Er schreibt so spannend und so packend wie Schuman, aber ohne auch nur einen Hauch von unbehaglichem Voyeurismus. Deshalb liebe ich dieses Buch von Schoepp. Es ist ein ehrliches, radikales und doch versöhnliches Buch. Es handelt vom Abschied von der Kriegsgeneration, einem Abschied, der in Alters- und Pflegeheimen vollzogen wird und bei dem die Odyssee durchs Gesundheitssystem zum Alltag gehört. Sebastian Schoepp hat diese deutsche Odyssee mitgemacht – er hat auf den schönen Korrespondenten-Posten in Buenos Aires, der ihm soeben winkte, verzichtet, ist nicht nach Lateinamerika gegangen und hat sich stattdessen der Pflege der Eltern gewidmet.
Schoepp ist vom Jahrgang her ein Kriegsenkel, von der Familiengeschichte her ein Kriegskind. Der Vater, Jahrgang 1923, hatte als Soldat an der Ostfront gekämpft, die Mutter, zwei Jahre jünger, hatte die Bombennächte in Berlin durchgemacht. Welche traumatischen Erlebnisse sie davongetragen haben mochten, so schreibt Schoepp am Anfang des Buches, »konnte ich nur erahnen«. In seiner Familie regierte ein zähes Schweigen über die Vergangenheit. »Wärste mal in der Kriegsgefangenschaft gewesen, dann würdeste jetzt nicht so ein Theater machen.« So pflegte Vater Schoepp Mittagessensgespräche zu beginnen. Irgendwann keilte der Sohn zurück: »Das klingt, als würdest du mir wünschen, auch in einem Lager gewesen zu sein.« Die Eltern reagierten konsterniert. Wie kam der Junge auf so was? Aber danach war erst einmal Schluss mit der Debatte. Und heute fragt sich Sebastian Schoepp: Hatte er selbst seinen Vater zum Schweigen gebracht? Wie viel Mitverantwortung »tragen wir Kriegskinder an der Sprachlosigkeit der Eltern«? Und er gibt selbst die Antwort: »Eine ganze Menge.« Und daran liege es vielleicht, »dass keine wirkliche Erinnerungskultur an die deutsche Nachkriegsgeschichte existiert, an Flucht, Vertreibung, Gefangenschaft, Vergewaltigungen«. Es sind solche Gedanken, Schoepps Nachdenklichkeiten, für die man sein Buch hoch schätzt.
»Er kann nicht gut lügen, weil er nicht gut erzählen kann. Er kann nur gut verschweigen« – so heißt es bei Uwe Timm in seiner Novelle über »Die Entdeckung der Currywurst«. Sie handelt davon, wie ein Mann nach Hamburg fährt, in die Stadt seiner Kindheit und dort immer wieder Frau Brückner im Altenheim besucht; von der ehemaligen Besitzerin einer Imbissbude lässt er sich die letzten Kriegstage erzählen … Im Buch von Sebastian Schoepp erzählt nicht der Vater dem Sohn von seinen Erlebnissen in sowjetischer Kriegsgefangenschaft bis 1949. Der Sohn selbst beginnt zu lesen und nachzuforschen in Briefen und Unterlagen vom Wehrmachtsarchiv. Es ist der erste Heiligabend nach dem Tod der Eltern, an dem der Sohn vor dem Bullerofen mit den Buchenscheiten im elterlichen Häuschen zu recherchieren beginnt und herausbekommt, dass der Vater im »Lager No. 7850« seinen Platz in der Lagerverwaltung hatte, einem Apparat aus Gefangenenselbstverwaltung und Kollaboration. Es war dies ein Außenlager von Krasnogorsk, ein paar Kilometer westlich von Leningrad. Dort wurde der Vater am 26. Juli 1949 entlassen und in einen Zug nach Westen gesetzt.
Vaters Interesse am Sowjetsystem hat Sebastian Schoepp nicht weltanschaulich schockiert. Der Marxismus, so bekennt er, »scheint mir trotz aller Irrtümer und Pervertierungen derer, die ihn missbraucht haben, noch immer die tolerierbarere Weltanschauung im Vergleich zu Faschismus oder gar Nationalsozialismus zu sein«. »Ein Bekenntnis meines Vaters zu Hitler in seinen früheren Feldpostbriefen«, so Schoepp, »hätte mich mehr schockiert.« Man folgt Schoepp mit steigendem und gespanntem Interesse auf seiner Zeitreise ins Leben seiner Eltern, vom Russlandfeldzug bis ins Pflegeheim – und auf seinen Überlegungen dazu, wie man selbst von seinen Eltern geprägt wird. Es ist kein rührseliges Buch, aber ein anrührendes, ein kritisches, aber kein böses Buch. Es ist ein wunderbares Buch. Es ist eine kleine, eine große 320-Seiten lange Kostbarkeit.
»The past is never dead. It’s not even past.«
William Faulkner
Hiergeblieben
Der Anfang vom Ende
»Man ist doch ein bisschen mitgenommen.«
Lothar Schoepp, Feldpostbrief vom 18. Februar 1944, Drohobycz, Ukraine
Buenos Aires ist eine schöne, aufregende Stadt – dort Korrespondent einer großen deutschen Tageszeitung zu sein, ist ein Journalistentraum, vor allem wenn man intensiv darauf hingearbeitet hat. Ich war viele Jahre in der Redaktion Außenpolitik für den iberoamerikanischen Raum zuständig, hatte von München aus die Korrespondenten in Lateinamerika und auf der Iberischen Halbinsel betreut und selbst die eine oder andere Dienstreise dorthin unternommen. Nun stand ich selbst vor dem großen Sprung. Auch privat schien alles über den Atlantik zu deuten. Ich war liiert mit einer Spanierin, einer passionierten Hobbytangotänzerin, die darauf brannte, in den Salons der argentinischen Hauptstadt ihre »Ochos«, »Cruzadas« und sonstige Drehungen zu perfektionieren.
Dass ich mich, kurz bevor dieser Traum wahr wurde, dann doch für München-Neuperlach entschied, hatte zwei Gründe: meine Mutter und meinen Vater.
Um es vorwegzusagen, es war keine schwere Entscheidung; es war die einzig mögliche.
Mein Arbeitgeber wartete gerade auf meine Zusage für Südamerika, als mich am Schreibtisch in der Redaktion ein Anruf der Nachbarin meiner Eltern erreichte. Mutter sei »umgekippt«.
Das war ihr in ihrem hohen Alter schon öfter passiert, aber immer glimpflich ausgegangen. Mal war sie im Garten gestürzt infolge einer Kreislaufschwankung und hatte sich den Arm gebrochen, mal rammte sie zerstreut ein parkendes Auto und musste danach eine Halskrause tragen. Sehr unangenehm, aber beherrschbar.
Was war jetzt los?
Ich fuhr durch Schnee und Eis zur Kreisklinik in der Kleinstadt östlich Münchens, in der meine Eltern lebten. Es dämmerte, die Straßen waren in ein kaltes, blaues Februarlicht gehüllt, es sah schon draußen aus wie in einem Operationsraum. Als ich ankam, fragte ich an der Pforte, wo Mutter liege. »Intensivstation«, lautete die Auskunft.
Man musste eine Art Schleuse passieren, die die Station von der septischen Außenwelt abschirmte. Dahinter ein nüchternes Wartezimmer. Dort lag eine Frauenzeitschrift aus. »Warum Fetischlokale immer beliebter werden«, lautete die Überschrift der Titelgeschichte.
Was hatte ich erwartet? Die Bibel?
Nach einer guten halben Stunde trabte ein Arzt herein. Er atmete schnell, der Schweiß rann ihm über das Gesicht. »Wir haben gerade mehrere Notfälle hereinbekommen«, sagte er. Man hörte Getrappel auf dem Flur, im Laufschritt wurden Tragen vorbeigeschoben. Ein schwerer Verkehrsunfall.
Zwischendurch hatte der Doktor Zeit gehabt, sich um Mutter zu kümmern.
»Sie hat ein Aneurysma«, sagte der Arzt, »wissen Sie, was das ist?«
»Ich habe eine vage Ahnung.«
»Ihr ist eine Schlagader in der Nähe des Herzens geplatzt, wie ein poröser Schlauch«, sagte der Arzt. »Das kann nicht so bleiben.«
Das klang einleuchtend.
»Und jetzt?«, fragte ich.
»Wir verlegen sie nach Bogenhausen, dort wird sie operiert, noch heute Nacht«, sagte der Arzt und verschwand in Richtung der Unfallopfer.
Mutter lag in einem verkabelten Raum, auch sie selbst war gründlich verkabelt worden. Aber sie war bei Bewusstsein, kramte in ihren Sachen herum.
»Kannste mal gucken, wo meine Handtasche ist?!«, lautete ihr Begrüßungssatz. Es war keine Frage, es war eine Anordnung. So war Mutter.
»Was ist denn mit dir los?«, wagte ich einen Gesprächsanfang in dem verharmlosenden Ton, der zwischen uns in Gesundheitsdingen üblich war. Nur nichts dramatisieren, so lautete stets die Devise. Sie hatte ihre randlose Brille auf und guckte verärgert.
»Ich weiß nicht, was los ist«, sagte sie in dem Ton energischer Verstimmung, der mich als Kind stets in Habachtstellung versetzt hatte. Störungen, egal ob bei ihr selbst oder bei anderen, pflegte Mutter mit äußerster Ungeduld aufzunehmen. Was nicht funktionierte, musste wieder zum Funktionieren gebracht werden, egal ob Gebrauchsgegenstände oder ihr eigener Körper. Sie hatte ihr Leben lang Sport getrieben, aber nicht exzessiv, Radfahren, Joggen, Skilaufen, solche Sachen. Raucher hielt sie für »Dreckschweine«, wie sie mir als Jugendlichem mal angesichts der vollen Aschenbecher in meinem Partykeller sagte. Einzig ein tägliches Gläschen Bier oder Wein zum Essen gehörte für sie zur Abweichung von der Selbstdisziplin, die gar keine war, sondern Gewohnheit und anerzogene Genügsamkeit. So war sie ohne große Störungen 87 Jahre alt geworden.
Ihre Verkabelung nahm sie nun mit der Duldsamkeit eines Menschen hin, der Schlimmeres erlebt hatte.
Ich gehöre ja eher zu den Wehleidigen. Schon als Kind schlug ich Symptome in Gesundheitsbüchern nach. Ich drehe halb durch vor jeder Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Mutter hatte noch Zahnärzte erlebt, die ihren Bohrer mit einer Tretkurbel bedienten und Patienten vor Extraktionen mit Lachgas betäubten.
Jetzt stand ich herum wie ein überflüssiges Möbelstück.
»Die behaupten, ich sei umgekippt«, sagte Mutter so, als könne das gar nicht sein.
»Bist du wohl auch«, sagte ich. »Wie fühlst du dich?«
»Mir ist schwindlig.«
Körperlicher Verfall war in Mutters Lebensplan nicht vorgesehen, sie und Vater hatten niemals auch nur die geringsten Anstalten gemacht, über ihr Alter oder das Sterben zu reden.
Mutter faltete ihre Brille zusammen, prüfte, ob alles in ihrer Handtasche war, die ich inzwischen in einem blauen Plastiksack unter dem Bett entdeckt hatte. Kreditkarten, Schnupftuch, Brillenetui, alles da.
Ich wartete stumm, bis die Leute vom Krankentransport kamen, Mutter auf eine Trage schnallten, was geraume Zeit in Anspruch nahm, weil man ungefähr zwanzig weitere Schläuche mit dazugehörigen Apparaturen an ihr befestigte, Nadeln unter die Haut schob, Beutel anschloss, Messgeräte justierte. Ihr blasses, faltiges Gesicht verschwand immer mehr in dem Aufbau.
Ich stand da und guckte zu. Später dachte ich, dass es wahrscheinlich angemessen gewesen wäre, ihre Hand zu nehmen, ihr übers Haar zu streichen, sie zu trösten – was man nach landläufiger Annahme eben so tut als guter Sohn. Doch solche Dinge hatte es bei uns nie gegeben.
»Gute Fahrt«, sagte ich, als man sie hinausschob, so, als ginge sie auf einen Ausflug. Es sollte witzig klingen.
»Tschüss«, sagte sie. Und dann kam jener trockene, halbironische Satz, den Mutter so oft im Leben zu sich selbst gesagt hatte: 1945 als junge Frau beim Einsatz in einer Rüstungsfabrik an der Ostsee, als sie vom Kriegsende überrascht wurde; in den 1950er Jahren als Studentin in Berlin, als die Entscheidung anstand, ob sie sich danach im Osten oder Westen eine Arbeit suchen sollte; zehn Jahre später, als sie längst in Bayern lebte und ihr Sohn auf die Welt kam. Diesen Satz, ein Lebensmotto, eine Art Mantra fast, nicht nur ihr eigenes, sondern das einer ganzen Generation, richtete sie nun an mich: »Sieh zu, wie du zurechtkommst.«
Es klang wie ein Vermächtnis, und zugleich schwang unüberhörbar ein Zweifel mit, ob der, der da vor ihr stand, mit der gesetzten Situation, also dem weiteren Leben, zurechtkommen würde.
Wenn ich den Arzt richtig verstanden hatte, stand ihr eine Herzoperation auf Leben und Tod bevor.
Das wusste auch der Krankenwagenfahrer.
»Wollen Sie gleich hinterherfahren?«, fragte er.
Das ist es wohl, was Menschen tun. Angehörige folgen besorgt der Ambulanz, sprechen mit Verwandten über ihre Handys, kampieren neben den Betten ihrer Lieben, füttern sie, schütteln Kissen auf, halten Hände, laden E-Book-Reader. Doch ich schüttelte nur den Kopf. So war ich nicht aufgewachsen. Ich kannte noch die Zeit, als es zweimal in der Woche Besuchszeit im Krankenhaus gab. Ich hatte gelernt, dass man zurechtkommen muss.
Der eigentliche Grund, warum ich nicht hinterherfuhr, um Mutter beizustehen, war jedoch ein anderer.
Es war Vater.
Der saß zum gleichen Zeitpunkt mit einem dick bandagierten Auge zu Hause im Wohnzimmer des elterlichen Häuschens, wenige hundert Meter vom Krankenhaus entfernt. Er war am Nachmittag operiert worden. Eine Katarakt-Operation (Grauer Star) ist heutzutage nichts Besonderes, Routine, meistens mit gutem Ergebnis. Doch zu diesem Zeitpunkt fatal. Die Aufregung um Vaters OP hatte zu Mutters Herzanfall das entscheidende Quäntchen Stress beigetragen. Sich um ihren hilflosen Ehemann zu kümmern, war eine zu große Herausforderung. Deshalb war sie in der Augenarztpraxis zusammengebrochen, während ihr Mann operiert wurde.
Die Hypochondrie habe ich von Vater geerbt. Noch mit 89 Jahren, in einem Alter, in dem andere todkrank darniederliegen, leistete er sich den Luxus, heftig zu somatisieren, obwohl es ihm körperlich vergleichsweise gut ging. Mehrmals die Woche musste oder wollte er zum Arzt, Mutter fuhr ihn tapfer, obwohl sie mit ihrem blauen VW-Polo schon den einen oder anderen fremden Kotflügel gestreift oder den Seitenspiegel am Garagentor gelassen hatte. Zu Vaters zahlreichen Leiden wie Bluthochdruck und altersbedingter Herzschwäche gesellten sich andere, die er sich bei dem Versuch einhandelte, die ersteren zu bekämpfen. Er war Naturwissenschaftler, Chemiker, und versuchte, seinen Körper zu behandeln wie eine Maschine, bei der man regelmäßig Flüssigkeiten nachfüllen musste, damit sie lief. Vater war ein umständlicher Mensch, der Berechnungen mehr glaubte als dem Augenschein. Das wäre ihm nicht nur im Krieg als Artillerist fast zum Verhängnis geworden, als er wegen eines Rechenfehlers die eigenen Leute beschoss. Es wirkte sich auch fatal bei der Berechnung seiner Medikamenten-Dosis aus, die er selbst täglich nachjustierte. Er saß dann hypernervös vor dem Blutdruckmessgerät und trieb mit seinen eigenen Beobachtungen den Blutdruck in die Höhe wie in einem Heisenberg’schen Experiment.
Ein willfähriger Hausarzt, der sich seinem ständigen Drängen nicht anders zu erwehren wusste, hatte Vater mit allerlei Blutverdünnern ausgestattet, die ihn fast ins Grab gebracht hatten. Ein paar Monate zuvor hatte Vater schwere innere Blutungen erlitten. Er war wochenlang im Krankenhaus und in der Reha gelegen, danach sogar kurz auf einer Pflegestation. Erst vor Kurzem war er wieder nach Hause gekommen.
Nun lag wiederum Mutter in einem Krankenwagen, und Vater saß klapprig und alt mit einem frisch operierten Auge allein am Esstisch und versuchte zu begreifen, was passiert war: nämlich dass er nun ohne seine Ehefrau auskommen musste. Für wie lange? Für immer vielleicht?
Frau H., die Nachbarin, hatte Vater aus der Augenarztpraxis nach seiner OP nach Hause gefahren, während ich im Krankenhaus bei Mutter saß, und ihm Suppe gekocht. Die löffelte er geduldig. Mit nur einem Auge war es schwierig, mit dem Löffel den Mund zu treffen. Er kleckerte.
Als er fertig war, packte die Nachbarin Besteck und Teller und ging.
Was hätte ich ohne Frau H. getan?
»Auf Wiedersehen und vielen Dank«, sagte ich.
»Nichts zu danken, ist doch selbstverständlich«, sagte sie.
Ich sah Vater an und er mich. Er hockte gekrümmt am Tisch, in sich zusammengesunken, 89 Jahre lasteten auf ihm. Gehen konnte er kaum ein paar Meter weit. Gut, dass der Treppenlift da war.
»Wie geht’s Mama?«, fragte er. Er nannte seine Frau mir gegenüber stets »die Mama«, als wäre ich noch ein Kind.
»Man hat sie in eine Spezialklinik gefahren, sie wird heute Nacht operiert.«
Vater guckte so betreten, wie er das mit einem verbundenen Auge konnte.
»Ist es schlimm?«
»Ich glaube schon.« Über das Ausmaß der Operation, die ihr bevorstand, schwieg ich mich aus.
Er schwieg ebenfalls.
»Kommst du klar?«, fragte ich ihn.
»Ja, ich komme klar«, sagte er.
Ich wusste, dass er nicht klarkam.
Und ich wusste, dass auch ich nicht klarkam.
Ich ging zur S-Bahn und fuhr nach Hause in die Großstadt, obwohl ich hätte bei ihm bleiben sollen, müssen.
Klar war eigentlich nur eines: Ich würde vorläufig nirgendwo hingehen – am wenigsten nach Buenos Aires.
Das große Verdrängen
Wie das Alter über den Alltag kommt
»Wo Altern nicht mehr im Interesse der Gesellschaft ist – und so ist es bei uns –, ist es auch die verlängerte Lebenserwartung nicht.«1
Frank Schirrmacher
Es fängt schleichend an. Eine klappernde, lockere Fliese auf dem Küchenboden; Flecken auf den früher makellosen Teppichen; eine lose Schelle an der Dachrinne; eingetrocknete Krusten auf der Kleidung; tropfende Wasserhähne: All das hätte es früher in der Doppelhaushälfte meiner Eltern nicht gegeben. Staubige Batterien der immer gleichen Putzmittel begannen die Schränke zu verstopfen, weil Mutter beim Kauf vergessen hatte, dass ja noch fünf Flaschen da waren. Vorrat an Scheuerpulver, Möbelpolitur, Feuchtwischtüchern für Jahre und Jahrzehnte sammelte sich an. Mit solchen Anzeichen des Kontrollverlusts über die eigene Umgebung kündigt sich die letzte Phase des Lebens an.
Wenn die Eltern alt werden, kommt unweigerlich der Zeitpunkt, da man sich fragt: Ab wann kann ich es nicht mehr laufen lassen? War es, als Vater den Herzschrittmacher bekam? War es, als Mutter im Garten stürzte und sich den Arm brach? War es, als ich die Schimmelflecken hinter der Toilette entdeckte, ein Warnzeichen in einem Haushalt, der so auf Ordnung bedacht war, dass man einen Anschiss bekam, wenn man auch nur einen Untersetzer an die falsche Stelle räumte (für mich war diese Pedanterie als Zwanzigjähriger letztlich der Anlass gewesen, von zuhause auszuziehen)? War es, als sie anfingen, dieselben alten Geschichten ständig erneut zu erzählen, und ich es aufgab, sie daran zu erinnern, dass ich sie bereits zwanzig-, dreißig-, hundertmal gehört hatte, sondern mich einfach hinsetzte und innerlich auf Durchzug schaltete (was manchmal ganz guttat)?
In dem Buch der amerikanischen Cartoonistin Roz Chast über den Abschied von ihren Eltern findet sich eine Zeichnung, die diese Gefühle treffend wiedergibt2: Die Zeichnerin stellt ihren Vater und ihre Mutter als Hochbetagte in einem altmodischen, riesigen Schlitten dar, ausgerüstet mit Decken und Ohrenschützern, in dem sie in einer verschneiten Berglandschaft entrückt lächelnd zu Tal rauschen. Die Tochter steht als Skifahrerin am gegenüberliegenden Hang, von wo aus sie hektisch winkt, die Katastrophe vorausahnend. Aber sie kann nichts machen. Ein Abgrund liegt zwischen ihnen. Mich rührte diese Darstellung, weil Roz Chast ihre Eltern, den nachgiebigen, gutmütigen und etwas trotteligen Vater, die clevere, willensstarke, respekteinflößende und kühle Mutter, mit melancholisch-ironischer Distanz in einer Weise konturiert hatte, als wären sie eine Blaupause meiner eigenen Familie.
Der Abgrund zwischen der Tochter am Skihang und den Eltern im Schlitten symbolisiert die Distanz, die zwischen ihnen herrscht, zwischen Eltern und Kindern, die jahrzehntelang ihre eigenen Leben gelebt hatten. Wie Roz Chast hatte ich es mit Eltern zu tun, die sich trotz hohen Alters beharrlich weigerten, zur Kenntnis zu nehmen, dass es bergab mit ihnen ging, die sich dem Gespräch darüber verweigerten, sich in störrischer Zweisamkeit abgekapselt hatten und nichts von der Zukunft hören wollten. Und was ging es mich auch an, wie es ihnen ging? Unsere Leben kannten nur wenige Berührungspunkte. Hinter ihre Bastion hatten sie sich zurückgezogen, bis es eben nicht mehr ging. In ihrem Buch zeichnet Roz Chast auf ironisch-beklemmende Weise nach, wie sie sich immer wieder müht, das Gespräch am Kaffeetisch auf die Frage zu lenken, was wohl auf die beiden zukommt, die die neunzig überschritten haben. Und immer prallen diese Versuche an die Mauer desselben Kommentars: »Können wir nicht über was anderes reden?«
Die Betretenheit mündet in ein »Que será, será«, das die Tochter schließlich am Küchentisch murmelt. Was sein wird, wird sein. Ein Augenblick der scheinbaren Erleichterung. Man hat das Thema wieder mal erfolgreich vermieden, verdrängt.
Trotz des Schweigens hatte ich mir innerlich ungefähr zwanzig Jahre lang Sorgen um meine Eltern gemacht, viel zu früh, wie sich herausstellen sollte. Als sie mit Ende achtzig wirklich krank wurden, erinnerte ich mich an schlaflose Nächte, die ich zehn Jahre zuvor schon verbracht hatte, als ich nach Barcelona ging, um einen Master zu machen. Als ich anschließend beruflich nach Düsseldorf weiterzog, lag Vater wegen einer Prostata-OP im Kreiskrankenhaus, ein Routineeingriff, den er gut überstand. Doch ich fragte mich schon zu diesem Zeitpunkt: Hatte ich ihn im Stich gelassen? Würde er danach noch in der Lage sein, das Weinlaub an ihrem Häuschen zu schneiden? Oder müsste ich das jetzt langsam übernehmen? Konnte ich überhaupt in Städte ziehen, die Hunderte Kilometer entfernt lagen? Musste ich als Einzelkind nicht verfügbar sein?
Wer sich überhaupt keine Sorgen zu machen schien, waren meine Eltern. Bis Anfang ihrer Achtziger lebten sie, als gäbe es kein Jenseits. Als Angehörige der Generation rüstige Rentner unternahmen sie mehrmals im Jahr Wander- und Radreisen in die Auvergne, die Bretagne, nach Umbrien, ausstaffiert mit Klepper-Jacken und immer ausgefeilteren Gangschaltungen gegen die müden Beine sowie Silikoneinlagen für die schmerzenden Füße. Vom Jakobsweg gibt es ein wunderbares Foto von Vater, wie er auf dem Rad die kahlen Hügel von Navarra bezwingt. Da war er Mitte siebzig, trug eine beige Schiebermütze gegen die Hitze und in sich die Fitness eines alten Mannes, der täglich im Keller auf dem Hometrainer strampelte.
»Wie alt sind deine Eltern?«, fragten Freunde. »Wahnsinn, toll, was die noch alles machen!«
Manchmal ertappte ich mich dabei, wie ich mir vorstellte, sie würden auf der Rückfahrt von einer dieser Reisen mit ihrem alten Toyota über irgendeine Klippe hinab ins Meer rauschen. Aber Vater kümmerte sich darum, dass die Bremsen stets bestens in Schuss waren.
Später beschränkten sich ihre Unternehmungen auf weniger entlegene Gegenden, die Fränkische Schweiz oder den Thüringer Wald, Wandern mit Gepäcktransport, gemächliche Ausflüge. Erst gingen sie Ski fahren, dann langlaufen; erst fernwandern, dann spazieren. Mit der Einschränkung ihres Bewegungsspielraums fanden sie sich nach außen hin klaglos ab: »Na, das haben wir ja nun alles gemacht«, pflegte Mutter zu sagen, wenn wieder mal eine Aktivität aus körperlichen Gründen gestrichen werden musste. »Dann sehen wir uns eben die Fotos an.«
Mutter wurde mit der nachlassenden Bewegung immer rundlicher, Vater hingegen erstaunlicherweise immer magerer.
Das Häuschen in der Kleinstadt wurde den nachlassenden Kräften behutsam angepasst, der Garten allmählich von Rasen auf Rosen umgestellt, weil man die nicht mähen musste. Da saßen sie nun auf ihren billigen Gartenmöbeln und sahen »der Zeit beim Vergehen zu«, wie es Mutter ausdrückte.
Auf Blumengießen verschwendete sie keine Mühe. Was vom Himmel komme, müsse genügen, befand Mutter. Auch für Gartenblumen galt bei ihr die Devise: Seht zu, wie ihr zurechtkommt.
Einmal kehrten meine Eltern von einem Ferienaufenthalt in Niederbayern zurück, neben ihrem Hotel war ein Altenpflegeheim mit Garten gewesen. Vom Balkon aus hatten sie einen Blick auf ihre mögliche Zukunft werfen können: Alte im Rollstuhl, Alte mit Rollator, Alte auf Krankenliegen, sabbernde Alte, gelähmte Alte, hilflose Alte, stumme Alte, lallende Alte.
Vater: So wolle man ja nicht enden.
Mutter: »Die wackeln alle mit dem Kopf.«
Krank waren nur die anderen.
Als ich andeutete, dass ich vielleicht nach Buenos Aires versetzt werden würde, aber nicht wüsste, ob ich sie alleinlassen könnte, hieß es nur: »Um uns brauchst du dir keine Sorgen zu machen.« Über Leiden und kurze Krankenhausaufenthalte wurde meist erst nach der Genesung beziehungsweise Entlassung Bericht erstattet, wogegen ich zum Schein protestierte, was mir im Kern aber ganz recht war.
Tatsächlich ging es ihnen lange gut, so gut, dass Vater sich noch mit achtzig den Luxus leisten konnte, Hypochonder zu sein, sich also Krankheiten einzubilden, die er gar nicht hatte. Schon 1943 hatte ein Stabsarzt an ihm diagnostiziert, er horche »zu sehr in sich hinein«. Vater war nicht erst im hohen Alter regelmäßiger Gast bei diversen Hausärzten, von denen er mindestens einen überlebte. Das führte später dazu, dass weder Mutter noch ich ihn in seinem beginnenden echten Leiden ernst nehmen wollten. Vater schluckte alles, was der Medizinschrank hergab, Mutter nichts. Dass beide fast gleich alt wurden, ist keine Auszeichnung für die Pharmaindustrie.
Es hätte durchaus Gelegenheiten gegeben, den allerletzten Lebensabschnitt verantwortungsbewusst vorzubereiten. Als meine Eltern entfernte Verwandte in einer Seniorenresidenz in Göttingen besuchten, lobten sie die gepflegte Atmosphäre dort, sogar einen Konzertsaal gebe es, einen Computerraum und einen »sprechenden Aufzug«, der die Stockwerke ansage. Und dann der Blick aufs Leinetal, wunderbar!
Die Stadt hatte für Mutter einen gewissen Heimatwert, ihre Vorfahren stammten von dort, und sie hatte 1944 ein Semester lang Chemie an der Uni studiert, bevor sie zum Rüstungseinsatz musste. In Bayern, wo meine Eltern vierzig Jahre lebten, waren sie nie wirklich heimisch geworden.
Ich biss mir auf die Zunge, um nicht zu sagen: »Wäre Göttingen was für euch?«
Man schiebt doch seine alten Eltern nicht ins Heim ab!
Dabei war früh klar, dass ihre Festung Doppelhaushälfte mit den steilen Treppen irgendwann keinen Schutz mehr gewähren, sondern zur Falle werden würde. Es war auch klar, dass sie dann entweder in die Welt der Heime hinausmüssten – oder diese Welt in Gestalt einer moldawischen oder ukrainischen Pflegerin zu ihnen ins Haus kommen würde. Doch um ihre Zukunft, das ahnte ich früh, würde ich mich kümmern müssen.
Dieses Wissen löste ein dumpfes Unbehagen aus, und ich fragte mich, warum. Eigentlich ging es ja um die normalste Sache der Welt: Sterben, Pflege, Tod, Abschied, Weitermachen. Jeder erlebt es, niemand kommt daran vorbei, ob Angehörige oder Freunde, wir alle müssen irgendwann gehen. Niemand kommt hier lebend raus. Im Alter für die Eltern zu sorgen, sollte doch selbstverständlich sein?
War es für mich aber nicht.
Aus zwei Gründen. Der erste Grund liegt in der postindustriellen Gesellschaft 3.0 auf der Hand: Im Moment der Pflegebedürftigkeit der Eltern ist der sorgsam aufgebaute, verdrahtete und durchdigitalisierte Alltag hin. Trotz beachtlicher Medienpräsenz des Themas sind die wenigsten von uns wirklich für diesen Moment gerüstet – zum einen, weil niemand weiß, auf was man sich vorbereiten soll, denn jedes Lebensende verläuft anders, so wie das Leben zuvor ja auch. Sterben und Tod werden notgedrungen negiert, sie stören unseren engmaschigen Alltag, auch wenn auf den allgegenwärtigen Bildschirmen virtuell mehr gestorben wird als je zuvor.
Dazu kam in meinem Fall ein zweites Problem, dessen Ursache ich in der Familiengeschichte vermutete. Meine Eltern waren gute Eltern, ich wuchs behütet auf, es fehlte mir materiell an nichts. Und doch war da eine Distanz, die ich mir nicht recht erklären konnte. Irgendetwas in unserer Geschichte machte mir den Gedanken an eine Hinwendung zu meinen Eltern im Alter schwer. Woher rührte diese Distanz? Und warum taten sich wiederum meine Eltern so schwer damit, Gefühle zu artikulieren, Bedürfnisse zu formulieren oder Schwächen einzugestehen? Sollte das etwas mit ihrer Vergangenheit zu tun haben, die für mich im Dunkeln lag?
Ich wurde 1964 geboren – damit gehöre ich zu den geburtenstarken Jahrgängen, den sogenannten Babyboomern, die in Deutschland normalerweise gleichzeitig Kriegsenkel sind, deren Eltern also den Zweiten Weltkrieg als Kinder mitgemacht haben. Ich bin vom Jahrgang her ein Kriegsenkel, von der Familiengeschichte her aber ein Kriegskind, also jemand, dessen Eltern die Zerstörung ihrer Welt als junge Erwachsene erlebt hatten. Vater, Jahrgang 1923, hatte als Soldat an der Ostfront gekämpft; Mutter, zwei Jahre jünger, hatte die Bombennächte in Berlin durchgemacht. Welche traumatischen Erlebnisse sie davongetragen haben mochten, konnte ich nur erahnen. In unserer Familie herrschte ein zähes Schweigen über die Vergangenheit.
Lange Zeit spielte das für mich keine Rolle, ich hatte es akzeptiert. Erst als meine Eltern alt und hilfsbedürftig wurden und wir äußerst mühsam wieder näher zusammenrücken mussten, begann ich, Details aus ihrem Leben zu einem großen Ganzen zusammenzusetzen. Erst da begriff ich, wie sehr ihr Verhalten, ihre Lebensauffassung, ihr Verhältnis zum Tod durch ihre Geschichte geprägt gewesen waren. Sie waren auf ihre Art Gefangene, saßen in ihren Kriegsbiografien »wie mit dem Arsch in der Glut«, wie es Alexander Gorkow in einem Buch über seine Eltern formuliert hat.3 Das hatte meine Mutter und meinen Vater zu verschlossenen Menschen gemacht, auch wenn sie praktisch unaufhörlich redeten.
Es gibt inzwischen allerhand Literatur über Kriegskinder und Kriegsenkel, die wohl wichtigste Autorin ist Sabine Bode, selbst ein Kriegskind. Ihre Bücher sind Bestseller, ein Zeichen, wie sehr die Nachgeborenen das Schicksal ihrer Eltern auch siebzig Jahre nach Kriegsende umtreibt. Bode stellt nach Interviews mit Dutzenden von Betroffenen und Zeitzeugen fest, dass es geradezu typisch für Kriegskinder beziehungsweise -enkel sei, Distanz zu den Eltern zu halten. Das große Schweigen sei symptomatisch für die deutsche Nachkriegszeit, die erst jetzt, da diese Generation abtritt, wirklich endet.
»So existieren in der Familie vielleicht noch unbearbeitete Konflikte, die den Beteiligten gar nicht mehr bewusst sein müssen«, schreibt die Autorin.4 Solche Konflikte könnten beruhen auf dem Gefühl fehlender Nestwärme in der Kindheit, wiederum Folge nicht bewältigter Kriegstraumata der Eltern, die zu einer seelischen Verkapselung geführt hätten. Emotional abgekapselte Eltern aber tun sich schwer damit, eine enge emotionale Beziehung zum Kind aufzubauen. Sie können unfähig sein, Offenheit und Nähe zu zeigen, Zuversicht und Lebensvertrauen zu vermitteln.
Ein Kind, so führt Bode aus, spüre diese Unfähigkeit zur Nähe und versuche instinktiv alles, um gegenzusteuern, denn es habe ja ein vitales Interesse an der Zuwendung der Eltern, müsse gefüttert und umsorgt werden. Es übernehme deshalb sozusagen Verantwortung für deren seelisches Gleichgewicht, eine früh einsetzende Überforderung, durch die das »Fürsorge-Prinzip zwischen Eltern und ihren Kindern auf den Kopf gestellt« werde.5 Bode schreibt Kindern, die so aufwüchsen, jene Tendenz zu, die ich auch an mir beobachtet hatte – nämlich die, sich zur Unzeit Sorgen um ihre alt werdenden Erzeuger zu machen,6 zu denen sie sonst großen emotionalen Abstand halten. Die Umkehrung der Verantwortungsverhältnisse endet nicht mit dem Erwachsenwerden.
Anfangs hatte ich vermutet, die stoische Weigerung meiner Eltern, über die Zukunft zu reden, sei allein der Arroganz von Menschen geschuldet, denen es aufgrund von guten Genen, Überlebenstalent, Bewegung und gesunder Lebensführung relativ lange gut gegangen war. Mit der Zeit begriff ich, dass da mehr verborgen lag. Mir kam es zunehmend so vor, als behandelten meine Eltern die Zukunft einfach mit der gleichen Methode wie die Vergangenheit – mit Missachtung. Meine Eltern hatten im echten Leben wahrscheinlich mehr Menschen sterben sehen als jeder Jugendliche beim digitalen Ballerspiel Call of Duty oder auf Netflix. Das hatte in ihnen wenig Neigung hinterlassen, sich ein zweites Mal im Leben mit dem Tod auseinanderzusetzen, vor allem nicht mit ihrem eigenen, den sie so oft ausgetrickst hatten. Verdrängung hatten sie als taugliches Mittel angesehen, die Geister von gestern zu bändigen. Warum also nicht in Bezug auf die Zukunft dasselbe Mittel anwenden, das nahende Siechtum mit Nichtachtung strafen und dadurch auf Distanz halten?
Ich merkte, dass der emotionalen Verstocktheit meiner Eltern, ihrer Realitätsverleugnung, ihrem Schweigen etwas zugrunde lag, das tiefer in unserer Geschichte verborgen war, und zwar nicht nur in der Geschichte unserer Familie – sondern der des ganzen Landes.
Diese Erkenntnis, die sich erst in der letzten Lebensphase meiner Eltern herauskristallisierte, hat mir sehr geholfen – nicht nur bei dem Versuch, sie besser zu verstehen und die schwere Zeit als Gewinn zu sehen. Ich kam meinen Eltern in diesen Jahren auch wieder näher und fand heraus, dass ich mit diesem Gefühl der Distanz keineswegs allein dastand. Eine ganze Generation quält sich mit diesem Problem ab. »Unerklärliche Ängste und ein unsicheres Lebensgefühl prägen noch heute die Generation der Kriegskinder und -enkel. Jeder dritte Deutsche ist davon betroffen«, heißt es in einem Artikel der Zeitung Die Welt.7 Ich erlebte sozusagen am eigenen Leib, wie sehr Geschichte ins Private drängt, wie sehr die kollektive Vergangenheit eines Landes das Leben jedes Einzelnen prägt. Es verhielt sich genauso, wie William Faulkner es ausgedrückt hat: »Das Vergangene ist niemals tot, es ist nicht einmal vergangen.«8
Doch zunächst hatte ich – als meine Eltern gebrechlich wurden – andere, praktischere Fragen zu beantworten, und zwar schnell. Was brauchten sie? Konnte ich Beruf und Pflege vereinbaren? Wie lange reicht das Geld? Machte ich hier eigentlich irgendetwas richtig?
Auch da stellte ich bald fest, Teil einer gesamtgesellschaftlichen Herausforderung zu sein.
Jeder pflegt allein9, lautet der treffende Titel eines Buches. Er illustriert, dass Pflege in unserem Land trotz vollmundiger Bekenntnisse der Politik kaum mit der geforderten schrankenlosen Mobilität, dem Dogma des Individualismus und der Dauerleistungsbereitschaft in der Gesellschaft zu vereinbaren ist. Gerade in Bayern – aber nicht nur dort – fühlt man sich bei der Altenpflege allen sozialen Veränderungen zum Trotz jenem vormodernen Familienbild10 verpflichtet, das auf den westdeutschen Gesellschaftsverhältnissen der Nachkriegszeit gründet, in denen die Familie nach dem staatlichen Totalversagen den sozialen Anker bildete. Wer sich hierzulande an offizielle Beratungsstellen wendet, stößt allenthalben auf ein altmodisches familiaristisches Modell, an dem normativ festgehalten wird. Es wird eisern das »Subsidiaritätsprinzip« verfochten, also die Verlagerung der sozialen Verantwortung auf die niedrigste mögliche Instanz: die Familie. »Subsidiarität« aber ist nichts anderes als ein hochtrabendes Synonym für Mutters guten alten Grundsatz: Sieh zu, wie du zurechtkommst.
Die Schwachstelle besteht darin, dass trotz aller gesellschaftlicher Gleichberechtigungsversuche und Gender-Debatten am Ende oftmals doch wieder nur auf eine »traditionelle Rollenteilung zurückgegriffen wird«11, wie der Pflegeexperte Thomas Klie anmerkt. Gerade in der Generation der Kriegskinder und -enkel wird Pflege als typische Aufgabe für Töchter oder Schwiegertöchter angesehen. Wer – wie ich – ein modernes Großstadtleben führte, wer ohne Partner oder Partnerin war, der oder die bereit gewesen wäre, sich in diese Rolle zu fügen, stieß schnell an Grenzen. Meiner damaligen Freundin hätte ich die Aufgabe weder zugemutet noch zugetraut.
Das Subsidiaritätsprinzip besagt zwar auch, dass öffentliche und private Träger da einspringen sollen, wo der Einzelne nicht weiterkommt. Kommunen, Beratungsstellen und Vereine sind eifrig bemüht, Hilfsmöglichkeiten zu schaffen. Sie fühlen sich jedoch dem »betreuten Wohnen zu Hause« verpflichtet, einem stark romantisierten Modell, wie Thomas Klie zu Recht sagt.12 Es verspricht ein sanftes Ableben in vertrauter Umgebung und im Kreise der Lieben. Doch Treppenlift einbauen, die moldawische Pflegekraft anlernen, Essen auf Rädern in Empfang nehmen, die Rotkreuz-Waschkraft anheuern, den Putzdienst organisieren: Das ist keine Familienidylle. Es ist eher so, als würde man eine kleine Pflegefirma daheim führen, als Zusatzherausforderung neben den beruflichen und familiären Pflichten, die ja weiterlaufen. Das kann gerade noch bei intakten Familien- und Wohnverhältnissen geleistet werden, in denen man sich die Aufgaben teilt oder einer der Angehörigen den Pflegemanager gibt. Wo das nicht der Fall ist, kann betreutes Wohnen zu Hause leicht in Überforderung, Einsamkeit und Verwahrlosung enden.
Dazu kommt, dass bei der Propagierung des Pflegeidylls in den eigenen vier Wänden viel Heuchelei im Spiel ist. Familiäre Pflege ist »skandalös unterfinanziert«, wie der Gerontologieprofessor Eckart Hammer13 feststellt. Und wie moralisch ist es überhaupt, ein Ideal zu propagieren, das nur aufrechtzuerhalten ist, indem man Legionen von Pflegekräften aus Osteuropa importiert, sie miserabel bezahlt oder gar zur Schwarzarbeit anstiftet? »Die Altenpflege hierzulande würde ohne die externalisierte, von informeller migrantischer Arbeit (…) getragene Dienstleistungsökonomie schlicht zusammenbrechen«, schreibt der Soziologe Stephan Lessenich. Man müsse kein »sozialpolitischer Verschwörungstheoretiker« sein, um festzustellen, »dass die Gesetzliche Pflegeversicherung in Deutschland dieses Externalisierungsarrangement in ihren Leistungskatalog, der die realen Pflegebedarfe der privaten Haushalte nicht einmal annähernd abdeckt, faktisch eingepreist hat«.14
Wer am betreuten Wohnen zu Hause scheitert, wie das bei uns der Fall war, dem bleibt das klassische Alters- und Pflegeheim, wo sich seit Jahrzehnten wenig verändert hat – oder der private Pflegemarkt, der zwar alle Möglichkeiten mit Stiften und Residenzen bietet, aber eben ein Geschäft ohne soziale Verpflichtung ist. Im Zweifelsfall gilt die Rendite mehr als die Bedürfnisse der Alten.
All diese Zustände treffen auf eine extrem verlängerte Lebenserwartung, die jene »irrwitzigen Vorsorgepflichten« begründet, »die jeder für seine eigenes Alter und das Altern der anderen treffen muss«15, wie es Frank Schirrmacher ausgedrückt hat. Anfang des 20. Jahrhunderts betrug die normale Pflegezeit für Angehörige einige Wochen oder Monate. Heute sind es im Schnitt sieben Jahre.16 Kein Angehöriger kommt aus diesem Tunnel als derselbe heraus, als der er hineingegangen ist. Bei mir waren es knapp vier Jahre, von August 2012 bis zum Tode meiner Mutter im Januar 2016, also weit unter Durchschnitt. Doch auch ich litt unter Stresssymptomen wie nervöser Überreizung, Bluthochdruck, Hyperventilation. Es war, als hätte ich einmal zu tief Luft geholt und danach nicht mehr richtig ausgeatmet. Ich bezahlte die Überforderung mit dem Scheitern einer Beziehung und dem Verzicht auf berufliches Fortkommen.
Ich kann immer noch nicht sagen, ob ich viel oder wenig geleistet habe. Vorwürfe hat mir niemand gemacht, meine Eltern kaum, Nachbarn und Freunde gar nicht, weder Pflegekräfte noch unsere spärliche Verwandtschaft meckerten herum. Niemand hat mich beurteilt oder entmutigt, wenn ich schwierige Entscheidungen traf, im Gegenteil. »Sie müssen sich nun über den Willen Ihrer Eltern hinwegsetzen«, sagte ein ehemaliger Kollege meines Vaters, der half, als es eng wurde. Er weiß bis heute nicht, wie sehr er mir mit diesem Satz die Legitimation verschafft hat, derer ich bedurfte.
In das inzwischen mantrahaft wiederholte Lamento über mangelnde Leistungen des Pflegepersonals kann ich nicht einstimmen. Die Bedingungen waren selten ideal, aber Schwestern, Reinigungskräfte, Fahrdienste, Pfleger, Pflegedienstleiterinnen, Ärztinnen und Ärzte taten überwiegend ihr Bestes. Es schien mir sogar so zu sein, als könnte fast jeder, der hilfsbedürftige Eltern hat, mit maximaler gesellschaftlicher Anteilnahme rechnen; man billigt ihm Depressionen zu, Verzweiflung, Erschöpfung, nachlassende Schaffenskraft. Ich habe nicht die geringsten Schwierigkeiten gehabt, wenn es darum ging, Versicherungen oder Zeitschriftenabos meiner Eltern zu kündigen, Steuerzahlungen stunden zu lassen, Dienstreisen abzusagen oder mal aus dem Büro zu verschwinden, wenn etwas für meine Eltern erledigt werden musste. Mein Ressortleiter sagte: »Nimm dir alle Zeit, die du brauchst.«
Andererseits hält diese Anteilnahme gewöhnlich nicht lange an. Mitunter ist sie schneller passé als der Aufmacher auf der Homepage der Tageszeitung. Ein Arbeitnehmer, der jahrelang Angehörige pflegt, wird zwar im Kern Verständnis erhalten. Die berufliche Leistung muss aber trotzdem stimmen.
Wer sein Leben nach Gebrechlichkeit ausrichtet, sollte besser ständig davon sprechen. Sonst gerät es in Vergessenheit. Ich hätte ja nach Südamerika gehen können, dann müsste ich jetzt keine nervigen Spätschichten in der Redaktion mehr schieben, sagte mir eines Tages beiläufig einer meiner Chefredakteure, der den Anlass meiner Absage offenbar vergessen hatte. Den Tod eines Angehörigen sollte man nach heutigem Zeitempfinden nicht nach einem Trauerjahr, sondern am besten nach drei bis vier Tagen verarbeitet haben. Sonst bekommt man von der neuen Lebenspartnerin nach einem halben Jahr eventuell vorgehalten: »Du hast dich so verändert.«
Ja, wie denn nicht?
Dass ich gesetzliches Anrecht auf zehn Tage Sonderurlaub zur Angehörigenpflege gehabt hätte, war mir klar, doch schien der bürokratische Aufwand größer als der Nutzen zu sein. Auch die Möglichkeit, eine Pflegeauszeit zu nehmen, verwarf ich. Ich musste ja Geld verdienen. Pflege sei »kein Sprint, sondern eine Langzeitaufgabe«, sagt ein Ehemann, der sich um seine kranke Frau kümmert, in dem Buch von Professor Hammer.17 Punktuelle Erleichterungen bringen wenig, man muss Beruf, Privatleben und Pflege dauerhaft miteinander in Einklang bringen. Kein Wunder, dass nur 57 Prozent der Männer über fünfzig, die sich um ihre Eltern kümmern, berufstätig sind; bei den Frauen sind es 62 Prozent. Dass Frauen häufiger weiterarbeiten, liegt daran, dass sie sich leichter für Teilzeit entscheiden.18 Und es gibt noch einen weiteren Grund, warum Männer, die sich um andere kümmern, seltener einer Erwerbsarbeit nachgehen. Stundenreduzierung gelte als »Beweis für schwächeres berufliches Engagement«, heißt es in einer Studie des RWI – Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung in Essen über pflegende Angehörige.19
Ich entschied mich, nicht nur auf Buenos Aires zu verzichten, sondern auch, eine Viertagewoche zu beantragen. Das erschien mir die nachhaltigere Lösung zu sein. Doch in vielen deutschen Unternehmen kommt dies einem Bekenntnis zum Karriereverzicht gleich, den man sich diesseits der fünfzig kaum erlauben kann.
Anfangs, als die Anteilnahme noch groß war, bat man mich in der Redaktion sogar, einen Artikel über diesen aus Sicht der Kolleginnen und Kollegen ungeheuren Schritt zu schreiben. Ich sagte nach einigem Zögern zu, weil der Beitrag auf einer Doppelseite mit Artikeln über neue Wohnformen bei der Altenbetreuung erscheinen sollte, die ich als schönfärberisch empfand. Da wurde über glückliche Alten-WGs mit verständnisvollen Pflegerinnen, ökologischem Essen und Tieren zum Streicheln berichtet, es wurde über das angebliche Entstehen einer neuen gesellschaftlichen Solidarität referiert, Ansätze zur Harmonisierung des Generationenverhältnisses wurden aufgelistet. Ich wollte der Idylle eine Prise Realismus beimengen. Denn sobald es um körperliche Betreuung geht, ist in der Regel Schluss mit der Vision von Oma auf dem Ponyhof. Geschmackvoll gestaltete Seniorenresidenzen verfügen selten über jenes graue Paralleluniversum aus Fäkalpumpen, Gummihandschuhen, Schnabeltassen und Erwachsenenwindeln. Eine alleinstehende frühere Schulfreundin von Mutter verbrachte ein paar Jahre auf einem seniorengerechten Ökohof mit selbstgebackenem Brot, Gnadenhof für Tiere und durchsonnten Apartments im Fränkischen. Als sie einen Schlaganfall erlitt, musste sie in ein tristes Heim der Arbeiterwohlfahrt umziehen, wo sie ihre letzten Monate verdämmerte. Dieses Ende der Geschichte wird beim Seniorenmarketing in der Regel verschwiegen.
Ich schrieb in dem Artikel, dass der Verzicht auf Buenos Aires mitnichten eine Heldentat gewesen sei, sondern eine Selbstverständlichkeit. Ich erhielt viele Briefe daraufhin, Lob für meine Opferbereitschaft, Zuspruch, Ermutigung, einen Heiratsantrag sogar. Man war gewillt, mir Selbstlosigkeit zu attestieren. Das Lob sagte allerdings weniger über meine Leistung aus als eher etwas über unsere Gesellschaft, die in dem Irrglauben lebt, der Einzelne habe endlose Wahlmöglichkeiten. Dabei hat ein Einzelkind natürlich überhaupt keine Wahl – und das nicht nur moralisch.
Ein Kind ist rechtlich in viel höherem Maße verantwortlich für die Eltern, als es die meisten wahrhaben möchten. Der Staat fragt nicht nach unseren beruflichen Zielen, er will, dass wir einstehen und aufkommen für unsere Erzeuger. So steht es im Gesetz. Zwar springt bei Bedürftigkeit das Sozialamt ein, aber dort herrschen bei der Altenbetreuung dieselben Grundsätze wie in der Sozialhilfe. Es ist dem Amt auch egal, wie das Verhältnis zwischen Eltern und Kindern war. Ich lernte eine alleinerziehende Mutter kennen, die gerade so über die Runden kam und eines Tages einen Brief vom Amt erhielt mit der Aufforderung, finanziell zur Pflege ihres hilflosen alten Vaters beizutragen, den die Behörde in ein Heim verfrachtet hatte. Die Tochter hatte ihn zwanzig Jahre nicht gesehen, der alte Mann hatte sie und ihre Mutter einst sitzenlassen.
Zwar gibt es bei der Pflege wie bei Hartz IV ein Schonvermögen. Die selbst genutzte Immobilie etwa ist weitgehend geschützt – allerdings nicht die vermietete. Das kann zum Problem werden, wenn Kinder das Häuschen ihrer Eltern vermieten, um eine Heimunterbringung zu bezahlen. Die meisten Menschen schrecken davor zurück, ihre Einkünfte offenzulegen, auch deshalb werden siebzig Prozent der Alten von Angehörigen zu Hause gepflegt.20
Pflege kostet bei hoher Intensität Tausende von Euro im Monat. Das private Stift, in dem meine Eltern ihr Lebensende verbrachten, hatte freundlicherweise den möglichen Höchstsatz des Eigenanteils gedeckelt, was nicht alle tun – auf 7 500 Euro im Monat. Meine Eltern haben diese Summe nicht annähernd erreicht. Aber die Existenz dieses Maximalbetrages zeigt, auf was man sich bei zwei pflegebedürftigen Menschen im schlimmsten Fall einzustellen hat.
Wenn sie nicht selber pflegen, müssen Kinder dafür sorgen, dass die Eltern ordentlich untergebracht sind. Sie müssen unterschreiben für tausend kleine und große Vorgänge, für Einweisungen und Beantragungen; sie müssen mit Heimleitungen verhandeln, mit den Kassen um Geld feilschen, aufpassen, dass die Betreuung funktioniert, und natürlich emotional da sein für ihre Eltern in diesem äußerst schwierigen Moment. Sie müssen sich um Vollmachten, Patientenverfügungen, Rentenzahlungen, hinterlassene Immobilien kümmern. Wäre ich ins Ausland gegangen, hätte ich eine gesetzliche Vertretung bestimmen müssen, eine Art Vormund, der für meine zunehmend verwirrten Eltern Verträge unterschrieben, ihre Bankkonten verwaltet und aufgepasst hätte, dass die Pflegekräfte gut arbeiten – und dass meine Eltern auch mal Blumen oder DVDs mit Heinz-Rühmann-Filmen bekämen, um nicht im TV-Müll zu ersticken. Das wollte ich nicht, das wollten sie nicht.
Angesichts eines komplexer werdenden Alltags stellt es für die meisten Zeitgenossen eine gewaltige Herausforderung dar, neben ihrem eigenen ein weiteres oder gar zwei Leben zu schultern. Auch Jüngere fühlen sich ja längst ausgelastet mit ihren Digitalabos, Onlinebankings, ihren Stromlieferungs- und Telefonverträgen, ihren Steuererklärungen; sie japsen, um ihr »zwar freudloses, aber keineswegs leeres, sondern vielmehr mit zahlreichen kleinen Unannehmlichkeiten gespicktes Leben« am Laufen zu halten, wie es Michel Houellebecq ausgedrückt hat.21 »Will man allen bürokratischen Anforderungen gerecht werden, bedarf dies einer mehr oder minder dauerhaften Anwesenheit, jede längere Abwesenheit birgt die Gefahr, mit der einen oder anderen Verwaltungsstelle in Konflikt zu geraten«, schreibt der französische Schriftsteller. Bei alten Menschen kommen Pflegekasse, Pflegedienste, Heime, medizinisches Personal, Hörgeräteakustiker dazu. Bei den Nachkommen laufen alle Fäden zusammen.
Angesichts all dessen ist es kaum zu glauben, wie blind unsere Gesellschaft in eine Epoche hineinschlittert, in der die Generation der jetzt Pflegenden selbst pflegebedürftig werden wird. Pflege sei »die Herausforderung des 21. Jahrhunderts«22, stellt Eckart Hammer fest. Das Statistische Bundesamt geht bis 2030 von einer Steigerung der Zahl der Pflegebedürftigen um fünfzig Prozent auf 3,4 Millionen aus. »Wir müssen uns rasch etwas einfallen lassen, um die Deckungslücke zu schließen.« Doch nach »rasch« sieht es nicht aus. In Wahlkämpfen spielt das Thema gemeinhin eine untergeordnete Rolle.
Dabei ist es beileibe keine Neuigkeit, dass die Versorgung des stetig wachsenden Heers von Hochbetagten Sozialkassen und Angehörige überfordert, Pflegebedürftigkeit ist längst »der Regelfall eines immer längeren Lebens«23. Die Form der Vermögensbildung, die meine Eltern betrieben hatten durch Lebensversicherung, Zinsen und einen sich stetig aufwärts entwickelnden Aktienmarkt, hat die heutige Generation angesichts niedriger Zinsen und einer volatilen Börse nicht. Eine gesamtgesellschaftliche Pflegestrategie mit gesicherter Finanzstruktur fehlt in Deutschland.
Dabei ist klar, dass die Babyboomer aufgrund ihrer starken beruflichen Involviertheit »keineswegs in gleicher Weise in der Lage sein werden, Aufgaben zu übernehmen wie die Kriegskindergeneration heute«, prognostiziert Thomas Klie.24 Und die Kinder der Boomer werden noch viel stärker zur Mobilität gezwungen sein als ihre Eltern. Verlässliche Familienstrukturen lösen sich auf. Wir sind auf das Alter weder finanziell noch mental vorbereitet – und ich rede nicht nur davon, was es kosten wird, dickere Wände zwischen Pflegeapartments in den Heimen einzuziehen, damit der Nachbar nicht aus dem Bett fällt, wenn der schwerhörige AC/DC-Fan nebenan seine betagte Stereoanlage aufdreht.
Frank Schirrmacher hinterließ 2004 in seinem Buch DasMethusalem-Komplott eine Mahnung: »Der Eintritt der Babyboomer ins Rentendasein wird in der ganzen westlichen Welt einen Altersschub auslösen und wie ein nie verglühender Raketentreibsatz über Jahrzehnte Millionen von Menschen, Einzelne, die sich zu ganzen Völkern summieren, über die Datumsgrenze des 65. Lebensjahres katapultieren; nicht nur in eine neue ökonomische und soziale, sondern auch in eine fremde seelische Welt.«25