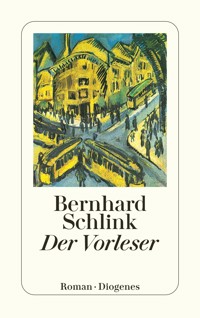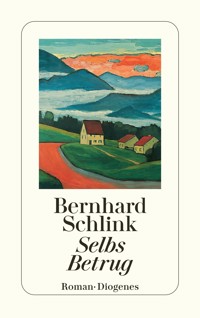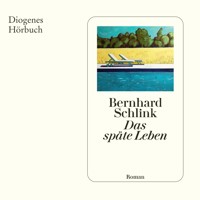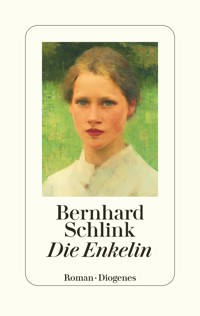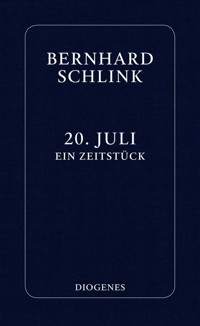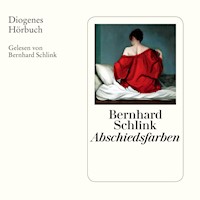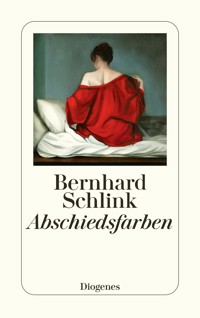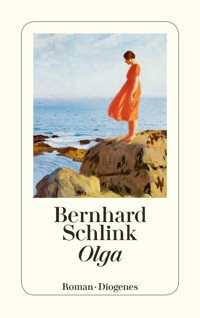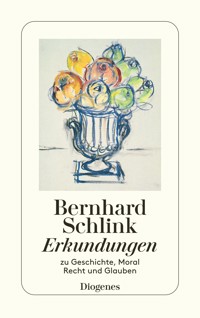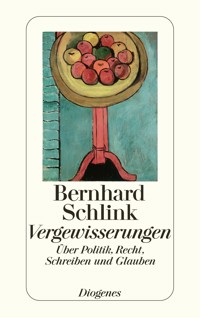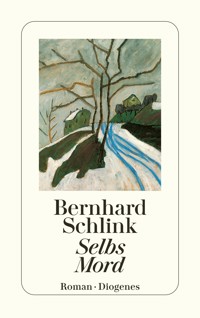
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Diogenes
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Selb-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Ein Auftrag, der den Auftraggeber eigentlich nicht interessieren kann. Der auch Selb im Grunde nicht interessiert und in den er sich doch immer tiefer verstrickt. Merkwürdige Dinge ereignen sich in einer alteingesessenen Schwetzinger Privatbank. Die Spur des Geldes führt Selb in den Osten, nach Cottbus, in die Niederlagen der Nachwendezeit. Ein Kriminalroman über ein Kapitel aus der jüngsten deutsch-deutschen Vergangenheit.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 253
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Bernhard Schlink
Selbs Mord
Roman
Die Erstausgabe
erschien 2001 im Diogenes Verlag
Umschlagillustration:
Gabriele Münter, ›Landstraße im Winter‹,
1911 (Ausschnitt)
Copyright © 2012 ProLitteris,
Zürich
Alle Rechte vorbehalten
Copyright © 2012
Diogenes Verlag AG Zürich
www.diogenes.ch
ISBN Buchausgabe 978 3 257 23360 5 (10. Auflage)
ISBN E-Book 978 3 257 60040 7
Die grauen Zahlen im Text entsprechen den Seitenzahlen der im Impressum genannten Buchausgabe.
[5]Inhalt
ERSTER TEIL
1 Am Ende [9]
2 Im Graben [13]
3 Beruf ist Beruf [17]
4 Ein stiller Teilhaber [20]
5 Gotthard-Tunnel und Anden-Bahn [27]
6 Nicht blöde [31]
7 C oder L oder Z [36]
8 Frauen! [40]
9 Immer weiter [45]
10 Zum Totlachen [51]
11 Schnelles Geld [56]
12 Randvoll [60]
13 Beschattet [66]
14 Nicht mit leeren Händen [70]
15 Ohne Beichte keine Absolution [76]
16 Kein Niveau [80]
17 Der schwarze Koffer [84]
18 Angst vorm Fliegen [89]
19 Es wächst zusammen [94]
20 Wie unsere früher [97]
21 Kindergesichter [104]
22 Der alte Zirkusgaul [109]
23 Katz und Maus [114]
[6]ZWEITER TEIL
1 Fahren Sie! [119]
2 Doppelt abgesichert [122]
3 Nicht mehr meine Welt [128]
4 Schlag auf Schlag [133]
5 Im Dunkeln [136]
6 Na dann [141]
7 Aberkennung der Pension [147]
8 Ein sensibles Kerlchen [151]
9 Reversi [154]
10 Wie ein Auftrag [159]
11 Tausend Möglichkeiten [162]
12 Verreist [166]
13 Gedeckter Apfelkuchen und Cappuccino [170]
14 Eins und eins, das macht zwei [174]
DRITTER TEIL
1 Zu spät [179]
2 Matthäus 25, Vers 14–30 [183]
3 Traktoren stehlen [189]
4 Im Sicherungsschrank [193]
5 Im dunklen Anzug mit Weste [198]
6 Drecksarbeit [202]
7 Bratkartoffeln [206]
8 Sieh dich vor! [210]
9 Ausfälle [215]
10 Alter Kacker [217]
[7] 11 Reue [222]
12 Sommer [224]
13 Labans Kinder [227]
14 Zentramin [231]
15 Und erst die Sprache! [235]
16 Einen Spaß erlaubt [240]
17 Unschuldsvermutung [247]
18 Nicht Gott [254]
19 Mit Blaulicht und Sirene [257]
[9] ERSTER TEIL
1
Am Ende
Am Ende bin ich noch mal hingefahren.
Ich habe mich bei Schwester Beatrix nicht abgemeldet. Sie läßt mich nicht einmal die kurzen, ebenen Wege vom Speyerer Hof zum Ehrenfriedhof und zum Bierhelder Hof machen, geschweige den langen, steilen zum Kohlhof. Vergebens erzähle ich ihr, wie meine Frau und ich vor Jahren am Kohlhof Ski gefahren sind. Morgens ging es hoch, der Bus voll mit Menschen, Skiern, Stöcken und Schlitten, und bis es dunkel wurde, drängten wir uns zu Hunderten auf dem abgefahrenen, mehr braunen als weißen Hang mit der verfallenen hölzernen Sprungschanze. Mittags gab’s im Kohlhof Erbsensuppe. Klärchen hatte bessere Skier, fuhr besser, und wenn ich fiel, lachte sie. Ich nestelte an den Lederriemen der Bindungen und biß die Zähne aufeinander. Amundsen hatte mit noch altertümlicheren Skiern den Südpol erobert. Am Abend waren wir müde und glücklich.
»Lassen Sie mich zum Kohlhof laufen, Schwester Beatrix, ganz langsam. Ich möchte ihn wiedersehen und mich an die alten Zeiten erinnern.«
[10] »Sie erinnern sich auch so, Herr Selb. Sonst könnten Sie mir nicht davon erzählen.«
Alles, was Schwester Beatrix nach vierzehntägigem Aufenthalt im Krankenhaus am Speyerer Hof erlaubt, sind ein paar Schritte zum Fahrstuhl, die Fahrt ins Erdgeschoß, wenige Schritte zur Terrasse, über die Terrasse, die Stufen hinab und auf dem Gras rund um den Springbrunnen. Großzügig ist Schwester Beatrix nur mit dem Blick.
»Schauen Sie, der schöne, weite Blick.«
Sie hat recht. Der Blick aus dem Fenster des Zimmers, das ich mit einem magenkranken Finanzbeamten teile, ist schön und weit, über die Bäume auf die Ebene und die Berge der Haardt. Ich schaue hinaus und denke, daß dieses Land, in das mich im Krieg der Zufall verschlagen hat, mir ans Herz gewachsen und meine Heimat geworden ist. Aber soll ich das den ganzen Tag denken?
So habe ich gewartet, bis der Finanzbeamte nach dem Mittagessen eingeschlafen war, habe leise und schnell den Anzug aus dem Schrank genommen und angezogen, den Weg zur Pforte gefunden, ohne einer Schwester oder einem Arzt zu begegnen, die ich kenne, und mir vom Pförtner, dem mein Status als flüchtiger Patient oder scheidender Besucher egal war, eine Taxe rufen lassen.
Wir fuhren hinab in die Ebene, zuerst zwischen Wiesen und Obstbäumen, dann unter hohem Wald, durch dessen Wipfel die Sonne helle Flecken auf Straße und Unterholz warf, dann vorbei an einer Holzhütte. Früher war’s hier zur Stadt noch ein gutes Stück Wegs und machten die Wanderer vor der Heimkehr eine letzte Rast. Heute fangen nach zwei weiteren Kurven rechts die Häuser an und liegt [11] wenig später links der Bergfriedhof. Am Fuß des Bergs warteten wir an der Ampel neben dem alten Kiosk, an dem ich mich immer gefreut habe: ein griechischer Tempel, der Vorplatz auf eine kleine Terrasse gebaut und das Vordach von zwei dorischen Säulen getragen.
Die gerade Straße nach Schwetzingen war frei, und wir kamen rasch voran. Der Fahrer erzählte mir von seinen Bienen. Ich schloß daraus, daß er rauchte, und bat ihn um eine Zigarette. Sie schmeckte nicht. Dann waren wir da, der Fahrer setzte mich ab und versprach, mich in einer Stunde wieder abzuholen und zurückzubringen.
Ich stand auf dem Schloßplatz. Das Haus war wieder hergerichtet. Es stand noch im Gerüst, aber die Fenster waren erneuert und der Sandstein des Sockels und der Tor- und Fensterfassungen gesäubert. Nur der letzte Anstrich fehlte. Dann würde es wieder genauso schmuck sein wie die anderen Häuser um den Schloßplatz, alle zweistöckig, gepflegt, mit Blumen vor den Fenstern. Was in das Haus kommen würde, Restaurant oder Café, Anwaltskanzlei, Arztpraxis oder Softwarefirma, war nicht angezeigt, und beim Blick durch die Fenster sah ich nur abgedeckte Böden und Malerleitern, -töpfe und -rollen.
Der Schloßplatz war leer, bis auf die Kastanien und das Denkmal der unbekannten Spargelverkäuferin. Ich erinnerte mich an die Straßenbahn, deren Linie früher hier in einem Kreis auf dem Platz endete. Ich sah zum Schloß hinüber.
Was erwartete ich? Daß im Haus das Tor aufginge und alle rauskämen, sich aufstellten, verbeugten und lachend auseinanderliefen?
[12]
[13] 2
Im Graben
An einem Sonntag im Februar hatte alles angefangen. Ich war mit meiner Freundin Brigitte und ihrem Sohn Manuel auf dem Heimweg von Beerfelden nach Mannheim. Brigittes Freundin, von Viernheim nach Beerfelden umgezogen, hatte zur Einweihung der Wohnung zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Die Kinder mögen sich, die Freundinnen redeten und redeten, und als wir aufbrachen, war es Nacht.
Kaum fuhren wir, begann es zu schneien, große, nasse, schwere Flocken. Die schmale Straße führte durch den Wald auf die Höhe. Es war einsam, kein Auto vor oder hinter uns und keines, das uns begegnet wäre. Die Flocken fielen dichter, in den Kurven schlingerte der Wagen, an den steilen Stellen drehten die Räder durch, und die Sicht reichte gerade, daß ich den Wagen auf der Straße halten konnte. Manu, der munter geplappert hatte, verstummte, und Brigitte faltete die Hände im Schoß. Nur ihr Hund Nonni schlief, als wäre nichts. Die Heizung wurde nicht recht warm, aber mir stand der Schweiß auf der Stirn.
»Wollen wir nicht halten und warten, bis…«
»Es kann Stunden schneien, Brigitte. Wenn wir erst einmal eingeschneit sind, sitzen wir fest.«
Ich sah das liegengebliebene Auto nur, weil es seine [14] Scheinwerfer angelassen hatte. Sie strahlten über die Straße wie eine Barriere. Ich hielt.
»Soll ich mitkommen?«
»Laß mal.«
Ich stieg aus, schlug den Kragen der Jacke hoch und stapfte durch den Schnee. Ein Mercedes hatte sich an einer Kurve in einen abzweigenden Weg verirrt und war beim Versuch, wieder auf die Straße zu finden, in den Graben geraten. Ich hörte Musik, Klavier mit Orchester, und sah hinter beschlagenen Fenstern im beleuchteten Inneren zwei Männer, einen auf dem Fahrersitz und einen schräg dahinter auf der Rückbank. Wie ein gestrandeter Dampfer, dachte ich, oder ein Flugzeug nach der Notlandung. Die Musik spielt weiter, als wäre nichts, aber die Reise ist zu Ende. Ich klopfte beim Fahrer ans Fenster. Er ließ die Scheibe einen Spalt runter.
»Kann ich Ihnen helfen?«
Bevor der Fahrer antworten konnte, beugte sich der andere rüber und machte die hintere Tür auf. »Gott sei Dank. Kommen Sie, setzen Sie sich.« Er lehnte sich zurück und machte eine einladende Handbewegung. Aus dem Inneren des Wagens strahlte Wärme und roch es nach Leder und Rauch. Die Musik war so laut, daß er mit erhobener Stimme sprechen mußte. Er wandte sich an den Fahrer: »Stell bitte die Musik leiser!«
Ich stieg ein. Der Fahrer ließ sich Zeit. Langsam streckte er den Arm zum Radio, griff nach dem Knopf, drehte ihn, und die Musik wurde leiser. Der Chef wartete mit gerunzelter Stirn, bis sie erlosch.
»Wir kommen nicht flott, und das Telephon geht nicht. [15] Ich fürchte, wir sind hier am Ende der Welt.« Er lachte bitter, als widerführe ihm nicht nur ein technisches Mißgeschick, sondern eine persönliche Kränkung.
»Sollen wir Sie mitnehmen?«
»Können Sie schieben helfen? Wenn wir’s aus dem Graben schaffen, schaffen wir’s auch weiter, der Wagen ist nicht kaputt.«
Ich guckte zum Fahrer und erwartete, daß er etwas sagen würde. Er war doch wohl für das Schlamassel verantwortlich. Aber er sagte nichts. Im Rückspiegel sah ich seine Augen auf mich gerichtet.
Der Chef hatte meinen fragenden Blick bemerkt. »Am besten setze ich mich ans Steuer, und Gregor und Sie schieben. Wir brauchen, wenn…«
»Nein.« Der Fahrer wandte sich um. Ein älteres Gesicht und eine gedämpfte, heisere Stimme. »Ich bleibe am Steuer, und ihr schiebt.« Ich hörte einen Akzent, konnte ihn aber nicht identifizieren.
Der Chef war jünger, aber ich sah seine zarten Hände und schmale Gestalt und konnte mir auf den Vorschlag des Fahrers keinen Reim machen. Aber der Chef widersprach nicht. Wir stiegen aus. Der Fahrer ließ den Wagen an, wir stemmten uns dagegen, die durchdrehenden Räder sirrten und ließen Schnee, Tannennadeln, Blätter und Erde stieben. Wir stemmten weiter, es schneite weiter, die Haare wurden naß und die Hände und Ohren klamm. Dann kamen Brigitte und Manu, ich hieß sie auf den Kofferraum sitzen, und als auch ich mich draufsetzte, griffen die Räder, und mit einem Ruck war der Wagen aus dem Graben.
»Gute Fahrt!« Wir grüßten und gingen.
[16] »Halt!« Der Chef lief uns nach. »Wem verdanke ich die Rettung?«
Ich fand eine Visitenkarte in der Jackentasche und gab sie ihm.
[17] 3
Beruf ist Beruf
Ich bin nicht am nächsten Tag nach Schwetzingen gefahren und nicht am übernächsten. Eigentlich wollte ich überhaupt nicht fahren. Unsere Begegnung auf der Hirschhorner Höhe bei Nacht und Schnee und seine Aufforderung vorbeizuschauen – es erinnerte mich an die Verabredungen, die man auf Reisen und im Urlaub trifft. Das Wiedersehen geht immer daneben.
Aber Beruf ist Beruf, und ein Auftrag ist ein Auftrag. Ich hatte mich im Herbst für Tengelmann um die Krankmeldungen der Verkäuferinnen gekümmert und die eine und andere falsche Kranke erwischt. Das war so befriedigend, wie als Straßenbahnkontrolleur Schwarzfahrer zu jagen und zu stellen. Im Winter kam kein Auftrag. Es ist nun mal so, daß man einen Privatdetektiv über siebzig nicht als Bodyguard anheuert oder über mehrere Kontinente hinter gestohlenen Juwelen herschickt. Sogar der Ladenkette, die ihren krank gemeldeten Verkäuferinnen nachspionieren will, imponiert ein junger Bursche mit Handy und BMW, von der Polizei ins private Sicherheitsgeschäft gewechselt, mehr als ein alter Kerl mit einem alten Opel Kadett.
Nicht daß ich im Winter ohne Aufträge nichts zu tun gefunden hätte. Ich habe mein Büro in der Augustaanlage [18] geputzt, die Holzdielen gewachst und gebohnert und die Fensterscheibe gewaschen. Die Scheibe ist groß; früher war das Büro ein Tabakladen und das Fenster das Schaufenster. Ich habe meine Wohnung um die Ecke in der Richard-Wagner-Straße aufgeräumt und meinen Kater Turbo, der zu dick wird, auf Diät gesetzt. Ich habe Manu in der Kunsthalle die Erschießung Kaiser Maximilians von Mexiko, im Reiss-Museum die Suebenheimer Hügelgräber und im Landesmuseum für Technik und Arbeit die elektrischen Stühle und Betten gezeigt, mit denen man im 19. Jahrhundert Bandwürmer aus dem Darm treiben wollte. Ich bin mit ihm in die Sultan-Selim-Camii-Moschee und in die Synagoge gegangen. Im Fernsehen haben wir verfolgt, wie Bill Clinton wiedergewählt und vereidigt wurde. Im Luisenpark haben wir die Störche besucht, die in diesem Winter nicht nach Afrika gezogen, sondern dageblieben waren, und am Rhein sind wir bis zum Strandbad gelaufen, dessen geschlossenes Restaurant weiß, unnahbar und würdevoll dalag wie das Kasino eines englischen Seebads im Winter. Ich machte mir vor, ich genösse, endlich alles das zu machen, was ich immer hatte machen wollen, wozu ich aber keine Zeit gefunden hatte.
Bis mich Brigitte fragte: »Warum gehst du so oft einkaufen? Und warum nicht tags, wenn die Geschäfte leer sind, statt abends, wenn alle sich drängen? Willst du was erleben, wie die alten Leute?« Sie fragte weiter: »Und ißt du deswegen in der Nordsee und im Kaufhof zu Mittag? Früher hast du, wenn du Zeit hattest, gekocht.«
Ein paar Tage vor Weihnachten kam ich die Treppe zu meiner Wohnung nicht hoch. Mir war, als wäre mir ein [19] Eisen um die Brust gelegt, der linke Arm tat weh, und der Kopf war auf eigentümliche Weise zugleich ganz klar und benommen. Ich setzte mich am ersten Absatz auf eine Treppenstufe und saß, bis Herr und Frau Weiland kamen und mir unters Dach halfen, wo ihre und meine Wohnung einander gegenüberliegen. Ich legte mich aufs Bett und schlief ein, verschlief einen und noch einen Tag und auch den Heiligen Abend. Als Brigitte, zuerst verärgert und dann besorgt, am ersten Feiertag nach mir sah, stand ich zwar auf, aß von ihrem Sauerbraten und trank ein Glas Roten. Aber wochenlang blieb ich müde und konnte mich nicht anstrengen, ohne in Schweiß und außer Atem zu geraten.
»Das war ein Herzinfarkt, Gerd, und nicht einmal ein kleiner, sondern schon ein mittlerer. Du hättest auf die Intensivstation gehört.« Mein Freund Philipp, Chirurg an den Städtischen Krankenanstalten, schüttelte den Kopf, als ich ihm später davon erzählte. »Mit dem Herzkasper ist nicht zu spaßen. Wenn du ihn ärgerst, nippelst du ab.«
Er schickte mich zu seinem internistischen Kollegen, der einen Schlauch von meiner Leiste in mein Herz schieben wollte. Einen Schlauch von meiner Leiste in mein Herz – ich lehnte dankend ab.
[20] 4
Ein stiller Teilhaber
Die Frau, die mich bei der Badischen Beamtenbank bedient und betreut, kannte den Namen Welker und die Bank am Schloßplatz in Schwetzingen. »Weller & Welker. Die älteste Privatbank im Pfälzer Raum. In den siebziger und achtziger Jahren hat sie ums Überleben kämpfen müssen und hat es geschafft. Sie wollen uns doch nicht untreu werden?«
Ich rief an und wurde verbunden. »Ah, Herr Selb. Schön, daß Sie sich melden, mir wär’s heute oder morgen recht, am liebsten…« Für einen Augenblick erstickten seine Worte in der abgedeckten Sprechmuschel. »Können Sie heute um 14 Uhr?«
Die Fahrbahn war trocken. Der Schnee schmutzte am Straßenrand, war von den Bäumen getropft und auf den Äckern in die Furchen geschmolzen. Unter tiefem, grauem Himmel warteten die Verkehrsschilder, Leitplanken, Häuser und Zäune aufs Frühjahr und den Frühjahrsputz.
Das Bankhaus Weller & Welker gab sich nur mit einer kleinen, angelaufenen, messingnen Tafel zu erkennen. Ich drückte einen messingnen Klingelknopf, und die Tür, die in ein großes Tor eingelassen war, schwang auf. In der überwölbten, gepflasterten Einfahrt führten links drei Stufen zu einer weiteren Tür, die sich öffnete, während sich die [21] erste schloß. Ich ging hoch und trat ein, und es war, als wechselte ich von unserer in eine andere Zeit. Die Schalter waren aus dunklem Holz, hatten in Brust- und Kopfhöhe hölzerne Gitter und daneben Intarsien aus hellem Holz, ein Zahnrad, zwei gekreuzte Hämmer, ein Rad mit Flügeln, einen Mörser mit Stößel, ein Kanonenrohr. Die Sitzbank an der anderen Seite des Raums war aus dem gleichen dunklen Holz; auf ihr lagen dunkelgrüne, samtene Kissen. Die Wände waren mit dunkelgrünem, schillerndem Stoff tapeziert, und die Decke war mit reichem Zierat versehen, wieder aus dunklem Holz.
Im Raum war es still. Kein Rascheln von Scheinen, kein Klirren von Münzen, keine gedämpften Stimmen. Hinter den Gittern sah ich weder die Männer mit Schnurrbart, am Schädel klebendem Haar, Bleistift hinter dem Ohr, Ärmelschonern oder Gummiband am Oberarm, die hierher gepaßt hätten, noch ihre modernen Nachfahren. Ich trat näher an einen Schalter, sah den Staub im Gitter, wollte einen Blick hindurchwerfen. Da ging die der Eingangstür gegenüberliegende Tür auf.
Auf der Schwelle stand der Chauffeur. »Herr Selb, ich…«
Er kam nicht dazu, den Satz zu beenden. Welker eilte an ihm vorbei auf mich zu. »Schön, daß Sie’s möglich machen konnten. Der letzte Besucher ist gerade gegangen, lassen Sie uns nach oben gehen.«
Hinter der Tür begann eine schmale, steile Treppe. Ich folgte Welker die Treppe hinauf, und der Chauffeur folgte mir. Die Treppe mündete in einen großen Büroraum mit Trennwänden, Schreibtischen, Computern und [22] Telephonen, mehreren jungen Männern mit dunklen Anzügen und ernsten Gesichtern und der einen und anderen jungen Frau. Schnellen Schritts eskortierten Welker und der Chauffeur mich hindurch und in das Chefbüro mit Fenstern zum Schloßplatz. Ich wurde auf ein ledernes Sofa komplimentiert, auf den einen Sessel setzte sich Welker und auf den anderen der Chauffeur.
Welker streckte einladend und erläuternd seinen Arm aus. »Gregor Samarin gehört zur Familie. Er fährt lieber und besser als ich…«, Welker sah das Staunen in meinem Gesicht und betonte, »doch, er fährt gerne und gut, und daher haben Sie ihn neulich am Steuer erlebt. Aber es ist nicht seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist alles Praktische.« Welker guckte zu Samarin, als wolle er sich dessen Zustimmung versichern.
Samarin nickte langsam. Er mochte Anfang Fünfzig sein, hatte einen massigen Kopf, eine leicht fliehende Stirn, blaßblaue, hervortretende Augen, kurzgeschorenes helles Haar und saß breitbeinig und selbstbewußt da.
Welker redete nicht sofort weiter. Zuerst dachte ich, er überlege, was er sagen wolle, aber dann fragte ich mich, ob sein Schweigen eine Botschaft sei. Was für eine? Oder wollte er mir Gelegenheit geben, alles aufzunehmen, die Atmosphäre, Gregor Samarin, ihn? Er war, als er mich begrüßt, in sein Büro und aufs Sofa gebeten hatte, auf selbstverständliche Weise aufmerksam und höflich gewesen, und ich konnte ihn mir als gewandten Gastgeber vorstellen oder auf diplomatischem oder akademischem Parkett. War das Schweigen Stil, alte Schule, gute Familie? Er sah nach guter Familie aus: klare, sensible, intelligente Züge, [23] aufrechte Haltung, gemessene Bewegungen. Zugleich sah er melancholisch aus, und wenn sein Gesicht bei der Begrüßung oder bei einem Lächeln für einen Moment fröhlich wurde, fiel doch gleich wieder ein Schatten darauf und verdunkelte es. Es war nicht nur der Schatten der Melancholie. Ich entdeckte um seinen Mund auch einen verdrossenen, schmollenden Zug, eine Enttäuschung, als habe das Schicksal ihn um eine Verwöhnung betrogen, die es ihm versprochen hatte.
»Wir werden bald unser zweihundertjähriges Bestehen feiern, ein großes Ereignis, zu dem sich Vater eine Geschichte unseres Hauses wünscht. Seit einer Weile arbeite ich daran, wenn mir die Geschäfte Zeit lassen, und da Großvater historisch geforscht und Aufzeichnungen hinterlassen hat, ist meine Arbeit nicht schwer, bis auf einen Punkt.«
Er zögerte, strich sich die Locken aus der Stirn, lehnte sich zurück und warf dem unbeweglich sitzenden Samarin einen kurzen Blick zu. »1873 brachen die Wiener und die Berliner Börse ein. Die Depression dauerte bis 1880, lange genug, daß die Tage der Privatbankiers gezählt waren; es begann die Zeit der Aktienbanken und Sparkassen. Manche Privatbankiers, die die Depression überlebten, haben ihre Häuser in Aktiengesellschaften umgewandelt, andere haben fusioniert, einige aufgegeben. Unser Haus hat sich gehalten.«
Er zögerte wieder. Ich werde nicht mehr ungeduldig. Früher wär ich’s geworden. Ich hasse es, wenn Leute nicht zur Sache kommen.
»Unser Haus hat sich nicht nur gehalten, weil [24] Urgroßvater und Ururgroßvater gut gewirtschaftet haben und die alten Wellers auch. Wir hatten seit Ende der siebziger Jahre einen stillen Teilhaber, der bis zum Ersten Weltkrieg rund eine halbe Million eingebracht hat. Das mag Ihnen nicht nach viel klingen. Aber es war eine Menge. Und eigentlich kann ich die Geschichte unseres Hauses nicht schreiben, ohne über den stillen Teilhaber zu schreiben. Aber«, diesmal zögerte er wegen des dramatischen Effekts, »ich weiß nicht, wer es war. Vater kennt den Namen nicht, Großvater erwähnt ihn nicht in seinen Aufzeichnungen, und ich habe ihn in den Unterlagen auch nicht gefunden.«
»Ein sehr stiller Teilhaber.«
Er lachte und sah für einen Moment jugendlich-spitzbübisch aus. »Es wäre schön, wenn Sie ihn zum Sprechen brächten.«
»Sie wollen…«
»Ich will, daß Sie herausfinden, um wen es sich bei dem stillen Teilhaber handelt. Den Namen, von wann bis wann gelebt, Beruf und Familie. Hatte er Kinder? Und sitzt eines Tages ein Urenkel vor mir und fordert seinen Anteil?«
»Die stille Teilhaberschaft wurde nie beendet?«
Er schüttelte den Kopf. »In Großvaters Aufzeichnungen ist von ihr nach 1918 einfach nicht mehr die Rede. Weder davon, daß noch Geld eingebracht wurde, noch von Abrechnungen und Auszahlungen. Irgendwie wird sie ihr Ende gefunden haben, und ich rechne nicht wirklich mit dem Urenkel, der plötzlich seinen Anteil verlangt. Wer bei uns 1918 einen großen Batzen Geld stehen hatte, hätte seitdem genug Anlaß gehabt, ihn sich wieder zu holen.«
»Warum stellen Sie keinen Historiker an? [25] Wahrscheinlich machen jedes Jahr Hunderte Examen, finden keine Arbeit und suchen gerne verschwundene Teilhaber.«
»Ich hab’s versucht, mit Geschichtsstudenten und pensionierten Geschichtslehrern. Das Ergebnis war jammervoll. Ich wußte danach weniger als davor. Nein«, er schüttelte den Kopf, »ich versuche es bewußt mit Ihnen. In gewisser Weise tun sie dasselbe, die Historiker und die Detektive, finden beide verschüttete Wahrheiten und gehen doch ganz verschieden vor. Vielleicht bringt Ihr Vorgehen mehr als das der Geschichtler. Nehmen Sie sich ein paar Tage Zeit, schauen und hören Sie herum, versuchen Sie den einen oder anderen Weg. Wenn’s nichts wird, dann wird’s nichts – das verkrafte ich schon.« Er nahm Scheckbuch und Füllhalter vom Tisch aufs Knie. »Was darf ich als Vorschuß ausschreiben?«
Ein paar Tage lang schauen und hören – wenn er dafür bezahlen wollte, konnte er es haben. »Zweitausend. Ich nehme hundert pro Stunde, plus Spesen, und Sie kriegen am Ende eine detaillierte Rechnung.«
Er gab mir den Scheck und stand auf. »Lassen Sie bald von sich hören. Und wenn Sie nicht anrufen, sondern vorbeischauen, freue ich mich. Ich bin die Tage hier.«
Samarin begleitete mich die Treppe hinab und durch den Schalterraum. Als wir in der Einfahrt standen, nahm er mich am Arm. »Herrn Welkers Frau ist letztes Jahr gestorben, und er arbeitet seitdem wie besessen. Die Geschichte der Bank hätte er sich nicht auch noch aufladen sollen. Sie rufen bitte mich an, wenn Sie etwas haben oder brauchen. Was ich ihm abnehmen kann, möchte ich ihm abnehmen.« Er sah mich auffordernd an.
[26] »Wie passen die Namen Welker, Weller und Samarin zusammen?«
»Sie meinen, wie Samarin zu Weller und Welker paßt? Gar nicht. Meine Mutter war Russin, hat im Krieg als Dolmetscherin gearbeitet und ist bei meiner Geburt gestorben. Ich bin bei Welkers als Pflegekind aufgewachsen.« Er sah mich weiter auffordernd an. Erwartete er von mir die Bestätigung, daß ich mich nicht an Welker, sondern an ihn wenden würde?
[27] 5
Gotthard-Tunnel und Anden-Bahn
In der Bibliothek der Universität Mannheim fand ich eine Geschichte des Bankwesens in Deutschland, drei dicke Bände mit Text, Zahlen und Kurven. Ich konnte sie ausleihen und mitnehmen, setzte mich in mein Büro und las. Draußen rauschte der Verkehr, wurde es dämmrig und dunkel. Der Türke, der nebenan Zeitungen, Zigaretten und allerlei Plunder verkauft, schloß seinen Laden, sah mich am Schreibtisch unter der Lampe sitzen, klopfte und wünschte mir einen guten Abend. Ich ging erst nach Hause, als mir die Augen weh taten, und saß wieder über den Büchern, ehe der Türke seinen Laden öffnete und die Kinder, seine ersten Kunden, auf dem Schulweg Kaugummi und Gummibärchen kauften. Am Nachmittag war ich durch.
Ich habe mich für das Bankwesen nie interessiert, warum auch. Was ich verdiene, geht auf mein Girokonto, was ich Tag für Tag brauche, geht davon runter, und runter gehen auch die Beiträge zur Kranken-, Pflege- und Lebensversicherung. Manchmal bleibt über einen längeren Zeitraum mehr Geld auf dem Konto, als runtergeht. Dann kaufe ich ein paar Aktien der Rheinischen Chemiewerke und lege sie ins Depot. Dort liegen sie unberührt vom Steigen und Fallen ihrer Kurse.
Tatsächlich sind das Bankwesen und seine Geschichte [28] alles andere als langweilig. In den drei Bänden fand ich auch das Bankhaus Weller & Welker gelegentlich erwähnt; es entstand Ende des 18. Jahrhunderts, indem der Schwabe Weller, Kommissions- und Speditionskaufmann in Stuttgart, und der Badener Welker, Bankier eines Vetters des Kurfürsten, sich zusammentaten und zunächst aufs Geld- und Wechsel- und bald auch aufs Geschäft mit Staatsanleihen und Wertpapieren verlegten. Ihr Bankhaus war zu klein, als daß es bei bedeutenden Vorhaben eine führende Rolle hätte spielen können. Aber es war so solide und renommiert, daß die größeren Banken es gerne beteiligten, etwa bei der Errichtung der Rheinischen Chemiewerke, der Emission der Mannheimer Stadtanleihe von 1868, die dem Bau der Eisenbahn Mannheim–Karlsruhe diente, und der Finanzierung des Gotthard-Tunnels. Eine besonders glückliche Hand hatte Weller & Welker im Lateinamerikageschäft, von brasilianischen und kolumbianischen Staatsanleihen bis zur Beteiligung an der Eisenbahn Vera Cruz–Mexiko und der Anden-Bahn.
Das ist eine Geschichte, die sich sehen lassen kann, auch neben den Geschichten anderer privater Banken, die nicht nur Geschichte haben, sondern Geschichte gemacht haben: die Bethmanns, Oppenheims und Rothschilds. Der Autor bedauerte, über das private Bankwesen nicht mehr schreiben zu können. Die Banken hielten ihre Archive verschlossen und machten sie allenfalls Wissenschaftlern zugänglich, die in ihrem Auftrag für Jubiläums- und Festschriften forschten und schrieben. Daß sie ihre archivalischen Bestände an die öffentlichen Archive abgäben, komme kaum vor, eigentlich nur bei Liquidationen oder Stiftungen.
[29] Ich holte ein Päckchen Sweet Afton aus dem Aktenschrank, in dem ich meine Zigaretten verschließe, damit ich, wenn ich rauchen will, nicht nur das Päckchen aufmachen, sondern aufstehen, zum Aktenschrank gehen und ihn aufschließen muß. Brigitte hofft, daß ich so weniger rauche. Ich zündete mir eine an. Welker hatte nur von seinen Unterlagen gesprochen, nicht von einem Archiv seines Hauses. Hatte das Bankhaus Weller & Welker sein Archiv aufgelöst und die Bestände abgegeben? Ich rief das Staatsarchiv in Karlsruhe an, und der für Industrie und Wirtschaft zuständige Beamte war noch bei der Arbeit. Nein, die archivalischen Bestände des Bankhauses Weller & Welker lägen nicht bei ihnen. Nein, sie lägen auch in keinem anderen öffentlichen Archiv. Nein, ob das Bankhaus ein Archiv habe, könne er mit letzter Gewißheit nicht sagen; die privaten Archive seien nur unvollständig erhoben und erfaßt. Aber es müsse mit dem Teufel zugehen, wenn ein privates Bankhaus…
»Und wir reden nicht über irgendein Bankhaus. Weller & Welker haben sich vor bald zweihundert Jahren zusammengetan. Die Bank hat den Gotthard-Tunnel und die Anden-Bahn mitfinanziert.« Ich gab ein bißchen mit meinen frisch erworbenen Kenntnissen an. Da sage jemand, daß Angeben nichts bringt.
»Ah, um die Bank geht es! Hat sie nicht auch die Eisenbahn Michelstadt–Eberbach gebaut? Warten Sie einen Augenblick.« Ich hörte ihn den Hörer ablegen, einen Stuhl rücken und eine Schublade auf- und zumachen. »Es gibt in Schwetzingen einen Herrn Schuler, der mit dem Archiv der Bank zu tun hat. Er forscht über die Geschichte der [30] badischen Eisenbahnen und hat uns mit seinen Fragen ganz schön beschäftigt.«
»Haben Sie Schulers Adresse?«
»Zur Hand habe ich sie nicht. Sie muß im Ordner mit der Korrespondenz sein. Ob ich sie Ihnen allerdings… Ich meine, das sind persönliche Daten, oder? Und die sind geschützt, oder? Warum, wenn ich fragen darf, wollen Sie seine Adresse?«
[31] 6
Nicht blöde
Der Lehrer a.D. Adolf Schuler bewohnte ein kleines Haus hinter dem Schloßpark, kaum größer als die benachbarten Gartenhäuser. Nachdem ich vergebens nach einer Klingel gesucht und an die Haustür gepocht hatte, ging ich durch den schneematschigen Garten ums Haus und fand die Küchentür offen. Er saß am Herd, löffelte aus einem Topf, las in einem Buch und hatte Tisch und Boden, Kühlschrank und Waschmaschine, Anrichte und Schränke mit Büchern, Ordnern, dreckigem Geschirr, vollen und leeren Dosen und Flaschen, schimmelndem Brot, faulendem Obst und schmutziger Wäsche vollgepackt. Es stank säuerlich und modrig, eine Mischung aus Keller- und Essensgestank. Auch Schuler selbst stank; sein Atem roch faulig, und sein fleckiger Trainingsanzug dünstete alten Schweiß aus. Er hatte eine schweißgeränderte Kappe auf dem Kopf, wie die Amerikaner sie tragen, eine metallene Brille auf der Nase und so viele Altersflecken im runzligen Gesicht, daß es nach einer eigenen, dunklen Hautfarbe aussah.
Er beschwerte sich nicht, daß ich plötzlich in der Kü-che stand. Ich stellte mich als pensionierten Amtmann aus Mannheim vor, der sich endlich mit der Geschichte des Eisenbahnwesens beschäftigen kann, für die er sich schon immer interessiert hat. Schuler war anfangs brummig, wurde [32] aber freundlich, als er meine Freude an den Schätzen seines Wissens merkte. Er breitete sie gerne aus, führte mich im Dachsbau seines mit Büchern und Papieren vollgestopften Hauses von einer Höhle zur anderen, von einem Gang zum nächsten, um hier ein Buch und dort eine Akte zu holen und mir zu zeigen. Nach einer Weile schien er nicht zu merken oder schien ihn nicht zu stören, daß ich nicht mehr nach der Beteiligung des Bankhauses Weller & Welker am badischen Eisenbahnbau fragte.
Er erzählte von der Brasilianerin Estefania Cardozo, Zofe am Hof Pedros II., die der alte Weller 1834 auf einer Reise durch Mittel- und Südamerika heiratete, und von ihrem Sohn, der in jungen Jahren nach Brasilien durchbrannte, dort ein eigenes Geschäft gründete und erst nach dem Tod des alten Weller mit seiner brasilianischen Frau nach Schwetzingen zurückkehrte und das Bankhaus mit dem jungen Welker weiterführte. Er erzählte von der Hundertjahrfeier, die im Schloßpark gefeiert wurde, zu der der Großherzog kam und bei der sich ein badischer Leutnant aus der Familie Welker und ein preußischer Leutnant aus der Entourage des Großherzogs so in die Haare gerieten, daß sie sich am Morgen des nächsten Tages duellierten, wobei zu Schulers badischer Freude der Preuße ins Gras biß. Er erzählte auch von dem sechzehnjährigen Welker, der sich im Sommer 1914 in die fünfzehnjährige Weller verliebte und, weil er sie nicht heiraten durfte, bei Kriegsausbruch freiwillig meldete, um bei einem törichten kavalleristischen Bravourstück den Tod zu suchen und zu finden.
»Mit sechzehn?«
[33] »Wofür sollen sechzehn Jahre zu jung sein? Fürs Sterben? Für den Krieg? Für die Liebe? Die junge Weller hatte portugiesisches und indianisches Blut, von der Mutter und von der Großmutter, und war mit fünfzehn Jahren ein Weib, das einem schon die Augen verdrehen und die Sinne verwirren konnte.« Er führte mich zu einer Wand, an der Photographie an Photographie hing, und zeigte mir eine junge Frau mit großen, dunklen Augen, vollen Lippen, reicher Lockenpracht und schmerzlichem, hochmütigem Ausdruck. Ja, sie war hinreißend schön, und sie war es auch noch als die alte Frau, als die sie die Photographie daneben zeigte.
»Aber fürs Heiraten fanden die Eltern die beiden zu jung.«
»Es war keine Frage des Alters. Die Familien hatten sich zum Prinzip gemacht, keine Ehen zwischen ihren Kindern zuzulassen. Sie wollten nicht, daß die beiden Partner Schwäger oder Vettern sind und daß zum Konfliktpotential des Geschäfts auch noch das der Familie kommt. Na ja, die Kinder hätten zusammen durchbrennen und sich enterben lassen können, aber die Kraft haben sie nicht gehabt. Jetzt, beim letzten Welker, war’s kein Problem mehr. Bertram ist das einzige Kind, und Stephanie war es auch, und die Eltern waren froh, daß das Geld beisammenbleibt. So viel ist es nicht mehr.«
»Sie ist gestorben?«
»Letztes Jahr bei einer gemeinsamen Bergwanderung abgestürzt. Ihre Leiche wurde nie gefunden.« Er schwieg, und ich schwieg auch. Er wußte, was ich dachte. »Es hat eine polizeiliche Untersuchung gegeben, die gibt es in [34] solchen Fällen immer, und an ihm blieb nichts hängen. Sie hatten in einer Hütte übernachtet, er schlief noch, und sie brach schon auf und ging über einen Gletscher, über den er nicht gehen wollte. Haben Sie’s nicht gelesen? Die Zeitungen waren voll davon.«
»Kinder?«
Er nickte. »Zwei, ein Junge und ein Mädchen. Sind seitdem im Internat in der Schweiz.«