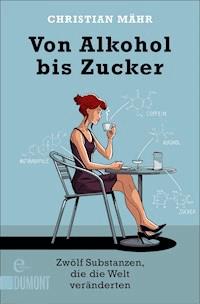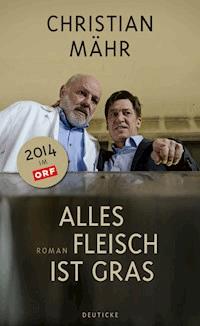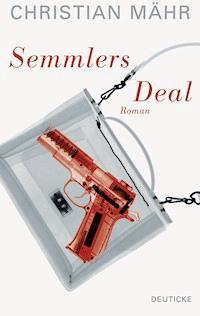
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Stellen Sie sich vor, Sie hätten einen Deal mit dem Universum: Wann immer Sie etwas haben wollen, bekommen Sie es. Sie müssen allerdings dafür ein Opfer bringen - ein adäquates Opfer. Semmler, Unternehmensberater und Erbe eines großen Vermögens, lernt eine Frau kennen, die ihm von dieser Möglichkeit erzählt. Bald darauf bemerkt er, dass er seinen Schlüsselbund vermisst. Ohne auch nur im Geringsten daran zu glauben, "opfert" er ein teures Feuerzeug. Als er zu Hause ankommt, ist Koslowski bereits da, sein nerviger Schulkollege, der den Schlüssel gefunden hat. Sollte an der Sache tatsächlich etwas dran sein? Schon bald ergibt sich die Gelegenheit für einen weiteren Versuch, denn Semmler trifft Ursula, Koslowskis Ehefrau, in die er sich blitzartig verliebt ... Viel zu spät bemerkt Semmler, dass er eine Lawine in Gang gesetzt hat, die er nicht mehr stoppen kann.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 341
Veröffentlichungsjahr: 2008
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Christian Mähr
Semmlers Deal
Roman
Deuticke
eBook ISBN 978-3-552-06106-4
Alle Rechte vorbehalten
© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2008
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt Electronic Publishing GmbH, Hamburg
http://www.deuticke.at
Semmlers Deal
1
Er hätte, dachte er viel später, einfach weiterfahren sollen. Denn alles, so dachte er, was ihm später widerfahren war, das Gute wie das Böse, kam davon, dass er angehalten hatte. Genau das hielt er für ungerecht. Nicht die Neugier hatte ihn anhalten lassen, die Sensationslust, so etwas einmal live zu sehen, was man sonst nur aus dem Fernsehen kannte. Anhalten lassen hatte ihn das reine Verlangen, zu helfen.
Weil es ging. Er war ja nicht verrückt. Wenn das Auto gleich versunken wäre – keine Idee, da noch etwas machen zu wollen. Aber es lag nicht einmal zur Hälfte im Wasser, die rechte Seite tiefer, die linke Seite höher; der Wagen stand auch. Nicht ganz, er bewegte sich vom Ufer weg, aber wirklich nur sehr langsam, und man konnte doch sehen, dass er in der wirbelnden braunen Brühe stand, auf den Rädern regulär zum Stillstand gekommen war, im kaum knietiefen Wasser auf dieser Seite – dass er aber im weiteren Verlauf nach rechts driften und in tieferes – viel tieferes! – Wasser geraten und mitgerissen würde wie die Baumstämme und allerhand Zeug, das man vom Ufer aus nicht einordnen konnte, nur sehen, dass es hinab trieb, sehr schnell, und dass es verloren war.
Sehen konnte jeder, der nicht einfach aufs Gas stieg und der Stelle auswich, wo die Straße abgebrochen war wie mürber Lebkuchen; sehen konnte jeder, dass die Frau, die am Steuer saß, dort sitzen blieb. Schreckstarre, Schock, das kalte Wasser. Sie würde ertrinken, elend, und nichts anderes.
Wer, fragte er sich oft, hätte nicht den Wagen auf die andere Seite gefahren, wäre nicht ausgestiegen, wäre nicht zur Abbruchkante gelaufen – nur einen Meter über dem Fluss? Wäre nicht hinunter gesprungen, hätte nicht die Fahrertür aufgerissen, die Frau am Arm gepackt und rausgezerrt? Wer denn nicht?
Auch wenn Koslowski nachher sagte, nicht alle hätten getan, was Semmler getan hatte. Aus Angst vor dem Wasser. Wieso Angst? Dort am Rand ging ihm das Wasser nicht einmal bis zum Knie, war auch nicht so reißend wie schon einen Meter weiter gegen die Mitte zu; die Tür ließ sich leicht öffnen, die Frau war nicht bewusstlos, nur benommen, half mit beim Aussteigen, machte zwei unsichere Schritte auf die Böschung zu, legte die Arme drauf, er, Semmler, packte ihre Beine, hob sie hoch und schob sie auf den intakten Asphalt, der war rutschig, die Dame krabbelte voran, setzte sich auf, was war ihnen passiert, ihnen beiden? Semmler hatte sich die Hosenbeine nass gemacht und die italienischen Schuhe ruiniert, also schön, die waren hinüber – hätte er die Frau ersaufen lassen sollen? Wegen der Schuhe?! Und sie wäre sitzen geblieben in ihrem japanischen Zwergauto (10.000 Euro Neupreis) und wäre untergegangen, denn als sie sich danach umdrehten, stand das Wasser schon bis zur Seitenscheibe, gurgelte draußen und drin in wilden Wirbeln, der Wagen drehte sich hin und her, als hielte er es dort nicht mehr aus, wo er zum Stehen gekommen war. Dann, ohne Vorwarnung oder irgendein Zeichen, kippte er nach rechts, streckte einen Augenblick noch die linken Räder aus dem Wasser und war verschwunden. Sie sahen ihn auch nicht mehr auftauchen, etwa Dach, Reifen oder sonst ein Teil, das Auto war weg.
»Danke, danke!«, sagte sie immer wieder, ergriff seine Hand mit beiden Händen und ließ die längste Zeit nicht los, »Danke, danke!«, wie eine Beschwörung; vielleicht hatte sie die Sprache verloren und konnte nun nur noch dieses eine Wort ausstoßen, es war ihm peinlich, er hatte ihr das Leben gerettet, ja und? Jeder andere hätte ...
...daran lag es ja, was ihn so störte an der Sache. Viel später. Viel, viel später.
Wenn ihm alles, was ihm noch zustoßen sollte, zugestoßen wäre, weil er die Frau hätte ertrinken lassen – dann hätte man einen gewissen Sinn darin erkennen können. Strafe, Rache, etwas dieser Art. Aber alles, was ihm zustieß, geschah, weil er Gisela Mießgang das Leben gerettet hatte. Das war nicht gerecht.
Sie hatte die Sprache nicht verloren, begann aber am ganzen Körper zu zittern; der Schock, dachte er, das ist jetzt der Schock; er führte sie zu seinem Wagen, setzte sie auf den Beifahrersitz, stieg ein und ließ den Motor an. Er drehte die Heizung auf.
»Eine Decke habe ich leider nicht«, sagte er.
»Das macht nichts«, sagte sie, »machen Sie sich keine Umstände.« Sie vermied es, ihn anzusehen, wurde ruhiger, erinnerte sich wohl an ihr übertriebenes »Danke-Danke!«; das war ihr jetzt peinlich, ein gutes Zeichen geistiger Gesundheit. Er betrachtete sie von der Seite, er durfte das unter den gegebenen Umständen, das war nicht aufdringlich, sondern Zeichen der Fürsorge. Ehe er losfuhr, musste er sich doch überzeugen, dass sie transportfähig war, nicht auf der Fahrt kollabierte oder so ... sie war blass, aber normal blass, nicht leichenblass oder kalkweiß; er kannte sich aus, er hatte bei seinem Zivildienst als Sanitäter Leute in solchen Umständen gesehen, diese Blässe hier war in Ordnung.
Mittelgroß, braunes Haar, Anfang dreißig, höchstens. Aber nicht gut aussehend. Das überraschte ihn. Es gab in diesem Alter keine Frauen, die nicht gut aussahen. Es gab schöne Frauen und hässliche (sehr selten), aber keine nicht gut aussehenden. Das fiel ihm jetzt auf, als eine neben ihm saß. Was war das Kriterium? Ob ich, dachte er, mir vorstellen könnte, mit ihr ins Bett zu gehen. Das war die Definition von »gut aussehend«. Bei dieser hier nicht der Fall. Schmales Gesicht, große dunkle Augen und volle Lippen. Die Details nicht übel, jedes für sich betrachtet, hatte etwas Anziehendes, nur der Gesamteindruck stieß ihn ab; über allem der Eindruck von etwas Widerlichem, das nicht hergehörte; und nicht aus unglücklichem Zufall, sondern aus Absicht, als hätte man die Früchte eines Stillebens mit einer dünnen, eben noch wahrnehmbaren Dreckschicht überzogen.
Die Kleidung konnte er nicht zuordnen, dafür hatte er kein Auge; grüner Anorak über einem mausgrauen T-Shirt, ein blauer Rock und rote Sportschuhe. Die konnten teuer sein oder billig, das wusste er nicht, er besaß keine solchen Sachen, kannte die Codes nicht.
»Wohin soll ich Sie bringen?«, fragte er.
»Ich weiß nicht ... machen Sie sich keine Mühe ... ich sollte das melden ... mit dem Auto ...« Sie suchte in der Handtasche herum. »Ich hab mein Handy verloren! Ich hab das Handy verloren!« Sie begann zu schluchzen, blickte ihn von der Seite an, unterdrückte das Geräusch, während er in seinem Jackett nach Papiertaschentüchern suchte. Er gab ihr eines.
»Tut mir leid«, sagte er, »das mit dem Auto.«
»Das Handy hab ich verloren«, sagte sie, schüttelte den Kopf. Eine reichlich unangemessene Reaktion, ihr Auto weg, aber sie beklagte den Verlust des Handys, das war wohl irgendein psychischer Schutzmechanismus, über den er nichts wissen wollte.
»Ich bring Sie zur Polizei«, sagte er, ehe sie wieder mit dem Weinen anfangen konnte, »und dann heim. Wo wohnen Sie?«
»In Dornbirn, aber das ist viel zu weit, Sie müssen doch sicher ...«
»Macht nichts«, sagte er, »ich hab Zeit.« Draußen fuhr ein großer Mazda vorbei, schwenkte nach links und hielt am Straßenrand. Semmler startete den Motor.
»Wohin wollten Sie?«
»Nach Mellau zu meiner Schwester.«
»Sie hätten nicht fahren sollen unter diesen Umständen ...«
»Ich hab nicht gedacht, dass es so schlimm wird ... und jetzt kann ich sie nicht einmal anrufen ...«
Semmler fuhr los. Aus dem Mazda fünfzig Meter vor ihm war ein Mann ausgestiegen, der in ihre Richtung blickte und winkte. Semmler hob die Hand, was man als Winken oder verscheuchen einer Fliege deuten konnte. Als sie an dem Wagen vorbei waren, sagte er: »Sie hätten sowieso keine Verbindung, bei dem Unwetter ist das ganze Mobilnetz zusammengebrochen.«
»Meine Schwester hat einen Festanschluss.«
»Dann rufen wir von der Polizei aus an.«
Im Rückspiegel sah er den Mann neben dem Mazda stehen und ihnen nachwinken. Ein Idiot.
Er hat mich nicht erkannt, dachte Koslowski. Kein Wunder, wie auch. Ich bin heute dicker. Viel zu dick. Dann ging er langsam zu der Abbruchkante hinüber. Der Himmel war noch von dicken Wolken verhangen, die sich in den Pfützen spiegelten, aber es regnete nicht mehr. Es hatte drei Tage und Nächte durchgeregnet. In der Luft lag ein Tosen, das lauter wurde, je näher er an die Kante kam. Das Wasser hatte die Farbe von Milchkaffee mit etwas zu viel Milch. Die Ach war doppelt so breit wie sonst und viel tiefer. Auf der anderen Seite des Flusses stand das Ufergebüsch in einem See, dort konnte sich das Hochwasser in die Wiesen ausbreiten fast bis zum gegenüberliegenden Hang.
Auf der Seite, auf der er stand, lag das Gelände höher, hier war alles in Ordnung bis auf das abgebrochene Stück Straße, zwei Meter breit und dreißig Meter lang, wie ein langer Span; es war nicht zu sehen, warum der Fluss das Ufer genau an dieser Stelle unterspült hatte, nichts Besonderes, keine Kurve, nicht einmal leichte Krümmung, aber hier war es passiert. Es hätte einen Kilometer vor oder nach dieser Stelle genau so passieren können. Jeder, der sein fünf Sinne beieinander hatte, würde unter diesen Bedingungen die Straße in den Bregenzer Wald meiden oder spätestens beim ersten abgebrochenen Stück umkehren.
Er zögerte, trat nicht an die Kante heran. Er hatte nur den Jaguar vor sich gesehen, nicht den Kleinwagen dieser Frau; erst die Frau, dann Semmler, dann er selber, das war Zufall, es hätte auch heißen können: Koslowski, Semmler, unbekannte Frau. Oder unbekannte Frau, Koslowski, Semmler. Wie wäre es dann ausgegangen? Das war nun wiederum von keinem Zufall abhängig: Ganz sicher wäre Paul Koslowski nicht in die hochgehende Ach gesprungen, um die unbekannte Frau zu retten. Nicht einmal eine Frau von beliebig intensivem Bekanntheitsgrad hätte er gerettet. Nicht einmal seine eigene Frau. Koslowski hatte die Fähigkeit, sich die Dinge in allen Folgewirkungen bis in die letzten kausalen Verästelungen vorzustellen; er konnte das nicht nur, sondern er musste es tun, die Dinge zu Ende denken. Es war ein Fluch, keine Gabe. Nur deshalb kam er auf den Einfall, Ursula an die Stelle dieser völlig belanglosen Frau, die ihm nichts bedeutete, zu setzen – und sich einzugestehen, dass er sie hätte ersaufen lassen. Ja, händeringend und weinend (sicher hätte er geweint dabei, herzzerreißend, so gut kannte er sich), aber eben summa summarum untätig. Warum? Weil nur ein Irrer da hinein springen würde. Es war lebensgefährlich. Die Feuerwehr würde davor warnen. Es nicht gutheißen, nein, nein. Es kam nichts Gutes dabei heraus, wenn Laien ... nur ein Irrer ... seine Gedanken verhedderten sich.
Alles ein Spiel des Zufalls. Nicht er war als zweiter der Reihe gefahren und nicht Ursula als erste. Nicht Ursula war in den reißenden Fluss gefallen, sondern eine Unbekannte. Und Semmler als zweiter hatte sie ohnehin herausgezogen, das war doch, man konnte es drehen und wenden, wie man wollte, die beste Variante von allen.
Er sog tief die Luft ein, klar, feucht und kühl nach der Hitze. Sie roch nicht mehr nach Staub und Ozon wie die Wochen zuvor, alles ausgewaschen. Wo das Ozon geblieben war, wusste er nicht, der Staub des langen August trieb als brauner Dreck im Hochwasser der Flüsse auf die Nordsee zu. Vorsichtig, beinahe in der Straßenmitte, bewegte er sich auf die Stelle zu, an der Semmler die Frau herausgezogen hatte. Dort wagte er einen Schritt auf den Rand. Es konnte objektiv nicht so gefährlich sein, wie es aussah, Semmler war reingesprungen und heil wieder herausgekommen, ganz an der Kante war die Strömung schwach, musste schwach sein, das konnte man logisch ableiten, sonst hätte die Flut Semmler fortgerissen, das war kein Supermann mit überirdischen Kräften; man konnte bis an den Rand gehen, wo der Asphalt eine gezackte Linie bildete, ungefährlich. Selbst wenn noch ein Stück abbrach, das Stück, auf dem er stand; Koslowski würde nur einen Meter tief ins Wasser fallen, das dort am Rand nicht reißend genug war, ihn ums Leben zu bringen. Aber er wagte nur einen einzigen Schritt.
Woher hatte Semmler gewusst, dass es ungefährlich war? Er hatte es natürlich nicht gewusst. Er kannte Semmler fast vierzig Jahre, hatte seine Stimme im Ohr. »Du denkst zu viel«, hatte er oft zu Koslowski gesagt, »das bringt nichts.« Es war eine nette Form zu sagen: »Du bist ein Feigling!« Koslowski war feige, darüber machte er sich keine Illusionen. Weil er eben die Dinge zu Ende dachte und sich vorstellte, wie sie sein würden. Diese Dinge am Ende. Wer das tat, kam zum selben Ergebnis wie Koslowski und ließ die riskanten Sachen sein. Selbstschutz. Aber man nannte es Feigheit, er selber nannte es so. Sie hatten nie darüber gesprochen, das Wort war nie gefallen. Eigentlich hätte Koslowski in den vergangenen vier Jahrzehnten den Lohn seiner Vorsicht einfahren und der Draufgänger Semmler hätte scheitern müssen.
So war es aber nicht gelaufen. Nicht dass Koslowski gescheitert wäre. Scheitern konnte man es nicht nennen. Matura, Chemiestudium. Und dann eben keine riskante Forschungskarriere bei einem deutschen Konzern, sondern eine viel schlechter bezahlte, aber weit sicherere Stelle in einem heimischen Pharmaunternehmen – also schön, was heißt schon »Pharma« ... sie hatten sich auf Salben und Tinkturen spezialisiert, auf Basis von Stein- und Latschenkieferöl. Die Firma gab es schon hundert Jahre, vom Bioboom der letzten Jahrzehnte hatte sie profitiert. Ohne eigenes Zutun. Und ja, sie betrieben dort Forschung und Entwicklung. Er betrieb Forschung und Entwicklung. Er und ein Laborant. Stimmte schon. Sie hatten die Rezeptur verbessert, die Galenik, die Kosten gesenkt. Und so weiter. Das war schon was. Im provinziellen Rahmen.
Semmler dagegen: der hatte nach dem Gymnasium Betriebswirtschaft studiert – also schön, das war weder Wagnis noch Schicksal-in-die-eigene-Hand-nehmen. Lag nur nahe bei dem Elternhaus ... aber dann. Zuerst hatte er geerbt. Was alles leichter machte, das musste man objektiv zugeben, Semmler war mit einem Schlag reich geworden. Aber statt das Vermögen nun zu verschleudern, die Fabrik zu ruinieren – was Koslowski von seinem Schulfreund erwartet hätte – war es Semmler gelungen, die Fabrik, als es mit der Textilbranche unübersehbar abwärts ging, durch irgendwelche Schliche in einen Gewerbepark umzuwandeln und richtig beschissen reich zu werden. Noch reicher. »Reich ist nur der Vorname«, wie man in der Schweiz sagt. Koslowski spekulierte selbst ein bisschen mit Derivaten und blieb immer schön unterhalb des Niveaus, wo es gefährlich werden konnte. Er verlor, aber er gewann öfter, alles auf der Basis von »Spielgeld«, das man riskieren konnte, das dazu vorgesehen war. Er hatte damit den einen und anderen Urlaub finanziert, er hatte einen Riecher für Gelegenheiten. Manchmal, nicht oft. Seine Vorsicht hielt ihn vor großen Risiken ab. Und vor großen Gewinnen. Solche Gewinne aber schien Semmler zu machen. Koslowski kannte die Semmlervilla, als sie beide noch ins Gymnasium gingen, war er dort manchmal zu Besuch gewesen. Es gab ein automatisches Tor. Zwei Meter groß, aus starken vierkantigen Stahlstäben. Vom Tor führte die gekieste Einfahrt an den Garagen vorbei zum Haus.
Aus irgendwelchen Gründen benützte Semmler nicht immer die Garage, sondern ließ den Wagen auf der Einfahrt stehen. Koslowski sah diesen Wagen dort so oft, dass es kein Zufall sein konnte: Semmler wollte ihn ausstellen. Wer zum Gewerbepark wollte, musste an dem breiten Tor in der Thujenhecke vorbei, das dazu aufforderte, einen Blick in den Garten der Semmlervilla zu werfen. Der fiel dann auf den Jaguar. Koslowski ließ es sich, wenn er vorbeifuhr, nicht nehmen, anzuhalten, auszusteigen und das Auto aus der Nähe anzuschauen. Jaguar. Semmler hatte schon in der Schule von dieser Marke geschwärmt. Andere auch, aber als Einziger in der Klasse hatte er auch die reale Aussicht auf ein Auto dieser Art. Koslowski war ans Torgitter getreten, hatte wie ein Sechsjähriger das Gesicht zwischen die Stäbe gepresst und auf das Auto gestarrt. Alles im Aufnahmebereich der Kamera, die hoch und unübersehbar am rechten Torpfosten befestigt war. Hatte gehofft, dabei von Semmler beobachtet, erkannt und über den Torlautsprecher angesprochen zu werden. Dann hätte sich eine kleine Unterhaltung ergeben, er wäre hinein gebeten worden, man hätte sich ausgetauscht, wie geht’s, was machst du so, bist du verheiratet, Kinder? Ein Kontakt wäre neu geknüpft worden, der schon ein Jahr nach der Matura abgerissen war. Semmler war zu keinem einzigen Jahrestreffen erschienen (Koslowski ging immer hin), und Semmler war auch kein einziges Mal vor seinem Haus aufgetaucht, wenn Koslowski dem Jaguar gebührende Bewunderung zollte. Vielleicht hatte er ihn aber auf dem Überwachungsmonitor doch gesehen, erkannt – und gehofft, Koslowski, der Versager, möge bald wieder verschwinden. »Das weißt du nicht«, hatte Ursula gesagt, »vielleicht ist er gar nicht zu Hause ... du bist ja fixiert auf diesen Semmler!« Dann bedauerte er, ihr von dem Wagen erzählt zu haben; er konnte sich einfach nicht zurückhalten.
Auf der Straße, direkt vor seinen Füßen, lag ein Schlüsselbund. Schwarzes Leder, ziemlich groß. Er hob ihn auf. Sechs Schlüssel, zwei schmale, vier mit breiterem Bart, alles neue, komplizierte Sicherheitsschlüssel. Semmlers Schlüssel.
Er steckte den Bund ein und ging zum Auto zurück. Nein, Ursula hatte unrecht. Er war nicht fixiert auf Semmler. Er war nur vier Jahre neben ihm in derselben Bank gesessen und hatte ihn abschreiben lassen. Immer. Ohne eine einzige Ausnahme, da hatte es nie die geringste Diskussion gegeben. Latein, Mathematik. Einfache Sache. Semmler war faul, Koslowski fleißig. Aber Semmler stand nicht so schlecht, dass eine bessere Note aufgefallen wäre; wenn er sie erreichte, die bessere Note, hieß es nur: diesmal hat er ja doch gelernt! Semmler war sagenhaft geschickt beim Schwindeln ... Ursula durfte er diese Dinge, an die er sich noch genau erinnern konnte, nicht erzählen, sie rollte sonst mit den Augen, ihre Stimme wurde schrill. Das sei krankhaft, meinte sie.
Er stieg ein, wendete den Wagen und fuhr talauswärts. Er wollte vermeiden, Semmler zu begegnen. Der würde zurückfahren und seinen Schlüssel suchen. Nein, er war nicht fixiert auf Semmler. Blödsinn. Die Sache heute durfte er Ursula auch nicht erzählen, um Gottes Willen, sie würde behaupten, er sei Semmler nachgefahren, so weit sei es schon, »Du verfolgst den Mann«, hatte sie ihm neulich vorgeworfen, »das ist doch nicht normal, du bist ein – wie heißen die – diese Psychopathen, die dann ...«
»Stalker ...«
»Ja, eben!«
Ja, eben! Was, bitte, sollte das heißen? Er hatte natürlich vermieden, diese Frage zu stellen, aus der sich ein hässlicher, lang gezogener Streit entwickelt hätte; das war es nicht wert.
Natürlich war er Semmler nicht nachgefahren. Blödsinn. So konnte man das nicht nennen. Er hatte sich das Hochwasser aus der Nähe anschauen wollen. Und Semmler auch. Er hatte nicht an Semmler gedacht, bis der keine fünfzig Meter vor ihm auftauchte, wo eigentlich? Das hatte er vergessen. Als er den silbergrauen Jaguar sah, war ihm Semmler eingefallen, wie auch nicht, sieh an, Semmler in seinem Jaguar, er kannte das Auto ... sie fuhren dieselbe Strecke in den Bregenzer Wald, sollte er jetzt einen Riesenumweg über Langen machen, nur um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, er verfolge Semmler? Wenn sie dabei gewesen wäre, Ursula, hätte er die Strecke über Bregenz und Langen genommen, aber sie hatte ja nicht mitgewollt, ihn einen Katastrophentouristen genannt. Er war allein gefahren, über Schwarzenberg, das war der kürzeste Weg, alle, die aus der Stadt in den Bregenzer Wald wollten, nahmen diese Strecke, Semmler natürlich auch.
Und hätte er beim Unfallort vorbeirasen sollen? Er hatte in sicherem Abstand vom Abbruchrand angehalten, und hatte ... also, nachgeschaut, ob Semmler bei seiner Rettungsaktion vielleicht Hilfe brauchte. Hatte er nicht, die Rettungsaktion war schon im Gange, als Koslowski aus dem Auto stieg und dann – dann war es ihm unangemessen vorgekommen, hinzulaufen und Hilfe anzubieten, die offensichtlich nicht benötigt wurde. Semmler kam mit der Frau allein zurecht.
Er würde heimfahren und Semmler anrufen. Es hatte keinen Zweck, zu warten, dass Semmler ihn anrief. Koslowski war nun überzeugt, dass ihn sein Schulfreund beim Vorbeifahren nicht erkannt hatte. Aber er, Koslowski, hatte diesen Gesichtsausdruck an ihm gesehen, durch die Scheibe, diesen Ausdruck, den er immer in Gegenwart von Frauen hatte; als ob er nicht ganz bei sich sei, so etwas Verhaltenes – die Frau war Durchschnitt, Koslowski hatte sie nicht weiter beachtet, aber bei Semmler kam es ja auch nicht darauf an, ob die Frau jung oder schön war, dass es darauf nicht ankäme, hatte er immer erklärt, sei das ganze Geheimnis. Semmler hatte unheimlich Schlag bei Frauen. Das störte Koslowski nicht, das war eine Naturbegabung; Semmler hatte nie geheiratet und spielte die Rolle des begehrten Junggesellen, von Playboy konnte man nicht reden, das wäre sogar den Betroffenen lächerlich vorgekommen, es war alles provinziell, drei Stufen heruntergefahren; in den Gratiskäseblättern standen immer dieselben fünfzig Hanseln, die mit ihren jeweils aktuellen Greteln bei zahlreichen events die society darzustellen versuchten.
Er würde Semmler anrufen, wenn er zu Hause war.
Sie sind dann doch nicht zur Schwester gefahren. Bei der Gendarmerie in Egg riet man dringend von einer Weiterfahrt ab. Gisela – so hieß die Gerettete – rief die Schwester in Mellau an; dort war alles in Ordnung und alle wohlauf. Der Verlust des Autos (Toyota Aygo) wurde gemeldet und protokolliert. Totalverlust. Es schien den Gendarmen nahezugehen. Sie sahen gestresst und übermüdet aus. Semmler bot an, die Frau nach Hause zu fahren. Sie hieß Gisela Mießgang. (Sie hatten sich auf der Fahrt zur Polizei bekannt gemacht.) Frau Mießgang sträubte sich erst eine kleine Weile, wie es der hiesige Minimalanstand erforderte; es wäre unhöflich gewesen, ein Anerbieten gleich beim ersten Mal anzunehmen (»Das ist doch nicht nötig«, »Machen Sie sich keine Umstände«, usw.), aber beim zweiten Mal willigte sie ein.
Frau Mießgang war bei der katholischen Kirche angestellt, erfuhr Semmler auf der Rückfahrt. Er hatte danach fragen müssen; sie hüllte sich vier, fünf Kilometer weit in Schweigen. Er verstand es, das neue Auto war weg, aber gab es da nicht eine Versicherung? Er hatte sich um solche Dinge nicht gekümmert, das machte alles Dr. Wohlgenannt, sein Steuerberater, kaum anzunehmen, dass Frau Mießgang einen Steuerberater hatte. Danach zu fragen schien nicht opportun, es kam nun, dachte er, darauf an, sie nicht aufs Thema Autototalverlust zu bringen, aber so steinernes Schweigen die ganze Fahrt lang hielt er nicht aus. Sie schien das zu begreifen und antwortete auf seine Fragen, nicht gerade einsilbig, aber kaum mehr als zwei- bis dreisilbig. Es wurde klar, dass der Verlust des Wagens eine Katastrophe für sie bedeutete; die Kirche mochte reich sein, ihre Angestellten waren es nicht. Sie hatte das Auto erst vor vier Wochen gekauft. Frau Mießgang, erfuhr er, arbeitete als Haushälterin beim Pfarrer Moser. Pfarrer Moser galt als Original, jeder im Land kannte ihn, weil er in den Leserbriefspalten der größten lokalen Tageszeitung extrem konservative Einsichten verbreitete. Semmler interessierte der reaktionäre Pfarrer nicht, aber mit dem Thema kamen sie endlich von dem abgesoffenen Auto weg. Wie er denn so sei, wollte er wissen, dieser Pfarrer Moser, als Chef und Mensch. Nett, sagte sie, privat sei er sehr nett, ein guter Mensch. Nun, das war zu erwarten gewesen, jemand wie Frau Mießgang würde keine Details über ihren Chef erzählen, pikante schon gar nicht. Als sie an der Unfallstelle vorbeifuhren, bat sie ihn, anzuhalten. Er unterdrückte mit knapper Not ein Seufzen.
»Ich möchte nur noch einmal ...«, sagte sie; was sie noch einmal wollte, erfuhr er nicht, nickte, murmelte »aber natürlich«, als habe er alles verstanden, und ließ sie aussteigen. Seine Anwesenheit war nicht erforderlich. Abschied vom Auto, ein bisschen sehr diesseitig für eine kirchliche Angestellte, kaum anzunehmen, dass Pfarrer Moser so eine Anhänglichkeit an einen profanen Gegenstand billigen würde.
Frau Mießgang stand auf der anderen Straßenseite an der Abbruchkante. Die Seitentür hatte sie offen gelassen. Dann holte sie mit ihrer Handtasche weit aus und warf sie nach vorn in die brodelnde Ach. Einen Augenblick fürchtete er, sie werde gleich hinterher springen, aber sie kehrte auf dem Absatz um und kam zum Auto zurück. Er konnte nicht so tun, als hätte er nichts gesehen. Er ärgerte sich, wie immer bei irrationalem Verhalten – noch mehr ärgerte es ihn, dass er nun darauf eingehen musste.
»Was war das jetzt?«, fragte er. Der scharfe Ton schien sie nicht zu stören.
»Ein Opfer«, sagte sie, »einfach nur ein Opfer.«
»Und wofür – ist dieses Opfer?« Sie blickte ihn von der Seite an.
»Für mein Leben!« Die Frage schien sie zu überraschen.
»Für Ihr Leben? Sie opfern die Handtasche für Ihr Leben?«
»Ja, es ist ein bisschen spät, ich weiß. Ich hätte es gleich machen sollen ...«
Er fuhr los. Nach einer Weile sagte er: »Wann gleich?«
»Als Sie mich grade rausgezogen hatten. Natürlich: opfern tut man eigentlich vorher, das ist ja klar, aber in besonderen Fällen geht es auch kurz danach – ich meine, wenn Ihnen vom Universum etwas Besonderes erwiesen wurde, was Sie vorher nicht wissen konnten, dann haben Sie ja dafür vorher auch nicht opfern können, verstehen Sie?«
»Nein.«
»Ganz einfach: Dieser Unfall, davon konnte ich ja nichts wissen, bevor er passiert war, oder? Und als er passiert war blieb zum Opfern keine Zeit, ich hatte einen Schock, dann sind ja auch schon Sie gekommen und haben mich gerettet – in solchen Fällen kann man auch nachträglich opfern – um dem Universum seine Dankbarkeit zu erweisen«, fügte sie nach kurzer Pause hinzu.
»Aha«, sagte er. »Sie opfern also dem Universum.«
»Ja, natürlich, etwas anderes hätte ja auch keinen Zweck, oder?«
»Verzeihen Sie, vielleicht verstehe ich da etwas nicht richtig, ich war auch schon länger nicht mehr in der Kirche – ›Universum‹ – damit meinen Sie doch Gott?«
»Nein, ich meine das Universum. Gott ist bloß so eine ... so eine Vorstellung. Aber es kann das jeder nennen, wie er will.«
Eine Zeitlang wurde geschwiegen, sie schien nicht geneigt, die Sache zu vertiefen, und er wusste nicht, wie eine Fortsetzung des abseitigen Themas ausschauen sollte. Eine Esoterikkiste, damit hatte er noch nie etwas anfangen können. Langweilig. Immerhin war sie keine von diesen mittelalten Frauen, die an fremden Türen läuten und sich mit jedem, der aufmacht, »über Jesus« unterhalten wollen; dass sie überhaupt von ihrer Privatreligion anfing, lag an den besonderen Umständen, der überstandenen Todesnähe und so weiter. Die Frau hatte heute viel durchgemacht. Zweiter Geburtstag. Da hatte sie es nicht verdient, angeschwiegen zu werden.
»Erzählen Sie«, sagte er, »wie sind Sie auf diese Theorie mit dem Universum gekommen?« Ich bin ein guter Mensch, dachte er, wenn man es genau nimmt, bin ich wirklich ein guter Mensch.
»Das ist keine Theorie«, sagte sie. »Es gibt einen Haufen Bücher darüber, finden Sie in jeder Buchhandlung, ›Wünsche ans Universum‹ und so weiter, alles Quatsch.«
»Ach tatsächlich?« Wenn sie seinen Tonfall bemerkt haben sollte, so ging sie darüber hinweg. Wahrscheinlich hatte sie keinen Sinn für Ironie.
»Was diese Leute meinen, ist einfach beten – Wünsche ans Universum – das klingt halt besser, als wenn einer sagt: ich bete zu Gott. Im Grunde dasselbe ...«
»Sie sprachen doch eben selbst vom Universum ...«
»Aber ich bete nicht! Ich opfere, das heißt, ich kündige zunächst ein Opfer an. Das ist ein großer Unterschied!«
»Inwiefern?« Die Sache begann ihn zu interessieren.
»Ganz einfach: ein Gebet ist im Prinzip eine Bitte. Man kann auch sagen: eine Bettelei. Man hat nichts und bittet Gott, das Universum, was immer Sie wollen – dass er oder es einem etwas gibt, einfach so, verstehen Sie? Bei einem Opfer dagegen ...«
»Ja, ja, das ist schon klar, da ist es ein Tausch, wie ein Handel, ›do ut des‹ ...«
»Ich gebe, damit du gibst«, übersetzte sie.
»Sie können Latein?« Das war ihm so rausgerutscht, peinlich, ohne, dass er hätte begründen können, warum die Frage arrogant und herablassend klang. Die Frau war vielleicht nicht immer Putzfrau gewesen, hatte vielleicht ein paar Klassen Gymnasium hinter sich oder sonst einen achtbaren Bildungsweg, dann, durch widrige Lebensumstände und eigene Fehler die geplante Karriere verfehlt und gerade noch so eben im sozialen Netz der Kirche aufgefangen, die sie dafür hasste und schon deshalb die offizielle Lehre ablehnte.
Er blickte sie von der Seite an. Sie hatte sich in den Sitz zurückgelehnt, den Kopf an die Stütze gelegt wie beim Versuch, während der Fahrt ein wenig Schlaf zu bekommen. Doch ihre Augen standen offen. Sie lächelte.
»Ja«, sagte sie, »ich kann Latein.«
Vorne kam ein Traktor in Sicht, den Semmler lang nicht überholen konnte. Als es endlich gelungen war, sagte er: »Weiß eigentlich der Pfarrer Moser von ihren Ansichten?«
»Natürlich nicht. Und wenn er’s wüsste, würde es ihn nicht wundern. Und es wär ihm egal ...«
»Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nicht ...«
»Hochwürden Moser hält nicht viel von Frauen im Allgemeinen und noch weniger von mir im Besonderen«, unterbrach sie ihn. Die Stimme klang nun schriller. Ihr Chef war ein wunder Punkt.
»Schikaniert er Sie?«
Sie lachte laut auf.
»Nein, nein, das tut er nicht! Selbst wenn er es wollte, könnte er ... wie soll ich sagen: ich bin nicht wert, schikaniert zu werden – aber ich sollte nicht solche Interna ausplaudern, am Ende sind Sie Journalist und schreiben einen Artikel über ... über ›Zoff im Pfarrhaus‹ – oder so ähnlich!«
»Ich bin kein Journalist.«
»Nein, natürlich nicht, das war nur ein Scherz, verzeihen Sie.«
Ihre Bemerkung hatte ihn verstimmt. Es war nicht die Unterstellung, Journalist zu sein, er pflegte keinen Dünkel in dieser Sache; die wenigen Menschen, zu denen er überhaupt ein freundschaftliches Verhältnis unterhielt, waren Journalisten. Es waren nicht ihre Worte, die ihn störten, sondern die Art, wie sie die ausgesprochen hatte – Tonfall und Duktus so falsch, so talentfrei gespielt, dass es jedem aufgefallen wäre; ein absichtlich verunglücktes Ablenkungsmanöver. Was bezweckte sie damit? Wollte sie sich über ihn lustig machen? Hielt sie ihn für so dumm, dass er es nicht merkte? Aber genau das, wonach es sich anhörte, konnte es nicht sein: wer würde seinen Lebensretter verhöhnen wollen, keine Stunde nach der Rettungstat? Vielleicht war sie ein bisschen verrückt? Oder total?
Auf dem Rest der Fahrt wurde fast nichts gesprochen; sie dirigierte ihn zu einem siebziger Jahre Wohnblock in Dornbirn. Drei Stockwerke, kürzlich renoviert, vor allem mit Farbe. Gelb, rosa, blassblau, zwischen den Gebäuden Rasen und Magnolienbäume. Niemand war zu sehen.
»Kommen Sie«, sagte sie beim Aussteigen, »ich mach Ihnen noch einen Kaffee!« Sie schritt voran auf eines der Häuser zu, ohne sich nach ihm umzudrehen. Ihr Rock war immer noch feucht, die Schuhe trug sie in der Hand. An der Haustür fiel ihm auf, dass der Rock nicht feucht war, sondern nass. Ihr Hintern zeichnete sich unter dem dünnen Stoff ab. Sie sieht gut aus, dachte er, sie sieht verdammt gut aus, nicht das Gesicht, aber die Figur, warum fällt mir das jetzt erst auf?
Die Erektion befiel ihn wie ein Frösteln von einem Windstoß. Es tat weh, er beugte sich keuchend vor, um Platz in der Hose zu schaffen, trat einen Schritt näher, hielt im letzten Augenblick noch Distanz, obwohl ihm keine denkbare Wonne wünschenswerter schien, als sich an diesen prallen Hintern zu schmiegen; sein Atem ging in flachen Stößen, er spürte den Puls in den Hals schlagen, er war wieder siebzehn und kurz, bevor ... er verdrängte den Gedanken, atmete tief durch. Sie nestelte mit dem Schlüssel herum, wieso hatte sie überhaupt einen Haustorschlüssel, sollte der nicht in der Handtasche sein, die sie der Ach geopfert hatte, nein, dem »Universum«? Warum erregte ihn diese Frau, die eher ganz- als halbverrückt, vor allem aber deutlich älter als alle seine Partnerinnen der letzten Jahre war?
Das Haustor ging auf, Stahlrahmen mit Drahtglas, siebziger Jahre, er kannte diese Tür, die falsche Bronzefarbe des Metalls; dahinter hatte er mit Sylvia geknutscht; es war genau dieselbe Tür, und Sylvia hatte nichts dagegen gehabt in jener über alle Nächte erhabenen Nacht. Und jetzt war es wieder so, genau so.
Sie traten ins Treppenhaus und die siebziger Jahre hatten ihn eingeholt, es roch jetzt auch so. Wohnblockmief, eine Note von Salmiak und synthetischem Zitronenaroma. Und Plastik. Der Handlauf des Geländers aus schwarzem Plastik, aus demselben, das auch die Vorderkanten der Stufen bedeckte, damit niemand ausrutschte. Er hatte das Jackett ausgezogen, über den Arm gelegt. Sehr asymmetrisch, damit der tiefer hängende Teil der Jacke die monströse Schwellung in der Hose bedeckte, denn jetzt war nicht zwei Uhr nachts wie damals, jetzt war später Nachmittag, Samstag; hinter den dünnen Wohnungstüren die Fernseher; volles Haus. Jeden Moment konnte jemand herauskommen. Ohne sich umzudrehen, fasste ihre Hand nach hinten, fand den Weg unters Jackett zu der Beule, er sog die Luft ein.
»Man muss«, sagte sie, »kein Ritual einhalten, keinen besonderen Ort aufsuchen«, sagte sie, während sie die Treppe hinaufstieg und ihn sanft massierte, ohne sich umzudrehen, Lift gab es keinen, natürlich nicht; »jeder Ort ist dafür geeignet, man muss es nur laut sagen, und dass es ein Opfer ist, das ist auch wichtig, und was man dafür opfert, das muss man auch laut sagen. Verstehst du?«
»Nein.« Seine Stimme versagte, heiseres Flüstern war alles, was er heraus brachte. Sie hatte es dennoch gehört.
»Dann nehmen wir einmal ein Beispiel.« Sie stieg nun langsamer auf, Stufe für Stufe, zog ihn an der Hose von hinten an sich, so dass die Schwellung an dem nassen Rock rieb. »Also folgendermaßen: ich opfere xy – hier setzt du den Gegenstand ein, den du opfern willst – ich opfere xy für einen Fick mit Gisela Mießgang. Das musst du dreimal sagen. Vorausgesetzt, du willst Gisela Mießgang ficken. Trifft das zu?«
»Ja.«
Sie waren im dritten Stock angekommen. Sie sperrte ihre Wohnung auf. »Mach hinter dir zu«, sagte sie. »Dieser nasse Rock bringt mich noch um«, sagte sie, zog ihn in einer einzigen, fließenden Bewegung aus, ließ ihn zu Boden fallen. Darunter trug sie nichts. Achtloser Umgang mit Kleidungsstücken schien eine Angewohnheit von ihr zu sein, überall lagen welche herum, auch andere Gegenstände. Bücher, Zeitungen, Kaffeetassen bemerkte er, obwohl sein Blick auf den weißen Hintern gebannt war, der im Dämmerlicht des Spätnachmittags leuchtete, als sie den Flur ins Wohnzimmer voranging. Die Dinge waren nicht an den Orten, die sie einnehmen sollten. Auf dem Teppich standen Gläser, ein Schneidbrett lag da, daneben ein Messer, als habe sie auf dem Bauch liegend gegessen.
Er ließ die Hose fallen. »Und dann opferst du diesen Gegenstand. Da hast du zwei Möglichkeiten.«
»Zwei«, flüsterte er.
»Jawohl«, sagte sie, ließ sich vor der Couch auf die Knie nieder, legte den Oberkörper auf die Sitzfläche. »Du bringst das Opfer selber dar, indem du den Gegenstand der Vernichtung zuführst. Das macht man bei kleinen Gegenständen, wie meiner Handtasche. Oder du wartest, bis das Opfer angenommen wird ... mach schon.«
Er kniete nun hinter ihr. So weit war es mit Sylvia nicht gekommen. Er stieß zu, begann, sich zu bewegen. Sie antwortete mit ihrem Hintern; sprach flüsternd zu ihm mit rauher Stimme. Obszönitäten, die er aus keinem Mund je gehört hatte, Schauer überliefen seinen Körper.
Es kam, wie es kommen musste. Alle Freude schwand.
Beim Anziehen stellte er fest, dass der Hausschlüssel nicht mehr da war. Er trug das Etui in der linken Hosentasche, den Autoschlüssel in der rechten; der war noch da, die linke Tasche leer. Frau Mießgang war bei der Nachsuche keine Hilfe. Semmler, der über reiche Erfahrung verfügte, hatte den »post coitum«-Spruch, wonach »alle Lebewesen nach dem Geschlechtsakt traurig« seien, nie bestätigt gefunden; weder bei sich selbst noch bei Partnerinnen, und immer als typische Philosophenausrede für schlechten Sex angesehen. Weil sie es nicht besser konnten, verliehen die alten Lateiner ihrem miesen Gefühl die Würde einer ontologischen Beschaffenheit – dass es vielleicht nicht an der Natur, sondern an den schwarzen Schwingungen der Sklavin lag, die es nicht so gut fand, jeden zweiten Tag vergewaltigt zu werden, darauf sind die Herren nicht gekommen ... warum ging ihm das nun durch den Kopf? Es lag wohl an Gisela Mießgang. Sie war mürrisch, um es vorsichtig auszudrücken. Dass er seinen Schlüssel verloren hatte, schien sie als persönliche Beleidigung aufzufassen, sie wollte ihn nun los sein, so rasch wie möglich.
Die Suche dauerte nicht lang und blieb ohne Ergebnis. Er habe, vermutete sie, den Hausschlüssel sicher bei der Rettungsaktion verloren, an der Ach, sagte sie, er hörte heraus, was sie meinte: In der Ach. Sein Hausschlüssel auf dem Weg in die Nordsee. Er müsse nachschauen, empfahl sie, wobei sie nicht die geringste Andeutung machte, im Falle der Nichtwiederbeschaffung des Schlüssels ihre Wohnung zur Übernachtung anzubieten; nicht dass er darauf angewiesen gewesen wäre, es hätte sich nur gehört, dachte er, als freundliche Geste.
Aber sie wollte ihn los sein, sonst war da nichts.
Als er die Treppe hinabstieg, brach er, wie er wohl wusste, seinen eigenen Rekord: er ärgerte sich über sie. Schon zwanzig Minuten nach dem Akt; bisher hatte das es immerhin eine Stunde gedauert bis ihm die Partnerin zu negativen Gefühlen verhalf. Er hatte nicht erwartet, dass sie ihn begleitete, aber sie hätte wenigstens ... beim Verlassen des Hauses fiel ihm wieder Sylvia ein. Darüber vergaß er, welches angemessene Verhalten er von Frau Mießgang, der Stütze von Hochwürden Moser, erwartet hätte.
Auf der Fahrt dachte er nicht mehr an Frau Mießgang.
Inzwischen war es Nacht geworden. Semmler führte im Auto eine Taschenlampe mit, das hatte Frau Mießgang, die ihm jetzt wieder einfiel, nicht wissen können; sie hätte ihm also eine zum Mitnehmen anbieten müssen, denn es war abzusehen, dass es an der bewussten Stelle, bis er dort war, vollständig finster sein würde. Aber nein, keine Taschenlampe, keine Hilfe von ihr. Er parkte den Wagen auf der flussabgewandten Seite und suchte den Boden an der Abrisskante ab. Nichts. Der Schlüsselbund war weg. Er machte die Taschenlampe aus und starrte in die Ach. Zu sehen war nichts mehr, nur zu hören, noch immer das Tosen, dazwischen Rumpeln und Poltern von den Steinen, die der Fluss auf dem Grund vorwärts rollte. Dort unten wurde alles zermahlen, zerrieben, groß und klein. Frau Mießgangs Auto, seine Schlüssel. Was immer hinein gefallen, auf den Grund gesunken war. Zwei Schritte. Zwei Schritte würden reichen.
Es roch nach frischem Wasser, obwohl die Brühe dreckbraun war. Oder war sie nicht mehr braun? Er schaltete die Lampe ein, richtete den Lichtkegel auf die Flut. Milchkaffee wie am Nachmittag. Das irritierte ihn. Nichts Muffiges, Faules in der Luft, sondern der Duft einer Quelle, eines riesigen, aus Abgrundtiefe heraufschießenden Schwalls kristallklaren Wassers. Trinken müsste man dieses Wasser in langen Zügen, immer weiter trinken, dann würde man gesunden. Von allem genesen. Das rührte ihn, die linke Wange wurde nass, die Kehle eng.
Er atmete tief durch, beruhigte sich. Das war nur eine ... Irritation wegen des Schlüssels. Nichts weiter. Er musste Bellmeyer anrufen. Bellmeyer hatte Ersatzschlüssel. Er kümmerte sich um das Anwesen, nicht nur den Garten, auch sonst um alles, sorgte dafür, dass die Putzfrauen nicht stahlen, dass der Elektriker kam, der Installateur, wenn es notwendig war. Semmler hatte Bellmeyer von seinem Vater übernommen. Früher war Bellmeyer Gärtner gewesen, er hatte ihn als Hausverwalter angestellt. In diesem Haus gab es siebenhundert Quadratmeter Wohnfläche, soviel, sagte Bellmeyer oft, wie in einem kleinen Block, da war ein Hausverwalter unverzichtbar.
Teuer war Bellmeyer nicht.
Wie ging dieser Spruch? Ich opfere XY für ... für meinen Schlüsselbund. Er drehte sich um. Niemand da. Allein auf weiter Flur. Er machte die Lampe aus, durchwühlte die Taschen. XY musste nichts Besonderes sein, nur etwas, das passte – nicht zu wertvoll, aber auch nicht zu gering. Er fand nichts, ging zum Auto zurück. Im Handschuhfach lag immer noch das Feuerzeug. Nicht aus Gold, nur vergoldet, ihrer Finanzlage entsprechend. Wessen Finanzlage? Na, ihrer! Er grinste. Er kam doch tatsächlich nicht auf den Namen, etwas mit »A«. Anita? Anna? Nein ... sie hatte es ihm zum Abschied geschenkt, wie viele Jahre das her war, hatte er auch vergessen. Egal. Das Feuerzeug war genau richtig für ein Experiment. Nicht zu wertvoll, nicht zu wertlos.
Er hielt es in der rechten Hand und sagte den Spruch auf. »Ich opfere dieses Feuerzeug für meinen Schlüsselbund.« Dann holte er aus, wie es Gisela Mießgang mit ihrer Handtasche gemacht hatte. Etwas ließ ihn innehalten. Ein Gedanke bestimmter Art, ein Rechengedanke. Dagegen konnte er nichts tun. Wann immer es um das Abschätzen von Werten ging, begann sein Kopf zu rechnen. Selbsttätig. Fix verdrahtet. Das Aufwands-Ertrags-Verhältnis stimmte nicht. Frau Mießgang opferte dem »Universum« ihre Handtasche – für ihr Leben, bitte schön, und er sollte dieses schöne Feuerzeug, Zeugnis eines hochromantischen Abschieds, für einen ordinären Schlüsselbund opfern, dessen Kopie sowieso bei Bellmeyer lag? Kam nicht in Frage. Beim Geschäft würde man sagen: er verderbe die Preise. Jetzt fiel ihm ein, er brauchte das Opfer nicht selbst zu bringen, das hatte sie gesagt. Er konnte warten, ob es angenommen würde, hatte sie gesagt. Er steckte das Feuerzeug wieder ein. Also würde er warten.
Bellmeyer am Telefon klang beunruhigt.
»Da wartet jemand auf Sie, Herr Kommerzialrat!« (Die Verwendung des nichts bedeutenden Titels ließ sich Bellmeyer nicht nehmen.)
»Was will er denn?«
»Etwas abgeben, hat er gesagt. Nur Ihnen persönlich abgeben, Herr Kommerzialrat. Er wartet.«
»Sie haben ihn doch nicht etwa reingelassen?«
»Wo denken Sie hin? Er wartet vor dem Tor, das ist öffentlich, da kann man nichts machen ...«
»Schon gut. Hat er gesagt, wie er heißt?«
»Koslowski, hat er gesagt. Und dass er Sie von der Schule kennt.«
Sie saßen sich in der Bibliothek gegenüber. An die Bibliothek konnte sich Koslowski nicht mehr erinnern, Semmlers Vater erlaubte den Kindern hier keinen Zutritt; sie lag im Erdgeschoss im Ostteil des Gebäudes. Und jetzt saß er in einem Ledersessel, umgeben von Büchern, die er zu gern aus