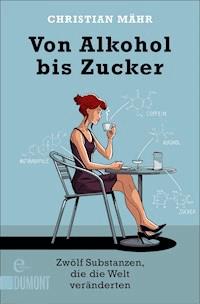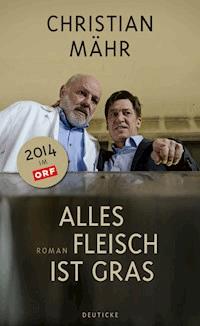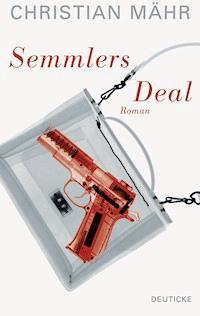Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Als Frau Leupold, Chemielehrerin in Pension, in ihrem Haus in Dornbirn einen tödlichen Unfall hat, muss sich Kater Sami einen neuen Besitzer suchen. Den findet er schon bald in Mauritius Schott, dem Nachbarn. Schott findet die Leiche, die er an ihrem Fundort belässt, und eine große Menge Geldscheine, die er gerne an sich nimmt. Das Geld stammt aus dem Drogenlabor, das Frau Leupold gemeinsam mit ihrem Enkel betrieben hatte. Mittlerweile ist auch die Wiener Unterwelt aufmerksam geworden und schickt ihre Schnüffler ins idyllische Vorarlberg. Mit schrägem Humor erzählt Mähr von unglücklichen Zufällen, die alle irgendwie mit dem Kater Sami zu tun haben und zu einer Reihe von tiefgekühlten Leichen führen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 430
Veröffentlichungsjahr: 2011
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Deuticke eBook
Christian Mähr
Das unsagbar Gute
Roman
Deuticke
ISBN 978-3-552-06179-8
Alle Rechte vorbehalten
© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2011
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Datenkonvertierung eBook:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
Unser gesamtes lieferbares Programm
und viele andere Informationen finden Sie unter:
www.hanser-literaturverlage.de
1
Jede Katze braucht einen Menschen. (Leider ist es so, dass nicht jede Katze einen Menschen hat. Auch nicht jeder Kater.) Bei Hunden würde man diesen Satz einsehen – aber bei Katzen? Die sind doch so unabhängig und eigensinnig und hochmütig und so weiter. Katzen sind falsch, weiß der Volksmund. Der Volksmund weiß bekanntlich gar nichts, es ist der dümmste Mund auf Gottes Erdboden, aber was er hervorplappert, ist ebenso unausrottbar wie die Grippe.
Katzen sind nicht falsch, überhaupt nicht. Ihre Sprache ist nur schwerer verständlich als die Sprache der Hunde. Hunde haben ihre Sprache an den Menschen angepasst, um sich Vorteile zu verschaffen, Hunde sind schlau. Das sei ihnen gegönnt, aber wenn wir bei der Wahrheit bleiben, sind Hunde Opportunisten, Katzen nicht. So gesehen sind Katzen wahrhaftiger als Hunde.
Jede Katze braucht einen Menschen, wie jeder Mensch einen Gott braucht. Natürlich kommt es vor, dass eine Katze mehrere Menschen hat; dann hat sie eben mehrere Götter. Nicht übertrieben viele wie die dreihundertdreißig Millionen, die nach Hinduglauben alle in den Hinterbacken einer Kuh wohnen, aber zwei, drei oder auch fünf. Wie die Götter der Menschen sind die Götter der Katzen, die Menschen, freundlich oder unfreundlich, launisch, sentimental, manche sind böse. Und schwer zu verstehen sind sie alle. Ihre Wege sind unerforschlich, und sie haben große Macht; sie tun Dinge, die den Horizont der jeweils niedereren Wesen übersteigen, und sie tun diese Dinge aus Gründen, die nur sie selber kennen.
Aber einen Unterschied gibt es: Die Götter der Katzen sind anwesend, man kann sie sehen und hören, sie greifen ins Leben der Katzen ein, geben Futter oder verweigern es in bedauerlichen Fällen. Die Götter der Menschen haben sich dagegen zurückgezogen. Sie sprechen nur durch Orakel oder Träume oder durch den Mund von Propheten; man kommt als Mensch nicht leicht an sie heran. Daher gibt es für Menschen Glauben und Zweifel. So etwas gibt es für Katzen nicht. Noch nie hat eine Katze, geschweige denn ein Kater, an etwas geglaubt, noch nie an etwas gezweifelt. Dafür ist kein Raum. Die Taten der Katzengötter sind eindeutig: Sie sind gut oder böse oder aber reiner Blödsinn.
Bei den Taten der Menschengötter weiß man nie, was man dazu sagen soll; man kann ja nicht zuschauen, sieht nur das Ergebnis und muss dann anfangen zu interpretieren – dazu aber muss man Theologie studieren und dazu wieder muss man Hebräisch lernen, Altgriechisch sowieso (du lieber Gott!) oder aber eben Quantenmechanik und Evolutionsbiologie. Vielleicht liegt es daran, dass die Katzen ihre Götter lieben (und fürchten), aber nicht anbeten; die Menschen ihre Götter seit Jahrtausenden anbeten, aber weder fürchten noch lieben. Das ist schon ein Unterschied.
Es ist schwierig, über Katzen und Menschen nachzudenken und nicht ins Philosophieren zu kommen, beschränken wir uns also rasch auf unsere eigentliche Aufgabe, die Geschichte des Katers Sami zu erzählen, dessen vordere zwei Drittel weiß sind, das hintere Drittel aber rötlich. Über dem linken Auge hat er einen recht großen Fleck derselben Färbung. Der Schwanz ist weiß-rot geringelt. (Damit man eine Vorstellung hat.) Die Geschichte handelt natürlich nicht nur von Sami, dem Kater, sondern auch von verschiedenen Menschen, guten und bösen, und ihren Schicksalen. Da ist zunächst der Mensch, den Sami hat, eine Frau Leupold, ehemalige Professorin für Chemie und Physik am Gymnasium, frühpensioniert wegen eines Nervenleidens, mit dessen Natur wir uns schon deshalb nicht auseinandersetzen müssen, weil diese letzten Endes auch mehreren konsultierten Ärzten verborgen geblieben ist, zuletzt dem von der Krankenkasse, was aber keine große Rolle spielte, weil die Frau Dr. Leupold ohnehin nicht mehr tragbar war, wegen ihres exzentrischen Verhaltens und der häufigen Krankenstände. Worin dieses Verhalten bestand, ließ sich nicht mehr eruieren, die ehemaligen Schüler sind in alle Winde zerstreut, die Kollegen pensioniert oder können sich angeblich nicht mehr erinnern. Ein einziger hat zugegeben, dass dies alles sowieso nur vorgeschoben war, die Kollegin Leupold habe es sich gerichtet, es sei ihr auch zu gönnen, wohl dem, der das Talent habe, auf die Frühpensionierung hinzuarbeiten, es bleibe einem Lehrer auch nichts anderes übrig in einer Zeit, wo sie jeden Drecksproleten aufs Gymnasium schicken … das Weitere, was der Kollege noch gesagt hat, lassen wir weg. Kurz: Der Frau Doktor Leupold war es gelungen, den Ruhestand ein paar Jahre zu verlängern, und zwar dort, wo allein es Sinn hat, am vorderen Ende.
Es ist ihr auch zu gönnen, denn mit der Frau Leupold hätten die wenigsten von uns tauschen mögen. Sie wohnte mit Sami in einer Villa, die ihr Großvater als Textilfabrikant am Beginn des letzten Jahrhunderts gebaut hatte. Sie wohnte im geerbten Domizil allein, weil sie sich nach einer kurzen, unglücklichen Ehe hatte scheiden lassen. Den Namen des Mannes, eines Maschinenbauingenieurs, hatte sie behalten, weil er ihr besser gefiel als der eigene (Hämmerle). Der Dipl.-Ing. Leupold lebte schon viele Jahre in Wien, es gab keinen Kontakt mehr. Die Tochter aus dieser Ehe, das einzige Kind, ergriff die Flucht und heiratete einen spanischen Anwalt; die Ehe, soweit ihre Mutter das mitbekam, schien glücklich zu sein, Hildegard lebte mit ihrem germanophilen Ramon in Valencia, ihr Sohn hieß nach spanischer Sitte, die den Familiennamen der Mutter einbezieht, Manfredo Gonzales Leupold, aber Manfredo verstand sich weder mit dem Vater noch mit der Mutter und kehrte, als er achtzehn war, nach Österreich zurück, um in Wien Germanistik zu studieren, was einen totalen Bruch mit den Eltern auslöste. Die hatten sich für ihren perfekt zweisprachigen Sohn eine EU-Karriere erträumt; um aber bei einer großen Zentralbehörde, sie heiße, wie sie mag, etwas zu werden, hätte Manfredo, wie seit fünfhundert Jahren im Abendland üblich, Jurist werden müssen. Für die Juristerei fehlte ihm jedes Interesse, für Germanistik übrigens auch, wie er bald feststellte, denn Manfredo Gonzales Leupold fühlte sich als Künstler und erbrachte mit diesem Namen schon eine beträchtliche Vorleistung, was ihm, seien wir ehrlich, etwa mit »Hans Huber« nicht gelungen wäre. (Er ließ sich auch in Wien »Manfredo« nennen, nicht etwa »Manfred«.) Was nun sein künstlerisches Talent angeht, so war es zweifellos vorhanden, wie alle versicherten, die ihn kannten, nur schien es über alle Bereiche der Kunst gleichmäßig verteilt, dadurch kam auf den einzelnen Sektor nicht so viel, wie Manfredo es sich gewünscht hätte. Er dichtete und musizierte, malte und modellierte, er sang und schauspielerte bei freien Gruppen. In der Wissenschaft sagt man, der Spezialist wisse alles über nichts, der Generalist nichts über alles. Manfredo Gonzales Leupold war also Generalist.
Unsere Zeit ist für Generalisten nicht günstig. Die meisten haben einen Brotberuf oder einen Sponsor. Manfredos Sponsor war seine Großmutter. Jedenfalls war es das, was die Nachbarn glaubten: Manfredo lebte in Vorarlberg, weil es so bequemer war, sie anzupumpen, die arme Frau. Unerklärlich blieb ihnen, was er bei diesen Verhältnissen wochenlang in Wien trieb, wo er sich nach Angaben seiner Großmutter aufhielt, wenn sie sich erkundigten, die Nachbarn. Der Manfred musste in Wien irgendwo wohnen, doch wohl nicht im Hotel, oder? Wovon sollte er andererseits eine Wohnung zahlen? Aber genauer zu fragen trauten sie sich nicht.
Was seine Großmutter betraf, so gab es für die Mitwelt keine Zweifel: Sie war reich. Sonst würde sie ja nicht in der Hämmerle-Villa wohnen; wer dort wohnte, hatte sie geerbt, und wer die Villa geerbt hatte, besaß auch noch einen Haufen andere Güter. Nur ein paar wussten es besser. Von dem Hämmerle-Vermögen war nicht so viel übrig, dass es auch nur zur Erhaltung gereicht hätte. Ein unförmiger, grauer Kasten mit Gaupen und Giebeln und einem Turm und einer Dachfläche von der Größe eines Tennisplatzes und siebenundzwanzig Fenstern, jedes aus acht kleinen Scheiben in bröckelnden Holzrahmen und einer später eingebauten Zentralheizungsanlage aus dem Jahr 1962 mit einem Ölverbrauch von achttausendfünfhundert Litern. Ja, so war das. Von den Sanierungskosten, die sich Frau Dr. Leupold hatte ausrechnen lassen, hätte man zwei schmucke Einfamilienhäuser hinstellen können. Das war also illusorisch. Eine ganze Menge Geld war beim Kauf heimischer Immobilienpapiere verschwunden; so viel, wie ihre Nachbarn glaubten, war es sowieso nie gewesen, so dass sich Frau Leupold mit einer prekären finanziellen Situation konfrontiert sah, bis … aber wir greifen vor. Die Situation hatte sich in den letzten beiden Jahren vollständig gewandelt, nur konnte die Frau Doktor Angewohnheiten, die sie unter der Last der Verhältnisse im Laufe von Jahren angenommen hatte, nicht über Nacht ablegen. Zu diesen Angewohnheiten gehörte der Drang, die Sucht geradezu, im Hause alles selber zu reparieren, was nur irgendwie zu reparieren war. Von ihrer Ausbildung als Chemikerin besaß sie ohnehin ein Gefühl für apparative Praxis.
Zu den einfachsten Übungen im Reich des Selbermachens gehört das Auswechseln von Glühbirnen, was manchem lächerlich vorkommen wird, das ist doch keine Reparatur, wird er sagen, dann könne man ja auch schon das Türöffnen zum »do it yourself« rechnen, aber derjenige sollte bedenken, dass der Glühbirnentausch an einer Deckenlampe in einem Haus mit vier Meter hohen Räumen keine ganz triviale Sache mehr ist. Man braucht eine Leiter, aber um sie aufzustellen, müsste man im Esszimmer, wo eine von den fünf Birnen im Jugendstilleuchter ausgefallen ist, den großen Esstisch zur Seite rücken, was kein Mensch tut, weil das Ding etwa zweihundert Kilo wiegt. Auch dem unpraktischsten Zeitgenossen wäre eingefallen, einfach auf den Tisch zu steigen. Für einen Menschen normaler Körpergröße war der Luster dann in Reichweite.
Frau Dr. Leupold machte es genauso. Sie hatte bei ihrem allabendlichen Rundgang das Versagen der Birne im Esszimmer entdeckt. Auf diesem Rundgang, der sie vom Keller durch alle Räume bis zum Dachboden führte, überprüfte sie alle technischen Einrichtungen, suchte nach Rissen im Putz, lockeren Fensterscheiben und losen Dachziegeln.
An jenem Abend stieg sie vom ersten Stock ins Erdgeschoss hinunter. In einer Sechzig-Quadratmeter-Garconniere ist das weiter kein Problem: Die Glühbirnen liegen in der Küchenschublade, keine Lampe ist davon weiter entfernt als fünf Meter, aber in einem Haus mit fast siebenhundert Quadratmeter Wohnfläche müssen alle Dinge ihren fixen Ort haben und dürfen nicht irgendwo verstaut werden, wo gerade Platz ist; das Suchen wäre endlos. Die Glühbirnen und tausend andere Sachen waren in einem kleinen Raum im Erdgeschoss in Wandregalen untergebracht, die Hintertür führte von hier in den Garten. So konnten Einkäufe gleich am richtigen Ort verstaut werden, wenn man das Haus von hinten betrat, was Frau Dr. Leupold sich zur Regel gemacht hatte.
Durch die Hintertür betrat auch der Kater Sami das Haus. Er hatte eine Katzenklappe. Manchmal benutzte er sie allerdings nicht, sondern blieb außen vor der Tür sitzen, bis er seinen Menschen im Raum dahinter rumoren hörte, und meldete sich dann mit Miauen. Es war dies überhaupt die einzige Gelegenheit, bei der er den katzentypischen Laut vernehmen ließ, sonst klang das, was er von sich gab, nach allem Möglichen, nur nicht nach Miau. Wenn Frau Dr. Leupold diesen Ton hörte, wusste sie, dass die Hintertür geöffnet werden musste; aus Gründen, die im Dunkeln blieben, weigerte er sich dann, den Schlupf zu benutzen, saß, wenn es sein musste, die ganze Nacht im Freien. Diesmal war es anders. Kaum hatte die Frau Dr. Leupold die Hintertür aufgeschlossen, schoss der Kater an ihr vorbei ins Innere des Hauses. Die Tür ließ sie offen. Sie musste weg, wollte aber das Auswechseln der Glühbirne nicht bis zu ihrer Rückkehr verschieben; Verschieben, aus welchen Gründen immer, war der Anfang vom Ende, für ein Haus wie das ihre bedeutete Verschieben, egal, was auf später verschoben wurde, den Beginn des Verfalls. Sie nahm eine Glühbirne aus dem Regal, lief nach oben, zog die Hausschuhe aus und stieg über einen der Stühle auf den Esszimmertisch.
Frau Dr. Leupold hätte nicht von ihren Gewohnheiten abrücken sollen; nein, nicht das sofortige Auswechseln der Glühbirne ist gemeint, das Nicht-Aufschieben notwendiger Handlungen, das war schon in Ordnung – sondern das Offenlassen der Tür, um zwei Sekunden einzusparen. Denn durch diese offene Tür betrat nun ein zweiter Kater das Haus der Frau Dr. Leupold.
Dem Kater hatten die Menschen den Idiotennamen »Schnurrli« gegeben, was auf diese und auf seine Verhältnisse überhaupt ein bezeichnendes Licht wirft; ein Name, auf den er, zu seiner Ehre sei es gesagt, niemals hörte. Dieser Kater war zweifärbig, Beine, Bauch und Brust weiß, Oberseite und Kopf rötlich, wobei bei ihm die scharfe Begrenzung halbmondförmig über die Flanken verlief, in der Mitte weit nach unten reichend, was den ungünstigen Eindruck hervorrief, es habe ihm jemand eine Decke übergeworfen – ähnlich jenen Paletots, in die Damen ohne Sinn für die Würde eines Tieres bei kaltem Wetter ihre winzigen Schoßhunde zu hüllen pflegen; nur der Festzurrgürtel um den Bauch fehlte. Schon bei einem Hund, wie klein er auch immer sein mag, sieht das idiotisch aus, bei einem Kater wie eine Entstellung, das Spiel einer bösartigen Natur. Der andere Kater war erst vor kurzem zugezogen, die Familie Stauber hatte ein Einfamilienhaus auf der anderen Seite der Leupold-Villa bezogen (günstig ersteigert, nachdem es in Laufe einer furchtbaren Scheidungsgeschichte des Erbauerehepaares auf den Markt gekommen war). Es soll Leute geben, denen das in allen Ecken hockende Unglück solcher Häuser den Erwerb verleiden würde; Staubers gehörten nicht zu dieser abergläubischen Sorte. Herr Stauber war Chefverkäufer eines großen Autohändlers, Frau Stauber Hausfrau, die beiden Söhne (vierzehn und sechzehn Jahre alt) gingen aufs Gymnasium. Sie hatten bis zu diesem Herbst in einer Vierzimmer-Eigentumswohnung am Stadtrand »gehaust«, wie Herr Stauber das nannte, jetzt erst, nach dem günstigen Griff nach ersteigertem Besitz, »wohnte« man; die anderen Familienmitglieder pflichteten ihm bei.
Staubers hätten sich auf Befragen selbst als glückliche Familie bezeichnet. Herr Stauber war erfolgreich im Beruf, die Söhne nicht ganz so erfolgreich in der Schule – einzig Frau Stauber litt zuzeiten unter dem Gefühl des Unausgefülltseins, wogegen sie aber selber schon ein Heilmittel gefunden hatte: nämlich ein Tier, eine Katze, die man am günstigsten im örtlichen Tierheim bekommen konnte. So fand der andere Kater dieser Geschichte den Weg in das ebenfalls günstig erworbene Einfamilienhaus der Familie Stauber. Für den Paletot-Kater war es eine Verbesserung, was allerdings nicht viel besagt, denn fast jeder Haushalt in Dornbirn wäre eine Verbesserung gegenüber dem Tierheim gewesen. Im Tierheim war man mehr oder weniger dauernd eingesperrt; für einen Kater besonders unangenehm, weil ein solcher ein Territorium beansprucht, was in einem Tierheim nur sehr unvollkommen möglich ist. Der andere Kater hatte viele Monate auf eine Änderung seiner Lage gewartet; wo er ursprünglich herkam, verliert sich im Dunkel der Geschichte, und wir wollen uns auch nicht damit belasten, dass wir gleichsam katzengeschichtlich vom Hundertsten ins Tausendste geraten. Der Grund für die lange Wartezeit, man muss es leider sagen, war die unmögliche Zeichnung des Katers, die das Tier lächerlich erscheinen ließ; traurig, wie sehr sich Menschen von solchen Äußerlichkeiten bestimmen lassen. Sie wandten sich nach dem ersten Blick von dem Kater ab und angenehm gestreiften Exemplaren zu. Mit den Staubers hatte der Paletot-Kater großes Glück, weil denen jedes ästhetische Empfinden abging und ihnen an dem Tier nichts Negatives auffiel.
Ein Kater beansprucht ein Revier von dreihundert Metern in alle Richtungen, in städtischen Gebieten lässt sich das nicht verwirklichen, weshalb vernünftige Exemplare ihre Pirschgänge zu verschiedenen Zeiten auf denselben Grundstücken absolvieren und so kräftezehrende Revierkämpfe vermeiden. Die Klugheit eines Stadtkaters ging den beiden Landkatern ab; ihre Heime lagen zu nahe beieinander, es kam, wie es kommen musste: erhebliche Differenzen zwischen Sami und Kater Schnurrli über die Aufteilung von Grund und Boden.
Kater Schnurrli war jünger und nicht so wohlgenährt wie Sami – wobei wir nicht andeuten wollen, er habe bei den Staubers nicht genug zu essen gekriegt, das nicht, aber Frau Stauber als Anhängerin gesunder Ernährungsweise fing jetzt nicht damit an, ausgerechnet den Hauskater zu mästen, der konnte froh sein, wenn sie bei ihm eine Ausnahme machte und die üblichen industriell hergestellten Lebensmittel aus dem Tierfutterladen servierte, was bei ihrer Familie nie in Frage gekommen wäre. Leider gab es von diesem herrlichen Industriefutter nicht die Mengen, die Schnurrli gern gefressen hätte. (Ich kürze den Namen von hier ab mit S. ab, das grenzdebile »Schnurrli« macht den ganzen Text kaputt; wenn also in Hinkunft von S. die Rede ist, meine ich den »anderen« Kater, ja, ich weiß, Sami beginnt auch mit einem »S«, ungünstig, aber was soll ich machen?)
Zurück zu S.: Der war bei größerem Appetit auf den Mäusefang angewiesen, und dazu brauchte er ein Jagdrevier ausreichender Größe. Das schöne angrenzende Grundstück der Leupold-Villa war aber schon Samis Revier, der Konflikt damit programmiert. Nun war der Kater S. jünger und aggressiver als Sami, dessen Körpergewicht nach tierärztlicher Aussage außerdem an der oberen Grenze des Zulässigen lag, was die Verteidigung gegen den Eindringling nicht leichter machte. Man kann es in einem Satz sagen:
Sami und S. waren Todfeinde.
An jenem Herbsttag hatte es wieder eine Auseinandersetzung gegeben, die, wir müssen es leider zugeben, mit einer Niederlage Samis endete, das heißt, mit einer Flucht, wie es im Verhältnis 70 : 30 der Fall zu sein pflegte; die Flucht führte ihn zum Haus seines Menschen, der Frau Dr. Leupold, wohin zu folgen der Kater S. bisher nie gewagt hatte. (Die Katzenklappe war ihm unheimlich.) Aber jetzt stand die Tür offen. S., im Überschwang des Sieges, ließ alle Vorsicht fahren und folgte der Frau Dr. Leupold ins Haus. Von Sami war nichts zu sehen oder zu hören, der hatte eines seiner Verstecke aufgesucht, von denen es in dem alten Kasten mehrere gab. Kater S. dagegen vergaß Sami, die neue Umgebung erregte seine Katerneugier. Außerdem nahm er mit seinem sechsten Sinn die Aura der guten Dr. Leupold auf – und diese Aura war viel besser als die entsprechenden Auren aller Mitglieder der Familie Stauber. S. folgte der Frau in den ersten Stock, man kann sagen, auf den Fersen, wovon sie nichts bemerkte.
An den Kater dachte sie nicht, nicht an den eigenen und schon gar nicht an einen fremden. Man darf sagen, dass es der Dr. Leupold nicht vergönnt war, diesen fremden Kater jemals zu Gesicht zu bekommen. S. sprang hinter ihr auf den Tisch und machte das, was Katzen tun, wenn sie die Aufmerksamkeit eines Menschen erregen wollen. Er strich um ihre Beine. Und warum wollte er ihre Aufmerksamkeit erregen? S. erwog (man kann es nicht anders sagen) einen Wechsel seiner Götter, er war im Begriff, abtrünnig zu werden – der Grund dafür lag in der ungeheuer angenehmen Ausstrahlung der Frau Leupold. Wir können uns mit unseren begrenzten Sinnen davon so wenig eine Vorstellung machen wie vom vierdimensionalen Raum und müssen, wie in solchen Fällen üblich, zu einem notgedrungen hinkenden Vergleich Zuflucht nehmen: Frau Leupold verstrahlte ihr Wohlwollen den Felidae gegenüber wie ein wattstarker Propagandasender im Kalten Krieg; eine Katze wurde davon angezogen, auch wenn es ihr an ihrem Platz noch so gut ging. Kater S. ging es nicht wahnsinnig gut bei den Staubers. Er hätte den Mittelpunkt seiner Lebensinteressen ohne Zögern verlagert, er war dazu schon entschlossen, als er in den Bannkreis der Dr. Leupold geriet, er hätte sich sogar mit Sami vertragen, wenn es denn nicht anders ging (das ist allerdings, wie ich zugeben muss, Spekulation) – aber es kam anders.
In dem Augenblick, als sich der Kater S. an ihren Unterschenkel schmiegte, trat Frau Dr. Leupold einen Schritt zurück. Die Birne hatte sie ausgetauscht, die kaputte hielt sie in der Hand.
S. erschrak und flüchtete. Er konnte wie alle Katzen laute Geräusche nicht ausstehen, noch weniger laute unbekannte Geräusche. Das eine Geräusch von den zwei, die ihn erschreckten, hatte er zuvor nie gehört: wenn Gläsernes zerbrach, denn im Hause Stauber wurde nichts zerbrochen. Das zweite Geräusch, dumpfer tönend als die platzende Glühbirne und lauter, hatte er auch noch nie gehört. Denn in seinem Katerleben war noch nie etwas sechzig Kilo Schweres, Weiches aus Tischhöhe auf den Fußboden gefallen. S. floh aus dem ersten Stock und aus dem Haus.
Sami lag im zweiten Stock unter einem Regal neben der Dachbodentür. Im Haus blieb alles ruhig. Von seinem Menschen und dem anderen Kater war nichts zu spüren. Nach langer Zeit gab es neue Geräusche. Es war jemand im Haus. Ein Mensch. Nicht seiner. Sein Mensch bewegte sich anders, machte eine andere Art Lärm. Sami schlich die Treppe hinunter und näherte sich dem Esszimmer.
Drin stand ein Mensch. Nicht sein Mensch. Sein Mensch lag auf dem Boden. Er kannte die Person. Sie stand nicht neben seinem Menschen, sondern etwas abseits an der Kommode, auf die Sami manchmal hinaufsprang, um an den Blüten zu knabbern, wenn dort neue Blumen standen. Er mochte den Geruch und Geschmack. Und die Farben. Sein Mensch hatte nie etwas dagegen gehabt. Der andere Mensch blickte zur Tür, als Sami hereinkam, ein Zufall, kommen hätte er ihn nie gehört. Dann begann der neue Mensch zu reden, Sami legte die Ohren leicht zurück. Er kannte die Stimme und konnte sie nicht ertragen. Zu hoch und zu laut, viel zu laut. Er wurde angesprochen, das war schon klar, Sami hin und Sami her, aber alles war falsch. Dieser Mensch mochte ihn nicht. Sami war alt genug, an den Stimmen der Menschen zu erkennen, wie sie es meinten mit ihm. Die hier meinte es nicht gut, aber nicht auf die übliche Weise nicht gut wie andere Menschen, in deren Gärten er auf Mäuse lauerte; sie klangen anders, wenn sie ihn verjagten. An diesem anderen Menschen stimmte etwas nicht. Denn er hatte Angst. Vor Sami.
Wie konnte das sein? Ein Mensch kann keine Angst haben vor Sami oder einer anderen Katze. Nur umgekehrt war das möglich, das war die Grundordnung des Daseins. Ein Mensch, der Angst vor Sami hatte, fiel aus dem Rahmen, mit dem stimmte etwas nicht, vielleicht war er krank.
Sami zog sich in einen Bereich des großen Hauses zurück, wohin ihm der neue Mensch nicht folgen konnte. Dort wartete er ab. Die Geräusche des kranken Wesens verstummten, Sami schlich hinunter, verließ das Haus. Er brauchte jemanden.
Wie alle Katzen besaß Sami ein untrügliches Gespür dafür, ob etwas lebendig oder tot war. Sein Mensch, den er kannte, seit er auf der Welt war, dieser Mensch war tot. Für einen Kater ist der Tod seines Menschen wie für einen Menschen der Tod seines Gottes, eine bedrohliche Erfahrung, die alles in den Grundfesten erschüttert. Da aber ein Kater in einem Universum mit vielen Menschen lebt, der Mensch aber in einem mit nur einem Gott, ist der Kater im Vorteil, denn er kann sich einen neuen Menschen wählen, einen neuen Gott. (Der Mensch versucht das natürlich auch, es geht aber immer schief.)
Stimmen 1
»Wieso bist du überhaupt dort rein?«
»Der Kater ist schuld …«
»Der weiße von der Leupold, hinten ist er so gelb gefleckt?«
»Nein, ein anderer. Das ist ja der Skandal, jetzt hat sie schon zwei von den verdammten Viechern …«
»Hab ich noch nie gesehen, ich kenn nur den mit dem geringelten Schwanz, der uns immer in den Garten …?«
»Ja, das ist der alte. Sami heißt er.«
»Woher weißt du das?«
»Hab ich gehört, wie sie ihn gerufen hat.«
»Komischer Name.«
»War ja auch eine komische Frau …«
»Wieso war?«
»Lass mich halt erst einmal fertig erzählen! Von vorne weg …«
»Also, bitte …«
»Ich trag grad den Müll raus, da seh ich dieses Vieh, wie es versucht, in unseren Garten zu scheißen. Es langt ja, dass es der alte Kater von der Leupold immer wieder versucht, und jetzt hat sie noch einen …
»Woher weißt du, dass es ein anderer war?«
»Sah ganz anderes aus, viel mehr gefärbt, der Rücken so schmutzig gelb – da hab ich so eine Wut gekriegt, ich sofort hinterher …«
»Das machst du doch immer so, nur genutzt hat es nie was.«
»Eben! Aber diesmal war da noch was anderes … wie soll ich sagen … der neue hat mich so angesehen dabei … gegrinst.«
»Der Kater?«
»Wenn ich doch sage! Die reine Provokation.«
»Das heißt also, der Kater hat … provozierend geschissen, nicht einfach nur so, sondern provozierend.«
»Mach dich nur lustig! Du hast es nicht gesehen! Es klingt blöd, weiß ich selber. Aber es ist da was dran, glaub mir. Als ich auf ihn los bin, bleibt er bis zum letzten Moment sitzen, bis ich ihn schon fast erwischt hatte! Der andere rennt immer gleich davon, wenn er mich sieht. Aber dieser gelbe … wie um mich zu frotzeln, versteht du?«
»Allmählich – und das hat dich so wütend gemacht …«
»… dass ich hinter ihm her bin übers Grundstück raus. Mach ich ja sonst nie. Ich renn ihm also nach über die Wiese auf die Leupold-Villa zu …«
»Hast du ihn erwischt?«
»Ach woher denn! Eine Katze kannst du nicht einholen, ausgeschlossen …«
»Trotzdem bist du hinterher, warum?«
»Ich wollte die Sache klären, ein für alle Mal! Mit der Leupold reden …«
»Streiten heißt das …«
»Und wenn schon. Ich hatte von dem Katzendreck die Nase voll. Du kannst nicht immer nur alles in dich reinfressen, einmal ist Schluss! Ich hab das deutlich gespürt, jetzt kommt alles auf den Tisch!«
»Hast du geklingelt?«
»War nicht nötig. Die Hintertür war offen.«
»Du bist einfach so ins Haus rein?«
»Warum denn nicht? Ich hab auch gleich gerufen. Frau Leupold, sind Sie da?, oder so, gehört hab ich nichts. Die Katze vor mir die Treppe rauf, ich hinterher …«
»Und? Kam Antwort?«
»Ja, sie hat auch was gerufen, glaub ich, aber gleich drauf dieser Krach, ein Splittern, dann war es still. Ich weiter rauf. Im ersten Stock liegt sie im großen Zimmer, das Speisezimmer oder Salon oder was das war, liegt auf dem Rücken am Boden. Neben dem Tisch.«
»Tot?«
»Hab ich gleich gesehen. Kein Puls am Hals, eine Pupille weiter als die andere, keine Chance mehr …«
»Und die Katze?«
»Weg. Wie vom Erdboden verschluckt. Nur ihr alter Kater, dieser Sami, hat sich blicken lassen, ist aber gleich wieder verschwunden.«
»War sonst noch wer da?«
»Interessant, dass du das fragst … aber das sah nicht nach Fremdverschulden aus, verstehst du, die ist vom Tisch gefallen … sah so aus, als ob sie versucht hat, eine Birne auszuwechseln, und dabei gestürzt ist. So sah das aus …«
»Ich unterbreche nur ungern, aber kommen wir noch zu irgendeiner Pointe? Hast du nicht die Polizei gerufen?«
»Hatte ich ja vor! Aber erst … hab ich mich umgesehen.«
»Rumspioniert.«
»Wie du willst. Hätt ich gleich die Polizei gerufen, hättest du mir doch Vorwürfe gemacht, dass ich nicht die Gelegenheit nutze …«
»Ja, hätte ich. Garantiert. War ja auch keine Vorwurf. Ich erwarte, dass du mir eine haarkleine Schilderung …«
»Daraus wird nichts. Ich musste dort möglichst schnell wieder raus …«
»Warum denn?«
»Die Hintertür war offen.«
»Was? Die hast du offen gelassen?«
»Was denn sonst? Hat ja kein Schlüssel gesteckt. Hätt ich was unter die Klinke klemmen sollen – nur zum Spionieren?«
»Also schön – du bist rausgerannt. War das alles?«
»Nicht ganz. Im Keller hab ich mich schon ein bisschen umgesehen. Da hatte sie so ein Labor eingerichtet …«
»Sie war ja Chemikerin …«
»Ja doch! Wir wissen beide, dass sie Chemikerin war. Du brauchst nicht alles zu kommentieren!«
»Schon gut, reg dich wieder ab …«
»Jedenfalls lag auf dem Tisch eine Tasche mit einem Haufen Geld …«
»Hast du gezählt?«
»Hab mich nicht getraut – wenn jetzt wer reingekommen wäre …«
»Wer soll den reinkommen?«
»Keine Ahnung. Außerdem: Ich konnte doch nichts anfassen wegen der Fingerabdrücke.«
»Ist doch lächerlich! Wer soll denn Fingerabdrücke suchen? Die Frau ist vom Tisch gefallen, weil sie eine Glühbirne auswechseln wollte. Unfall, kein Fremdverschulden. Kann sogar unsere Polizei feststellen …«
»Ja, red du nur! Ich hätte dich sehen wollen in der Situation!«
»Zu blöd. Das hätt ich mir wirklich gern angeschaut …«
»Du hättest ja nicht allein einkaufen gehen müssen.«
»So ein Blödsinn! Das ist nur, weil du immer so im Garten rumtrödelst, es war eh schon spät; die guten Landjäger sind dann beim Scheyer weg …«
»Dann hätten wir halt andere genommen.«
»Ich will aber die Speziallandjäger aus dem Bregenzerwald, die hat halt nur der Scheyer. Und wenn ich ausnahmsweise einmal besser drauf bin, geh ich halt … ist ja jetzt auch nicht zu ändern. Wie lang ist das jetzt her?«
»Eine halbe Stunde vielleicht.«
»Und? War noch irgendwas?«
»Ich hab nichts gesehen. Ist niemand zum Haus gekommen.«
»Schön. Dann warte ich, bis es dunkel ist.«
»Und dann?«
»Geh ich rüber.«
»Wozu denn?«
»Um mich umzusehen, darum.«
»Und du traust dir das zu heute …?«
»Ja, ich spür nichts, keine Angst, es geht mir gut.«
»Wär nur blöd, wenn du dort drüben umfällst.«
»Ach was, das letzte Mal ist Monate her …«
2
Schott mochte keine Katzen. Nicht nur keine Katzen im Speziellen, er mochte überhaupt keine Tiere; halt: Das ist zu allgemein und missverständlich, das rückt ihn gleich in ein schiefes Licht. Schott war kein Tierhasser oder so … nur in einem tierlosen Elternhaus aufgewachsen, Vater Finanzbeamter, Mutter Sekretärin bei der Handelskammer, eine jüngere Schwester, alle vier in einer Vierzimmerwohnung einer staatlichen Siedlungsgesellschaft, Haustiere waren nicht explizit verboten, aber ihre Haltung mit so vielen Auflagen verbunden, dass es einem Verbot gleichkam, wenn man sich nicht auf Kanarienvögel oder Goldhamster beschränkte. Nach der Ansicht von Schotts Vater war Haustierhaltung sowieso eine Tierquälerei, dagegen konnte man schwer etwas sagen, beide Eltern chlorophyllgrün, wie Schott das später nannte, Tiere nur in freier Wildbahn und so weiter; ein Pony bei ökologisch korrekter Haltung in einer tieradäquaten Anlage wäre durchgegangen, aber Schotts waren keine Familie, wo die Tochter eines zum vierzehnten Geburtstag bekommt, dafür fehlte das Geld, obwohl nicht einmal ein Auto vorhanden war. Aber der Traum vom eigenen Haus und eine familientypische Verbissenheit, dieses Traumziel zu erreichen. Es wurde dann auch erreicht, Hilde, die sich natürlich ein Pony gewünscht hätte, wie sie ihrem Bruder viel später gestand, verzichtete wie jeder andere in der Familie von vornherein, äußerte nie den Wunsch danach.
Hatte Schott sich ein Tier gewünscht? Die Frage kam ihm im Lauf der Ereignisse in den Sinn, aber er konnte sich nicht erinnern. Vielleicht, dachte er, wäre alles anders verlaufen, wenn er zu Tieren eine Beziehung gehabt hätte von früher her … eine gesündere. Allerdings wusste er auch nicht, ob seine aktuelle Beziehung zu Tieren, zu Haustieren speziell, ungesund zu nennen war, er mochte sie halt nicht, Haustiere verursachen Kosten, und sie machen Dreck.
Wie dieser Kater.
Der Kater der Frau Leupold strich durch die Siedlung, betrachtete alle Gärten als sein Eigentum, andere Katzen schien es in der Nähe nicht zu geben. Oder er hatte sie vertrieben. Schott erinnerte sich an dem bewussten Tag, den Kater oft gesehen zu haben, immer aus der Ferne, wenn er durch die Hecke in den Nachbargarten verschwand. Er hatte ihn immer nur verschwinden sehen, nie kommen. Der Kater ging, wenn Schott nach Hause kam, wartete hinter dem Haus im Garten, bis Schott sich am Fenster bemerkbar machte oder auf die Terrasse kam. Dann trat er den Rückzug an in Richtung einer der drei Hecken, die das Grundstück nach hinten und auf den Seiten begrenzten. Wegen dieser Hecken hatte es mit den Nachbarn böses Blut gegeben. Für Jahre. Die Hecken entsprachen ökologischen Kriterien, aber nicht den Vorstellungen der Nebensiedler. Brombeer, Hartriegel, dazwischen Eschen und irgendwelche Gewächse, die auf »-dorn« endeten, Schott wusste nicht mehr, welche der Vater angepflanzt hatte und welche von selber gekommen waren. Die drei Hecken bildeten einen dichten Verhau, ein »Paradies für Vögel und Kleinsäuger«, wie der Vater oft betonte, drei grüne Pflanzenwalzen, in der Mitte übermannshoch, denkbar größter Gegensatz zu den geschnittenen Buchenhecken und Thujen der Nachbarn. Die Vögel, die darin nisteten, gingen noch an, was die Leute aufregte, waren die Kleinsäuger, obwohl sie die nie zu Gesicht bekamen; Igel, Mäuse, Wiesel und weiß der Geier, was sonst noch alles – Schotts Hecke blieb ein Ärgernis über den Tod des Vaters hinaus, Schott Sohn dachte nicht daran, am Garten etwas zu verändern, um es etwa den Bünzlis der Umgebung recht zu machen, verwendete den satirischen Begriff, mit dem die nahen Schweizer ihre eigenen Spießbürger verunglimpften, für die Mitsiedler, nannte die ganze Siedlung in Gesprächen mit Kollegen nie anders als »Bünzlihausen«. Er hatte nie gern hier gelebt, in seinen Sturm-und-Drang-Jahren die Gegend gemieden. Als dann auch die Mutter gestorben war, hatte er das Elternhaus übernommen, die längst in Feldkirch verheiratete Schwester ausgezahlt und wohnte seither hier. Aber wenn es so weiterging, nicht mehr lang.
Nein, Schott mochte keine Katzen.
Als er an diesem Herbstabend nach draußen ging, um den Biomüll auf den Komposthaufen zu werfen, erschrak er, als der Kater vor der Hintertür saß.
Sami.
Weiß mit rötlichem Hinterteil und Schwanz und asymmetrischen, ebenso rötlichen Flecken auf dem Kopf. Das Tier miaute nicht, sah Schott aber an und ließ mehrmals einen Laut wie kurzes Krächzen hören, als wolle er eine Krähe nachmachen. Nur viel leiser als bei einer Krähe.
Schott setzte den Biomülleimer ab. Der Kater kam auf ihn zu, strich um seine Beine, entfernte sich wieder in den Garten hinaus. Nach links, auf seine Heimstätte zu, die Villa der Frau Leupold. Dann setzte er sich wieder hin, blickte über die Schulter zu Schott zurück und krähte.
»Was willst du?«, fragte Schott. Der Kater krähte. Das ist vollkommen absurd, dachte Schott, wir führen eine Unterhaltung, obwohl es so etwas gar nicht geben kann; es war eine Szene aus einer dieser idiotischen Tierserien seiner Kindheit, wo ganze Dialoge zwischen Mensch und Tier vorkamen, alles Dressur und Schnitttechnik, die Simulation einer Verständigung zwischen den Kreaturen, die es nicht gab und nicht geben konnte, ein kindischer Trost für Leute, die längst eingesehen haben, dass es nicht einmal zwischen den Menschen so etwas wie Verständigung gab. Bianca fiel ihm ein, mit der er auch nach vier Ehejahren keinen Modus der Verständigung gefunden hatte. Diese Serien haben sie ja auch für Erwachsene gemacht, dachte Schott, die Kinder waren nur der Vorwand.
»Hau ab«, sagte er, nahm den Biomülleimer auf und ging durch den verschneiten Garten zum Komposter. Der Kater folgte ihm. Zwei Meter neben dem Plastikbehälter blieb er sitzen und beobachtete, was Schott dort tat. Schott tat nichts Besonderes; er öffnete die Klappe, leerte den Inhalt des Eimers in die Öffnung, schloss die Klappe. Als er damit fertig war, sich zum Gehen wandte, sah der Kater zur Villa der Frau Leupold hinüber, zu seinem Zuhause. Aber dort war niemand. Alles dunkel.
Schott ging zurück, diesmal lief der Kater vor seinen Füßen in der Schneespur; mehr ein Hüpfen als Laufen, das Tier versuchte die Abdrücke von Schotts Schuhen auszunutzen. Er läuft nicht gern im Schnee, dachte Schott. Da sinkt er bis zum Bauch ein und wird nass. Warum folgt er mir dann zum Komposter?
Der Kater gab Antwort, als sie wieder beim Haus angekommen waren. Auf seine Weise. Er setzte sich vor die Hintertür, legte das Köpfchen in den Nacken und miaute. Ja, es war dieser langgezogene Katzenlaut, aber von einer Intensität, wie ihn Schott nie gehört hatte. Etwas Elementares lag darin, ein Unterton von Verzweiflung – aber das interpretiere ich jetzt rein, dachte Schott, wahrscheinlich hat es mit Verzweiflung nichts zu tun … vielleicht … der Kater schaute wieder zum anderen Haus hinüber. Er will was, dachte Schott. Es hat mit dem Kasten zu tun. Das ist es! Drum schaut er dorthin.
Von irgendwo in seinem Bewusstsein kam das Verständnis für den Kater. Schott staunte. Als verstünde er eine Sprache, die er nie gelernt hatte. Ein Hund würde auf das Haus zurennen, stehen bleiben, sich umdrehen, bellen, wieder herkommen, wieder losrennen und so weiter – bis auch der blödeste Vertreter der Gattung Homo verstanden hätte, was das heißt: Komm mit, ich muss dir was Wichtiges zeigen! So war das in den Tierfilmen. Aber Sami war nicht Lassie. Der Kater verfügte nicht über ein so anthropoaffines Verhaltensrepertoire. Und was heißt schon anthropoaffin, fiel Schott jetzt ein, verhalten sich echte Hunde so wie die Hunde im Fernsehen? Oder haben sie die so dressiert – dieses Bellen, Hin- und Herlaufen, weil wir uns vorstellen, dass der Hund das genau so machen müsste, wenn er uns etwas zeigen will? Ein Hundebesitzer wüsste das natürlich. Vielleicht würden Hundebesitzer Lassie auslachen. Die Hundebesitzer waren in der Minderheit. Auf sie konnte man verzichten – ein interessanter Gedanke, fand Schott, das sollte er verfolgen, recherchieren, konnte ja sein, dass sich da etwas ergab, dass er recht hatte: mediale Erwartungshaltungen, die Verfälschung der Natur; Lassie und Flipper benehmen sich so, wie sie sich benehmen, weil wir glauben, sie müssten sich so benehmen. Aber woher beziehen wir diesen Glauben? Dem müsste man nachgehen … nein, müsste man nicht, fiel ihm ein. Nicht auf diese Weise. Nicht mehr. Solchen Ideen nachgegangen war er jahrelang, hatte Bücher geschrieben, nein, Manuskripte, die niemand … er verdrängte den Gedanken. Konzentration auf das Naheliegende. Er sollte also zur Villa von Frau Leupold. Der Kater Sami wollte das so. Warum? Dafür gab es einen Haufen denkbarer Gründe, kein einziger gefiel Schott. »Dem Frauchen geht es schlecht, ist es das?« Er richtete die Frage an den Kater, der antwortete, indem er Schott um die Beine strich und Laute zwischen Schnurren und Knurren von sich gab. Schott musste lachen. Der Kater sah ihn an. »Also schön«, sagte Schott, »wir gehen rüber, aber vorne auf der Straße, ich kann nicht durch die Hecke durch. Das siehst du doch ein?«
Schnurr, knurr, grummel.
Schott stellte den Eimer ab, ging ums Haus auf die Vorderseite. Der Kater hinter ihm auf dem schmalen Trampelpfad im Schnee. Vorn in der Einfahrt setzte sich der Kater wieder an die Spitze, spazierte auf dem aperen Teil der Straße zum Nachbargrundstück hinüber. Die Villa der Frau Leupold lag im Dunkeln, kein Lebenszeichen.
»Ich sollte umkehren, Kater, weißt du das?« Der Kater reagierte nicht, lief an der Eingangstür vorbei auf die Rückseite.
»Das kann ich nicht machen«, sagte Schott, »so herumschleichen. Ich muss wenigstens so tun …« Er läutete. Niemand kam. Schott trat einen Schritt zurück, rief »Frau Leupold!« Allerdings nicht laut, nur pro forma. Er hatte nicht die Absicht, die Nachbarschaft zusammenzuschreien. Keine Reaktion, natürlich nicht. Er folgte dem Kater ums Haus. Der wartete an der Hintertür, die der Schott’schen Hintertür sogar glich, ein ähnliches Kellertürmodell aus massivem Blech. Mit dem Unterschied, dass in der Leupold’schen Variante unten eine Katzenklappe eingebaut war. Davor saß Sami, der Kater, und blickte Schott an. Akustische Untermalung gab es diesmal nicht, es war auch keine nötig, denn hier handelte es sich um eine sehr einfache Denksportaufgabe: Warum bleibt der Kater vor der Katzenklappe sitzen? – Weil er will, dass der Begleitmensch auch hineinkommt, ergo dessen die Tür aufmacht.
»Du dummes Tier«, sagte Schott, »die ist doch zu, die kann ich nicht aufmachen!« Natürlich: Für Tiere sind alle Menschen gleich, wenn ein Mensch Türen öffnen kann, dann können es alle. Um diesen Irrtum zu demonstrieren, drückte Schott die Klinke nieder. Aber der Kater Sami war gar nicht dumm. Die Tür ging auf. Dahinter war es dunkel.
Er hätte nicht herkommen sollen, das sah Schott jetzt ein. Der Kater hatte ihn dazu gebracht. Irgendwie. Durch diese komischen Laute, durch sein ganzes Wesen. Er war auf den Kater reingefallen. Der schlüpfte durch die offene Tür und verschwand im Dunkeln.
»Frau Leupold!«, rief Schott ins Haus. »Sind Sie da? Der Kater hat irgendwas …« Schott wusste schon, dass er keine Antwort bekommen würde.
Schott war nie in der Villa der Frau Leupold gewesen. Die legte keinen Wert auf Nachbarschaft, man verstand das sogar. Sie wohnte in einer Villa, die Nachbarn in Häusern, ein großer Unterschied; man bedauerte sie, wenn auch nicht offen, dass sie jetzt diese Nachbarschaft ertragen musste – im Rahmen eines Stadtentwicklungsprojekts der sechziger Jahre hatten Kleinhäusler in spe die Gelegenheit bekommen, Gemeindegründe günstig zu erwerben und ihre Häuschen drauf zu bauen. Die Siedlung war im Laufe der Jahrzehnte an die alte Fabrikantenvilla herangekrochen und dort zum Stillstand gekommen, denn Frau Dr. Leupold weigerte sich, ihr Grundstück an wen auch immer zu verkaufen, nicht an Einzelpersonen und nicht an die vier verschiedenen Bauträger, die deswegen an ihre Tür geklopft hatten. Frau Dr. Leupold erfreute sich wegen dieser Verweigerungshaltung einer gewissen Beliebtheit bei den unmittelbaren Nachbarn, denn sosehr der gewöhnliche Häuselbauer das Häuselbauen bei sich selber schätzt, so wenig schätzt er es nebenan; seine Idealvorstellung vom Nachbargrundstück ist eine als Wasserschutzgebiet eingezäunte Wiese und am Horizont ein Staatsforst. Ein Riesengrundstück mit einem alten Kasten, bewohnt allein von einer pensionierten Gymnasialprofessorin, die weder laute Musik hört noch laute Feste feiert, kam diesem Ideal schon recht nahe.
Dies ging Schott durch den Kopf, als er den Lichtschalter gefunden und die Hintertür von innen zugezogen hatte. Der Kater Sami saß schon an der nächsten Tür und schien mit Krächzlauten seine Sicht der Dinge mitzuteilen. Schott verstand nichts davon. Er seufzte. Was nun kommen würde, war ihm klar, er würde eine unangenehme Entdeckung machen, dieselbe nämlich, die der Kater Sami vor ihm gemacht und deretwegen beschlossen hatte, die Hilfe eines anderen Menschen zu holen, das kluge Tier.
Unter regelmäßigen »Frau Leupold!«-Rufen, auf die er gleichwohl keine Antwort erwartete, ging Schott in den vorderen Teil des Hauses, der Kater voran. Dort im Flur verschwand das Tier vom einen Augenblick zum anderen und ließ Schott allein in einem fremden Haus zurück, zu dessen Betreten ihn niemand anders aufgefordert hatte als ein momentan nicht anwesender Kater. Schott stellte sich vor, wie der Schlüssel im Haustor ging und eine sehr verärgerte, dafür aber quicklebendige Frau Dr. Leupold des ihr nur flüchtig bekannten Nachbarn Schott in der Diele ansichtig wurde.
Schott fluchte, schrie »Frau Leupold, sind Sie da?« und sprang die Treppe zum ersten Stock hoch. Wenn er keine Antwort bekam, war er verpflichtet, den ganzen Riesenkasten Zimmer für Zimmer abzusuchen, schuld daran war das Katzenvieh, das ihn hereingelockt und sich jetzt verkrochen hatte, das feige Tier.
All diese Befürchtungen waren gegenstandslos.
Als ersten Raum im ersten Stock betrat Schott das große Esszimmer, dort traf er auf Frau Dr. Leupold, die ihm wegen seiner ungebetenen Anwesenheit keine Vorwürfe machte. Sie sagte überhaupt nichts. Sie lag neben dem riesigen Tisch auf dem Rücken und war tot. Schott fragte noch einmal: »Frau Leupold?«, dann trat er näher und betrachtete das Gesicht, die Augen standen weit offen, der Mund ein wenig, eine Pupille, die linke, schien verengt, aus dem linken Ohr waren zwei oder drei Tropfen Blut aufs Parkett gesickert, die Zeichen eines Schädelbasisbruchs, wie Schott vom Rot-Kreuz-Vorbereitungskurs zu seinem Zivildienst noch wusste. Schott ging in die Hocke, legte zwei Finger an die Karotis der Frau Dr. Leupold und spürte, wie erwartet, keinen Puls.
Schott erhob sich.
Das war ein Schlag, das hier. Kein Schicksalsschlag, der ihn niedergeworfen hätte, sondern ein heimtückischer Rempler, der einen taumeln, das volle Tablett fallen lassen ließ, eine Gemeinheit, ein dummer Streich. Wenn es so etwas wie ein persönliches Schicksal gab – und Schott hatte in den vergangenen sechs Monaten immer weniger Grund, an der Existenz einer solchen Macht zu zweifeln –, dann war ihm diese Macht nicht wohlgesinnt. Auf diese spezielle Art, wie sich Antipathien in Schulen und Internaten herausbilden; ein Reihe idiotischer Streiche und Triezereien, alles harmlos und doch Grundstein lebenslanger erbitterter Feindschaften.
So ein Schabernack war das Auffinden der toten Frau Dr. Leupold, mit der Schott zu ihren Lebzeiten keine drei Worte gewechselt hatte, denn was würde daraus entstehen: endlose Scherereien, vor allem aber Behördenkontakte, die Schott vor allen anderen Kontakten besonders verabscheute. Jetzt müsste er eine solche Behörde anrufen, welche eigentlich? Zuerst die Polizei, dann seine Anwesenheit im Haus erklären … der Kater hat sich so seltsam benommen – welcher Kater? Wo war der überhaupt? Sollte er ihn suchen? Schott spürte, wie ihn eine gewisse Panik ergriff. Er begann irrational zu werden. Er sollte nicht den Kater suchen, er sollte die Polizei anrufen. Verdammte Schweinerei.
Er rief nicht an. Stattdessen ging er von Zimmer zu Zimmer in dem großen Haus, besuchte einen Raum nach dem anderen. In jedem spazierte er ein wenig herum, betrachtete die Möbel, die Bilder an den Wänden.
Man muss das verstehen.
Schott ging es nicht gut. Er hatte Sorgen. Job verloren. Vor sechs Monaten. Umstrukturierungsmaßnahmen bei der Zeitung, für die er fünfundzwanzig Jahre gearbeitet hatte. Fette Abfindung, das schon. Kein tiefes Loch oder sonstige Psychogeschichten, das nicht. Aber bis zur regulären Pension fehlten … er vergaß immer, wie viele Jahre, das war lächerlich, das war ja keine höhere Mathematik, er verdrängte nur den Gedanken, denn wenn er sich die Zahl endlich merken würde, dann würde er seine Abfindung durch ebendiese Zahl dividieren und das Ergebnis noch einmal durch zwölf, und heraus käme eine absurd niedrige Zahl, die wahrscheinlich nur drei Stellen hätte … davor hatte er Angst, vor diesem fiktiven Monatseinkommen, von dem er nicht würde leben können. Leben war noch das Wenigste; was er außerdem von dieser Summe nicht würde bestreiten können, war die Rate für das Haus. Bianca hatte bei der Scheidung auf das Haus verzichtet – gegen eine anständige Ablöse. Der gut verdienende Schott blieb im Haus und zahlte lieber mehr an die Exfrau. Keine weise Entscheidung.
Schott hatte das Unglück nicht auf sich zukommen lassen, sondern versucht, dagegenzusteuern. Er suchte eine andere Stelle, fand aber nur schlecht bezahlte Freelancer-Jobs für Werbebüros. Immerhin, er fand sie. Und verlor sie wieder: lauter kleine Sticheleien des Schicksals. Noch schlimmer auf der zweiten Schiene. Er hatte versucht, literarische Arbeiten unterzubringen. Viele und oft. Einen Roman, ein Dutzend Erzählungen. Zwei davon waren gedruckt worden, in einem regionalen Literaturmagazin, das sich eines gewissen Ansehens bei den kulturell Interessierten erfreute. Jedenfalls bestätigten das alle, die er danach gefragt hatte. Außer diesem Ansehen, an dem er teilhaben konnte, gab es ein bescheidenes Abdruckhonorar. Mit den Früchten seiner literarischen Bemühungen hatte er, wenn er alles zusammenrechnete, drei oder vier Mal fein essen gehen können, damals noch an der Seite Biancas.
Vom Roman waren ihm ein Ordner mit Ablehnungsschreiben und ein tiefer Hass auf all jene geblieben, die mit der Literatur professionell umgingen, gleich, ob als Verfasser, Lektoren, Verleger oder Kritiker. Die gehörten, dachte er, alle erschossen. Ohne Ansehen der Person. Die Welt wäre danach ein besserer Ort.
Aber das waren nur Träume. Die Realität sah anders aus. Er lief in einem fremden Haus herum, in dessen erstem Stock die tote Hausbesitzerin lag, und je länger er das tat, herumlaufen nämlich, desto nachdenklicher würden die Blicke der Polizisten sein, die sie auf ihm ruhen ließen. Oder nicht? »Wann, sagten Sie, haben Sie die Katze bemerkt, Herr Schott?« – Diese Zeit der sozusagen ersten Kontaktaufnahme mit Sami konnte er ja beliebig nach hinten schieben; bis fünf Minuten vor den tatsächlich erfolgten Anruf bei der Polizei. Fünf Minuten durfte man sich nach Entdeckung der Leiche schon Zeit lassen, von wegen Schock und so weiter.
Als er damit angefangen hatte, wusste er, dass er erst aufhören konnte, wenn er fertig war – mit dem Besichtigen. Wenn er alles gesehen hatte. Jedes Zimmer, jede Abstellkammer im ganzen Haus. Es war eine Gründerzeitvilla. Das dauerte. Auch deshalb, weil die Zimmer so vollgeräumt waren. Haufenweise Stilmöbel, Truhen, Schränke. Die ließ er unberührt. Wenn er erst damit anfing, Schubladen aufzuziehen, kam er vor dem Morgengrauen nicht mehr aus dem Haus.
Je länger seine Besichtigungstour dauerte, desto mehr wuchs der Ärger. Über sich selbst. Über die Situation, die ohnehin bizarr genug war. Die er mit seinem Verhalten verschlimmerte. Was suchte er? Das wusste er nicht. Nichts Bestimmtes. In dem Haus war alles so, wie er sich das in etwa vorgestellt hatte. Die materiellen Überreste von hundert Jahren provinzieller Industriedynastie; am Ende des Jahrhunderts war es steil bergab gegangen, das konnte man nicht übersehen. Das Haus bot keine Überraschungen.
Bis auf den Keller.
Der war die letzte Station seines Rundgangs. Neben dem Heizungskeller gab es noch mehrere große Räume. Einer enthielt Gerümpel und Regale voller Einmachgläser. Alle leer. Die Frau Leupold hatte die Lust am Einkochen von Obst schon lang verloren. Warum, wurde klar, als er einen anderen Kellerraum betrat. Frau Leupold stellte jetzt wohl anderes her: In der Mitte ein schwerer Tisch, an dem ein Dutzend Personen Platz gehabt hätten, nur gab es keine Stühle. Auf dem Tisch Glasapparaturen, Flaschen, Schraubgläser, eine Küchenwaage, ein Mikroskop. An den Wänden Schränke, in einem Putzzeug, Feuerlöscher und ein weißer Arbeitsmantel, im anderen auf Stellagen vielfarbige Plastikbehälter mit Schraubdeckeln und Etiketten mit kurzen Bezeichnungen, aus Buchstaben und Zahlen, die Schott nichts sagten.
Ein Labor. Die Frau Professor Leupold betätigte sich also auch in ihrer Pension als Chemikerin. Hatte sich betätigt. Und war dabei nicht, wie es der gemeinen Erwartung entspräche, in die Luft geflogen, sondern ganz ordinär vom Tisch gefallen. Beim Glühbirnenwechseln. Die Chemie war nicht so gefährlich, wie man glauben mochte. Die Dinger auf dem Tisch sahen harmlos aus. Nirgendwo brodelten giftfarbene Flüssigkeiten, keine geheimnisvollen Dämpfe quollen aus gläsernen Röhren, die Apparaturen waren alle leer und blitzblank. In der Luft lag ein Hautgout aus Lackverdünner und einem Putzmittel mit etwas zu aufdringlichem Zitronenaroma.
Und noch etwas gab es, das ihm nur auffiel, weil es nicht herpasste. Eine geblümte Plastikmappe auf einer Ecke des Labortischs. Mit Reißverschluss. Der stand offen, man hätte ihn zuziehen können. Mit Mühe, die Mappe war vollgestopft.
Mit Geld.
Schott nahm die Tasche, trug sie zu dem kleinen Schreibtisch an der linken Wand und schüttete sie aus. Alles Hunderter und Fünfziger, auch ein paar Zwanziger. Sonst war nichts drin. Nur Geld. Er setzte sich. Das meiste in Bündeln verschiedener Stärke, mit farbigen Gummiringen zusammengehalten. Hunderttausende. Ganz grob, vielleicht mehr. Er legte alles aufeinander, unten die Gummiringbündel, die dicken zuerst, dann die dünneren, obenauf die Einzelscheine. Wenn man das Geld so ordnete, war es gar nicht so viel, volumetrisch. Ein kleiner Stoß. Die Tasche hatte nur so voll ausgesehen, weil jemand Scheine und Bündel ohne Plan hineingestopft hatte. In der Eile. Oder weil derjenige ein schlampiger Mensch war. Schott war nicht schlampig. Alles hatte in seiner Kleidung Platz. Die Bündel steckte er unters Hemd in den Gürtel, schnallte ihn um ein Loch enger. Die Einzelscheine brachte er im Jackett und den Hosentaschen unter. Als alles verstaut war, fiel ihm auf, dass er seine Geldbörse gar nicht verwendet hatte. Es ging eben auch so, wenn man sich ein bisschen Mühe gab. Der Gürtel spannte. Ich sollte unbedingt fünf Kilo abnehmen, dachte Schott. Der Kater übrigens auch. Ein fettes Tier. Der Kater Sami stand wieder in der Tür und schnurrte.
»Mit der Fresserei ist jetzt Schluss«, sagte Schott und drohte dem Tier mit wackelndem Zeigefinger, während er sich vom Schreibtisch der verblichenen Frau Leupold erhob. Sami gab ein krähendes Geräusch von sich, das man nach Belieben als Zustimmung, Einwand oder skeptischen Kommentar deuten konnte, im Sinne von: Wir werden ja sehen. So fasste Schott die Äußerung des Katers auf.
»Ja, wir werden sehen, Kater!«, sagte er. »Wir gehen interessanten Zeiten entgegen.«
Er löschte das Neonlicht und verließ den Raum, den Keller und das Haus. Draußen war es dunkel. Schott zog die Tür hinter sich zu, der Kater war schon vor ihm hinausgeschlüpft. Der Kater ging voran. Erst die Einfahrt, dann die Straße, endlich der weit kürzere Weg zum Schott’schen Einfamilienhaus. Sami, der Kater, schien zu wissen, wohin die Reise ging.
Als Schott in seinem eigenen Wohnzimmer saß, nachdem er Jacke und Schuhe ausgezogen, dem Kater eine Untertasse mit aufgeschnittener Lyoner Wurst in der Küche hingestellt und damit den neuen Fressplatz festgelegt hatte; nachdem er endlich die Geldbüschel aus der Hose genestelt und auf dem Couchtisch aufgetürmt hatte – da erst kam ihm der Gedanke, ob er nicht vielleicht verrückt geworden sei, aber schon komplett verrückt, nicht nur so »borderline«, oder wie das hieß. Er war in ein fremdes Haus eingedrungen und hatte im besagten fremden Haus einen Haufen Geld gestohlen. Und er würde, damit das klar ist!, jeden verdammten Cent davon behalten. Er brauchte das Geld. Jeden einzelnen Cent davon. Er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Buchstäblich. Wenn es diese anderen Fälle gab, wo jemand zur falschen Zeit am falschen Ort war und von einer – was weiß ich: Straßenwalze überfahren wird, dachte er, dann muss es zum Ausgleich auch Fälle wie meinen geben, wo man dem Gegenteil einer Straßenwalze begegnet. Dem Glück. Frau Leupold hatte für das Geld keine Verwendung mehr. Er aber schon. Am Rande seines Bewusstseins tauchten Fragen auf, woher die Frau Leupold dieses Geld hatte, wie es mit dem Labor zusammenhing, aber er verscheuchte sie.
»Schluss!«, rief er in sein leeres Haus, »das hat später noch Zeit …«