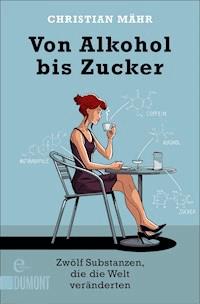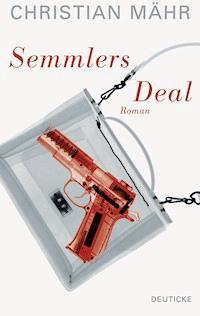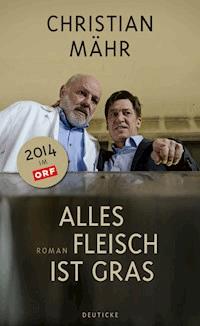
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Zsolnay, Paul
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Durch einen Sturz über die Stiege stirbt Roland Mathis, der widerwärtige Schnüffler, der Anton Galba und seine heimliche Geliebte mit ihrem Verhältnis erpresst hatte. In Panik lässt Galba, Leiter der Abwasserreinigungsanlage Dornbirn, die Leiche im Häcksler verschwinden. Der den Fall untersuchende Polizist Nathanael Weiß verdächtigt Galba von Anfang an. Allerdings gibt es auch in seinem Umfeld einen Widerling, den er gerne loswerden würde. Galba muss notgedrungen mitmachen, doch für Weiß ist das erst der Anfang: Es gilt, Schädlinge der Gesellschaft auszurotten. Christian Mähr erzählt in diesem bitterbösen Krimi aus Österreich von Moral und Mordlust in der Kleinstadt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 544
Veröffentlichungsjahr: 2010
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Deuticke E-Book
Christian Mähr
Alles Fleisch ist Gras
Roman
Deuticke
»Alles Fleisch ist Gras« wurde von der Allegro Film in Koproduktion mit dem ORF, gefördert vom Fernsehfonds Austria und dem Land Vorarlberg als ORF-Landkrimi verfilmt.
ISBN 978-3-552-06132-3
Alle Rechte vorbehalten
© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2010
Umschlaggestaltung: Hauptmann & Kompanie Werbeagentur, Zürich, Kim Becker, unter Verwendung eines Fotos von © Allegrofilm/Petro Domenigg
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen
finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Datenkonvertierung E-Book:
Kreutzfeldt digital, Hamburg
1
Erst als er fertig war, fiel ihm auf, wie lächerlich das aussah, was sie hier machten; das blanke Hinterteil vor ihm, der hochgeschlagene Rock – und er selber mit den Hosen, die sich um die Knöchel wulsteten, dabei hatte er sich vorgenommen, nie in eine Situation zu geraten, in der er mit knöchelverhüllendem Hosenwulst hinter einer gebückten Frau stand, er hasste dieses Bild, es zerstörte alles Ernste am Sex, machte die Szene zu einer Witzzeichnung, es fehlte nur die Unterschrift, irgendein blöder Spruch.
Ein Hochsitz an einer Waldlichtung, sie kniete vor ihm auf der Bank, schaute in die verkehrte Richtung, in den Wald hinein und umklammerte immer noch mit beiden Händen einen Ast der Fichte, an die der Hochsitz gebaut war.
Jetzt war es zu spät, der Schaden angerichtet, das einzig nicht lächerliche Detail ihre kleinen, unschuldigen, nackten Füße, denen er nie widerstehen konnte; das war einer ihrer Codes, die sie sich angewöhnt hatten – hatten angewöhnen müssen in der Situation im Betrieb – wenn sie sich wie in Gedanken unter dem Schreibtisch die Sandalen auszog, hieß das, sie hatte Lust, mäßig bei einer, unbändig bei allen beiden, er beobachtete sie den ganzen Tag auf solche Signale und wusste, wie er den Abend zu organisieren hatte. Bei diesem Spaziergang war sie es gewesen, die ihn überrumpelt hatte, sprang vom Waldweg ins Dickicht, lachte ihn über die Schulter aus, weil er ihr so schwerfällig folgte, dann fasste sie einen kahlen Fichtenstamm, den einen Holm der Leiter, die schon zwei Meter weiter oben an der Öffnung des Holzhäuschens endete, schlüpfte aus den Sandalen und stieg die Sprossen hinauf, ohne ein Wort zu sagen. Er wartete, bis sie oben war, kam erst dann nach, um eine Überlastung zu vermeiden, dazu war er zu sehr Ingenieur, wusste, wie diese Hochstände gezimmert wurden, zwei Nägel durch die kurzen Rundhölzer, die als Sprossen dienten, das war schon die ganze Holzverbindung, unglaublich, dass nicht mehr passierte, wenn die übergewichtigen Jagdgäste hinaufkletterten.
Roland Mathis war nur dreißig Meter weit weg, höchstens dreißig. Als er um die Biegung des Waldwegs kam, waren sie auf dem kleinen Bildschirm verschwunden. Er blieb sofort stehen, hielt den Atem an. Es war fast völlig dunkel, nur im Apparat leuchtete ihm der Weg grünlich vor dem Auge, wenn er durchs Okular spähte, der Waldweg, die Bäume, der Hochsitz direkt am Weg, rechts an eine Fichte gebaut, jetzt sah er sie, da waren sie ja, von ihm nur der Rücken zu sehen, ihre Arme, mit denen sie ihn umschlang. Roland Mathis hatte ideale Sicht. Dennoch wechselte er auf die linke Seite des Weges, da gab es einen Baumstumpf, wo er das Gerät auflegen konnte. Er blickte direkt in die seitliche Öffnung des Hochsitzes, die Tür hatten sich die Jäger gespart; es gab auch welche mit Türen und Fenstern, wegen der Kälte wahrscheinlich, der hier war offen, behelfsmäßig, da hatte er Glück gehabt, dass dieses Ding auf der Seite offen war und nicht so weit oben, höchstens drei Meter. Auf der anderen Seite begann eine Lichtung, die vom Hochsitz aus beobachtet werden konnte, schlau eingerichtet, dachte er, mit minimalen Mitteln größter Nutzen. Er wurde ganz ruhig, was ihn wunderte. Befürchtet hatte er, wenn es endlich so weit war, herumzunerveln, den Zwischenring zu verlieren, die Aufnahmen zu verhauen, nichts davon. Wenn die dort oben weitermachten, wie er es erwartete, und nicht nur rumschmusten, dann war er am Ziel.
Am Anfang schmusten sie rum, dann nahmen die Dinge ihren Lauf. Wie immer. Denken und Planen waren nicht nötig, es herrschte eine andere Zeit, eine andere Ordnung des Seins, es gab keine Zweifel und keine Probleme, vor allem aber keine Skrupel. Sie wimmerte und schrie, er dachte nicht an den Hosenwulst, er dachte gar nichts. Fast nichts. Man wird es hören, dachte er allerdings, man kann sie hundert Meter weit hören. Damit verband sich keine Befürchtung oder Sorge. Man kann sie hören und wenn schon … dieses Aus-der-Zeit-Fallen genoss er am meisten, er war süchtig danach, so sollte das Leben sein, dachte er, nicht immer, beileibe nicht, das würde niemand aushalten als Dauerzustand, aber in Portionen, abgemessenen Dosen war es unverzichtbar … nein, nicht süchtig, falsches Wort, süchtig ist man nach Drogen, aber das hier, dieser Sex mit ihr, das war … das war keine künstliche Substanz, sondern die Essenz des Lebens. Genau! Jeder sollte das haben, dachte er, jeder und jede. Es begeistert uns, natürliches Elixier, das die Evolution vorgesehen hat, um uns den Aufenthalt auf diesem Planeten zu ermöglichen; wer es nicht hat, der kümmert dahin, stirbt zwar nicht gleich, das nicht, aber mit Verzögerung dann eben doch, woher kommen denn der ganze Krebs und die Herzgeschichten? Von der ungesunden Lebensweise und dem Cholesterin, ja, wahrscheinlich! Alles Lügenmärchen. Ungesunde Lebensweise stimmt sogar, aber nicht so, wie es die Ärzte und die Pharmaverbrecher den Leuten einzureden versuchen, dachte er, die nur ihre Mittelchen verkaufen wollen, die ihm dann die Scherereien der biologischen Stufe machten, sondern ungesund, weil ohne Sex, das war das ganze Geheimnis …
Er wusste, während ihm diese Gedanken durch den Kopf gingen, dass sie überzogen und pubertär waren und er sie nie jemandem offenbaren konnte, auch ihr nicht. Besonders ihr nicht. Er hätte sich angehört wie ein Fünfzehnjähriger nach dem ersten Sex mit einer womöglich deutlich älteren Partnerin, total überwältigt. Es stimmte ja auch. In gewisser Weise war es seine erste sexuelle Erfahrung. Die erste richtige. Alles davor nur Surrogat, auch mit Hilde, leider, aber es war so, daran konnten zwanzig Jahre Ehe nichts ändern und nicht zwei Töchter und alles …
Er hatte nicht gewusst, dass Sex so sein konnte. Er beugte sich vor, streichelte ihren Rücken und küsste sie zwischen die Schulterblätter. Langsam zog er sich zurück, sie seufzte; der Laut glich dem beim Vorstoß, er fand das seltsam und faszinierend, wenn man die beiden Seufzer aufnähme, dachte er, nur diese Seufzer, könnte niemand entscheiden, welcher vom Anfang stammte und welcher vom Ende. Als ob es gar keinen Unterschied gäbe, was nur daran liegen konnte, dass es Anfang und Ende gar nicht gab, weil das nur zwei Seiten derselben Medaille waren und das Eigentliche, das, was sie beide verband, Helga und ihn, keinen Anfang hatte und kein Ende, also ewig währen würde.
»Woran denkst du?« Sie hatte sich aufgerichtet und umgedreht, den Fichtenast losgelassen, natürlich; wieso verdorrte der nicht im selben Augenblick? »Du denkst wieder, gib’s zu!« Mit einer trägen Geste entsetzlicher Laszivität strich sie den Rock glatt, setzte die Ellbogen auf die Brüstung, lehnte sich nach hinten, ohne sich auf die Bank zu setzen, auf der sie breit gespreizt gekniet hatte, er sah es noch vor sich, es war erst zwei Minuten her, aber im selben Augenblick kam ihm das, was er mit eigenen Augen gesehen hatte, wie ein Trugbild vor, eine fotorealistisch am Computer zusammengebastelte Montage, dazu brauchte man nicht nach Hollywood, das brachte jeder daheim zustande; es hatte nur nichts mit ihm zu tun. Es ist zu schön, dachte er, deshalb kann ich es nicht glauben, der Verstand weigert sich, die Erinnerung als echt einzustufen, das muss ein Fake sein, sagt der Verstand, das gibt es nicht.
»Woran denkst du wieder?«, insistierte sie, löste sich von der Brüstung, legte ihm die Hände an den Hals, zog ihn mit sachter Bewegung näher, sah das Wasser in den Augen glänzen, bedeckte sein Gesicht mit Küssen. »Du sollst nicht denken, nicht traurig sein, es soll doch schön sein, nicht traurig …«
»Ich bin nicht traurig«, flüsterte er.
»Aber du weinst doch …«
»Weil ich glücklich bin …«
Sie umarmte ihn. Dieses Reden danach hatte sich so eingespielt; sie erwartete auf die Frage: Woran denkst du? keine Antwort. Es war kein Text, an den sie sich hätten halten müssen, nur ein Set bestimmter Sätze und Handlungen, immer ähnlich, immer eine Beschreibung überirdischen Glücks. Sie hatten das nicht geplant, alles ergab sich im Lauf der Zeit. Manche Worte hatten einen Nebensinn, denken war so ein Codewort während der Arbeit, wenn sie ihn bei der Diskussion eines technischen Problems fragte: Wir sollten doch noch eine O2-Bestimmung machen, nur um sicherzugehen – was denkst du? Dann antwortete er ungefähr: Ich denke, das ist eine gute Idee, oder etwas Ähnliches. So konnte es noch eine Weile weitergehen mit verschiedenen Verbindungen von denken. Mitdenken, vordenken, nachdenken. Und niemandem, der sonst dabei war, fiel etwas auf, obwohl sie sich kaum noch das Lachen verbeißen konnten. Oder weinen.
»Wenn ich an den Sandabscheider denke, könnte ich weinen«, hatte er heute in der Sitzung gesagt und auf die überraschten Blicke der anderen von der Unvernunft der Leute zu schwadronieren begonnen, was sie alles ins Klo werfen und so weiter, eben gestern habe er einen Regenschirm aus dem Sandabscheider gezogen … Die Rede war völlig wirr, wurde nur deshalb nicht höhnisch kommentiert, weil er der Chef war; dass ein Schirm in einem der Abscheider steckte, kam schon vor, der stammte dann aber sicher nicht aus einem Klosett.
Nur Helga hatte ihn nicht angesehen, auf die Tischplatte im Besprechungszimmer gestarrt, aber alles richtig registriert und am Nachmittag eine ihrer Sandalen »verloren«, die rechte, zwei Hüpfschritte mit dem anderen Fuß zurück, den nackten rechten angewinkelt hochgehalten. Um den Laborboden nicht zu berühren, bis sie wieder in ihre Sandale geschlüpft war. Um ihm zu zeigen, dass sie seine Frage verstanden und gleichzeitig beantwortet hatte. Ja, sie hatte Lust, ja.
Sie trafen sich immer am Abend. Weit außerhalb der Anlage an bestimmten Punkten im Wald oder im Ried. Dass die Anlage aus offensichtlichen Gründen weit außerhalb der Stadt lag, erwies sich als Vorteil; das Gelände rundherum war unübersichtlich. Wäldchen, Gebüsche, Riedflächen, in denen der Wachtelkönig brütete und ein paar andere, die auf roten Listen standen, weshalb man große Teile hatte unter Naturschutz stellen müssen, außerdem nach Brüssel melden wegen der europäischen Bedeutung und so weiter. Für Leute, die Ehebruch begehen wollen, ist das ideal, dachte er oft. Wenigstens im Sommer. Was würden sie im Winter tun? Aber jetzt war Sommer. Erst Sommeranfang. Juni. Dieses Wunderbare mit Helga hatte im April begonnen.
Outdoor. Das war der Vorteil, dachte Roland Mathis. Diese Vorliebe der beiden für die freie Natur. Indoor wäre ein Problem gewesen. Dort war es schon auch möglich, keine Frage, die Profis machten es ja auch, aber er war kein Profi. Er war auf diesem Sektor Amateur. In geschlossene Räume einzudringen war außerdem strafbar, und wie er anders zu etwas Unwiderlegbarem kommen sollte, als eben in geschlossene Räume einzudringen, konnte er sich nicht vorstellen; schön, die Detektive installierten Minikameras in irgendwelchen Zimmern, aber diese Zimmer mussten sie zu diesem Behufe ja vorher betreten haben, oder? Darüber redete nie jemand, alle schauten nur auf die Fotos. Also musste man, um eine Übertretung zu beweisen, selber eine begehen, das widerstrebte Roland Mathis in der Tiefe seines Herzens, das konnte er nicht ausstehen. Überhaupt Übertretungen. Er war kein Jurist, Gott bewahre, das waren sowieso die Schlimmsten, die Rechtsverdreher, aber was der Herr Diplomingenieur Galba hier abzog, das war sogar nach den Grundsätzen des linksfaschistischen Systems, in dem sie alle zu leben gezwungen waren, nicht in Ordnung, da hatte sich ein Rest natürlichen Volksempfindens aus anderen, besseren Zeiten in den Paragraphen gehalten; das hatten die Verderber übersehen, die Korrumpeure; Unzucht mit Abhängigen oder so ähnlich. Freilich würde sich der Herr Diplomingenieur herausreden, von wegen, sie sei ja gar nicht abhängig, sondern eine erwachsene Frau, man solle sie doch fragen, ob er sie etwa gezwungen habe, und so weiter und so fort, Gewäsch, das ihm aber alle glauben würden, das war auch klar. Weil die Pest schon sehr weit in den Volkskörper eingedrungen war, nicht im physischen, wohl aber im seelisch-geistigen Sinne … Er wischte sich mit dem blaukarierten Taschentuch den Schweiß von der Stirn. Er war erschöpft. Physisch war das keine große Sache. Am Boden knien und Fotos machen, aufgestützt auf dem Baumstumpf. Über dreißig Fotos. Also doch die Aufregung. Adrenalin. Verständlich. Hatte er ja noch nie gemacht, so etwas. Er zwang sich, zu kontrollieren, ob er alles beieinander hatte. Am liebsten wäre er gleich weggerannt, tödlicher Fehler, er konnte im Dunkeln überhaupt nicht rennen und musste auch noch leise sein; wenn er auch nur auf einen dürren Zweig stieg, würden sie es hören, so nah war er dran. Nach der postkoitalen Phase würden die zwei denselben Weg zurückgehen, das war zu erwarten; er zog sich zurück, so schnell er konnte, den Apparat vorm Gesicht. Der Restlichtverstärker aus DDR-Beständen war ein älteres Modell, deshalb konnte man es ja auch kaufen, verhältnismäßig groß, wie eine Super-8-Kamera, dazu gedacht, von einem Wachturm aus in aller Ruhe die Umgebung auszuspähen; aber damit konnte man unten auf dem Boden niemanden verfolgen, das Gerät hatte ein Positivelement, eine achtfache Vergrößerung, der optische Weg brauchte Platz, er hätte etwas ganz Kurzes gebraucht, zum Anschnallen an einen Helm, wie es die Marines haben – aber das gab es nicht zu kaufen, und im Netz in dunklen Kanälen zu forschen, wagte er nicht. Bei der allgemeinen Terrorhysterie wäre es sehr unklug gewesen, in ein Suchraster zu geraten – »Wofür haben Sie das denn gebraucht, Herr Mathis? – Ach, rein privat, sagen Sie? Das glauben wir nicht. Wir haben uns nämlich Ihren Computer angesehen …« Das durfte er nicht riskieren.
Die EOS 350 an den RLV zu montieren, war überraschend kompliziert gewesen; er hatte sich ein Zwischenstück drehen müssen; die Scharfstellung ging einigermaßen, auf der Mattscheibe sah es grauenhaft aus, mit ein bisschen Bildbearbeitung dann aber doch ganz passabel, er hatte an Hirschen geübt, hier ganz in der Nähe. Zum Fotografieren war die achtfache Vergrößerung wieder gut.
Langsam, ganz langsam erfüllte ihn ein Hochgefühl. Dreimal schon hatte er es versucht, heute war es gelungen. Beim ersten Mal kam er mit dem RLV noch nicht zurecht; es war schwierig, das Ding vors Gesicht zu halten und dabei zu gehen; man sah nicht, wo man hintrat. Auf dem Forstweg noch praktikabel, aber als sie ins Unterholz abbogen, war es aus. Er wollte keine Verletzungen riskieren. Oder dass der Apparat bei einem Sturz Schaden nahm.
Beim zweiten Mal ging es schon besser, er konnte ihnen in großem Abstand auf einem schmalen Pfad folgen, dann verlor er sie aus den Augen, sie hatten sich ins Ufergebüsch der Ach zurückgezogen, durch das Unterholz kam er nicht, ohne Geräusche zu erzeugen, er war umgekehrt. Beim dritten Mal waren sie mit ihrem Toyota Aygo weggefahren, er verzichtete auf die Verfolgung, davon hatte er keine Ahnung; nur so viel war ihm klar, dass man eine Überwachung nicht mit einem einzigen Auto machen konnte. Aber sonst hatte er niemanden. Er war allein. Wie immer war er allein.
Ein einziges Mal in seinem Leben hatte er das Gefühl gehabt, es könne etwas werden. Mit einer Frau, einer jungen Frau. Denn Helga strahlte etwas aus … etwas Reines, was ihm bei anderen Frauen nie begegnet war, was seine Mutter gehabt hatte, sonst aber niemand. Diese Helga war ihm freundlich erschienen, ja, richtig: erschienen war sie ihm; er hätte an einen Engel denken können. Wenn er den jüdisch-christlichen Ballast nicht längst über Bord geworfen hätte. Und auch jetzt noch … Sie vögelte mit dem Herrn Diplomingenieur, das hatte er eben fotografiert, über dreißig Mal, aber was hieß das schon? Es hieß gar nichts. Die Frauen sind so: Es ist ihnen nicht gegeben, der Verführung zu widerstehen, es ist biologisch in ihnen angelegt, geschwängert zu werden, Mutter zu werden, tief eingewurzelt im Rassengedächtnis der Frau, seit Äonen ihre Bestimmung: der Wille zur Hingabe an den Mann, an den Herrn. Dafür konnte sie nichts. Das war ein Punkt, den die Kameraden im Forum oft nicht verstanden und richtig einzuschätzen wussten – viel Frauenhass sammelte sich da an, aus Enttäuschungen, persönlichen Erfahrungen. Und tatsächlich konnte man ja am Verhalten der Frauen irre werden, wenn man nicht genau hinsah und die Sache bis zum Ende durchdachte: das Kokettieren, das Unzuverlässige, vordergründig Falsche, ja Bösartige diente doch nur dazu, der Aufgabe der Art- und Rassenerhaltung zu entsprechen: den Besten zu wählen aus den Vorhandenen. Unbewusst machten sie das, es brauchte sie keiner zu lehren. Aber eben bei den Vorhandenen lag der Hase im Pfeffer. Da waren eben neuerdings viele vorhanden, die gar nicht hergehörten, völkisch und sogar im alten Europa auch schon rassisch. Aber dieses Anderssein, das Fremde, vermochte die Frau nicht aus Eigenem zu erkennen, im Gegenteil: Alles, was an einem Manne anders war, weckte ihr instinktives Interesse als Zeichen einer möglichen vortrefflichen Erbanlage. Wohlgemerkt: innerhalb des eigenen völkischen, rassischen Kreises, der in Frage kam; diesen Kreis rein zu erhalten, war Aufgabe der Männer; die Natur hatte hier ganz einfach eine Aufgabenteilung vorgenommen. Den Männern oblag es, sicherzustellen, dass nur Geeignete zur Verfügung standen, den Frauen oblag dann die Auswahl aus diesen. Erst mit dem Gift des jüdisch-christlichen Monotheismus hatte diese andere Praxis Einzug gehalten, die Praxis der Gleichmacherei, die Praxis des Bastardismus. Vermischung hieß die Devise auf allen Ebenen der Gesellschaft. Möglichst viele möglichst bunt gemischte Bastarde sollten erzeugt werden. Es war ja kein Zufall, dass dieser Herr Diplomingenieur ausgerechnet Galba hieß; dass eben dieser Herr den Leitungsposten innehatte. Und dass eben er jene Helga verführte, die dem nichts entgegenzusetzen hatte, das Fremdartige nicht zu erkennen vermochte – mit der seiner Art eigenen Schlauheit hatte sich Galba genau das richtige Opfer ausgespäht, mit seiner schalen Weltläufigkeit und Angeberei umgarnt. Natürlich war sie ihm erlegen, glaubte alles, was er ihr erzählte, weil sie arglos war: ein Erbteil auch dies, die angeborene Güte der nordischen Frau.
Aber damit würde es nun ein Ende haben. Roland Mathis hatte nun Gelegenheit, das Reden auf den Versammlungen, das Schreiben in den einschlägigen Foren gegen die Tat zu tauschen. Das würde er tun. Schon am nächsten Tag.
*
Outdoor. Der Juli gehörte ihnen, August, September. Danach würde er sich etwas überlegen. Eine Lösung finden. Er oder sie, daran hatte er keinen Zweifel. Sie kamen aus demselben Stall, beide Techniker, dachten lösungsorientiert. Er hätte sie vor zwanzig Jahren kennenlernen sollen. Aber das wäre ja nicht gegangen, vor zwanzig Jahren ging sie noch zur Schule, er war ihr nicht begegnet, dafür Hilde, die hatte er nach ausgedehnter Verlobungszeit, wenn man das so nennen wollte, geheiratet. Da war er schon dreißig gewesen. Seine Eltern wollten Enkelkinder. Sein Vater war Zahnarzt, aber nur, weil er im letzten Moment, wie er selber oft erzählt hatte, darauf gekommen war, dass er die Belastungen des eigentlich angestrebten Chirurgenberufs nicht ertragen würde; vom einzigen Sohn erwartete er, diese Scharte auszuwetzen und ein richtiger Mediziner zu werden, also Chirurg. Es ging nicht ums Geld, sondern ums Renommee, die interne medizinische Werteskala; schon während der Gymnasialzeit hatte sein Vater immer wieder davon gesprochen, wie das sein würde, wenn sein Sohn die erste Operation allein durchführen würde und so weiter … Den Sohn zog es zur Technik, Medizin interessierte ihn nicht, keine ihrer Sparten. Der Vater hatte dann nachgegeben, so schnell, dass es den Sohn, der auf einen langen Kampf eingestellt war, überrascht hatte wie nichts im Leben bis zu diesem Zeitpunkt. Daraus entstand ein diffuses Scham-, fast ein Schuldgefühl, auch, weil als Studienort Wien akzeptiert wurde statt der vom Vater bevorzugten Stadt Innsbruck, wo dieser über zahlreiche Verbindungen verfügte, im CV natürlich, was der Sohn hätte alles nützen können, aber ausschlug, nicht weil er politisch links gewesen wäre, sondern weil ihn der Kartellverband genauso wenig interessierte wie sonst alles Politische. Dann wegen der Zweizimmerwohnung, die im 15. Bezirk gekauft wurde, renovierter Altbau im vierten Stock in der Guntherstraße. Und wegen des Geldes. Zu einer Zeit, da ein großer Teil der Studentenschaft sich schon in Jobs verzetteln musste, um den Lebensunterhalt zu verdienen, residierte Anton Galba nicht nur in einer eigenen Wohnung, er erhielt auch regelmäßige Überweisungen. Großzügige. Er brauchte nicht zu jobben, nicht einmal in den Ferien.
Und dann, trotz, vielleicht auch wegen dieser hervorragenden Bedingungen ging es im Studium nicht so voran, wie er sich das gedacht hatte. Statt in Rekordzeit abzuschließen, ließ er fünfe gerade sein, verbummelte zwei Semester, wurde aber nicht zur Rede gestellt. Von der Mutter, die ihn vergötterte, sowieso nicht, aber auch nicht vom Vater, der ihn nur zu jeder dann doch bestandenen Teilprüfung beglückwünschte, als sei das ein kleiner Nobelpreis. All das war kontraproduktiv und hätte ihn fast aus der Bahn geworfen. Anton Galba wunderte sich immer noch, wie er es endlich geschafft hatte, ein Maschinenbaudiplomingenieur zu werden, freilich kein herausragender, das wusste er selber; er fand dann auch nicht sofort eine Stelle, nicht in Österreich, wo zu bleiben er fest entschlossen war. Er wollte nicht weg, suchte aber nicht mit der nötigen Energie, wie er ja auch nicht mit der nötigen Energie studiert hatte (so legte er es sich heute zurecht) – hätte aber beim herrschenden Mangel an Maschinenbauern über kurz oder lang auch bei einem österreichischen Unternehmen einen Posten hinreichender Lukrativität gefunden, wenn nicht sein Vater seine politischen Beziehungen spielen lassen und den Sohn als Leiter der Dornbirner Abwasserreinigungsanlage empfohlen hätte. Es gab zwar eine Ausschreibung, die gibt es immer, aber Anton Galba wäre auch ohne Protektion genommen worden. Er war überqualifiziert. Im Rathaus herrschte Verwunderung, dass sich ein Dipl.-Ing. beworben hatte und mit dem Gehalt zufrieden war, das man ihm zahlen konnte. »Mehr können wir halt nicht zahlen«, hieß es. Warum hatte er zugesagt? Anton Galba ergriff die Gelegenheit wie den rettenden Strohhalm. Er hatte Angst vor einer beruflichen Zukunft, die er sich in den düstersten Farben ausmalte: Konkurrenzdruck, maßloser Stress in irgendeinem Unternehmen, wo er sich in einem Haufen karrieregeiler Intriganten durchsetzen musste, und bei welcher Arbeit? Winzigste Verbesserungen an einem Ausgleichgetriebe zu entwickeln … Kommilitonen, die vor ihm fertig geworden waren, erzählten Horrorstorys aus der deutschen Industrie. Ja, ja, man brauchte sie. Um sie auszuquetschen bis aufs Blut. So hatte er sich die Technik nicht vorgestellt, so hatten sie sich die Technik alle miteinander nicht vorgestellt. Aber Antons Vater bewahrte ihn vor dem beklagenswerten Schicksal, ein Rädchen im Getriebe zu sein, wie er ihn davor bewahrt hatte, uninteressierten Pubertierenden Nachhilfe in Mathematik geben zu müssen. Auf seinen Vater ließ Anton Galba nichts kommen. Beim Thema Familiengründung hatte er endlich Gelegenheit, den heimischen Erwartungen zu entsprechen, und heiratete Hilde, seine Sandkastenliebe, die er ein paar Jahre aus den Augen verloren, wiedergefunden und von sich überzeugt hatte. Hilde hasste Komplikationen und schwierige Verhältnisse. Die hatte sie im Elternhaus erlebt. Sie wollte einen guten, normalen Mann ohne Laster, sie wollte heiraten und sie wollte Kinder. Anton Galba war so ein Mann, er heiratete sie und machte ihr Kinder. Zwei Töchter im Abstand von zwei Jahren. Alles lief gut. Sie kauften ein Grundstück, bauten ein Haus und waren die Musterfamilie. Hildes trunksüchtiger Vater, der als einziger dunkler Fleck das Rundumglück hätte stören können, erlag rechtzeitig seiner Leberzirrhose, ihre Mutter hatte er schon vor Jahren ins Grab gebracht. Anton Galbas Eltern waren hervorragende Schwiegereltern. Die Mädchen gesund. Im Urlaub flog man auf die Kanarischen Inseln. Die Leitung der Abwasserreinigungsanlage war spannender, als Anton Galba erwartet hatte. Sein Sozialprestige war erstaunlich hoch: Die Leute verstanden, worum es ging; wer nur für fünf Groschen Verstand hatte, musste froh sein, dass es jemanden wie Anton Galba gab, der das Werkl am Laufen hielt – das war ein Mensch, dessen absolute Nützlichkeit für buchstäblich jeden am Tage lag und nicht in Zweifel gezogen wurde. Wer konnte so etwas von sich sagen? Nur sehr wenige. Anton Galba genoss das Gefühl. Er hatte großes Glück gehabt.
Und dann hatte er Helga kennengelernt und damit Glück in einer neuen Bedeutung, nämlich »von Glück erfüllt sein«, nicht nur im Sinne von »Glück haben«. Mit Hilde hatte sich im Lauf der Jahre eine Art gegenseitigen sexuellen Desinteresses eingestellt, das Anton Galba für normal hielt – jetzt wunderte er sich, wie er zu dieser Ansicht gekommen war, denn er hatte mit niemandem darüber geredet, keinen Menschen um Rat gefragt. Bis eben Helga auftauchte. Als eine von fünfundvierzig BewerberInnen um den frei gewordenen Laborposten von Herrn Schmelzig, der es geschafft hatte, mit einer unklaren, sich über Jahre hinziehenden, von einem Büschel Atteste begleiteten Magengeschichte in Invaliditätspension zu gehen. Mit fünfundfünzig. Das Beispiel Schmelzig verdeutlichte, dass man sich, wenn man seine fünf Sinne beieinander hatte, aus den Diensten der Stadt Dornbirn nur in Richtung Ruhestand entfernte und nicht zu einer anderen Firma, wo man den Gefahren der Umstrukturierung ausgesetzt war. In der Dornbirner Stadtverwaltung wurde nicht so umstrukturiert, dass Leute auf die Straße flogen. Das wussten alle, deshalb gab es ja auch fünfundvierzig BewerberInnen. Sie war unter den zwölf Beschäftigten erst die zweite Frau neben Margot Schneider, seiner Sekretärin. Erst hatte er befürchtet, es werde mit dem anderen Laboranten, Roland Mathis, zu Reibereien kommen; das war ein äußerst gewissenhafter Mensch ohne Kontakte zu den Kollegen, ein pedantischer Arbeiter mit festen Abläufen, in die Anton Galba nie eingriff. Zu seinem großen Erstaunen freundeten sich die beiden Laboranten an; der fünfzigjährige Einzelgänger und die halb so alte weltoffene Frau; man sah Mathis lächeln, wenn ihm Helga etwas erzählte, manchmal lachte er sogar. Dass er überhaupt ein nichtdienstliches Gespräch führte, war schon ein Wunder. Dass die beiden gut miteinander auskamen, fiel ihrem Chef gleich von Anfang an auf; dass er selber mit Helga noch viel besser auskam, folgte unmittelbar; er fragte sie dann nach Mathis, wie der denn so sei, komisch, sagte sie, ein bisschen komisch, aber gutmütig. Das Thema wurde nicht vertieft.
Auf dem Rückweg sprachen sie nichts mehr miteinander. Alles war gesagt und getan, sie liefen Hand in Hand durch die Dunkelheit zur Anlage zurück, eingesponnen in den warmen und weichen Kokon wechselseitiger Beglückung. An Roland Mathis dachten sie nicht und hätten auch nicht an ihn gedacht, wenn alles, wie es nun ging, hundert Jahre weitergegangen wäre; und doch würden sie schon einen Tag später damit anfangen, intensiv und oft an Roland Mathis zu denken, was umso erstaunlicher war, als weder Helga Sieber noch Anton Galba je einen Blick in die Seele des Roland Mathis getan hatten, so dass ihnen fast alles, was den bewegte, unbekannt blieb.
*
Die Abwasserreinigungsanlage Dornbirn erstreckte sich über sieben Hektar und umfasste eine mechanische, eine biologische und eine chemische Reinigungsstufe. Zwei Vorklärbecken (je 3000 Kubikmeter), zwei Belüftungsbecken (je 16000 Kubikmeter), vier Nachklärbecken (je 5400 Kubikmeter) und zwei Sedimentationsbecken (ebenfalls je 5400 Kubikmeter), zwei Faultürme (je 5000 Kubikmeter), einen Gasometer mit 5000 Kubikmeter und diverse Zusatzbauten und -einrichtungen, die höchst wichtige Funktionen erfüllten, aber auf einem Luftbild der Anlage gegen die riesigen Klärbecken wie architektonische Kinkerlitzchen wirkten. Die Anlage war auf dem neuesten Stand der Technik. Was sie von anderen Anlagen ähnlicher Größenordnung unterschied, war die erweiterte Schlammbehandlung, die Dipl.-Ing. Anton Galba in jahrelangen Versuchsreihen optimiert hatte. Der Klärschlamm, Endprodukt jeder Abwasserreinigung, war hier kein lästiges Endprodukt, das mühselig deponiert werden musste, sondern wurde zu einem hochwertigen Trockengranulat weiterverarbeitet, eine Art Superdünger, der Bäume doppelt so schnell wachsen und Maispflanzen dreimal so hoch werden ließ wie ungedüngte Vergleichspflanzen – das konnte Galba alles auf eigens angelegten Versuchsanbauflächen nachweisen. Dort standen zwei Wäldchen, jedes unterteilt in Laub- und Nadelhölzer, das eine granulatgedüngt, das andere nicht, angelegt zur selben Zeit einzig zum Zweck, die Düngewirkung zu demonstrieren. Die gedüngten Bäume, mittlerweile vierzehn Jahre alt, waren genau doppelt so hoch und dick wie die ebenso alten ungedüngten. Auf zwei weiteren Flächen wies er mit sogenannten Lysimetern nach, dass dieses Granulat keine Schwermetalle an das Niederschlagswasser abgab – dazu sammelte er in unterirdischen Rinnen eben dieses Sickerwasser und ließ es im Labor analysieren, das eine unter normalem Boden aufgesammelt, das andere unter gedüngtem. Das machte er über viele Jahre hinweg, um auch Langzeiteffekte aufzufangen. Alles wurde dokumentiert und veröffentlicht. Das Granulat war sehr begehrt bei allen Personen, zu deren Aufgaben es gehörte, an den denkbar ungünstigsten Stellen auf Teufel komm raus etwas wachsen zu lassen: Wildbach- und Lawinenverbauung, Straßenbau, Böschungsbegrünung, Hochlagenaufforstung und so fort. Alle paar Wochen stand eine Delegation aus irgendeiner Weltgegend bei Anton Galba im Büro und wartete auf die fällige Exkursion hinaus zu den Versuchsfeldern; das Granulat eignete sich nämlich auch für Zwecke, die ihm nie eingefallen wären. Das Neueste war die Verwendung bei der Begrünung von Wüsten. Kurz: es war ein Wundermittel, und Anton Galba stolz darauf. In der Stadt nannte man ihn »den Mann, der aus Scheiße Gold macht«. Das hörte er gern. Das Granulat wurde unter dem Namen »Togapur« auch an Private verkauft, es gab am Rande des Geländes eine eigene Abgabestelle.
Anton Galba hatte die ganze Granulatsache aus eigenem Antrieb entwickelt, ohne Auftrag der Gemeinde, die schon zufrieden gewesen wäre, wenn die ARA nicht schlechter lief als die Nachbaranlage im Unterland. Galba hätte in einer Universitätsstadt eine ganz andere Karriere gemacht, eine Firma gegründet, irgendetwas in dieser Art, er wäre reich und in bestimmten Kreisen berühmt geworden, aber daraus wurde nichts. Dornbirn bot kein intellektuelles Umfeld. Wer sich hier etwas ausdachte, blieb entweder Einzelkämpfer oder ging weg. Anton Galba hatte noch das Glück, dass er seine Ideen in einer recht gehobenen Position umsetzen konnte; außerdem war auch in der untergründig bildungsfeindlichen Atmosphäre, die das ganze Land seit der Gegenreformation prägte, das, was er vorhatte, fast jedem verständlich: eben aus Scheiße Gold zu machen, das verstanden sie alle, es entsprach dem bäuerlichen Biedersinn, das war etwas Handfestes, nichts Verrücktes. Und es rentierte sich. Das taten die wenigsten Sachen, sich rentieren. Als Redewendung gab es die skeptische Frage Rentiert sich das?, die meistens gleich vom Fragesteller selber abschlägig beschieden wurde: Das rentiert sich nicht! Zugereiste, wie Galbas Vater, der Zahnarzt, brauchten einige Zeit, um die allgegenwärtige Verwendung dieser Phrase auch in nichtökonomischen Zusammenhängen richtig einzuschätzen – so hörte er oft auf sein Angebot einer Betäubungsspritze vor einer tiefer reichenden Bohrung vom Patienten ein ablehnendes Rentiert sich nicht! und kam auch nach Jahren des Nachdenkens zu keinem anderen Schluss, als dass diese Ablehnung eben doch nur pekuniär begründet sein konnte; denn die Krankenkasse erstattete bei Füllungen keine anästhetischen Maßnahmen, nur bei Extraktionen; der Betreffende hatte dann den zu erwartenden Schmerz mit den Zusatzkosten verglichen und sich gegen die Spritze entschieden. Wie diese Kalkulation im Einzelnen aussah, konnte sich Dr. Galba allerdings nicht vorstellen, dazu fehlte ihm der genetisch fixierte Erwerbssinn der Landesbewohner, der sie zwang, die Redeweise vom Rentieren – viel häufiger Nicht-Rentieren – elliptisch auf alle Lebensbereiche auszudehnen. Nicht rentieren konnte sich zum Beispiel auch ein Ausflug, sogar, wenn er zu Fuß unternommen und kein Groschen dabei ausgegeben wurde; die Floskel versammelte hinter sich alles Negative, das einer Sache oder Unternehmung anhaften mochte, alles Langweilige, Sinnlose, Vergebliche. Die positive Formulierung hörte man kaum, außer im höhnisch sarkastischen Ausruf: Das hat sich wieder rentiert!, wenn man eine Vorstellung, die nicht konveniert hatte, des Landestheaters in Bregenz verließ. Dabei ging es nicht nur ums Geld, wie Dr. Galba jahrelang angenommen hatte. Die Vorarlberger waren nicht etwa geizig – sie spendeten reichlich allen möglichen Hilfsorganisationen, was sich in keinem Falle rentieren konnte. Umgekehrt wurde ein Schuh draus: Das Reden vom Rentieren, vom Geld, war nur der Deckmantel, in den ganz gewöhnliche, persönliche Urteile gehüllt wurden, so, als hätten diese Urteile ohne sprachlichen Bezug auf unzweifelhaft Geldwertes weder Basis noch Bestand.
Anton Galba war in Dornbirn geboren und aufgewachsen und an die örtlichen Eigenheiten gewohnt. Die Schlammbehandlung, die er entwickelt hatte, rentierte sich mittlerweile, aber das war nicht von Anfang an so gewesen. Es hatte Rückschläge gegeben, langwierige Optimierungsprozesse wie bei jedem chemisch-biologischen Verfahren dieser Größenordnung; alles Dinge, von denen die Öffentlichkeit nichts mitbekam. Er hatte als verantwortlicher Betriebsleiter alle Schwierigkeiten gemeistert. Aber es war ihm schwergefallen. Er hatte nicht die glückliche Laborhand wie manche seiner Studienkollegen. Er fand nicht auf Anhieb die richtige Lösung. Wenn es bei einem Problem nur einen Ausweg gab, aber vier Sackgassen, dann wählte er von denen erst einmal zwei, in seltenen Fällen drei, bevor er den Ausweg fand. (Aber niemals alle vier, das konnte er sich zugutehalten.) Dieses Manko machte er durch erhöhten Einsatz wett. Nächte. Wochenenden. Überstunden sowieso. Anton Galba war zäh. Nur das, was man gemeinhin dasLeben nannte, war für Jahre an ihm vorbeigelaufen, wie er sich eingestehen musste. Diese Einsicht setzte sich bei ihm erst allmählich durch. Davor lagen lange Monate eines diffusen Missbehagens, begleitet von ebenso diffusen körperlichen Symptomen. Müdigkeit, Kreuzweh, Kopfweh, Fußweh, noch anderes Weh, das er inzwischen vergessen hatte, das sich aber mit Aspirin hatte jedes Mal vertreiben lassen; am schlimmsten war die missliche Stimmung, in die er mitten am Tage verfiel, ein anlassloser Groll auf alles und jedes. »Du wirst halt alt«, kommentierte Hilde diese Zustände, und noch mehr als die Diagnose missfiel ihm der Ton selbstgerechter Gewissheit, in der sie vorgebracht wurde.
Das Wort Midlife-Crisis fiel nie, aber natürlich war diese Bezeichnung die zutreffende, wie er heute wusste. Und, auch das musste er zugeben, seine Reaktion auf diese Krise, sich nämlich auf Schnall und Fall in eine zwanzig Jahre jüngere Frau zu verlieben, war nicht rasend originell.
»Was machst du dir Gedanken«, sagte Helga, als er sie mit diesen Gedanken konfrontierte, »es gehören immer zwei dazu, oder? Du hast mir von Anfang an gefallen, vom ersten Tag an …« Das tröstete ihn, sie hatte ja recht.
*
Er hätte später nicht sagen können, ob ihm an Roland Mathis am nächsten Tag etwas aufgefallen sei – wenn ihn jemand danach gefragt hätte. Bei einem halbwegs normalen Verlauf der Ereignisse hätte ihn sicher jemand gefragt. Neben vielen anderen Dingen, man kennt das aus dem Fernsehen. Aber so, wie die Dinge dann liefen, fragte ihn niemand nach Roland Mathis, jedenfalls nicht gleich. Er malte sich oft aus, wie das gewesen wäre, der normale Verlauf, was für Fragen gekommen wären, was er darauf geantwortet hätte; er bemühte sich, Fragen und Antworten vorauszusehen, das Spiel – mehr war es ja nicht – mit möglichst viel Realität zu füllen. Aber auch bei aller Anstrengung des Sich-wieder-Erinnerns, bei aller Mühe, sich kleinste Details dieses Tages ins Gedächtnis zu rufen, fiel ihm an Roland Mathis nichts auf. Der war, sofern er sich an ihn an diesem Tag erinnern konnte, so mürrisch wie immer, machte den leicht abwesenden Eindruck wie alle Tage davor. Bis eben zum Abend. Da blieb er nämlich länger als sonst. Galba hatte an diesem Abend Berichte nachzuschreiben, er hatte seine Frau angerufen und ihr mitgeteilt, dass es heute länger dauern könne – er erledigte solche Arbeiten im Büro, nie zu Hause, wo er, wenn schon nicht den vorzüglichen Ehemann (das war vorbei), so doch den nicht weniger vorzüglichen Vater spielte. Auch Helga hatte etwas vor, so dass amouröse Verwicklungen an diesem Abend nicht zu erwarten waren, sie teilten die Einsicht, man soll es nicht übertreiben, überhaupt nichts. Und das schon gar nicht.
Mathis stand bei der BSB5-Titration, das Gerät hatte einen Fehler, hinter den er heute noch kommen wollte, wie er mit seiner leisen, verwaschenen Stimme Galba am Nachmittag erklärt hatte. Galba dachte sich nichts dabei, er schätzte Mathis nicht besonders als Mensch, aber als Mitarbeiter. Es gab praktisch nichts, was der nicht reparieren konnte. Das sparte viel Geld. Auch Galba selber war geschickt, wie ihm alle versicherten, also stimmte es wohl, aber kaputte Geräte zu reparieren, kam in seiner Stellung nicht in Frage: Er konnte Fehler konstatieren und Reparaturen delegieren oder veranlassen, das war’s dann. Der Chef mit einem Schraubenzieher, das machte kein gutes Bild. Außer zum Zweck der Optimierung oder Fehlersuche. Suche und Behebung waren zwei Paar Schuhe. Also erhob er sich gegen neun vom Schreibtisch, um Mathis bei der offenbar immer noch nicht beendeten Fehlersuche zu unterstützen, denn nach einer Behebung sah das nicht mehr aus, die hätte Mathis längst erledigt. Er trat an den Titrierstand heran, der sich vollständig aufgebaut und betriebsbereit seinen Blicken darbot, Mathis stand davor und stierte in die Glasvorlage, als spiele sich dort ein unerwartetes chemisches Wunder ab, die tatsächliche, nicht bloß metaphorische Wandlung von Scheiße in Gold, und er sagte, ohne sich umzudrehen, als Galba herantrat: »Ich muss mit dir reden.«
Galba war nicht erschrocken, keine Spur. Dass die Mitarbeiter »mit ihm reden mussten«, kam ab und zu vor, aber wirklich nur ab und zu. Worum ging es da? Immer nur um Personalprobleme. Das hieß in der ARA, dass ein Personalteil mit einem anderen Personalteil nicht auskam, dass der eine etwas gesagt hatte, was der oder die andere in den falschen Hals gekriegt hatte, und so weiter. Anton Galba erledigte solche Fälle mit dem zu erwartenden Ernst und einer gewissen jovialen Nachdrücklichkeit, die ihn bei seinen Leuten beliebt machte. Er regte sich nicht auf, hielt solche Sachen nicht für kontraproduktiven Quatsch, wie er das von anderen Chefs gehört hatte – aber er absolvierte auch keine Konfliktbewältigungs- und Mediationsseminare.
So war er gespannt, mit welchem zwischenmenschlichen Problem ihn der mürrische Einzelgänger Roland Mathis konfrontieren würde. Seltsame Sache: Der redete kaum mit den Kollegen, wie konnte sich da Streit entwickeln? Mathis warf ihm nun einen, wie sich Galba einbildete, durchaus skeptischen Blick zu und sagte: »Aber nicht hier. Im Turm.«
Der Singular Turm war nicht korrekt, in Wahrheit gab es drei Türme. Zwei Gärbehälter, große Zylinder mit kegelförmigem Aufsatz, jeder von ihnen fast so breit wie hoch (ohne den Aufsatz), dazwischen erhob sich ein Bauwerk, auf das die Bezeichnung Turm zutraf, der Zugangsbau zu den beiden Faultürmen, ebenfalls rund, aber schmal und sichtbar höher als die beiden dicken. Eben diesen meinte Roland Mathis mit Turm; Galba empfand das Brimborium etwas albern, sie waren allein im Labor, was Mathis zu sagen hatte, konnte er ihm auch hier mitteilen, aber der hatte sich schon zur Tür gewandt, Galba blieb nichts übrig, als ihm zu folgen. Später sollte er sich oft fragen, wie die Unterredung wohl verlaufen wäre, wenn sie im Labor geblieben wären. Und was Mathis mit diesem seltsamen Vorschlag, im Turm weiterzusprechen, wohl bezweckt hatte.
Sie gingen am Betriebsgebäude 2 vorbei, umrundeten das Schlammsilo und überquerten den zweiten Hof. Es war inzwischen so dunkel, dass man noch den Vordermann erkannte, aber keine Zeitung hätte lesen können. Der Himmel hatte sich bezogen, die Luft stand still, es würde bald regnen, warm und leise, es roch nach Regen. Und nach der ARA roch es auch. Ein schwerer, süßlicher Dunst von den Belüftungsbecken her; ein Duft, der die Anwohner manchmal die Nase rümpfen, die Fenster schließen und Leserbriefe verfassen ließ – dass sie ihre Grundstücke eben wegen der geplanten ARA erheblich billiger gekriegt hatten, stand nicht in diesen Briefen der Häuselbauer, das vergaßen sie, dachte Galba und ärgerte sich wie jedes Mal, wenn ihm das Thema einfiel, ein Reflex.
Mathis ging voran, Galba drei Meter dahinter, sie machten den Eindruck von Leuten, die einen gemeinsamen Weg haben, etwa zur Kantine, aber nicht so gut miteinander bekannt sind, dass sie sich bemüßigt fühlen würden, nebeneinander zu gehen und eine Unterhaltung zu führen. Mathis beschleunigte, Galba nicht, das fehlte noch, dass er diesem Spinner hinterherrannte, aber Mathis hatte das getan, um einen kleinen Vorsprung zu haben, so dass er die Tür im Turm aufschließen konnte, ehe sein Chef heran war. Fürchtete er den Satz: »Das ist weit genug, hier ist kein Mensch weit und breit, also, was willst du?« (Sie waren alle per du in diesem Betrieb.) Mathis öffnete die Tür, trat ein und machte Licht. Er ignorierte den Lift, nahm gleich die Betontreppe, die rund um den Liftschacht als Wendel nach oben führte.
»Wie weit denn?«, rief ihm Galba nach, Mathis antwortete, Galba verstand nur »… nicht weit«, Mathis hatte sich nicht umgedreht, war schon hinter der ersten Biegung verschwunden. Galba seufzte und stieg hinauf. Was sollte das werden? Ein Gespräch auf einer der Verbindungsbrücken in fünfundzwanzig Meter Höhe? In freier Luft?
Im dritten Stock wäre er fast in Mathis hineingelaufen. Der stand hinter der Ecke und wartete. Galba sah jetzt erst, dass der andere eine Kamera bei sich hatte.
»Willst du Fotos machen?«, fragte er.
»Hab ich schon. Schau.«
Er ließ den Chef den Bildschirm betrachten. Galba beugte sich vor, das Ding war winzig, die Fotos alle monochrom, eine Art schmutziges Grün, aber trotz der Beschränkungen des Screens konnte man doch erkennen, was der Kollege Mathis da fotografiert hatte, sogar sehr genau erkennen, nicht nur, was die Leute taten, sondern auch, wer sie waren. Und das Grün passte dazu, musste sich Mathis eingestehen, es gab den Bildern ein Flair von Künstlichkeit; also keine primitive Pornographie. Pornographie mit Anspruch? Oder doch blanke Ironie, Sarkasmus oder so? Am besten fragen.
»Warum sind die alle grün?«, fragte er.
»Das geht nicht anders«, erklärte Mathis, »das ist der Restlichtverstärker, man kann auch keine anderen Farbtöne einstellen.« Nach einer Weile fügte er hinzu: »Aber man sieht ja, wer es sein soll.«
»Ja, das sieht man«, bestätigte Galba. Kein künstlerischer Anspruch also, nur ein technisches Artefakt. Warum sollte ausgerechnet Roland Mathis auch unter die Fotokünstler gegangen sein?
»Ich hab auch Papierabzüge«, sagte Mathis, »in DIN A4, aber nicht hier …«
»Was?«
»Ich meine, ich hab sie nicht mit, die Abzüge, aber ich kann dir Kopien …«
»Nein, nein, lass nur, ich hab nicht richtig aufgepasst, ich hab nicht mitgekriegt, was du damit machen willst …«
»Hab ich noch nichts drüber gesagt …«
»… Ich meine, da gibt’s doch endlose Möglichkeiten. Du kannst das Zeug ins Internet stellen, auf so eine Plattform, wie heißen die Dinger …«
»… YouTube … Daran hab ich noch gar nicht gedacht …« Er schien überrascht.
»Genau! Oder als Mail verschicken. An den Bürgermeister. An alle Stadträte. An meine Frau, die hat einen eigenen Computer, die Adresse hast du sicher schon raus …«
»Hab ich …«
»Na eben! Oder an den Pfarrgemeinderat … warum nicht, fällt mir eben spontan ein …« Galba zuckte die Achseln. Er spürte, wie er wütend wurde. Mathis machte jetzt ein ausgesprochen blödes Gesicht, das konnte Galba nicht leiden, wenn die Leute so guckten.
»Das hab ich aber alles nicht vor, wenn …«, sagte er.
»… Ach nicht? Dann versteh ich das aber nicht, ich meine, wenn keine Veröffentlichung geplant ist, warum … WARUM MACHST DU DANN SO EINEN SCHEISS?«, brüllte er. Mathis machte einen halben Schritt zurück, legte den Finger auf die Lippen.
»Psst, Chef, das hört man meilenweit! Außerdem hast du mich unterbrochen. Ich wollte sagen, ich mach das alles nicht, wenn du tust, was ich dir jetzt sage …«
»Ach so! Da bin ich jetzt aber beruhigt. Simple Erpressung. Ich fürchte nur, du hast dir den Falschen ausgesucht. Ich bin nicht reich, ich dachte, das weißt du …«
»… Darum geht’s nicht …«
»… Oder bist du mit fünfzig Euro zufrieden – pro Monat, das könnte ich vielleicht noch erübrigen …« Mathis schwieg. Ironie drang nicht zu ihm durch.
»Das ist typisch für euch«, sagte er dann.
»Für wen?«
»Für euch Slawen. Du bist doch Slawe, oder?«
»Was? Slawe? Was soll das heißen, ich bin …«
»Na, du heißt doch Galba, oder etwa nicht?«
»Natürlich heiß ich Galba, wovon redest du überhaupt?«
»Galba tönt für mich slawisch, aber ich gebe zu, ich kenn mich da nicht hundertprozentig aus, das geht mich ja auch nichts an, wie ihr Brüder euch nennt, vielleicht ist das auch ein Zigeunername – oder Jude? Nein, eher nicht, müsste dann wohl Galbenstein heißen … klingt wie Galgenstein, genau, das wär’s!« Er fing an, aus vollem Hals zu lachen. Er ist verrückt, dachte Galba, mein Gott, er ist verrückt, lange schon, und ich hab’s nicht gemerkt, wir alle haben nichts gemerkt.
»Wie auch immer«, fuhr der Laborant Roland Mathis fort, »du hast an dieser Kleinen nichts zu schaffen, verstehst du?« Er kam den halben Schritt, den er zurückgewichen war, wieder näher. Und setzte noch einen halben Schritt dazu. »Das ist nämlich Rassenschande. Ich weiß, der Begriff ist nicht sehr gebräuchlich, weil ihn die Siegerjustiz verboten hat, aber er trifft die Sache genau. Ich hab lange darüber nachgedacht, wie ich es sonst nennen soll, ich bin ja aufgeschlossen, sogar modern, ich gehe mit der neuen Zeit, ich bin nicht verstockt, durchaus nicht, ich bin vernünftigen Argumenten aufgeschlossen – aber genauso wie zwei mal zwei vier ist, bleibt Rassenschande eben Rassenschande, was soll ich machen? Es ist widernatürlich, gegen die Natur, das solltest sogar du einsehen. Ich meine, wenn du dir eine Negerin angelacht hättest oder eine Fidschischlampe oder eine vom Balkan …« Er stand nun dicht vor Galba und blickte ihm direkt ins Gesicht, »… wenn du es mit denen treiben würdest, von mir aus mit allen dreien – und wenn du denen Bälger machen würdest …«
Seine Augen glänzten. In dem trüben Licht der Neonbeleuchtung des Treppenhauses leuchten seine Augen, dachte Galba, wie kommt das?
»Als nordischer Mensch käme mir das ungelegen, aber es entspräche eurer Anlage, dass ihr euch vermehrt wie die Karnickel, es wäre vom rassenbiologischen Standpunkt sogar einsehbar – aber das einzudämmen, erfordert eben den Rassenkrieg, den Krieg der Rassen, den kann ich nicht allein führen, sag selber, das wäre ja idiotisch.« Galba sagte nichts.
»Aber euch zieht es ja immer zur germanischen Frau. Um Bastarde zu zeugen, immer nur Bastarde! Und darum muss es diese Helga sein, justament. Ja, ich verstehe schon, es ist der Urinstinkt niederer Rassen, durch Bastardisierung …« Der Rest des Satzes blieb ungesagt. Anton Galba überlegte später, wie er wohl weitergegangen wäre … durch Bastardisierung die nordische Rasse … oder hieß es die germanische Rasse … und dann … herunterzuziehen … nein … runterzumachen … oder schlicht zu zerstören? Kein mögliches Ende erschien ihm wirklich plausibel, das beunruhigte ihn. Anton Galba besaß nicht die Fähigkeit, einen einfachen Satz des Laboranten Roland Mathis zu vollenden, obwohl sie im selben Betrieb gearbeitet hatten, mit denselben Problemen konfrontiert gewesen waren. Obwohl sie dieselbe Sprache verwendet hatten. Ich hätte ihn, dachte er dann, ausreden lassen sollen. Vielleicht wäre er nach diesem Exkurs in die fremde, Millionen Lichtjahre entfernte Galaxie doch auf die Erde zurückgekehrt, so dass man wieder hätte miteinander sprechen können; viel wahrscheinlicher war freilich, dass sie danach nie wieder ein Wort gewechselt hätten. Aber genau wusste er es eben nicht.
Denn er hatte ihn nicht ausreden lassen. Sondern weggestoßen. Was heißt gestoßen. Geschubst. Buchstäblich. Mit den Fingerspitzen. Nur mit den Spitzen seiner Finger, um die Berührungsfläche so klein wie möglich zu halten, hatte er den Roland Mathis von sich weggeschubst. Der war gestolpert. Worüber eigentlich, kam nie heraus, Galba fand keine Erklärung, so viel er auch darüber nachdachte (und er dachte sehr, sehr viel darüber nach). Es war ein Unfall, ein Zusammenwirken unglücklicher Umstände. Mathis fiel nach hinten die fünfzehn Stufen der Treppe hinunter, blieb auf dem nächsten Absatz liegen. Und war tot.
Das fand Anton Galba heraus, als er dem Laboranten die Finger an die Carotis legte. Kein Puls. Anton Galba stieg die Treppen hinunter ins Erdgeschoss, löschte das Licht im Treppenhaus und trat ins Freie. Es war nun so dunkel, dass man nichts mehr erkennen konnte, keine Person, keinen Gegenstand, nicht die Hand vor den Augen. Auch zu hören war nichts, außer das gleichmäßige Brummen der Schlammpumpen vom Silo her. Anton Galba schwitzte, das Hemd fühlte sich feucht auf der Haut an. Die ersten Tropfen fielen. Er kehrte in den Turm zurück.
Er war nicht panisch, nicht hysterisch, nicht einmal hektisch. Eine große Ruhe hatte ihn ergriffen, aber eine künstliche wie von einem verschreibungspflichtigen Medikament, das nicht gern verschrieben wird, weil sich die Berichte über Abhängigkeit häufen. Daran könnte man sich gewöhnen, dachte er, an dieses Gefühl. Er hatte keine Ahnung, woher es kam, aus welchen unbekannten Tiefen seiner Seele. Vielleicht schützt sie sich, die Seele nämlich, vor den Dingen, die ich noch nie getan habe, aber von denen sie schon weiß, dass ich sie gleich tun werde. Dachte er.
Er ging wieder hinauf in den dritten Stock. Roland Mathis blickte immer noch überrascht zur Decke, für ihn war das die untere Seite des nächsten Treppenabsatzes. Er schaute so konzentriert dort hinauf, dass man meinen konnte, Roland Mathis bedaure zutiefst, den vierten Stock nicht geschafft zu haben. Aber was hätte das geändert? Er läge auf jenem Absatz, eben ein Stockwerk höher. Was wäre besser daran?
Jeder Abschnitt und Ansatz der Treppe gleicht allen anderen, dem darunter und dem darüber. Vielleicht, kam es Anton Galba in den Sinn, sehen die Toten Dinge, die wir nicht sehen, und Zusammenhänge, die uns verborgen bleiben. Vielleicht ganz einfache Dinge und Zusammenhänge, die uns genauso offenstünden, wenn wir nur lang genug hinschauen würden. Aber das können wir nicht. Weil wir zwinkern. Nach ein paar Sekunden müssen wir zwinkern. Roland Mathis musste nicht mehr zwinkern, die Flüssigkeit auf seinen Augäpfeln vertrocknete. Und viele andere Prozesse setzten nun ein, sichtbare und noch unsichtbare. Anton Galba verspürte neben dem Gefühl künstlicher Ruhe ein zweites: eine gewisse Feierlichkeit. Alles Fleisch ist Gras, und alle seine Güte ist wie eine Blume auf dem Felde. Jesaja 40, Vers 6. Auf dieser Stelle war Pfarrer Moser im Konfirmandenunterricht herumgeritten (Galba war evangelisch), aber Galba erinnerte sich nicht mehr, warum. Nur der Vers hatte sich in einem Gedächtniswinkel festgesetzt, vierzig Jahre lang. Für die passende Situation. Alles Fleisch ist Gras. In der Tat. Der Psalmist hatte wohl keine Ahnung gehabt, wie buchstäblich wahr seine Worte waren. Das mit der Blume auf dem Felde … nun ja, darüber hätte man im Falle Roland Mathis streiten können. Oder auch nicht. Auch giftige Pflanzen hatten Blüten.
Anton Galba untersuchte den Toten. Nirgends Blut.
Alles Fleisch ist Gras.
So sei es.
2
Nathanael Weiß hatte Anton Galba seit dem letzten Klassentreffen nicht mehr gesehen. Das hatte nichts mit gegenseitiger Abneigung zu tun, nur mit der Abneigung, Kontakte zu pflegen, die während der Schulzeit auch nicht bestanden hatten. In dieser Klasse gehörte Galba einer anderen Clique an als Weiß, die Cliquen ließen einander in Ruhe, jeder befasste sich mit den Dingen, die ihm wichtig waren, und kümmerte sich nicht um andere. Nach der Schule lief alles sofort auseinander, die gegenseitigen Abstände vergrößerten sich weit über Sichtweite hinaus – aber zu den Klassentreffen kamen dann doch fast alle und ließen eine Gemeinschaft hochleben, die in dieser Form nie bestanden hatte. Weiß wie Galba gingen immer hin, sprachen aber nur mit den Mitgliedern ihrer jeweiligen Clique.
Als sie einander jetzt gegenüberstanden, spürte Nathanael Weiß jene Distanz, die sich bei jedem einstellt, wenn er in die Nähe einer Uniform kommt. Wie eine Verkleidung ist das, dachte er oft; sie wissen nicht, wie sie sich verhalten sollen, keiner weiß das, es macht die Menschen verlegen. Es gibt kaum noch Uniformen. Geistliche, Musikkapellen und die Exekutive. Militär kommt nur im Fernsehen vor. Es ist ein bisschen wie Fasching, nur überhaupt nicht lustig.
Sie gaben einander die Hand, Galba deutete auf einen Stuhl. Weiß nahm Platz. Galba fühlte sich verpflichtet, seiner Verwunderung Ausdruck zu geben, also gab er.
»Ich hätte nicht gedacht, dass du selber … ich meine, ist das üblich? Du bist doch dort der Vize, oder?«
Weiß nickte.
»Was ist das für ein Rang?«, fragte Galba, deutete auf die Uniform. »Ich weiß, du hast es mir das letzte Mal gesagt, entschuldige, ich hab’s vergessen, ich hab ja nicht so viel zu tun mit Polizei …«
»Chefinspektor«, sagte Weiß. »Chefinspektor«, fügte er nach einer Weile hinzu, als Galba nichts geäußert hatte, als sei Chefinspektor das Ergebnis einer langen und verwickelten Überlegung.
»Und diese … diese Dinger an der Schulter? Dis… Des…«
»Distinktionen«, sagte Weiß.
»Drei Sterne? Ich dachte, drei Sterne ist … warte, ein Stern, Leutnant, zwei Oberleutnant, drei … dann schon Hauptmann …«
»Ja, das wären aber drei Sterne auf rotem Grund. Das sind drei goldene Sterne auf silbernem Grund …«
»Gibt’s das auch umgekehrt? Drei silberne auf Goldgrund?«
»Gibt’s. Dann wär ich General.«
»Toll! Wirst du das noch?«
Weiß schaute ihn mit ernstem Blick an. Anton Galba wollte schon fragen, ob er etwas Falsches gesagt habe, als Weiß antwortete.
»Ich glaube nicht. Sicher nicht. Falsche Partei …« Er betrachtete eine Zeitlang das Poster an der Rückwand des Büros, auf dem die Prozessabläufe der ARA dargestellt waren. Galba beobachtete ihn genauer. Weiß kam ihm fremd vor in der Uniform. Nicht wegen des Verkleidungseffekts, wie er eintritt, wenn einem vertraute Personen auf einem Kostümball als Napoleon oder Pirat begegnen. Dort, dachte Galba, ist es der Widerspruch zwischen Sein und Schein; das irritiert, ärgert. Einfach nur affig. Aber hier … da gab es keinen Gegensatz zwischen der Person Nathanael Weiß und der Uniform. Die passte nicht nur, die schien mit ihm verwachsen, als sei er so auf die Welt gekommen. Ausgewachsen und Uniformträger. Der Weiß, der in der Uniform lebte, hatte nichts gemein mit dem Weiß der Schulzeit und den Klassentreffen. Dort war er immer in Zivil erschienen.
Weiß schien es nicht eilig zu haben. Er versenkte sich in die verschiedenfarbigen Linien auf dem Poster, die Stoff- und Energieströme symbolisierten. Er tut so, als ob ihn das interessiert, dachte Galba. Aber er sitzt zu weit weg von dem Poster. Will er damit beweisen, wie gut er noch sieht? Mit diesen Augen, die Galba nun fixierten, wäre das bemerkenswert. Leicht gerötet, ein Schleier im Blick, als habe er Dinge gesehen, die er nicht hatte sehen wollen. Noch ein Detail fiel ihm nun auf. Das dunkelblaue Jackett war so wolkig gestaltlos wie eine beliebige Freizeitjacke; ob das so gehörte oder nicht, ließ sich nicht sagen. Früher hatte es da aufgesetzte Taschen gegeben und eine Menge Knöpfe und einen körperbetonten Schnitt, nach der Zusammenlegung mit der Gendarmerie war die Polizei europäischen Standards angeglichen worden, weshalb sie jetzt aussah wie irgendein privates Wachkorps. Nur der aufgenähte Adler und die Umschrift »Polizei« machten den Unterschied deutlich.
»Du hast ganz recht«, sagte Weiß. »Welchen Wert hat eine Uniform, wenn ich sie anschreiben muss?« Er lächelte. Anton Galba saß mit halboffenem Mund da und nickte. Der kann Gedanken lesen. Das ist mir in der Schule nicht aufgefallen. Wenn das so ist, bin ich … Er unterbrach die eigenen Gedanken, die in eine unerfreuliche Richtung abzugleiten drohten, und fragte: »Willst du einen Schluck? Ich hab da …« Er zog aus der linken unteren Schublade eine Flasche heraus. »… einen sehr guten Wermut. Aus dem Urlaub.«
»Danke, keinen Wermut. Kann den Geschmack nicht ausstehen …«
»… Oder einen Brandy aus Andalusien …«
»Das ist viel besser!«
Weiß ließ sich einschenken, sie stießen an.
Er hätte doch sagen müssen: Nein danke, bin im Dienst, oder so. Aber er sagt keinen Ton, nimmt einen kräftigen Schluck. Das ist doch ungewöhnlich. Zittert die Hand, die das Glas zum Mund führt? Kein bisschen. Dafür sitzt der Krawattenknoten nicht so akkurat, wie er sitzen sollte, fiel Anton Galba nun auf … da gab es eine halbfingerbreite Lücke zwischen Krawatte und dem …
»Also: wie lang ist dieser Mathis jetzt weg?«
Anton Galba schaute sein Glas an und bemühte sich um Konzentration. Es ging hier nicht um die Anzeichen möglicher Verwahrlosung bei Chefinspektor Weiß, sondern um das Verschwinden des Laboranten Roland Mathis.
»Zwei Tage.«
»Erzähl von Anfang an!«
»Er kam vorgestern nicht zur Arbeit. Wenn jemand krank wird, muss er es melden und dann innerhalb von drei Tagen ein ärztliches Attest bringen, aber da kam nichts …«
»Schon gut. Weiter!« Er machte eine flinke, aufmunternde Handbewegung. Und er lächelte. Wie der nette Polizist bei der Radfahrprüfung in der Schule. Da waren sie zwölf gewesen.
»Ich hab natürlich angerufen. Am Festnetz hat sich niemand gemeldet, das Handy war aus. Ich bin dann hingefahren … ein kleines Haus im Rohrbach. Es war schon Abend, alles dunkel. Ich hab geläutet, mehrmals, keine Reaktion. Es war auch alles abgeschlossen. Als ob er verreist sei. Als er am nächsten Tag nicht aufgetaucht ist, hab ich euch angerufen.«
»Auto?«
»Stand vor dem Haus.«
»Gut. Bleibt nichts übrig, als sich das anzuschauen.«
»Das Haus?«
»Was sonst? Ehe wir da großartig eine Fahndung rausgeben, müssen wir doch sicher sein, dass er nicht in der Wohnung liegt – mit gebrochenem Genick …«
»Wieso gebrochenes Genick?«
»Wieso nicht? Ein Sturz auf der Treppe, ausrutschen, stolpern …«
»Ja, ja, aber … es könnte doch auch ein Herzinfarkt sein, ich meine, wieso ausgerechnet gebrochenes Genick?« Maul halten!, fuhr es ihm durch den Kopf. Einfach nur das Maul halten. Aber das ging nicht. Er bemühte sich um einen neutralen Tonfall, Interesse. Wie bringt man neutrales Interesse in die Stimme? Sicher nicht so, wie er das gerade tat. Alles war verloren …
»Oder gibt’s da eine Statistik, dass die tödlichen Haushaltsunfälle meistenteils Genickbrüche sind?«
Meistenteils, du liebe Güte? Wo hatte er das Wort her? Wieso redete er so geschraubt?
Weiß warf ihm einen langen, trägen Blick zu, ehe er den Brandy austrank und sich erhob.
»Statistik? Keine Ahnung. Müsste ich nachschauen … aber wir werden ja sehen. Bist du so weit?«
»Ich soll mit?«
»Na ja, du bist doch der Chef von dem Mann.« Auch Galba stand auf. »Schon, es ist nur …«
»Er ist doch höchstens einen Tag tot«, sagte Weiß. »Also noch nicht verfault oder so.« Er lachte. Es klang wie ein kurzes, bellendes Husten. »Natürlich, wenn er sich umgebracht hat mit einer Rasierklinge … Ich geh zuerst rein, dann bist du vorgewarnt.« Er wandte sich zur Tür.
Ich muss das Maul halten, dachte Anton Galba. Was ist bloß in mich gefahren. Ich mache mich verdächtig – praktisch mit jedem Wort, das ich sage. Er atmete schnell, obwohl er wusste, dass genau das in dieser Situation ganz falsch war. Er hätte ruhig durchatmen sollen; aber das konnte er nicht. Es hörte sich nach Hecheln an.
»Nimmt dich die Sache so mit?« Weiß klang besorgt.
»Na ja, bis jetzt habe ich mir das noch nicht so … so bewusst gemacht … Ich hatte zu tun, den Ausfall zu ersetzen, Dienstplan, verstehst du, aber jetzt, wo die Aussicht besteht, dass wir ihn wirklich finden in seinem eigenen Haus …« Weiß legte den Arm um ihn. »Das wird schon, glaub mir. Klar, unangenehm. Geht aber vorbei.«
Auf der Fahrt wurde nichts gesprochen. Sie saßen hinten, vorne zwei Polizisten, ein Er und eine Sie, jung. Sie machten einen angespannten Eindruck, fast bedrückt. Weiß hatte ihn als »Diplomingenieur Galba, der Chef des Vermissten, ein Schulfreund von mir« vorgestellt, was unverständliches Gemurmel der beiden hervorrief. Ist das normal, dachte Galba, dieser Auftrieb, drei Mann hoch wegen einer Vermisstensache, einer davon der Vizepostenkommandant, hieß das so? Er würde fragen müssen. Überhaupt: fragen, Interesse zeigen. Es wäre gut, sich Weiß gewogen zu erhalten. Als »Schulfreund«. Er zweifelte nun, ob es eine so gute Idee gewesen war, sich mit Weiß verbinden zu lassen. Was hatte er sich davon erhofft? Das wusste er schon nicht mehr. Ich mache Sachen und ein paar Stunden später hab ich keine Ahnung, warum ich sie gemacht habe. Das muss aufhören! Ich brauche einen Plan … nein, nein, keinen Plan. Pläne gehen schief. Dieses Spontane, Unüberlegte – vielleicht war das genau richtig: sich so zu verhalten wie die Mehrheit der Leute, nämlich blöd. Kindisch. Das war unverdächtig.
Das Haus des Roland Mathis machte einen etwas heruntergekommenen Eindruck. Die Fassade hätte einen neuen Anstrich vertragen, der Garten war verwildert. Eine Wiese mit drei Apfelbäumen, das Laub vom Vorjahr lag auf dem Rasen, neben dem Komposthaufen ein großer Plastiksack mit Laub; Mathis hatte wohl mit dem Zusammenrechen und Verstauen begonnen und dann die Lust verloren, es kam ja immer neues Laub dazu bis zum ersten Schnee. Der Sack war umgefallen, der Inhalt zur Hälfte verstreut. Es gab ein großes Beet mit halbmeterhoch gewachsenen Stauden. Kraut, das niemand geerntet hatte.
Weiß läutete.
Wenn er, dachte Galba, jetzt rauskommt, krieg ich einen Herzinfarkt. Eine unsinnige Idee, gefährlich, verräterisch. Ich werde mich verraten, dachte er, es kann nicht anders sein, ich bin nicht gebaut für so was … Ich werde …
»Was ist so komisch?«, fragte Weiß.
»Wieso?«
»Du grinst.«
»Mach ich immer, wenn ich nervös bin. Heißt nicht, dass ich etwas lustig finde …«
»Hast du früher nicht gemacht …«
»Hat sich viel geändert gegenüber früher …«
Nach dem dritten Läuten gingen sie ums Haus herum. Die Kellertür war abgesperrt. Weiß schlenderte zum Auto, wo das Paar wartete, redete mit den beiden.
»Was passiert jetzt?«, fragte ihn Galba, als er wiederkam.
»Der Schlosser ist unterwegs. – Was meinst du damit, dass sich viel geändert hat gegenüber früher?«