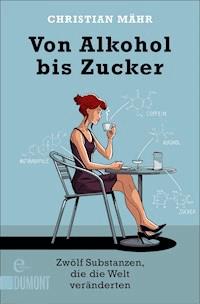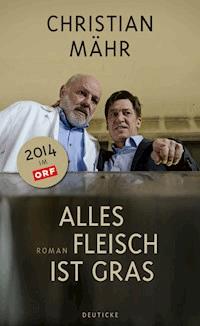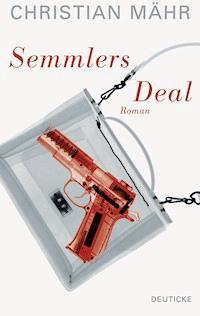Deuticke E-Book
Christian Mähr
Tod auf der Tageskarte
Roman
Deuticke
ISBN 978-3-552-06249-8
Alle Rechte vorbehalten
© Deuticke im Paul Zsolnay Verlag Wien 2014
Schutzumschlaggestaltung: Lowlypaper / Marion Blomeyer, unter Verwendung einer Illustration von Angela Kirschbaum
Satz: Eva Kaltenbrunner-Dorfinger, Wien
E-Book-Konvertierung: Beltz Bad Langensalza GmbH
Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de
Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke
Prolog
Der Himmel hatte aufgeklart, was nicht seiner Erwartung entsprach. Gedacht hatte er, die Fahrt in diese entlegene Ecke würde vergeblich gewesen sein. Wie so vieles andere in seinem Leben. Aber jetzt besserte sich seine Laune. Das Haus fand er schnell, das dritte nach dem Ortseingang, rechts oben, das konnte man nicht verfehlen. Er bog von der schmalen Straße ab und fuhr die noch schmalere Zufahrt hinauf; es sei geräumt, hatte es geheißen, richtig, aber geräumt heißt nur, dass der Bauer, der das mit seinem Traktor erledigt, mit dem vorn montierten Schubschild den Schnee wegschiebt – den ganzen Schnee (von der einen Schneeperiode zu Weihnachten) bis auf die unteren zwei, drei Zentimeter, die bleiben liegen und verfestigen sich mit jedem Fahrzeug zu einer immer glatteren, später eisigen Bahn. So ist das halt, er hatte nichts anderes erwartet. Er schaltete den Vierradantrieb ein, der Suzuki spurte den Weg hinauf wie auf Schienen. Er freute sich, er liebte den Wagen. Es gibt eben keine schlechten Straßen, es gibt nur unzureichende Autos. Natürlich, wenn es frisch geschneit hat … aber der Bauer mit seinem Traktor kommt dann jeden Tag, die Gemeinde bezahlt dafür, da kann man nichts sagen.
Der Weg war nicht steil und nicht lang. Er stellte den Suzuki ab. Genügend Platz, das war schon einmal gut, Parken hinter dem Haus gegen den Hang zu, auch das war besser als vorn, wo jeder sehen könnte, was aus- und eingeladen wurde. Er nahm den Alukoffer und das Stativ vom Rücksitz und ging zur Tür. Der Schlüssel passte, da hatte er auch schon anderes erlebt, aber da hing ja auch eine stabile Marke am Bund mit der Aufschrift »Ebnit«. Wie das eben Menschen machen, die in allen Dingen eine gewisse Ordnung halten, ihre Schlüssel beschriften, den Ort draufschreiben, wo das Ferienhaus steht. Und dem Gast nicht den Schlüssel zum heimatlichen Holzschuppen mitgeben, der dann nicht passt. Tausend Meter höher und vierzig Kilometer weiter, nachts um zwei. Auch schon vorgekommen. Dieser Schlüssel passte.
Es war eiskalt im Haus.
Strom vorhanden, Wasser, alles da. Er trat in den großen Wohnraum, öffnete die Schiebetür auf den Balkon. Schön breit, wie Martin Grau gesagt hatte, drei Meter mindestens. Im vorderen Teil lag der alte Schnee so hoch, dass dort an eine Aufstellung nicht zu denken war, aber in der Nähe der Tür schützte das überstehende Dach. Hier setzte er das Stativ ab, öffnete den Alukoffer und nahm sein Fernglas heraus. Nichts, was man sich gemeinhin unter diesem Begriff vorstellt. Es war laut Prospekt ein »Semi-Apo-Bino« mit 88 Millimeter Objektivdurchmesser und seine neueste Erwerbung. Zwei kurze, aneinander montierte Fernrohre, schwarz lackiert, am unteren Ende machte die Optik einen Neunzig-Grad-Knick; die Okulare schauten nach oben, und nur von oben konnte man hineinschauen, nicht von hinten, wie bei einem gewöhnlichen Fernglas. Das ist praktisch, wenn man das Glas oft oder ausschließlich nach oben richtet, auf den Himmel, man würde sich mit einem normalen Fernglas den Hals verrenken. Das »Semi-Apo-Bino« war auch dafür gedacht, auf den Himmel zu schauen, diente ausschließlich astronomischen Zwecken, nicht zur Beobachtung der Rehlein am Waldesrand. Ohne Stativ war es nutzlos, es wog über sechs Kilo, das hätte auch Schwarzenegger nicht lang hochhalten können.
Er montierte das Glas, nahm die Objektivschutzdeckel ab, holte sich einen Stuhl aus dem Wohnzimmer. Während der ganzen Zeit grinste er, murmelte beglückt vor sich hin.
Der Himmel. Der Himmel war es, der ihn glücklich machte. Atemberaubend. Einfach nur atemberaubend. Die Fahrt hatte sich gelohnt, das war jetzt schon klar. Und zehntausend Jahre Glück, wie die Chinesen sagen, für Martin Grau, der ihm diesen Beobachtungsplatz zur Verfügung stellte – und weil wir schon dabei sind: auch zehntausend Jahre Glück für die Chinesen, die ein so relativ farbreines Binokular in einer ihrer Sonderwirtschaftszonen hergestellt und zu einem so moderaten Preis nach Europa verkauft hatten, dass er es sich trotz der angespannten Finanzlage des Gasthauses und trotz der unüberwindlichen Abneigung Mathildes gegen sein Astro-Hobby hatte leisten können! Zehntausend Jahre Glück!
Er war nicht der Typ, der leicht ausflippte. Leute, die ihn kannten, hätten sich auf »mürrisch« als das passende Adjektiv geeinigt. Ein angenehmer Zeitgenosse war er nicht. Der Grund der untypischen Euphorie an jenem Abend war schlichte Dunkelheit. Der Himmel – dunkel. Bis auf die Sterne natürlich. Man sieht umso mehr von ihnen, je dunkler der Himmel selber ist. In Mitteleuropa muss man Orte, an denen das der Fall ist, zwar nicht mit der Lupe, aber mit Spezialkarten aus dem Internet und einem GPS suchen. Und wenn man sie gefunden hat, muss man hinfahren, oft sehr weit. Astrofreunde aus Süddeutschland fahren auf die Silvretta, rund zweitausend Meter Seehöhe, weil es dort ein Hotel und einen lichtgeschützten Parkplatz gibt. Das war ihm zu umständlich. Er wohnte in Dornbirn, der größten Stadt Vorarlbergs im lichtverschmutzten Rheintal; die Amateurastronomen nennen das so, für sie ist Kunstlicht eine »Verschmutzung« der natürlichen Umwelt, der Himmel wird durch die Abertausenden Lichtquellen der Zivilisation aufgehellt, die lichtschwachen astronomischen Objekte »ertrinken« im hellen Himmelshintergrund, dagegen helfen auch keine technischen Maßnahmen an ihren Instrumenten, dagegen würde nur eine astronomenfreundliche Gesetzgebung mit strenger Beschränkung der nächtlichen Beleuchtung und drakonischen Strafen für Zuwiderhandelnde helfen. Bei diesem Thema ging er aus sich heraus; seine Freunde wussten das und machten sich über ihn lustig.
»Ich hab mir jetzt so einen Beamer gekauft, wie sie die Diskotheken haben«, hatte Dr. Lukas Peratoner erst letzte Woche in der Runde verkündet, natürlich war er von eins auf zwei an die Decke gegangen, bis die anderen sich das Lachen nicht mehr verbeißen konnten, da merkte er, dass sie ihn wieder einmal drangekriegt hatten. Lichtverschmutzung war eines der wenigen Themen, bei denen er Gefühle zeigte.
Der Südhimmel vor ihm strahlte in Sternenpracht. Er hatte Mühe, Sternbilder zu identifizieren; zu viel Konkurrenz durch Sterne, die man im Rheintal nicht sehen würde, in der Umgebung der gewohnten Konstellationen. Die verschwanden wie bekannte Gesichter in einer Menschenmenge. Am prächtigsten der Orion im Südwesten. Er richtete das Glas auf das Schwert, die Sternenkette unterhalb des Gürtels. Der Orionnebel stach aus der Samtschwärze des Hintergrunds, er wechselte schnell die Okulare auf zweiunddreißigfache Vergrößerung, vertiefte sich in das Studium dieses Gasnebels, den er so noch nie gesehen hatte. Das war keine diffuse Wolke mehr, sondern ein komplexes Gebilde. Deutlich sah er die beiden »Arme«, sogar den kleinen Nebel M43 im Norden. Jetzt bedauerte er, den großen Dobson nicht mitgenommen zu haben. Er hätte mit der höheren Vergrößerung weiter in die helle Zentralregion eindringen können, die Trapezsterne sehen … aber das große Newton-Fernrohr war schwer und sperrig, das nahm man nicht auf gut Glück an einen unbekannten Standort mit. Es hätte ja sein können, dass der Platz ungeeignet war. Musste nur eine Straßenlampe in der Nähe sein, ein Baum an der falschen Stelle. Das konnte ihm ein Laie wie Martin Grau nicht vorher sagen, das musste er selber beurteilen.
Er senkte das Glas in die Horizontale. Er wollte diesen Himmel nicht mit einem Instrument durchforsten, das dafür nicht geeignet war … Blödsinn: Jedes Fernrohr hat seinen Himmel, hatte es früher immer geheißen, also auch das Bino, aber was er endlich einmal sehen wollte, waren fette Galaxien. Galaxien sonder Zahl sozusagen. Dazu brauchte er mehr Öffnung.
Er setzte sich wieder und beobachtete den Waldrand auf der anderen Seite des Tals. Erstaunliche Lichtstärke trotz der hohen Vergrößerung. Jeden Baum konnte er unterscheiden, jeden Ast. Er schwenkte das Glas am Kinoneiger des Stativs weiter herum auf die Siedlung zu. Die ersten Häuser zogen ins Blickfeld.
Ein Bino ist nichts anderes als ein großes Fernglas, man sieht darin alles aufrecht und seitenrichtig. In seinem Spiegelteleskop, das er nicht mitgenommen hatte, wäre alles auf dem Kopf gestanden, man konnte damit keine irdischen Ziele betrachten, in der Astronomie war diese Eigenheit des Strahlengangs egal: Hätte er sich also der Mühe unterzogen, den schweren Newton mit dem Dobsonunterbau mitzuschleppen, wäre er nicht auf die Idee gekommen, die Landschaft zu betrachten. Mit einem astronomischen Fernrohr geht das nicht. Aber er war für den Newton eben zu faul gewesen, hatte sich mit dem Bino begnügt, das man bequem transportieren konnte, in der einen Hand den Koffer mit dem Glas, in der anderen das Stativ. Man darf, wenn man will, alles Folgende also seiner Faulheit zuschreiben.
Die meisten Häuser waren dunkel, es ging schon auf halb zwölf, die Leute am Land machen die Nacht nicht so zum Tage, wie das in urbaneren Gebieten die Regel ist. Hinter den wenigen erleuchteten Fenstern tat sich nicht viel. Entweder der Raum war leer oder von seinem Standort nur eine leere Ecke einsehbar. Oder Vorhänge deckten das Innere ab. Hinter zweien der Fenster ging eine Figur vorbei, er konnte nicht einmal erkennen, ob es ein Mann oder eine Frau war. Apropos Frau, damit das auch klar ist: Nirgendwo wand sich eine Nackte in leidenschaftlicher Umarmung auf einem bequem einsehbaren Bett. Es gab überhaupt kein Bett zu sehen. Er hätte eine Sexszene dem, was er wirklich zu sehen bekam, vorgezogen. Man kann es sich nicht immer aussuchen.
Ein einzeln stehendes Haus auf der anderen Talseite erregte seine Aufmerksamkeit, weil dort das Licht an- und ausging. Er bekam es in den Augenwinkeln mit, richtete das Bino auf das Haus. Ein Feriendomizil, Blockbauweise, moderner, stylisher als das, in dem er sich gerade aufhielt. Große, viel zu große Fenster auf das Tal hinaus. Gehört einem Deutschen, dachte er, so, wie es aussieht. Oder einem Schweizer. Das heißt, formal gehören tut’s einem Vorarlberger Strohmann. Einer der Vorhänge halb zugezogen, der Großteil des Raumes einsehbar.
Mit zweiunddreißigfach hatte er die höchste Vergrößerung erreicht, die das Bino hergab, das Haus mochte zwei Kilometer entfernt sein, im Glas sah er das Geschehen, wie er es mit freiem Auge aus einem Zweiunddreißigstel dieser Distanz, etwa sechzig Meter, beobachten würde.
Er stellte scharf. Eine automatische Geste. Man dreht bei diesen Binos am Okular, wenn man etwa nicht deutlich sieht. Nun wurde alles unscharf, er drehte zurück. Das Bild war vorher schon scharf gewesen, es gibt aber Fälle, in denen das menschliche Gehirn eine Notprozedur einleitet und ein Bild, das wir zwar schon gesehen, aber noch nicht wahrgenommen haben, entstellt und umdeutet, was subjektiv als Verschwommenheit, optische Täuschung oder Ähnliches empfunden wird – alles nur, damit wir nicht wahrnehmen müssen, was wir sehen. Man reibt sich die Augen, schaut noch einmal hin. Vielleicht ist das Skandalon ja schon weg. Wer an einem Fernglas hängt, hat Pech. Er stellt scharf und muss sehen.
Er schloss die Augen, erhob sich, montierte das Bino ab. Er brauchte länger als sonst. Seine Hände zitterten. Seine Lippen auch, dann auch die Zähne, er begann damit zu klappern. Er verstaute alles, lud den Astrokrempel in den Wagen und fuhr los. Vorsichtig die Zufahrt hinunter. Das Haus auf der anderen Talseite lag jetzt im Dunkel, das war auch ohne Fernglas zu erkennen. Er wollte nicht hinsehen, konnte es aber nicht unterdrücken, das Hinsehen. Der Wagen kam abrupt zum Stehen, steckte links in einer Schneeverwehung. Es brauchte einige Zeit, bis er die Reduktion eingelegt hatte und nach hinten rausfahren konnte. Er stellte den Motor ab und lehnte sich im Sitz zurück. Er bemühte sich, tief zu atmen. Tiefe Atmung soll ja gegen Panik helfen, das fiel ihm jetzt ein, das hatte er irgendwo gelesen. Wahrscheinlich in einer Zeitschrift bei Dr. Krager, seinem Hausarzt. Was dort im Wartezimmer auflag, war immer Monate hinter der Gegenwart. Zu Ostern las man von neuen Ideen für Weihnachtsschmuck und Rezepten für Gänsebraten. Daran zu denken tat ihm gut, er gewann Abstand zu dem, was er gesehen hatte. Mentale Kilometer. Das Haus auf der anderen Talseite war dunkel, blieb dunkel. Wie wäre es, wenn es schon die ganze Zeit dunkel gewesen wäre, wenn er gar kein Licht in dem Zimmer gesehen hätte? Dann hätte das Licht auch nichts beleuchtet, oder? Dann hätte er nichts sehen können. Ohne Licht keine optische Wahrnehmung, tut uns leid, da hilft auch kein Fernglas. Er sah wieder zu dem Haus hinüber. Es sah dunkel aus, nicht tot oder so, dunkel halt, wie ein verlassenes Ferienhaus im Winter aussieht, der Besitzer kommt erst in zwei Wochen aus Düsseldorf, es ist dunkel, es ist leer, es ist saukalt in dem Haus, die Wasserleitung abgestellt, damit sie nicht einfriert, die Deutschen vergessen so was nicht, es ist alles so wie in dem Dutzend anderer Ferienhäuser, wie soll es denn sonst sein, Herrgott nochmal?
Er hatte nichts gesehen. Eine Täuschung. Ein Spaß war das auch nicht, etwas im Hirn, eine Blutung … ein leichter Schlaganfall. Na und? Kommt vor. Lieber ein leichter Hirnschlag, als dass er das, was er glaubte, gesehen zu haben, gesehen hatte. Alles war besser … für einen Hirnschlag war er allerdings bemerkenswert gut beieinander, Arme, Beine, funktionierten, er hielt das Lenkrad fest in beiden Händen, bremste, kuppelte, gab Gas. Alles klar, alles im grünen Bereich.
Natürlich fuhr er langsam. Nur kein Übermut jetzt mit seinem atypischen Hirnschlag. Er würde zu Dr. Krager gehen, gleich morgen. Alles schildern, sich überweisen lassen zu einem Spezialisten mit der großen Röhre. Denn ein Tumor konnte es ja auch sein; hat doch keinen Zweck, drum herumzureden, das bringt nichts außer tödliche Verzögerung, Früherkennung ist das Ein und Alles; wenn überhaupt was hilft, dann Früherkennung … er würde dem Doktor erzählen müssen, was er gesehen hatte. Ja, was?
Er hatte es vergessen.
Es war weg. Die Erinnerung schwand, immer mehr Filterschichten schoben sich vor das Gesehene, auch vor die Begleitumstände, das Fernglas, die Hütte von Martin Grau. Gelöscht. Er war froh. Das gehörte sicher zu den Symptomen. Von Hirnschlag oder Hirntumor oder sonst was mit Hirn. Alles kam aus dem Hirn. Gut so. Er wusste nicht mehr, was er gesehen hatte. Aber er wusste, dass es besser war, es käme aus seinem armen, kranken Gehirn als aus der Wirklichkeit, ja so war das. Denn bei seinem Gehirn konnte man etwas machen (oder auch nicht, das war dann Pech), aber an der Wirklichkeit könnte man nichts machen, das wusste er. Und auch noch, dass er lieber tot wäre, als dass die Szene, die er gesehen hatte, real wäre. Ja, man musste es eine Szene nennen, jetzt fiel sie ihm wieder ein, die Szene, das Tableau, die Gestalten. Das Gehirn hatte den Kampf verloren, besser gesagt: der eine Teil, die Amnesieabteilung, gegen die Hauptabteilung von der Wahrnehmung, die immer auf dem schlichten Standpunkt steht: Was es wiegt, das hat’s. Nicht, dass so eine Sache unmöglich wäre, technisch. Technisch ist vieles möglich. Nur in Vorarlberg, im Vorarlberg der Gegenwart war das, was er gesehen hatte, doch nicht möglich, oder? Das festzustellen war aber nicht seine Aufgabe. Das war Sache der Polizei. Er musste die Polizei verständigen.
Er hätte sich besser mehr auf die Straße konzentriert, als über Mögliches und Unmögliches zu spekulieren. Weit außerhalb von Ebnit, schon in der Nähe von Dornbirn, war durch eine Variation des winterlichen Mikroklimas der Belag ein Stück weit vereist. Er kam ins Schleudern, von der Straße ab und fuhr mit geringer Geschwindigkeit gegen einen Baum. Und flog mit dem Kopf an die Scheibe, weil er das Anschnallen vergessen hatte. In der Exaltation des Aufbruchs.
Er verlor das Bewusstsein. Keine Angst, sonst ist ihm nicht viel passiert. Eine Prellung durch das Lenkrad, der Airbag hatte nicht ausgelöst.
Wir brauchen ihn ja noch. Ja, wir brauchen ihn noch. Und viele andere Menschen brauchen ihn auch noch.
*
Zwei Wochen später
Es könnte ja auch ein Stück Holz sein, dachte Rudolf Büchel, das Griffende einer Gartenkralle, das ihm in die Seite gebohrt wurde. Durch das Hemd konnte er nicht unterscheiden, ob das Ding wie ein Stab war oder etwas mit einem Loch, aus Holz oder Metall. Die Umstände sprachen eher für die zweite Variante. Metall mit Loch, ein Rohr. Vor allem sprach der dafür, der es ihm in die Seite drückte, das Rohr. Der Mann sah nicht aus wie jemand, der Scherze machte. Sondern wie der typische Vertreter eines Menschenschlages, dem man nicht gern begegnet. Leute mit unangenehmen Berufen. Geldeintreiber, Angestellte obskurer Securityfirmen, Spezialisten einer Geheimpolizei aus Ost- oder Südosteuropa. Kugelkopf mit Drei-Millimeter-Frisur, markante Brauen, darunter ein Gesicht mit schlechter Laune, die sich seit Kindertagen darin festgefressen hatte; vielleicht kamen die schon so auf die Welt.
Gesagt hatte er nichts, hatte Rudolf Büchel nur mit einem einzigen, durch lange Übung perfektionierten Griff ins Auto bugsiert, sich daneben gesetzt und ihm den rohrartigen Gegenstand in die Seite gebohrt. Der andere war vorn eingestiegen und fuhr los. Den anderen kannte Rudolf Büchel von früher. Bis jetzt hatte er ihn für einen Geschäftspartner gehalten.
»Das Ding ist ein Kleinkaliber«, sagte der, »hat net viel Durchschlagskraft. Aber wennst an Blödsinn machst, schießt der Balkan ein paar Mal hintereinand. Die kleinen Projektile fuhrwerken dann in dir umeinander und zermatschkern dir die Kutteln. Daran verreckst, aber nicht gleich – nur damit wir uns verstehen.«
»Verstehe«, sagte Rudolf, »ich hätte nur gern gewusst …«
»Halt die Goschn«, sagte der Geschäftspartner vom Vordersitz. Es klang nicht unfreundlich. Rudolf schwieg. Sie fuhren durch Dornbirn, als wenn nichts wäre. Was machen die bei einer Polizeikontrolle? Den Beamten erschießen, flüchten? Dann überlegte Rudolf Büchel, wie oft er in zwanzig Jahren kontrolliert worden war. Kein einziges Mal trotz der Liechtensteiner Nummer. Oder deswegen. In seinem Kopf begann sich Panik auszubreiten. Der Mann neben Rudolf, den der Fahrer »Balkan« nannte, hatte bis jetzt kein Wort gesagt. Rudolf hörte textiles Rascheln, traute sich nicht, den Kopf zu drehen. Was er dann hörte, war das charakteristische Glucksen, wenn man aus einer Flasche trinkt. Was getrunken wurde, blieb ihm auch nicht verborgen. Alkoholgeruch breitete sich im Auto aus. Unspezifischer. Es hätte nach Slibowitz riechen sollen, wenn jemand schon »Balkan« hieß, aber das war nicht der Fall. Es roch nur nach reinem Sprit. Wodka vielleicht. Der Fahrer hatte nichts gesagt, aber doch auf das Trinken reagiert; ein Körperzucken, das einem anderen als Rudolf Büchel verborgen geblieben wäre. Dem blieb es nicht verborgen, er war es gewohnt, kaum wahrnehmbare Äußerungen anderer Menschen zu lesen wie eine Botschaft; das Leben, das er führte, das führte er aufgrund dieser Fähigkeit, die ihm freilich keine Unfehlbarkeit verlieh. Manchmal las er die Botschaften auch falsch. Wäre das nicht so, hätte er nicht tun müssen, was er getan hatte, und Leute wie die, mit denen er nun im Auto saß, nie kennengelernt. Daran dachte er – von Panik war er weit entfernt. Er hatte eine Situation wie diese noch nicht erlebt, aber ähnliche. Sie waren unausweichlich.
Sie bogen in die Straße zum »Gütle« ein. Dort gab es ein schönes Gasthaus, Rudolf war oft dort gewesen. Sie werden aber nicht mit mir essen gehen, dachte er. So war es auch. Noch vor dem »Gütle« bog der Geschäftsfreund auf die Straße ins Ebnit ab. Rudolf unterdrückte die Frage, die ihm auf der Zunge lag. Was wollten sie im Ebnit? Ein kleines Bergdorf mit wunderbarer Luft und Natur und so weiter. Jeder kannte dort jeden. Wenn die etwas Illegales vorhatten (das über Freiheitsberaubung hinausging), würden sie dafür doch nicht ausgerechnet ein Walserdorf mit nicht einmal zweihundert Einwohnern aussuchen?
Es war dunkel geworden, das Auto durchquerte das Dorf, fuhr auf die gegenüberliegende Talseite. Dort hielten sie an. Balkan stieg aus, öffnete die Tür auf der anderen Seite und zog Rudolf Büchel am Hemdkragen heraus. Ringsum lag alles schon in tiefer Nacht; Rudolf stolperte auf eine Tür zu, der andere schloss sie auf, trat ein, machte Licht. Offenbar ein Ferienhaus, recht modern eingerichtet, wie Rudolf mit einem Blick feststellte. Langsam beruhigte er sich. Die wollten mit ihm reden, das war es; sonst hätten sie nicht so einen Ort gewählt. Die Sache mit der Entführung, mit der Pistole und so weiter – nur das Machogehabe in diesen Kreisen, offenbar unerlässlich für das Bild, das sie von sich hatten. Er wurde ruhiger. Sie betraten einen großen Raum, das Wohnzimmer des Feriendomizils. Nicht viele Möbel, ein Schrank, eine hypermoderne Sitzecke. Sah nicht einladend aus. Unbequem. Der ganze Raum lud nicht ein zum Verweilen. Das Beste war noch die Panoramascheibe von einer Wand zur anderen. Draußen lag alles im Dunkel, wenn man das Licht ausmachte, müsste der Blick auf das sternbeglänzte Tal prachtvoll sein. Der Mann, der »Balkan« genannt wurde, drückte ihn auf einen Stuhl, blieb dahinter stehen. Der andere mit dem innerösterreichischen Akzent, den Rudolf nicht einordnen konnte, stellte sich ans Fenster, wandte ihnen den Rücken zu. Lange Zeit sagte er nichts. Dann seufzte er, drehte sich um.
»Wo ist das Geld?«
Die Frage hatte Rudolf erwartet. Wenn die Sachen so liefen wie diese, ging es ums Geld. Er verstand nur nicht, warum das erst jetzt auftauchte, nach einem halben Jahr. Es war doch geschäftlich alles in Ordnung gewesen.
»Ich hab Schulden bezahlt«, sagte er.
»Ist noch was übrig?«
»Eine Million oder so …«
»Und wo ist die?«
»Bei mir zu Hause. In einem Koffer unterm Bett.«
Balkan, der bis zu diesem Zeitpunkt kein Wort geäußert hatte, lachte laut auf. Offenbar versteht er Deutsch, dachte Rudolf. Eine große Ruhe überkam ihn. Es war alles vorbei, die schöne Zukunft, alles. Sie wollten das Geld zurück. Er hatte in einem dunklen Winkel des Bewusstseins immer damit gerechnet. Ja, genau damit. Im wirklichen Leben konnte er nicht gewinnen. Gewinnen konnte er nur am Spieltisch. Manchmal. Manchmal auch sehr viel. Er hätte dann nur immer aufhören sollen. Dazu war er nicht imstande gewesen.
»Wirklich«, sagte er, »in einem Koffer unter meinem Bett. In der Wohnung in Dornbirn. Wenn ihr was gesagt hättet …«
»… hätten wir es gleich mitnehmen können, verstehe.« Der Innerösterreicher trat nahe an ihn heran. »Du gibst es also zu?«
»Was?«
Die Ohrfeige traf von links. Er hatte sie nicht erwartet, der Kopf flog in die andere Richtung. Es tat weh, aber nicht so, wie andere Methoden wehtun konnten. Rudolf verstand, das war nur eine freundschaftliche … Aufmunterung. Es war klar, dass sich solche Leute bei geschäftlichen Problemen nicht mit langwierigem Mailverkehr oder dem Austausch anwaltlicher Schreiben aufhielten. Das waren Berufsverbrecher. Andere Leute hätten ihm auch keine zwei Millionen bezahlt. Für das, was er anbieten konnte.
»Ich geb dir jetzt an guten Rat«, sagte der Mann vor ihm. »Bring den Balkan nicht auf die Palme! Der vergisst sich sonst.« Vom Akzent war fast nichts mehr zu spüren. Hochdeutsch hieß das wohl: Achtung, es wird ernst! Aber das hatte Rudolf auch so begriffen. Die Augen standen bei dem Mann zu nah beisammen. Das sah unvorteilhaft aus. Die Brauen fast in der Mitte verwachsen. Einen Job als Verkäufer hätte der nie kriegen können. Aber einen als Geldeintreiber. Rudolf wunderte sich, welche Gedanken ihm durch den Kopf gingen. Er hätte in Panik geraten, wimmern, heulen oder wie ein Wasserfall reden sollen. Aber das ging nicht. Normale Menschen würden sich so verhalten, die meisten. Er spürte nur eine kalte und köstliche Ruhe, die sich von der Körpermitte ausbreitete. Ja, dieselbe Ruhe wie beim Spielen. Nur ging es hier nicht um ein paar Tausender, nicht einmal um eine Million. Auch nicht um zwei. Es ging um sein Leben.
Offenbar war jetzt eine Pause vorgesehen, damit er in sich gehen und die Ohrfeige überdenken konnte. Die Ohrfeige und was danach kam – ob erst noch ein bisschen geprügelt wurde oder man gleich zum Fingerbrechen übergehen würde. Er hörte Balkan aus dem Raum gehen. Balkan hat Durst. Trinkt im Dienst, wenn man das so bezeichnen will. Trotz der Anwesenheit seines österreichischen Chefs. Das konnte nur bedeuten, dass Balkan für das Folgende unerlässlich war – etwas tun musste, was der Chef selber nicht tun konnte. Was mit dem Fingerbrechen zusammenhing. Und den Steigerungen. Wieso glaubten die, dass solche Steigerungen nötig sein würden? Er hatte ihnen das Geld ja schon angeboten. So dachte Rudolf Büchel, als Balkan für einen Moment draußen war. Als Spieler muss man nicht nur die unwillkürlichen Äußerungen der anderen richtig deuten, sondern auch aus ihren bewussten Aktionen die richtigen Schlüsse ziehen. Warum sie diese oder jene Karte ausspielten. Alles im jeweiligen Kontext natürlich.
Er würde diesen Leuten nichts erklären können. Irgendetwas war schiefgelaufen mit dem Deal. Die hatten eine vorgefasste Meinung. Keine Chance, daran was zu ändern. Es ging nicht um eine Rückzahlung, eine Rückabwicklung des Geschäfts.
Es ging um Bestrafung. Um eine Art der Bestrafung, die sogar für abgebrühte Verbrecher so furchtbar war, dass nicht einmal sie die ohne weiteres durchführen konnten. Balkan kam zurück. Der Alkoholdunst war unverkennbar, Rudolf drehte sich halb um. Balkan sollte die Bestrafung durchführen. Die keineswegs darin bestand, einem die Scheiße rauszuprügeln. Dafür hätte ein Typ wie Balkan keinen Alkohol gebraucht. Der Mann sah zum Erbarmen aus. Schweiß auf der Stirn, und die Haare standen ab. Hatte er sich die Haare gerauft? Die Pistole hatte er vorne in den Gürtel gesteckt. Sehr nachlässig, wenn er sich vornüberbeugte, konnte sie rausfallen. Und, ja – er schwankte. Der gute Balkan schwankte.
Diese Leute unterschätzten ihn. Er spürte das, sie strahlten es ab wie wattstarke Sender. Es war ein verbreitetes Phänomen. Spieler werden immer unterschätzt. Süchtige, Schwächlinge wie Säufer oder Junkies, ja, ja, bla, bla. Die Leute schauen nicht so genau hin. Für manche Spieler trifft es zu, aber nicht für alle. Die Leute überlegen nicht, dachte Rudolf Büchel. Spieler ruinieren sich, okay. Aber sie brauchen ziemlich lang dafür, oder? Wie kommt das? Wenn sie so schwach und unfähig sind … woher haben sie das viele Geld, das sie im Lauf von Jahren verspielen? – Sie haben es gewonnen. Nicht alles stammt aus geräumten Firmenkassen und geplünderten Familiensparbüchern. Einen großen Teil gewinnen die Spielsüchtigen. Würden sie immer nur verlieren, würde die Karriere bis ganz unten nicht Jahre dauern, sondern nur wenige Wochen. Wie bei einem Alkoholiker, der nach der ersten Flasche Schnaps tot umfällt. Das ist dann aber kein Alkoholiker mehr, sondern ein Normalbürger, der dummerweise eine Flasche Schnaps getrunken hat. So was kommt vor, hat aber nichts mit Sucht zu tun. Apropos Alkoholiker: Balkan konnte durchaus einer sein. Warum nahmen die für so einen Job einen Säufer? Weil sie keinen anderen hatten. Kein gutes Personal heutzutage. Jede Menge Einbrecher, Schläger, Mörder, aber niemanden für wirklich harte Sachen. Mit viel Blut. Vielleicht war das der Grund.
Rudolf war ganz ruhig. So etwas kam nicht oft vor, dass man die Gewissheit hatte. Dass man nicht verlieren konnte. Fast immer gab es ein Restrisiko. Aber manchmal, sehr selten, eben nicht. Da wusste der Spieler aufgrund außersinnlicher Wahrnehmung, dass er gewinnen würde. So wie jetzt. Rudolf kannte sogar die Waffe. Eine 22er Beretta. Der Kerl hatte sie nicht einmal gesichert. Unglaublich. Wenn sie losging, würde er sich schwer verletzen. »Ungefähr so«, sagte Rudolf Büchel mit ruhiger Stimme, zog Balkan die Pistole aus dem Gürtel und schoss ihn dreimal in die Hoden. Der krümmte sich zusammen, rollte auf dem Boden herum, quiekend wie ein Schwein. Unglaublich hohe Töne. Rudolf stand auf, trat einen Schritt vom Stuhl weg.
»Möchtest du dich dazulegen?«, fragte er den Österreicher. Der schüttelte den Kopf, hob die Hände und seufzte tief. Das Gewimmer von dem Mann am Boden war unerträglich. Rudolf trat neben ihn, steckte ihm die Mündung ins Ohr und schoss zwei Mal. Es herrschte augenblicklich Ruhe.
»Bei jeder verdächtigen Bewegung«, sagte Rudolf Büchel, »nicht nur bei jeder, die du machst, sondern auch bei jeder, von der ich mir nur einbilde, dass du sie machst …« Er vollendete den Satz nicht, deutete nur mit dem schlanken Lauf der Waffe auf den Toten. Der Österreicher nickte.
»Setz dich«, sagte Rudolf. Der Mann nahm auf einem der beiden Sessel Platz, auf den anderen setzte sich Rudolf.
»Meine Idee war es nicht«, sagte der Österreicher. Seine Stimme klang ruhig. »Es kam natürlich von ganz oben.« Er blickte zur Zimmerdecke.
»Ja, schön, das kann ich mir denken. Und worin bestand sie, diese Idee?«
»Nun ja … eine Art … Rädern.«
»Was?«
»Rädern. Das ist eine Hinrichtungsart aus dem Mittelalter. Dabei werden die Knochen systematisch …«
»Ich weiß, was Rädern ist! Das brauchst du mir nicht zu erklären. Seid ihr verrückt geworden oder was?« Seine Stimme überschlug sich. Jetzt kam der Schock. Der von der eigenen Tat (immerhin hatte er grad jemanden umgebracht) – verstärkt durch die Enthüllung des Gegenübers. Er begann zu zittern, er sah es selber an der Mündung der Beretta. Der Österreicher musste das auch sehen, aber er schien gar nicht darauf zu achten.
»Die waren halt sehr aufgebracht, die Herren da oben. Ich soll eine Exempel statuieren, hat es geheißen …«
»Wo habt ihr denn das Rad? Im Kofferraum?« Rudolf Büchel begann zu lachen, auch ein Laie hätte die blanke Hysterie herausgehört.
»Du wirst lachen, aber die dachten tatsächlich an ein Wagenrad, so ein altes, echtes mit einem Eisenreifen drum rum. Also bitte, wo soll ich denn heutzutage so ein Rad hernehmen? Aus einem Heimatmuseum klauen? Wagenräder haben doch heute Gummireifen, die müsste man erst abmachen, zum Beispiel von einem Reserverad oder so …« Er sah bekümmert aus. Die Erinnerung an die Suche nach Ersatz für ein mittelalterliches Marterinstrument schien ihn immer noch mitzunehmen. »Ich hab denen das ausreden können, das mit dem Rad. Es ist ja doch nur auf irgendeine Autofelge rausgelaufen, das hat keinen Stil. Die legen sehr viel Wert auf Stil, das war unser Glück …«
»Sie haben drauf verzichtet – aufs Rädern?«
»Äh … nicht wirklich. Sie haben gesagt, wir sollen einen großen Hammer nehmen.«
»Was?«
»Ja, so einen zum Zaunpfähleeinschlagen.«
»Und den habt ihr mit? Im Auto?«
Der Österreicher hob die Hände in einer Abwehrgeste. »Beruhige dich, wir hätten dich vorher umgebracht, sauberer Genickbruch, keine Frage, du hättest gar nichts gespürt, ehrlich! Ich hatte das mit Balkan abgesprochen, so was Perverses machen wir nicht, alles, was recht ist, aber es gibt Grenzen …«
Rudolf Büchel glaubte alles, was er hörte. Nur nicht den letzten Satz mit dem vorher Umbringen. Einen Augenblick überlegte er, den Österreicher ins Knie zu schießen, erst ins linke, dann ins rechte, und ihn dann verrecken zu lassen. Die Ratio gewann aber die Oberhand.
»Warum?«, fragte er. »Was hat die so aufgebracht?«
»Ganz einfach. Weil du sie beschissen hast. Deshalb diese … diese Hinrichtungsart und dann – ja, richtig, das hätt ich fast vergessen, dann sollten wir den Leichnam irgendwo ablegen, wo er garantiert gleich gefunden wird, damit’s a großes Bahö gibt …«
»Was gibt? Ba-hö?«
»An Auflauf … an Rummel … eine öffentliche Erregung, verstehst? Als Warnung an alle, die was es angeht, dass man sich es nicht gefallen lasst, dass man buckelfünfert wird …«
»Was?«
»Verarscht.«
»Ach so. Verstehe. Trotzdem …«
»Ja, nennan mas a Überreaktion, da bin i ganz bei dir, aber was soll i sagen, ma muaß des aus der Sitation heraus verstehn, es hat do Vorkommnisse …«
»Was für Vorkommnisse? Was soll das überhaupt alles heißen?«
Der Österreicher hob beschwichtigend die Hände. »Es hat net funktioniert.«
»Was?«
»Des Verfahren, was du denen verkauft hast. Es hat einfach net funktioniert. Es is net des herauskommen, was sie sich erwartet ham.« Er zuckte die Achseln, schien sich innerlich zu straffen und verfiel wieder ins Hochdeutsche. »Bitte, das hab ich intern so gehört. Direkt gesagt hat mir niemand was – von oben, mein ich.«
»Da war doch eine Probe dabei …«
»Ja, die Probe. Hundert Milligramm.«
»Wird so sein. Mit dem Technischen hab ich mich nie beschäftigt, das hat alles ein Angestellter erledigt. Und der ist hundertprozentig zuverlässig. Also komm mir jetzt nicht mit so einem Scheiß! Das Geschäft ist ordnungsgemäß abgewickelt worden. Ihr wolltet das Verfahren, und die Probe war der Beweis, dass es funktioniert. Die Probe hätte sich ohne das Verfahren ja gar nicht herstellen lassen. Sagt mein Angestellter jedenfalls. Und ihr habt das geglaubt, sonst hättet ihr ja auch nicht den Preis gezahlt …«
»D’accord, reg dich net auf, ich erzähl ja nur, was dann passiert ist. Wir haben auch Fachleute, die haben das dann ausprobiert, das Ergebnis war negativ. Und die sogenannte Probe, sagen die, habt ihr von irgendwo anders her, jedenfalls nicht aus eurem Wunderverfahren. Ein glatter Betrug, sagen die.«
Rudolf Büchel schüttelte den Kopf. Sein Interesse schwand. Blödes Technikergezänk. Streit um irgendwelche wissenschaftlichen Details. Das langweilte ihn. Er konnte wissenschaftliche Details nicht leiden. Wie er überhaupt die Naturwissenschaft nicht leiden konnte. Schon, weil sein Vater davon begeistert war und darin aufging. Er hätte nicht auf Lässer hören sollen. Er hätte sich nicht dazu überreden lassen sollen, sich an seinem Vater zu rächen. Und gleichzeitig seine Schulden zu bezahlen. Er hätte sich eine Pistole besorgen und den Wucherer umlegen sollen. Und die Schläger gleich dazu. Er war dazu imstande, das hatte man ja vor ein paar Minuten gesehen. Jetzt ging es ihm schon viel besser. Er konnte jemanden umbringen. Ohne mit der Wimper zu zucken, wie man sagt. Es machte ihm nichts aus. Nur gewusst hatte er das nicht. Bis heute. Gewalt, gar Tötung, war in seinem Repertoire nicht vorgekommen, nicht vorstellbar gewesen. – Aber darüber zu lamentieren brachte nichts. Er hatte einen komplizierten Weg gewählt und damit einen Haufen Schwierigkeiten. Momentan fehlte ihm jede Vorstellung, wie er aus denen herausfinden sollte. Aber vielleicht war das auch nicht nötig. Der Österreicher schien sich ähnliche Gedanken zu machen. Jetzt zeigte er auf. Er zeigte auf wie in der Schule, wahrhaftig! Rudolf Büchel nickte gnädig.
»Wir stecken beide in der Scheiße«, begann der Verbrecher. »Du und ich. Du, weil diese Leute nicht lockerlassen, bis du weg bist vom Fenster, das darfst du glauben, die vergessen so was nicht. Und ich, weil ich das Ding vermasselt habe.« Er deutete auf Balkan, der alles und in jeder Hinsicht hinter sich hatte. »Betrachten wir unsere Chancen: Du kannst mich natürlich auch noch erschießen, das will ich gern zugeben, aber dann sitzt du in dieser Hütte mit zwei Leichen. Was machst du dann? Wohin damit? Was wird der Eigentümer der Hütte sagen, wenn er hier auftaucht? Wer ist das überhaupt?«
»Ja, wer ist das?«, fragte Rudolf Büchel.
Der andere lächelte. »Siehst du, das ist eine Information, die du brauchst – wenn du das alles allein durchziehen willst.«
»Weiter«, sagte Rudolf Büchel.
»Jetzt nehmen wir einmal an, du erschießt mich nicht. Dann könnte ich dir helfen, aus der Sache rauszukommen. Und mir natürlich auch.«
»Und zwar wie?«
»Meine … Auftraggeber wollen deine Leiche in einem bestimmten Zustand an einem aufsehenerregenden Ort aufgefunden wissen. Wobei es ihnen auf den Zustand ankommt, aber nicht auf die Identifizierung, verstehst du?«
»Nicht ganz …«
»Die wollen, dass jemand eindeutig Zugerichteter gefunden wird, aber man soll nicht wissen, wer das ist.«
»Das ist doch Blödsinn heutzutage! Zahnschema, DNA – die identifizieren einen doch noch nach Jahrhunderten. Beim Ötzi haben sie nach fünftausend Jahren festgestellt, dass er Verwandte in Sardinien hat – oder so ähnlich …«
»Ötzi ist ein gutes Beispiel«, wandte der Österreicher ein. »Man kann nämlich auch sagen, dass Ötzi, obwohl er umgebracht wurde, fünftausend Jahre nicht vermisst worden ist! Wenn ihn jemand vermisst hätte, dann hätte ihn der gesucht, gefunden und wahrscheinlich beerdigt. Er wäre schon lang zu Staub zerfallen. Wir wüssten gar nichts über ihn.«
»Und was hat das mit mir zu tun?«
»Auch dich wird niemand vermissen. Du lebst allein, deine Eltern sind tot, die entfernteren Verwandten wollen wegen deines Lebenswandels nichts mit dir zu tun haben. Die würden sich erst melden, wenn es was zu erben gäbe.«
»Du bist ja gut informiert …«
»Das gehört zum Berufsbild. – Dich wird niemand vermissen. Vor allem deshalb, weil du es wegen deiner Finanzprobleme vorgezogen hast, das Weite zu suchen. In Richtung Südamerika, worauf eine vage elektronische Spur deutet. Dort verschwindet dann alles, sozusagen im Nebel des Regenwaldes.«
»Das heißt aber, ich kann mich hier nicht mehr sehen lassen.«
»Wieso denn? Verschwunden bist du für die dort. Hier bist du nicht verschwunden, wozu auch? Hier hat es ja überhaupt kein Problem gegeben, und es gibt nur eine Verbindung zwischen hier und dort. Mich, verstehst du?«
»Ja, das tu ich schon.« Rudolf Büchel überlegte eine Zeitlang. Er stellte sich die Situation in all ihren Verästelungen und möglichen Konsequenzen vor. Darin war er gut. Nach ein paar Sekunden wurde ihm klar, dass bei der Sache noch etwas fehlte. »Hör zu«, sagte er, »ich geb dir hunderttausend, keinen Cent mehr, also versuch nicht, herumzufeilschen, das verärgert mich nur.«
Der Österreicher hob die Arme. »Also schön, das ist nicht das, womit ich gerechnet hatte … andererseits ist es schön, dass du mitdenkst und verstehst …«
»… dass so jemand wie du nichts ohne Geld machen kann, und zwar überhaupt nichts. Aus Prinzip. Du würdest einem ohne Bezahlung nicht einmal sagen, wie spät es ist …«
»Ich hätt es nicht besser formulieren können. Es geht da ums Prinzip. Gratisarbeit ist der Anfang vom Ende, glaub mir!« Er lächelte. »Wenn das geklärt ist, wir also beide hier rausmarschieren, sollten wir auch gleich überlegen, wieso das Ganze nicht funktioniert hat …«
»Ich hab dir doch gesagt …«
»Ja, ja, ich glaub dir auch. Du bist ein Spieler, du hast doch keine technischen Interessen – es muss also von deinem Angestellten ausgehen, diesem Lässer.«
»Wenn du glaubst, dass der eine Linke gedreht hat, liegst du falsch. Es heißt ja oft, man kann nicht in Menschen hineinschauen, aber das ist Blödsinn. Natürlich kann man das, manche wenigstens …«
»Du zum Beispiel …«
»Allerdings. Ich lebe sozusagen davon. Und ich sag dir, der Lässer hat sich da gar nichts ausgedacht, dazu ist er nicht fähig.« Rudolf Büchel steckte die Pistole ein und stand auf. Er trat ans Fenster, wandte dem Österreicher den Rücken zu. Der hätte ihn von hinten anspringen und überwältigen können. Als ehemaliger Soldat einer Spezialtruppe, was er wahrscheinlich war. Der tat das aber nicht. Zu den Fähigkeiten eines Spielers gehörte auch, einzuschätzen, wann und wem man trauen durfte. Der Österreicher stellte sich neben ihn.
»Wenn sich der Lässer nichts Blödes ausgedacht hat, wenn also das Probestück kein Fake war – was ist dann eigentlich passiert?«
»Das ist eine Frage, die mich seit etwa zwanzig Minuten auch beschäftigt. Man sollte das aufklären.«
»Du hast recht«, sagt der Österreicher. »Es ist unerklärlich, eine Art Geheimnis. Das müssen wir lösen. Geheimnisse hinter dem eigenen Rücken sind immer schlecht.«
»Wir müssen uns mit dem Lässer unterhalten«, sagte Rudolf Büchel.
»Intensiv«, sagte der Österreicher. »Zuvor müssen wir allerdings eine den Vorgaben entsprechend präparierte Leiche … wie sagt man da? … anfertigen?«
»Egal, wie du es nennst, es ist auf jeden Fall eine Sauerei.«
»Da hast du recht. Und deshalb hilfst du mir dabei.« Rudolf Büchel seufzte, sagte aber nichts.
»Ich hol den Hammer. Mach das Licht aus.«
1
Matthäus Spielberger drückte den Knopf am Kabel über seinem Bett, worauf sich das Oberteil mit elektrischem Surren aufrichtete. Er selber richtete sich auch auf, ohne dafür etwas tun zu müssen, was ihm zwar möglich gewesen wäre, sich aber nicht empfahl. Bei jeder Bewegung tat ihm der Kopf weh, nicht wahnsinnig stark, aber doch so, dass er die Bewegung vermied. Der Kopf war eingebunden.
»Wie geht’s dir?« Mathilde beugte sich über ihn und lächelte ihn an. Sie sah besorgt aus, furchtbar besorgt.
»Kopfweh«, sagte er. »Wer ist im Gasthaus?«
»Angelika, die macht das schon. Ist ja jetzt nicht so viel los.«
»Du weißt, wer Angelika ist?«, fragte Dr. Peratoner von der anderen Bettseite her. Die Deckenlampe des Krankenzimmers spiegelte sich in seiner Glatze, sein Gesicht trug den Ausdruck schwerer Sorge, bei ihm deutlicher als bei Mathilde, mit der Matthäus immerhin verheiratet war; so jemanden wünscht man sich als Arzt, dachte Matthäus, aber Peratoner war kein Arzt, nur Chemieprofessor am Gymnasium und pensioniert.
»Wer sind Sie?«, fragte Matthäus. »Und wer ist diese Frau?« Lukas Peratoner schnappte nach Luft und stand halb auf, es hob ihn gleichsam vom Sitz. »Um Gottes willen!«, stieß er hervor, »wie ich befürchtete, unser Matthäus leidet an retrograder Amnesie durch das Hirntrauma …«
»Ach was«, sagte Mathilde, »nur ein Anfall akuter Kindsköpfigkeit!« Sie gab Matthäus einen leichten Stoß.
»Hilfe!«, rief Matthäus, »in diesem Spital werden Patienten misshandelt! Dr. Peratoner, ich weiß, wer Sie sind, jetzt ist es mir wieder eingefallen, wie können Sie das zulassen – als Landtagspräsident!« Mathilde lachte wider Willen, sie wusste, sie sollte ihn bei dem Blödsinn nicht auch noch ermuntern, aber sie konnte sich nicht helfen, sie lachte bei seinen Einfällen immer. Dr. Peratoner setzte sich mit säuerlicher Miene.
»Wenn du nur deine Späße machen kannst! Wir alle waren krank vor Sorge …«
»So, wart ihr – das ist nett. Aber überflüssig, mir ist nichts passiert. Eine Gehirnerschütterung, sagt der Arzt.«
»Eine Commotio cerebri, vulgo Gehirnerschütterung«, begann Dr. Peratoner zu dozieren, »ist immerhin eine Gehirnverletzung mit mehr oder weniger ausgeprägten Funktionsstörungen des Organs, am sichtbarsten davon die Bewusstseinsstörung. Damit ist nicht zu spaßen, der volkstümliche Ausdruck Gehirnerschütterung ist ein merkwürdiger, vor allem aber unstatthafter Euphemismus.« Während er sprach, ging er vor dem Krankenbett auf und ab, die Hände am Rücken verschränkt; bevor er umkehrte, wippte er jeweils mit den Zehen. Matthäus verspürte ein unbändiges Verlangen, ihm ein Papierkügelchen in den Rücken zu schießen, leider hatte er keines.
»Du musst mir ein Gummiband mitbringen«, sagte er zu Mathilde.
»Was?«
»Ach, lass nur …«
»Was in deinem Falle auffällt, lieber Freund«, setzte Peratoner fort, der das Schwätzen während seiner Rede gewohnt war, »ist das Auftreten einer erheblichen retrograden Amnesie, wie mir dein Arzt, Dr. Rösch, mitteilte!«
»Was wolltest du denn im Ebnit um diese Zeit?«, fragte Mathilde.
»Keine Ahnung, ich kann mich nicht erinnern, dass ich da reingefahren bin …«
»Ebendas ist die retrograde Amnesie«, erklärte Lukas Peratoner. »Und eben sehr ausgeprägt … das gefällt mir gar nicht. Ihr müsst verstehen: Eine anterograde Amnesie, die sich auf den Unfall und eine kurze Spanne danach bezieht, ist vollkommen normal, aber ein Gedächtnisverlust über eine so lange Zeitspanne davor gibt doch zu denken.«
»Mach dir keine Sorgen, mir geht’s gut …«
»Ein solcher Gedächtnisverlust«, setzte Peratoner fort, als ob Matthäus gar nichts gesagt hätte, »lässt doch auf tiefer gehende Schäden schließen.«
»Ja, ja, wird so sein …« Matthäus schwang die Füße aus dem Bett.
»Wo willst du denn hin?«, fragte Mathilde.
»Na, wohin wohl? Heim natürlich. Kannst du mir meine Sachen einpacken? Sind alle im Schrank.«
Sie schob seine Beine mit sanftem Druck ins Bett zurück. »Von Heimgehen kann keine Rede sein! Der Arzt sagt, du bleibst mindestens noch drei Tage zur Beobachtung.«
»Ebendies wollte ich dir ja vermitteln«, sagte Peratoner, »du bist längst nicht so weit, dass ans Aufstehen zu denken wäre, geschweige denn ans Heimgehen! Es liegt mir fern, dich zu beunruhigen, lieber Freund, aber du solltest diese Verletzung nicht auf die leichte Schulter nehmen und ärztlichen Rat strikt befolgen!« Er setzte sich wieder. Der Vortrag war also beendet. Dr. Peratoner neigte zum Vorträgehalten mit begleitendem Herumgehen, eine berufsbedingte Verhaltensdeformation durch jahrzehntelangen Frontalunterricht. Matthäus dachte, was er bei solchen Gelegenheiten schon oft gedacht hatte: Das muss man aushalten können. Sein Reden, sein Herumgehen, sein Verhalten. Überhaupt den ganzen Mann.
»Apropos Verletzung, was ist mit dem Auto?«
»Die Stoßstange ist hinüber und unten irgendwas verbogen, sagt der Hämmerle von der Werkstatt.« Mathilde seufzte. »Aber mach dir keine Sorgen, ich regle das schon; er macht mir einen guten Preis.«
»Wenn ich dich nicht hätte!« Matthäus trat das Wasser in die Augen.
»Wer ein solches Weib errungen«, deklamierte Dr. Peratoner, »stimm in unsern Jubel ein, nie wird es zu hoch besungen …«
»… Retterin des Gatten sein«, setzte Mathilde fort. »Fidelio, Schluss vom zweiten Akt, ich weiß.« Manchmal ging ihr dieser Freund ihres Mannes auf die Nerven. Seine anderen Freunde übrigens auch, die meisten von ihnen. Manchmal ging ihr auch Matthäus auf die Nerven. Jetzt zum Beispiel. Er nahm den Unfall zu leicht, er nahm ja alles andere auch zu leicht; das Gasthaus, die Beziehungsprobleme der Tochter, die wirtschaftliche Lage.
»Bei deinen Sachen war auch noch das«, sagte sie und zeigte einen Ring mit zwei Schlüsseln vor. »Wofür sind die?«
»Keine Ahnung. Ich denke aber, es wird sich um die Hausschlüssel für das Anwesen im Ebnit handeln …«
»Welches Anwesen?«
»Je nun, das Anwesen, wo meine langjährige Geliebte mit unseren drei Kindern zu Hause ist …«
»Es musste ja so kommen«, mischte sich Dr. Peratoner ein, »ich hatte dir oft und oft abgeraten, die beiden Wohnsitze so relativ nahe beieinander zu haben, das stand schon so vor dreißig Jahren in einem Ratgeber der Perlenreihe.«
»Was für ein Ratgeber?« Mathilde war weniger schockiert als verwirrt.
»Das Büchlein hieß: Bigamie für Anfänger und Fortgeschrittene, glaube ich.« Sie versetzte dem Professor über das Bett hinweg einen Stoß, dass er fast hintenüber vom Stuhl fiel. Die Männer lachten, Matthäus hell und klar, Peratoners Lachen klang wie Ziegengemecker.
»Idioten!«, schimpfte sie. Aber sie war erleichtert. Sie hatten sie nicht drangekriegt, nicht richtig … oder doch? Doch. Eine Sekunde – oder auch zwei – hatte sie den Blödsinn geglaubt und war eine weitere Sekunde in die Nähe eisigen Schreckens gekommen.
»Wenn du mir untreu wirst, bring ich dich um«, sagte sie mit leiser Stimme. »Die Schlampe natürlich auch, aber dich zuerst, und sie muss dabei zugucken. Ist dir das klar?«
»Natürlich«, beeilte er sich mit ernster Miene zu versichern, »keine Frage …«
Dr. Peratoner faltete die Hände vor der Brust und deutete eine Verbeugung an. »Meine liebe Frau Spielberger, Sie verzeihen mir doch? Ich konnte einfach nicht widerstehen …«
Mathilde lächelte. Was blieb ihr übrig? Sie hatte sich nicht nur mit den Marotten ihres Mannes, sondern auch mit denen seiner Freunde abgefunden, unter denen die von Peratoner, sie nach dreißig Jahren immer noch zu »siezen«, die harmloseste war. Manchmal dachte sie: Ich bin die einzig normale Person in der »Blauen Traube« und das gilt auch, wenn man Tochter Angelika mitrechnet. Die war zwar nicht so verrückt wie Matthäus und seine Crew, aber anders. Sie stand auf. »Wir kommen dich morgen wieder besuchen«, sagte sie, »wenn du was brauchst, ruf einfach an.« Sie beugte sich vor und drückte ihm einen Kuss auf den Kopfverband, unter dem sich nichts verbarg als eine große Beule, wie ihr Dr. Rösch versicherte hatte; was vielleicht weiter drin los war, könne man ohnehin nicht verbinden, das CT zeige jedenfalls nichts Auffälliges. »Er muss sehr vorsichtig gefahren sein, die Aufprallgeschwindigkeit war wohl gering, da hat er Glück gehabt trotz des fehlenden Gurts.« Das war auch so ein Punkt: Noch nie hatte sie gesehen, dass ihr Matthäus ohne Anschnallen fuhr. Als ihn der Ebniter Manfred Berchtold im Auto neben der Straße fand, hatte Matthäus den Gurt nicht angelegt gehabt.
Auch Dr. Peratoner verabschiedete sich. Matthäus protestierte. Peratoner winkte ab. »Der Arzt verordnete dir Ruhe. Die wirst du in meinem Beisein kaum finden. Und ein Zweites: Ich will dem Verdacht deiner bezaubernden Gattin nicht Nahrung geben …«
»Welchem Verdacht?«, fragte Mathilde.
»Wir könnten in ihrer Abwesenheit Allotria treiben und so seine Genesung verzögern, wenn nicht gefährden!« Sie wandte sich wortlos zur Tür, Dr. Peratoner zwinkerte Matthäus zu und folgte ihr.
»Mich beunruhigt, dass er sich nicht anschnallte«, sagte er auf dem Korridor, »das ist nicht seine Art. Dann dieser Schlüssel …«
»Was soll damit sein?«
»Er war in einem Haus, so meine Theorie. Dort sah er etwas, was ihn zutiefst erschütterte, aus dem Gleichgewicht warf, etwas, das ihn fliehen ließ …«
»Wieso denn fliehen? Darauf deutet nichts.«
»Doch! Nämlich das Versäumnis, den Sicherheitsgurt anzulegen. Er ist doch, Sie werden es bestätigen, meine Liebe, ein Gewohnheitsmensch, der nicht leicht von eingefahrenen Verhaltensweisen abweicht. Wenn ihn etwas davon abbringt, muss es außergewöhnlich sein.« Sie antwortete nicht. Es war genau wie so oft. Wenn man seine umständliche, altmodische Redeweise einmal beiseiteließ, hatte er recht. Und nebenbei das Talent, ihre ureigenen Ängste zu formulieren, die sie lieber unausgesprochen gelassen hätte.
Draußen stiegen sie in seinen alten Ford, mit dem sie auch hergefahren waren. Er brachte sie zur »Blauen Traube« zurück, verabschiedete sich und fuhr weiter. Sie hatte keine Ahnung, was er trieb, wenn er nicht mit den anderen in ihrem Gasthaus hockte. Sie wusste nur, dass er seit Jahren geschieden war, das war irgendwie bekannt. Er sprach, sooft er sich auch über Gott und die Welt verbreitete, nie über persönliche Dinge. Kinder gab es keine, aber das vermutete sie nur, sie hätte es an keiner Äußerung festmachen können. Er lebte im vierten Stock eines Wohnblocks in Dornbirns Grüngürtel, sie war nie dort gewesen. Matthäus schon. Er hatte Lukas Peratoner kennengelernt, als der noch am Gymnasium unterrichtete und abends ins Gasthaus kam, um einen gemischten Wurstsalat oder ein Schnitzel zu essen und zwei, drei Bier zu trinken. Damals war er noch verheiratet gewesen, nicht besonders glücklich, denn glücklich verheiratete Männer sitzen nicht jeden Abend im Gasthaus, hatte ihr Vater immer gesagt, der alte Wirt. Inzwischen zweifelte sie am Wahrheitsgehalt dieser Sprüche; ihr Vater konnte kaum als Fachmann für glückliche Ehen gelten, wenn man seine eigene betrachtete. Mathilde zog es vor, das nicht zu tun, sie dachte, wenn es ihr einfiel, schnell an etwas anderes. Ein Gasthaus bot endlose Möglichkeiten, an etwas anderes nicht nur zu denken, sondern denken zu müssen, jedenfalls ein Gasthaus wie die »Blaue Traube«. Sie hatte oft das Gefühl, wenn sie nur einen Tag aufhören würde, zu denken und gleich danach zu handeln, würden sie am Tag darauf pleite sein. Das stimmte so nicht, es war eine Übertreibung. Aber keine schwere.
Die »Blaue Traube« war eines jener Gasthäuser, die früher das Stadtbild beherrscht hatten. Es gab sie zu Dutzenden. Sie waren alle eingegangen. Heute gab es Restaurants, Cafés, Bars, Ethnolokale und Diskotheken, aber keine »Gaschthüser« mehr. Sie eigneten sich nicht zum »Ausgehen«, schon der Gedanke war absurd. In die »Blaue Traube« ging man »hin«, nicht »aus«. Es wurde nichts geboten, was Ausgehen gerechtfertigt hätte. Außer Hausmannskost und Alkohol.
Sie ging durch die Küche in den Gastraum. Ein paar Schüler saßen colatrinkend an dem großen Tisch in der Ecke, einer hatte ein Heft vor sich. Am anderen Ende des Raums Lothar Moosmann am Stammtisch. Er winkte ihr zu. Sie unterdrückte ein Seufzen und ging zu ihm hinüber. Es gab jetzt in der Küche noch nichts zu tun.
»Wie geht’s ihm?«, fragte er, als sie Platz genommen hatte.
»Du hättest ja mitgehen können, statt hier rumzusitzen.« Der Satz tat ihr leid, kaum, dass sie ihn ausgesprochen hatte. Aber es nützte nichts: Von allen Freunden ihres Mannes behandelte sie den Holzschnitzer am schlechtesten, etwas an ihm provozierte sie. Schon, wie er sich anzog. Kleingewachsene sollten auf ihre Kleidung Wert legen, dachte sie, jeder Fehler sieht an ihnen übertrieben aus. Er trug seine übliche graugrüne Winterstrickjacke über einem rot-weiß karierten Hemd. Sie griff nach seinem Hals, richtete den eingerollten Kragen auf. Das kam bei ihm oft vor, das mit dem Hemdkragen. Vielleicht macht er es absichtlich, dachte sie, bevor er herkommt. Nur, damit ich ihm den Kragen umschlage. Der Berührung wegen. Sie schauderte bei dem Gedanken. Aber die Geste unterdrücken konnte sie auch nicht. So war es immer.
»Herrgottzack, du weißt genau, ich geh in kein Spital!« Seine Flucherei störte sie nicht, das war ihr klar, das amüsierte sie nur. Ihr Vater hatte als frommer Katholik Fluchen nicht ausstehen können und den einen oder anderen deswegen vor die Tür gesetzt. Wenn Lothar da war, wurde in diesem Raum in einer Stunde mehr geflucht als früher im ganzen Jahr. Gefiel ihr das? Sie wollte nicht darüber nachdenken.
»Es geht ihm so weit gut«, sagte sie, »er kann sich nur nicht erinnern, was er im Ebnit wollte. Es ist alles weg.« Lothar knetete die Hände auf dem Tisch, unförmige Pranken. Seine Hände waren zu groß, eindeutig. Der Kopf auch. Vor allem wegen der Frisur. Er schien das graue Borstenhaar nie zu kämmen, es stand nach allen Seiten ab. Er konnte die Hände selten still halten. Wenn ihn etwas bewegte, gar nicht.
»Schlecht«, stöhnte er, »kein gutes Zeichen …«
»Danke! Du baust einen wirklich auf …«
Halb erhob er sich. »Entschuldige, ich wollte dich nicht …« Er legte ihr die Riesenhand auf den Arm. Die Berührung war viel zarter, als es ihm zuzutrauen gewesen wäre. Er verehrte die Frauen, egal welche, und wurde fuchsteufelswild, wenn ihnen jemand wehzutun drohte, egal wer, der konnte sich seine Knochen nummerieren. Ja, Lothar Moosmann verehrte die Frauen. Er hatte bloß keine.
Er setzte sich wieder, unglücklich, weil er sie beunruhigt hatte, und seufzte.
»Also, was ist?«, wollte sie wissen. »Red schon, ich kann’s verkraften!«
»Es ist nur … weil ich gelesen habe, so lange Erinnerungslücken deuten auf einen Schaden, also einen ernsteren, verstehst du, dass ihm etwas davon bleibt …«
»Das ist mir nicht neu. Der Doktor hat mich schon entsprechend aufgeklärt …«
»Was, der Arzt im Spital?« Wieder sprang er halb auf.
»Nein, unser Doktor.« Er setzte sich.
»Offenbar lest ihr alle dieselben Seiten im Internet«, sagte sie, »um mich zu beunruhigen.«
»Ich will das nicht, dich beunruhigen, und der Doktor sicher auch nicht, aber wenn so ein Scheißzeug passiert, so ein verrecktes, macht man sich halt Gedanken.« Sein Blick schimmerte feucht; es war, sie kannte ihn lang genug, nicht der Alkohol, der ihm das Wasser der Rührseligkeit in die Augen trieb. Es war die schiere Angst, dem Freund und Kumpanen könnte etwas zugestoßen sein. Etwas, das ihn anders werden ließ, als sie es alle gewohnt waren. Seine Runde, der Doktor, der Lothar, der Franz-Josef … der würde sich auch noch melden. Es ist verrückt, aber die machen sich mehr Sorgen um ihn als ich, dachte sie mit leisem Unbehagen, das sie gleich mit einem unwiderlegbaren Gedanken abwendete: Ich hab dafür keine Zeit, ich muss ein Gasthaus führen, das – leider, leider – nicht von drei Stammgästen leben kann, vor allem dann nicht, wenn sich ihre Konsumation auf ein paar Bier und einen Lumpensalat beschränkt. Und ein Wiener mit Kartoffelsalat alle heiligen Zeiten. Und was den Wirt betrifft, der guter Dinge in einem Krankenhausbett liegt: Da kann er nichts anstellen, so ist es doch! Und nicht etwa in Augsburg oder München oder Wien bei einer dieser dreimal verfluchten Astronomiebuden wieder ein Okular bestellen. Für vierhundertneununddreißig Euro. Gottverdammte vierhundertneununddreißig Euro! Erschlagen hätte sie ihn können, als sie die Rechnung gefunden hatte. Jetzt kamen ihr die Tränen hoch. Er war manchmal so … so …
»Was hast du?« Wieder legte er ihr die schwere Schnitzerhand auf den Arm. Sollte wohl »begütigend« wirken. Andere Gesten zum Begütigen von Frauen hatte er wohl nicht … Sie riss sich los. »Ach nichts!« Schnell weg von dem Scheißokular! Im Geiste fluche ich mehr als der Lothar laut … »Wenn ich nur wüsste, was er dort gewollt hat! Er kann sich nicht erinnern, überhaupt reingefahren zu sein ins Ebnit.«
»Den Himmel testen«, sagte Lothar.
»Was?«
»Die Dunkelheit fürs Sterngucken. Der Martin Grau hat ihm den Schlüssel für die Hütte überlassen.«
»Welcher Martin Grau?«
»Den kennst du nicht, glaub ich. Ein ORFler. Der will auch anfangen mit der Sternguckerei, überlegt aber noch, ob sich das rentiert und so … der Matthäus lässt ihn dafür erst einmal mitschauen, wenn es gut geht im Ebnit …« Der Schnitzer verstummte, unterdrückte einen Fluch, weil er wieder einmal das Maul nicht hatte halten können. Diese ganze Geschichte sollte sie wissen, die Mathilde als Ehefrau. Nicht er, der Lothar. Aber freuen tat es ihn schon, dass der Matthäus ihm, dem Lothar, von der Exkursion erzählt hatte und nicht dem Doktor zum Beispiel. Ja gut, klar, dem hätte er es als Letztes erzählt, weil der damit geradenwegs zur Mathilde gelaufen wäre, als treuer Vasall, weil er seit zwanzig Jahren in sie verschossen war, der Trottel …
»Er hat’s dir halt nicht erzählt, weil du so dagegen bist. Gegen das ganze Astronomiezeug … vermutlich.«
»Vermutlich, ja …«
»Heilandzack!«, brach es aus ihm heraus, »er ist am Leben und gesund, halbwegs, mein ich, und wo er war, ist auch klar, bei seinem Hobby. Und, verdammt noch eins – das Hobby ist nicht zweiundzwanzig und weizenblond, das muss doch auch was wert sein! Apropos Weizen: Bringst du mir bitte noch eins?« Sie nickte und stand auf. »Heut Abend gibts Spätzle. Magst du?« Diesmal stand er ganz auf, breitete die Arme aus und schickte ihr eine Kusshand nach. »Ich tät sterben für deine Spätzle, Mathilde, das weißt du!«
»Ja, ja. Ich mach dir dann frische.« Sie wusste, dass er nicht zur Hauptgeschäftszeit kommen würde, sondern gegen zehn. Sie ging in die Küche. Kann es sein, dass wir alle nicht ganz normal sind? Ja, das kann sein. Das ist gut möglich. Ach was, wahrscheinlich. Sie hatte diesen Gedanken schon oft gehabt, wenn sie ihre Stammgäste und ihren Ehemann vor ihrem geistigen Auge aufmarschieren ließ. Und ihre Tochter mit Liebeskummer. Liebeskummer als Dauerzustand. Als – wie sagte man da? – als weibliche Lebensform. So, wie manche Frauen Prostituierte sind oder Nonne. Nein, normal war das nicht.
Lothars Weizen fiel ihr ein, sie ging zur Schank zurück. Sie konnte nicht wissen, dass der Ausdruck »nicht normal« eine neue Bedeutung annehmen würde, eine weitreichende, ihr ganzes Leben umfassende. Ihr Leben, das von Matthäus, das der Tochter und der Stammgäste.
*
Matthäus Spielberger kam drei Tage später wieder heim, Tochter Angelika hatte ihn im Foyer des Spitals abgeholt, in zwei Decken gewickelt, weil die Heizung in ihrem Polo nicht richtig funktionierte, und sich mit extremer Fürsorglichkeit um ihn gekümmert. Um das wie Säure an ihrer Seele nagende schlechte Gewissen zu betäuben. Denn während ihr Vater im Krankenhaus lag, hatte sie ihn nicht ein einziges Mal besucht. Es waren nur ein paar Tage, trotzdem … es hatte die Zeit gefehlt, weil die Sache mit Erich in eine kritische Phase getreten war. Nach nur sechs Monaten (eher fünf, wenn man genau ist) hatte sich Erich als das erwiesen, was er aller Wahrscheinlichkeit nach schon am Anfang gewesen war: als egoistischer Arsch ohne Sinn für die Bedürfnisse einer Frau wie Angelika Spielberger … um Gottes willen, wie hört sich das an, dachte sie, wie aus einer Nachmittags-Realityshow, bin ich wirklich schon so weit unten? Sie verdrängte den Gedanken und begann, ihren Vater auszufragen, kompletter Gesundheits-Check. Sie hätte ihm gleich einen mehrseitigen Fragebogen geben können. Er bewies große Geduld. Ja, er schlafe durch, nein, er leide nicht unter Ausfällen gleich welchen Sinnesorgans, sie müsse sich keine Sorgen machen, und seine Kopfschmerzen kämen eher davon, dass er mit dem Schädel gegen die Scheibe geknallt war und eher nicht von übersehenen Blutgerinnseln in seinem Gehirn, und woher sie das mit den Kopfschmerzen überhaupt habe? – Internetrecherche, ach so. Er verkniff sich alle Gegenfragen, die ihm auf der Zunge lagen. An der Art, wie sie schaltete, am unsteten Blick konnte er ablesen, dass wieder etwas ganz und gar nicht in Ordnung war. Aber lange Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass Fragen in dieser Akutphase nicht zu irgendeiner Verbesserung führen würden.
Zu Hause geleitete sie ihn vorn in die Gaststube, obwohl sie das Haus für gewöhnlich von hinten betraten, aber heute war es etwas anderes; an der Theke schälte sie ihn aus den Decken, was alle im Gastraum sehen konnten. Wie sehr sie sich nämlich um ihren alten, verunfallten Vater kümmerte, den sie sogar aus dem Spital nach Hause gefahren hatte!
»Oh!«, sagte Franz-Josef Blum und zwängte seinen Bauch hinter dem Ecktisch hervor, »ein Geretteter! Schaut ihn euch an, der einzige Überlebende der gescheiterten Polarexpedition, mit knapper Not der eisigen Wüste von Ebnit entronnen, allerdings mit furchtbaren Erfrierungen, nehme ich an?«
»Wenn ich für jeden blöden Spruch von dir ein Zehnerle kriegen täte, wär ich ein reicher Mann«, sagte Matthäus Spielberger. Franz-Josef Blum umarmte ihn. »Das ist nur der Schock, der aus ihm spricht«, sagte er zu Angelika. Matthäus befreite sich aus der Umarmung.