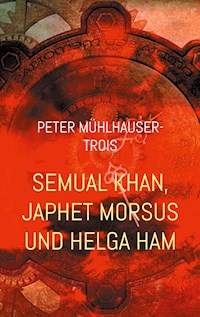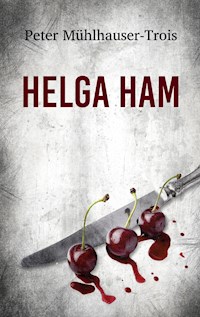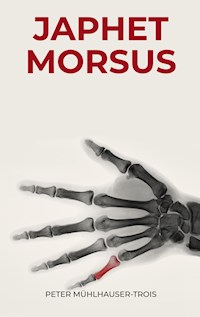2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Er konnte doch nicht seinen Namen vergessen haben? Seine Füße und Hände, die Schuhe und Kleidung, alles besah er sich auf der Suche nach etwas, das ihm bekannt vorkam, das ihm verriet, wie er hieß. Denim stand auf seinem T-Shirt. Ob das sein Name war? Ein Zauberer. Und ein Gewöhnlicher. Eine Geschichte über eine ungewöhnliche Freundschaft. Auftakt der spannenden "Sem" - Tetralogie!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Semuals Eltern werden vor seinen Augen von dem Zauberer Japhet Morsus umgebracht. Um den Mord zu verhindern reist der Dreizehnjährige in die Vergangenheit. Dort hat er vergessen, wer er ist und woher er stammt. Deshalb steckt man ihn in ein Heim für Waisenkinder. Eins davon heißt Japhet Morsus.
Eine Geschichte über Freundschaft und was sie bewirken
kann.
Der Autor
Peter Mühlhauser-Trois, Jahrgang 1983, ist diplomierter Gesundheits- und Krankenpfleger und lebt mit seinem Sohn in der Nähe von Graz. Semual Khan ist sein erster Roman, eine Fortsetzung befindet sich bereits in Arbeit.
Die Erinnerung ist das einzige Paradies, aus dem
wir nicht vertrieben werden können.
Jean Paul
Inhaltsverzeichnis
Verwaist
Aufbruch
Sherlock Holmes‘ Haus
Das Rad der Zeit
Tabula rasa
Fieber
Das CuraNaus
Verkannt
Vier Internate
Albine
Flucht um Mitternacht
Swetlana
Das Versprechen
Non scholae, sed vitae discimus
Das Wettschwimmen
Die Idee
Freundschaft vs. Vernunft
Das Maturum
Ein fast perfekter Plan
Fort
Im Karzer
Wie gewonnen ...
... so zerronnen
Der Unfall
Abgefangen
Eingesperrt
Die Flucht
Der rechte Weg
Verwaist
Sem konnte nicht schlafen. Seit Stunden klebte er am Fenster und starrte in die Nacht. Blitze zuckten über den Wald und entfernt grollte der Donner. Äste knackten und Zweige wirbelten in der Luft, als spiele der Wind mit ihnen Fangen; wieder und wieder knallten sie an das Fenster. Trotzdem wich Sem erst von der Scheibe, als es zu regnen begann und er nichts mehr sehen konnte.
Die Tropfen klatschten wie Hagel auf das Glas. In seinem Zimmer auf dem Dachboden hörte es sich an, als fielen Ziegelsteine vom Himmel. Doch nicht das Wetter hielt ihn wach, sondern die Gedanken an seinen Vater.
Er kommt bald zurück, hatte ihm seine Mutter versprochen. Bald, was hieß bald? Eine Woche? Ein Monat? Ein Jahr? Was, wenn er dieses Mal nicht zurückkommen würde? Wenn er nie wieder zurückkam?
Er schlug mit der flachen Hand gegen die Fensterscheibe. Wo steckst du so lange? Tränen trübten seine Sicht. Sofort rubbelte er sich mit dem Ärmel des Pyjamas die Augen trocken.
Große Jungs weinen nicht! Einen Moment roch er das Rasierwasser seines Vaters. Dabei war es mehr als einen Monat her, dass dieser den Pyjama anhatte, den er jetzt trug. Er biss die Zähne zusammen. Fünf Wochen. Vor fünf Wochen war sein Vater fortgegangen. Zum millionsten Mal. Ohne ihn mitzunehmen. Und das nur, weil er erst dreizehn war. Als würde er noch Windeln tragen.
Es klopfte.
»Semual?«
Sem zuckte zusammen und drehte sich um.
Seine Mutter stand an der Tür und sah ihn besorgt an. Eine Strickweste hing locker über ihrer rechten Schulter. »Du bist noch wach.« Es war eine Feststellung, keine Frage.
Sem nickte.
»Ein fürchterliches Wetter, was?«
»Das ist es nicht«, sagte Sem.
Seine Mutter ging zu ihm ans Fenster und legte beruhigend einen Arm um ihn. Dabei rutschte ihre Weste zu Boden. Sie hob sie nicht wieder auf. »Mach dir um deinen Vater keine Sorgen«, sagte sie leise. »Er schafft das.«
»Er war noch nie so lange fort«, entgegnete Sem.
»Er kommt bald zurück«, versicherte ihm seine Mutter.
Sem trat gegen die Wand. »Das sagst du jeden Tag. Wie lange müssen wir uns noch verstecken?« Er starrte aus dem Fenster. Wie die Welt da draußen wohl aussehen mochte, fernab von dem kleinen Refugium, das ihm seine Eltern geschaffen hatten? Früher hatte er auf einer Schaukel gesessen und seine Mutter hatte ihn angeschubst. Damals gab es noch Spielplätze. Und er durfte nach draußen gehen.
Sem spürte den besorgten Blick seiner Mutter.
»Alles wird gut«, sagte sie, während sie ihm durch die Haare fuhr. Sem hasste das. Brüsk schob er ihre Hände beiseite. Alles wird gut – wie konnte sie nur so etwas Dummes sagen? Nichts würde gut werden. Gar nichts!
Seine Mutter betrachtete ihre Fingernägel. Sie fröstelte. Selten ließ sie sich anmerken, dass auch sie Angst hatte. »Ich verspreche dir ...«, sagte sie, und wurde von einem Blitz unterbrochen, der am Himmel eine feine gezackte Linie formte, die nicht verblasste. Sie legte ihre Hand auf Sems Schulter. »Bleib, wo du bist und rühr dich nicht von der Stelle.« Dann eilte sie aus dem Zimmer.
Bleiben? Sem dachte nicht daran. Er lief ihr nach. Am Treppenabsatz blieb er stehen. Seine Mutter rannte, immer zwei oder drei Stufen auf einmal nehmend, hinunter. Die Haustür flog auf und völlig durchnässt trat sein Vater ein, zusammen mit Männer, die Sem nicht kannte. In Pas Bartstoppeln klebte getrocknetes Blut. Sem wollte zu ihm laufen, die Arme um ihn schlingen und ihn begrüßen, doch das war nicht der richtige Zeitpunkt.
Schnell schlossen die fremden Männer hinter sich die Tür; es waren sieben.
Pa begrüßte Ma mit einem flüchtigen Kuss und umarmte sie. »Ich glaube, wir wurden verfolgt.«
»Was? Von wem?«
»Von Morsus.«
Ma sah ihn entsetzt an.
Sem zuckte zusammen. Morsus? Doch nicht der Morsus? Japhet Morsus? Er krallte sich ans Treppengeländer, um nicht hinunterzufallen. Von allen Zauberern, hieß es, war er der Schlimmste; er hatte die Welt zu der gemacht, die sie jetzt war.
Pa befahl den Männern die Eingangstür zu sichern und lief mit Ma die Treppe hinauf. Oben blieb er stehen und starrte Sem an.
»Ins Zimmer!« Seine Hand wies auf die Tür.
»Aber ...« Sem hatte sich das Wiedersehen mit seinem Vater anders vorgestellt.
»Na los«, sagte Ma.
Gemeinsam eilten sie den Flur entlang.
»Wir haben es. Wir haben es gefunden«, flüsterte Pa.
Ma atmete erleichtert auf. »Das heißt, wir können ...« Eine Explosion im Erdgeschoss verschluckte die Worte.
»Schnell!« Pa schob beide ins Schlafzimmer.
Ma schloss die Tür. »Er ist im Haus?« Ihre Stimme war kaum mehr als ein Flüstern.
Pa nickte. »Meine Leute werden ihn nicht lange aufhalten können. Wir müssen uns beeilen.«
Schreie. Schüsse. Klirrendes Glas.
Sem hielt sich die Ohren zu, rührte sich nicht vom Fleck. Vielleicht war er dafür doch noch zu jung.
Sein Vater sprang in die andere Ecke des Zimmers zu einem viertürigen Wandschrank. Hastig riss er die mittlere Tür auf. »Hier rein!«
Sem reagierte nicht.
»Semual!« Sein Vater schnippte mit den Fingern und Sem kletterte rückwärts in den Schrank.
Sein Vater schloss hinter ihm die Tür. »Egal was passiert, Sem«, sagte er und klopfte mit Nachdruck an den Schrank, »du bleibst da drinnen und rührst dich nicht. Niemand darf wissen, dass es dich gibt, hörst du?«
»Warum nicht?«, fragte Sem.
»Du bist unsere einzige Hoffnung, wenn es nicht klappt«, antwortete Pa.
Sem wollte etwas fragen, brachte aber keinen Ton hervor. Er kauerte sich auf einen Stoß Hemden und schlang die Hände um seine Beine. Durch einen schmalen Spalt zwischen den Schranktüren konnte er draußen seine Eltern sehen.
»Wenn alles gut geht«, Pa wandte sich an Ma, »dann wird all das hier nie passieren.« Er angelte aus seiner Hosentasche ein rundes Etwas und legte es vor sich auf den Boden.
»Ist es das?«, fragte Ma fast ehrfürchtig.
Pa nickte. »Es wird alles gut. Jetzt wo ich die beiden Teile zusammenfügen kann.« Er streckte ihr die offene Hand entgegen.
Ma starrte sie entsetzt an. »Meine Weste«, sagte sie.
»Was ist damit?«
»Sie liegt in Sems Zimmer. Auf dem Fußboden. Darin ist das Rad.«
Im Haus war es plötzlich verdächtig still. Doch nur für einen kurzen Augenblick.
Dann schlug jemand an die Zimmertür. Einmal, zweimal. Sem strengte die Augen an, um besser zu sehen.
Eine Explosion fegte die Tür aus den Angeln. Mit lautem Krachen schlug sie vor seinen Eltern auf. Sie wichen zurück, doch im Türrahmen war niemand zu sehen. Auf einmal bebte der Boden unter Sem, und Trommelschläge, ließen das ganze Haus erzittern. Es war, als würde sich jemand auf sie zubewegen. Sem hielt die Luft an.
»Das war nicht nett«, sagte eine Stimme. Sem sah niemanden.
»Empfängt man so einen alten Bekannten?«
Pa stellte sich vor Ma.
»Wie rührend«, hallte es von den Wänden wider.
Ma schnaubte und trat aufrecht an Pas Seite. »Zeig dich!«
»Du wirst mich nicht wiedererkennen.« Flammen züngelten aus dem Boden, kletterten die Wände entlang nach oben, leckten an den Vorhängen und füllten den Raum mit Hitze. Rote Schatten tanzten über die tapezierten Wände.
»Wo bist du?«, keuchte Pa.
»Hier«, antwortete die Stimme belustigt. »Ich bin das Feuer, das euch umgibt, der Boden, auf dem ihr steht, die Luft, die ihr atmet.«
Ma schüttelte den Kopf. »Nein!« Wegen des Qualms musste sie husten. »Ich will ... dein ... Gesicht sehen, Morsus!«
»Ein letztes Mal, um der alten Zeiten willen?«, fragte die Stimme. »Nun gut.« Die Flammen erloschen, und vor den Eltern stand eine hagere Gestalt; ein schwarz gekleideter Mann mit langen dunklen Haaren und ausgeprägten Kieferknochen. Hässliche Narben entstellten seine linke Wange.
»Dachtet ihr wirklich, ein Haufen Gewöhnlicher könnte mich aufhalten? Mich, den mächtigsten Zauberer aller Zeiten?« Morsus lachte heiser. »Wie nennt ihr euch? Die Erlöser? Wer wird jetzt kommen, um euch zu erlösen?« Morsus ballte seine rechte Hand zur Faust, fixierte seine beiden Opfer. Pa und Ma brachen zusammen.
»Seht ihr, es ist so einfach. Noch einen letzten Wunsch?«
Pa griff wortlos nach Mas Hand.
»Was, kein Ave Maria?«, fragte Morsus süffisant. Er lächelte. »Ronko hat wenigstens gebetet.«
Pa zuckte zusammen.
Ronko? Sem hatte diesen Namen noch nie zuvor gehört.
Morsus lachte.
»Sherlock Holmes‘ Haus«, stammelte Pa und sah zum Schrank.
»Was soll das heißen?«, fragte Morsus.
Sem riss die Augen auf, sog scharf die Luft ein. Diese Worte galten nicht Morsus. Nein. Sie galten ihm!
»Sher- lock«, keuchte seine Mutter.
Sherlock Holmes, wiederholte Sem in Gedanken. Der Detektiv war einer seiner Lieblingsromanfiguren. Mehr noch. Er kannte die von Doyle erschaffenen Bücher alle.
»Was für seltsame letzte Worte«, zischte Morsus.
Sem wollte seinen Eltern helfen. Doch im selben Moment fingen sie Feuer. Zuerst sein Vater, dann seine Mutter. Die Flammen fraßen sich durch den Stoff ihrer Kleider, drangen wie eine Bestie mit messerscharfen Reißzähnen tief in ihre Haut ein. Ihre Körper schwärzten sich und lösten sich auf.
Sem blieb nicht einmal Zeit zum Schreien. Versteinert, vollkommen erstarrt saß er da. Als würde er nie wieder in seinem Leben einen klaren Gedanken fassen können. Dann registrierte er, dass der Nebelschleier vor seinen Augen von den Tränen herrührte, die ihm über die Wangen liefen.
»Asche zu Asche«, sagte Morsus. »Staub zu Staub.« Er verschwand genauso plötzlich, wie er gekommen war.
Mit schmerzverzerrtem Gesicht kippte Sem auf die Seite. Er wollte losbrüllen, konnte aber nicht. Seine Kehle war ohne Kraft, Arme und Hände schienen ihm aus Blei. Er schnappte nach Luft, gierig wie ein Ertrinkender, doch unfähig sie einzuatmen. Es war, als hätte er einen Plastiksack über dem Kopf, der sich mit jedem Atemzug mehr und mehr zusammenzog. So lange, bis er endlich das Bewusstsein verlor.
Aufbruch
Holmes hasste Unpünktlichkeit. Verärgert schielte er auf seine Taschenuhr. Zehn vor Zwölf. Was sollte das? Erst bestellte man ihn mitten in der Nacht in eine leerstehende Kohlefabrik und dann versetzte man ihn. Er schwenkte die Petroleumlampe ein letztes Mal, um auf sich aufmerksam zu machen, doch das Licht durchbrach kaum die Dunkelheit.
»Hallo.« Eine Frau. Die Stimme klang vertraut. Kannte er sie?
»Ich bin hier.« Holmes kniff die Augen zusammen, konnte aber niemanden erkennen.
»Sin ... sind Sie allein?«
Holmes hob die Lampe vor sein Gesicht und nickte.
Im Halbdunkel erschien eine dicht verschleierte Person. »Gott sei Dank, dass Sie pünktlich gekommen sind.«
Pünktlich!? Holmes verkniff sich eine bissige Bemerkung. »Kein Problem«, sagte er stattdessen, »mein Freund und Mitarbeiter Dr. Watson wartet draußen auf uns. Wollen wir nicht ...«
»Nein«, antwortete die Dame mit zittriger Stimme. »Mr Holmes, ich ... ich habe Sie hierhergebeten, weil ich nicht weiß, ob ich Ihnen trauen kann.« Sie schlug den Schleier zurück und zeigte ihr Gesicht. Es war leichenblass.
»Das können Sie, keine Angst«, sagte Holmes in beruhigendem Ton. Er verringerte den Abstand zwischen ihnen, tauchte sie in das Licht, um ihr ein wenig Angst zu nehmen. »Wir werden gewiss bald alles in Ordnung bringen, Mrs ...«
»Khan«, antwortete die Dame, während sie ihn peinlich genau musterte.
»Gut, Mrs Khan, worum geht es?«
Sie seufzte. Unschlüssig faltete sie die Hände wie zum Gebet. Es brauchte einen Moment, bis sie sich durchrang weiterzusprechen. »Um meinen Sohn, Sir! Semual. Er ist verschwunden. Ich fürchte, Japhet Morsus hat etwas damit zu tun. Aber niemand will mir glauben.«
»Oh«, sagte Holmes. Er wich einen Schritt zurück, räusperte sich. »Wenn es um Mr Morsus geht, so sind mir die Hände gebunden. Ich stehe ihm absolut loyal gegenüber. Ich hoffe, Sie verstehen das.«
»WAS? Nein! Nicht Sie auch! Bitte nicht ... ich ...«
Holmes schüttelte den Kopf. Die Lampe zitterte so heftig, dass das Licht im Glas gespenstisch flackerte und erlosch. »Was haben Sie erwartet?«, rief er in die Finsternis. »Niemand stellt sich den Zauberern in den Weg. Auch ich nicht. Hören Sie? Niiieemand!«
Sem riss die Augen auf. Was für ein Traum. Holmes, sein Idol, ein Anhänger von Morsus? Lächerlich. Ein kalter Schauer lief ihm über den Rücken. Morsus! Seine letzte Tat blitze vor Sems geistigem Auge auf, wie Fotografien einer Diashow. Nein! Er schloss die Augen, musste normal atmen, musste sich konzentrieren, aus diesem Albtraum herausfinden. Seine Eltern, tot? Das war ein Traum. Wie der mit Holmes und seiner Laterne. Er lachte über seine eigene Dummheit. Bestimmt suchten seine Eltern schon nach ihm. Er stand auf und knallte mit dem Hinterkopf gegen ein Brett. Argh!
Wo war er? Sem krallte die Finger in ein Stück Stoff und rang nach Luft. Im Kleiderschrank seiner Eltern? Was hatte er hier zu suchen?
Er tastete nach der Schranktür und öffnete sie. Dann richtete er sich auf, stieß mit dem Rücken gegen die Kleiderstange und hob sie aus ihrer Verankerung. Sie knallte auf den Boden.
Er kletterte nach draußen, hielt sich die Hände vor die Augen und linste zwischen seinen Fingern hindurch. Erleichtert atmete er durch und nahm seine Hände vom Gesicht.
Der Mond schimmerte sanft ins Schlafzimmer seiner Eltern. Es sah so aus wie immer.
Alles in Ordnung. Sem lächelte. Nichts passiert. Er wandte sich Richtung Tür und erschrak. Sie war nicht mehr da.
»Was zum ...« Er taumelte an die Wand, krallte die Fingernägel in die Tapete.
Und dann sah er sie. Die Tür lag auf dem Boden. Sie hatte dort nichts zu suchen! Sem schluckte die Tränen hinunter, stieg über die kaputte Tür. Er lief hinaus, zwang seine gefühllosen Beine vorwärts und eilte die Treppe nach unten.
Nichts deutet auf einen Kampf hin. War also doch alles nur ein böser Traum gewesen?
»Ma!«, rief er. »Pa!« Keine Antwort. Sem wollte den Kloß in seinem Hals hinunterschlucken. Es gelang ihm nicht. Er lief in die Küche. Nichts. Die Treppe hinauf in sein Zimmer. Nichts. Nebenan ins Badezimmer. Nichts. Kein Traum!
Sem lief zurück ins Schlafzimmer. Er legte die Hände an den Mund und brüllte aus voller Kehle: »MA! PA!« Doch es war zwecklos. Sie waren tot.
Der glatte Holzboden drückte auf seine Knie, dann auf die Handflächen, auf die Wange.
Er lag genau an der Stelle, an der sein Vater und seine Mutter gestanden hatten, als Morsus seinen tödlichen Zauber sprach. Obwohl es keinen Hinweis darauf gab, dass es hier gebrannt hatte, bestand für Sem kein Zweifel mehr. Japhet Morsus hatte seine Eltern ermordet.
Sem rollte sich auf dem Boden zusammen, nicht gewillt jemals wieder aufzustehen.
Der Tag brach herein, Licht stahl sich in das Giebelfenster, kroch über den Fußboden und glitt über Sem hinweg.
Jemand strich sanft durch seine Haare.
»Semual aufstehen, die Sonne scheint.« Mas Stimme klang weit entfernt.
»Nein, noch nicht«, murmelte Sem, drehte sich auf die Seite - und erschrak. Er lag immer noch auf dem Fußboden, durchgefroren, die Wangen nass von den Tränen. Ma? Er öffnete die Augen. Niemand hier. Sem schluchzte und streckte die Finger aus, in der Hoffnung seine Mutter noch einmal zu berühren.
Ein letztes Mal.
Da fielen die Sonnenstrahlen auf einen Gegenstand. Grelles Licht traf ihn wie ein Schwertstreich. Sem beschirmte die Augen mit der flachen Hand.
Ist es das?, hörte er seine Mutter fragen.
Dann die Stimme seines Vaters. Es wird alles gut. Jetzt wo ich die beiden Teile zusammenfügen kann.
Sein Vater hatte etwas auf den Boden gelegt, kurz danach ...
Nein, nicht daran denken! Sem presste die Augen zusammen. Er wollte nichts mit diesem blitzenden Ding zu tun haben. Deswegen waren seine Eltern tot. Sem schlug sich mit den flachen Händen auf den Kopf. Nichts hören, nichts sehen, nichts ...
Keine Chance. Er spürte das gleißende Licht trotz geschlossener Augen. Als wollte das Ding von ihm wahrgenommen werden. Sem hätte es am liebsten weggetreten. Was nützte ihm dieser Gegenstand? Seine Eltern würden damit auch nicht wieder lebendig werden.
Andererseits ...
Er hielt die Luft an.
Wenn alles gut geht, wird all das hier nie passieren, das hatte sein Vater gesagt – was auch immer das heißen mochte. Sem blinzelte, sprang auf und schnappte sich das Ding. Es sah aus wie eine Münze; kreisrund und flach, aber mit einem Loch in der Mitte. Auf der goldenen Oberfläche war etwas eingraviert. Zahlen? Buchstaben? Da fiel ihm etwas anderes ein.
Meine Weste!, hatte seine Mutter gesagt. Sie liegt in Sems Zimmer. Auf dem Fußboden. Darin ist das Rad.
Sem schluckte. Welches Rad? Er stolperte aus der Tür und wankte in sein Zimmer. Die Weste lag genau da, wo sie seiner Mutter von den Schultern gerutscht war. Was war so wichtig, um dafür zu sterben?
Sem rieb sich die Augen trocken und durchwühlte die Westentaschen. Seine Fingerspitzen stießen auf etwas Hartes. Er zog es heraus und betrachtete es. Die Miniaturausgabe eines hölzernen Wagenrades. Zwölf sorgfältig eingearbeitete Speichen darin, nicht dicker als seine Finger. Sie waren heller und glatt poliert, im Gegensatz zu dem rauen, dunkel gebeizten Rad. Außen um das Rad herum ragten winzige Zacken heraus.
Das Loch in der Mitte entsprach exakt der Größe der merkwürdigen Münze. Ohne nachzudenken, fügte er die beiden Teile zusammen.
Doch nichts geschah.
Sem zitterte. Was hatte er erwartet? Ein Wunder? Ehrlich gesagt – ja. Nichts würde er sich mehr, nichts sehnlicher wünschen, als ein Wunder.
Er kam sich plötzlich sehr dämlich vor, starrte auf das Rad in seiner Hand.
Und dafür waren seine Eltern gestorben? Sem schleuderte das Rad an die Wand, wo es abprallte und geräuschvoll zu Boden fiel. Er biss sich auf die Lippe und schmeckte Blut. Seine Trauer verwandelte sich in Wut. Und Hass.
»Morsus.« Sem sah hoch zur Decke. »Ich finde dich und dann ...« Seine Stimme hallte laut von den Wänden wider, brach beim letzten Wort abrupt ab.
Er fühlte sich schwach, hilflos, allein. Aber Pa hatte ihn als einzige Hoffnung bezeichnet. Er würde ihn nicht enttäuschen.
Unschlüssig betrachtete er das Rad. Was sollte er damit tun? Hier lassen? Nein! Es musste wichtig sein. Sem hob es wieder auf. Schwer lag es in seiner Hand. Eine Weile rührte er sich nicht.
»Jetzt«, sagte er laut. Jetzt war es an ihm, Holmes zu spielen und dem Hinweis seiner Eltern nachzugehen. Wenn er das nicht gleich tat, würde er es nie schaffen. Er brauchte frische Luft. Sofort.
Schnell eilte er in sein Zimmer und kramte im Kleiderschrank. Etwas Unterwäsche, eine Jeans, zwei T-Shirts, das musste reichen.
Eilig zog er sich an.
Hinter dem Bett stand ein verschlissener Rucksack, in den er das zweite Shirt, die Unterwäsche und eine Trinkflasche packte. Das merkwürdige Rad steckte er in eine Seitentasche. Dann verließ er das Haus.
Er sollte es nie wieder betreten.
Sherlock Holmes‘ Haus
Sem hatte oft mit dem Gedanken gespielt, den Wald zu verlassen und seinem Vater hinterherzulaufen, wenn dieser wieder einmal auf sich warten ließ. Hunderte Male war er kurz davor gewesen, auf eigene Faust aufzubrechen. Jetzt erkannte er, was für eine dämliche Idee das gewesen wäre.
Es war ein einziges Auf und Ab. Hatte Sem den einen Hügel hinter sich gebracht, wartete schon der nächste. Er schnaufte und wischte sich den Schweiß von der Stirn.
Wie lange würde er dieses Tempo beibehalten können? Atemlos lehnte er sich an einen Baumstamm. Seine Hände glitten über die raue Rinde.
Nein, nicht stehen bleiben! Er stieß sich ab und hetzte weiter den Weg entlang. Nasses Laub verwandelte den in eine schmierige Fläche, auf der er immer wieder ausrutschte.
»Großartig«, schimpfte er, als er mit dem Po über einen Abhang glitt und wie ein verkehrt herumliegender Käfer auf dem Rucksack zu liegen kam. An einem anderen Tag hätte er das durchaus komisch gefunden, heute nicht. Er rappelte sich auf, rückte den Rucksack zurecht und marschierte weiter. Schließlich hoffte er, noch vor Sonnenuntergang Fernstadt zu erreichen. Fernstadt! Sie lebten seit Jahren nicht mehr dort. Und doch erinnerte er sich an die Straße, die er suchte. Wie hätte er sie vergessen können? Sie hieß genauso wie die Straße, in der Sherlock Holmes wohnte: Baker Street.
Sherlock Holmes‘ Haus, das waren die letzten Worte seines Vaters. Dass er genau diese gewählt hatte, konnte kein Zufall gewesen sein. Es war eine Aufforderung, zurück nach Fernstadt zu gehen. Zur Baker Street 221b.
Der Wald entpuppte sich als ein einziges Labyrinth, und Sem stampfte zornig mit dem Fuß auf, als er sich erneut zwischen zwei Wegen entscheiden musste. Warum hatten ihn seine Eltern auch wie ein rohes Ei behandelt? Es wäre ein Leichtes gewesen, aus dem Wald zu finden, hätte sein Vater ihn nur ein einziges Mal mitgenommen. Aber nein, alles, was er bekommen hatte, war eine laxe Wegbeschreibung. Und die war schon ewig her. Je weiter er vorwärtsschritt, desto mehr fühlte er sich im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Holzweg. Der Pfad hatte mittlerweile mit einem Weg genauso viel gemeinsam wie Steinstufen mit einem Hühnersteig.
Durch dieses Gestrüpp hatte sich schon seit Ewigkeiten keiner mehr gezwängt. Sem blieb stehen. Welchen Weg waren dann aber sein Vater und dessen Männer gegangen?
Mit einem Anflug von Panik drehte er sich im Kreis. Diesen? Jenen oder noch einen anderen? War er die ganze Zeit schon in die Irre gelaufen? Wie sollte er jetzt die Straße finden?
Er verlor das Gleichgewicht und fiel in ein Nest aus Disteln, die sich in seine Oberschenkel bohrten.
Sein Schrei schreckte die Vögel auf, die empört herumschwirrten. Und ihm war, als stürzten die Bäume wie Mikadostäbe über ihm zusammen. Schützend schlug er sich die Hände über den Kopf.
Da sah er es! Hinter den Fichten. Oder täuschten ihn seine Augen?
Er schnappte sich einen Stock und hackte die Brennnesseln und Dornen nieder, schlug sie kurz und klein.
Er hatte sich nicht getäuscht. Hinter den Zweigen der dicht beieinanderstehenden Fichten konnte er sie klar erkennen.
Die Straße. Sie war vor langer Zeit asphaltiert worden, nicht sehr breit und in den Schlaglöchern stand jetzt das Wasser. Aber er hatte sie gefunden. Endlich.
Er keuchte, während er seinen Körper auf die Oberschenkel stützte. Seine Hände waren mit Kiefernnadeln übersät und bluteten aus mehreren Wunden. Ohne auf die Füße zu achten, stolperte er vorwärts, kämpfte sich durch das Geäst und kugelte einen kleinen Hang hinunter in den Straßengraben. Dort patschte er in eine Pfütze.
Egal.
Er klopfte sich den Dreck vom Gewand, zog die Riemen seines Rucksackes fester und kletterte aus dem Graben. Dann lief er die Straße entlang.
Stunden später troff ihm der Schweiß von der Stirn. Die Sonne brannte. Er atmete schnell und flach. Was für eine Hitze! Stechmücken umschwirrten seinen nass geschwitzten Körper und blieben in seinem Haaransatz kleben. Sucht euch jemand anderes für euer Mittagessen! Sem kratze sich die Kopfhaut blutig, schaffte es aber nicht, die Biester los zu werden.
Er stolperte, stand wieder auf, stolperte erneut. Dieses Mal blieb er liegen. Seine Kehle brannte wie Feuer. Wann hatte er zuletzt etwas getrunken? Keuchend riss er sich den Rucksack von den Schultern, öffnete ihn und tastete nach der Wasserflasche. Hastig schraubte er sie auf, setzte sie an die Lippen und nahm einen kräftigen Schluck – noch einen, und noch einen. Plötzlich hielt er inne. Einmal noch, dann war die Flasche leer.
Warum hatte er nicht mehr Wasser mitgenommen? Verdammt, was hatte er noch alles vergessen?
Sem seufzte, als er die Flasche zurück in den Rucksack steckte. Alles vor seinen Augen verschwamm. Noch nie in seinem Leben war er in einer so aussichtslosen Lage gewesen. Weit und breit gab es niemanden, an den er sich hätte wenden können. Seine Eltern waren tot und ...
Nein, das waren sie nicht! Es gab eine Möglichkeit sie zu retten. Und er würde sie finden.
Aus der Ferne ertönte ein Motorengeräusch. Ein Auto?
AUTO! Sem schreckte hoch. Er wusste doch, dass es ein Fehler war, stehen zu bleiben, sich hinzusetzten, auszuruhen.
Schnell rollte er mit dem Rucksack von der Straße in den Graben und blieb dort reglos liegen. Sein Herz klopfte bis zum Hals. Hoffentlich hatte ihn der Fahrer nicht bemerkt. Es dauerte nicht lange und der Wagen zog an ihm vorbei.
Sem atmete erleichtert auf. Trotzdem packte ihn die Panik. Er wusste, was ihm drohte, wenn ihn ein Zauberer entdeckte. Daher blieb er im Graben liegen, schwach und nicht gewillt wieder aufzustehen. Wie sollte er weitergehen? Wollte er wirklich die Straße entlang laufen und in den Graben springen, wenn ein Auto vorbeikam? Ständig mit der Angst im Nacken, entdeckt zu werden?
Baker Street 221b – wo genau sollte das sein? Was, wenn es diese Adresse überhaupt nicht gab? Was, wenn er seine Eltern missverstanden hatte, und sie mit Sherlock Holmes‘ Haus etwas ganz anderes meinten? Nein! Ihre Botschaft war klar. Sem nickte. Natürlich. Er rappelte sich auf.
Wenn alles gut geht, wird all das hier nie passieren, diese Worte hielten ihn aufrecht. Sie waren der Strohhalm, an den er sich klammerte, den er nicht loslassen wollte.
Doch dazu musste er erst einmal nach Fernstadt kommen.
Entschlossen folgte er der Straße, aufmerksam, um Gefahren rechtzeitig zu erkennen. So etwas wie eben durfte nicht noch einmal passieren.
Ein Pritschenwagen parkte verlassen am Straßenrand. B.STREET stand in Großbuchstaben an der hinteren Bordwand. Ein Zeichen? Schwer atmend stierte Sem auf die Aufschrift. Das konnte kein Zufall sein.
Sein Herz machte einen Sprung. Mit dem Wagen könnte er noch vor Sonnenuntergang in Fernstadt ankommen, wenn er sich auf der Pritsche versteckte. Er strauchelte zum Fahrzeug. Müde stellte er einen Fuß auf den hinteren Reifen, zog sich hoch, rutschte aber ab und knallte mit dem Kinn auf das Blech der Radabdeckung. Autsch. Wütend trat er gegen den Kotflügel.
Mit den verschwitzen Händen wischte er sich über die Hose und versuchte es erneut. Dieses Mal klappte es. Er hievte sich über die Bordwand und landete auf einem harten Gegenstand, der sich in seinen Rücken bohrte. Sem biss die Zähne zusammen und zog ihn weg, ohne nachzusehen, um was es sich handelte.
Was ihm widerfahren würde, wenn ihn der Besitzer des Fahrzeuges bemerkte, wollte er sich lieber nicht ausmalen. Wobei ... Was, wenn das Auto schon seit Tagen hier stand? Wer sagte ihm, dass der Besitzer bald zurückkehren würde? Die Idee, als blinder Passagier in die Stadt zu fahren, kam ihm plötzlich sehr dumm vor.
Vielleicht sollte er besser nach den Autoschlüsseln suchen? Aber für eine Spritztour war er viel zu müde. Zudem beruhten seine Fahrkenntnisse einzig und allein auf den Infos einer Ferrari-Zeitschrift. Ob das reichte?
Zunächst musste er sich einmal ausruhen. Übel, wie ihm war, hatte er das Gefühl, sich jeden Moment übergeben zu müssen.
Auf der Ladefläche lag allerlei Werkzeug - Schraubendreher und -schlüssel, eine rostige Säge, zwei Spaten, ein Eimer und auch eine löchrige Decke. Sem schob die Sachen zur Seite. Er brauchte nicht viel Platz. Die Decke behielt er, rollte sich darunter ein und zog sie über den Kopf. Sie roch modrig, doch sie war trocken. Wenigstens etwas. Das Fahrzeug hatte nicht über Nacht hier gestanden.
Er atmete langsam ein und aus. Gleich würde es ihm besser gehen.
Doch die Übelkeit wollte nicht verschwinden. Er schlug sich die Hand vor den Mund. Er würgte. So hatte er sich zuletzt vor zwei Jahren gefühlt, als er nach einem Streit mit seiner Mutter zwei Tassen Grog geleert hatte, Pas Lieblingsgetränk. Fünf Löffel Honig hatte es gebraucht, um das Gebräu schmackhaft zu machen. Pa ging es nach so einem Tee immer besser, ihm war lediglich schlecht geworden. Am nächsten Tag schwor er sich, nie wieder Alkohol anzurühren.
Ihm kam die Magensäure hoch. Angewidert schluckte er den bitteren Geschmack hinunter. Warum hatte er es verdammt noch mal so eilig gehabt? Blöd von ihm, wie ein Marathonläufer aus dem Wald zu hetzen. Kein Wunder, dass ihm schlecht war, wenn ihm das Herz bis zum Hals schlug.
Ihm fielen die Augen zu, aber er riss sie wieder auf. Nicht! Wenn er jetzt einnickte, könnte das fatale Folgen haben. Er begann damit, die rostigen Nägel zu zählen, die um ihn herum lagen. Vielleicht ließ sich sein Herzschlag auf diese Weise beruhigen? Eins. Zwei. Seine Augen wurden schwer. Fünf. Sechs. Ihm war, als hinge auf seinen Lidern Blei. Sieben. Acht. Die Augen fielen ihm immer wieder zu. Vielleicht sollte er einen Nagel benutzen, um sie aufzuspreizen?
Nach hundertfünfzig Nägeln machte er eine Pause. Die Übelkeit war weg. Doch ... Irgendetwas stimmte nicht.
Die automatische Türverriegelung klickte. Laut, wie ein Schuss. Er war nicht mehr allein.
Zusammengerollt verharrte er auf seinem Platz. Schritte bewegten sich auf das Fahrzeug zu. Sem lugte durch ein Loch der Decke, konnte aber von seiner Position aus nichts erkennen.
Er betete, nicht entdeckt zu werden. Im gleichen Moment knallte eine Motorsäge neben ihm nieder, dann eine Axt, zuletzt ein Helm. Sem stockte der Atem.
»Haben wir‘s?«, fragte eine heisere Stimme.
»Denke schon, lass uns fahren.« Schuhe knirschten auf dem Asphalt, eine Tür wurde aufgerissen und wieder zugeschlagen. Wenig später heulte der Motor auf und das Fahrzeug setzte sich in Bewegung. Gemächlich ruckelte es die Straße entlang.
Gott sei Dank! Sem bekreuzigte sich. Das hatte er seit Jahren nicht mehr getan. Warum jetzt? Seine Mutter hatte sich oft gewünscht, er möge den Glauben an Gott wiederfinden; hatte ihm gesagt, dass Gott keine Schuld am Tod seines Bruders träfe. Pah! Welcher Gott lässt zu, dass ...
Er biss sich auf die Lippen. Nicht daran denken! Er schlang die Arme um die Knie und atmete tief durch. Eine falsche Bewegung und er war geliefert. Wegen der Seitenspiegel fühlte er sich wie auf dem Präsentierteller. Er drückte sich an die Bordwand und hielt sich an einem Riemen der Abdeckplane fest. Jetzt nicht den Kopf verlieren.
Trotz des gleichmäßigen Hin und Her des Pritschenwagens wurde er nicht wieder müde. Schlafen kam ohnehin nicht infrage. Die Fahrt konnte jederzeit vorbei sein.
Und tatsächlich blieb der Wagen schon nach kurzer Zeit stehen. Sem hielt erschrocken die Luft an. Was sollte er tun? Abspringen? Er spitzelte unter der Decke hervor. Keine gute Idee. Es war zwar mittlerweile dunkel, aber wohin sollte er laufen?
Die Autotüren wurden zugeknallt. Er beschloss, erst einmal ruhig liegen zu bleiben.
»Heut bezahlst du«, sagte der Mann mit der heiseren Stimme zu dem anderen.
Die Beiden gingen über die Straße. Ganz in der Nähe quietschte eine Tür. Leise Musik drang zu Sem. Dann hörte er nichts mehr. Er war ganz allein.