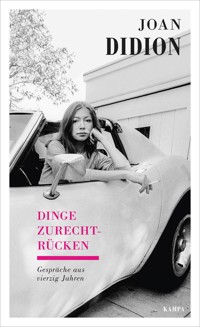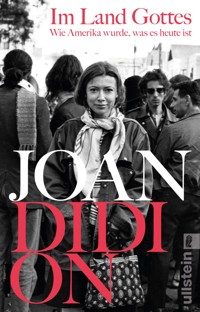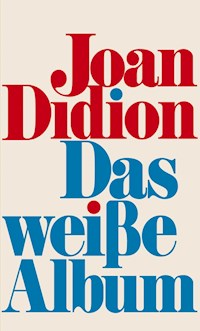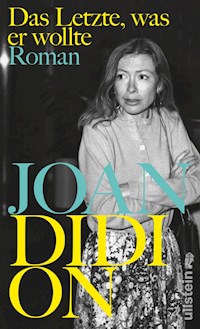10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
»Ihr Scharfsinn ist gewohnt fein geschliffen und ihr Blick eiswasserklar... Didion hat die Stimmung in Amerika eingefangen.« The New York Times Joan Didion gilt seit langem als eine der brillantesten Autorinnen der USA. Die in diesem Band versammelten Essays und Reportagen aus den Jahren 1982 bis 1992 belegen dies eindrucksvoll. Ob Joan Didion vom Parteitag der Demokraten unter Bill Clinton berichtet oder von einem spektakulären Prozess in New York City, ob sie sich mit der Politik, den Medien oder dem Showbusiness befasst — immer zeichnen ihre Texte ein präzises Bild des geistigen und kulturellen Klimas in Amerika, das noch heute gültig ist. »Die beste Feder der amerikanischen Intellektuellen.« Der Spiegel »Jeder ihrer Sätze ist kostbar.« Die Welt
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Das Buch
Im April 1989 wurde eine weiße Endzwanzigerin auf ihrer abendlichen Laufrunde durch den Central Park überfallen und vergewaltigt. Sie überlebte den Angriff lebensgefährlich verletzt, sechs nicht-weiße Jugendliche wurden angeklagt. Der darauf folgende Strafprozess hielt New York über Monate in Atem. In ihrer titelgebenden Reportage »Sentimentale Reisen« beschäftigt Joan Didion allerdings weniger der Vorfall selbst als vielmehr die öffentliche Debatte und die sie bestimmende »sentimentale« Sehnsucht danach, die oft frustrierend komplexe Realität auf Gut und Böse, Schwarz und Weiß zu reduzieren.
In ihren Essays und Reportagen aus den 80er und frühen 90er Jahren widmet sich Didion unterschiedlichen Phänomenen ihrer Zeit, die ihr an den exemplarisch ausgewählten Orten Washington, New York und Kalifornien begegnet sind. Indem sie von Momentaufnahmen der amerikanischen Gegenwart ausgeht und von persönlichen Begegnungen mit Schauspielern, Politikern und anderen Figuren des öffentlichen Lebens, zeigt sie die Sehnsüchte und Widersprüche auf, die den Geist jener Jahre prägen.
Die Autorin
Joan Didion, geboren 1934 in Sacramento, Kalifornien, arbeitete als Journalistin für verschiedene amerikanische Zeitungen und war u.a. Redakteurin der »Vogue«. Sie hat fünf Romane und zahlreiche Sachbücher veröffentlicht, darunter »Das Jahr magischen Denkens«. Ihre Essays und Reportagen sind ein zentrales Element ihres Gesamtwerkes. Joan Didion lebt in New York City.
»Didions Reportagen haben alle Vorzüge großer Literatur. Sie ist eine hervorragende Geographin der Landschaft der öffentlichen Kultur Amerikas.« The New York Times Book Review
Joan Didion
Sentimentale Reisen
Essays
Aus dem Amerikanischen von Mary Fran Gilbert, Karin Graf, Sabine Hedinger und Eike Schönfeld
Ullstein
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1992 unter dem Titel After Henry bei Simon & Schuster, New York. Die deutsche Ausgabe wurde um einen Text gekürzt (»Insider Baseball«), enthält aber zusätzlich den Essay »Blick auf den Hauptgewinn« (»Eye on the Prize«).
Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de
Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.
Hinweis zu Urheberrechten
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten.Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken, deshalb ist die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Widergabe ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
ISBN: 978-3-8437-1438-9
Alle Rechte an der Übertragung ins Deutsche bei Rowohlt Verlag GmbH, Reinbek 1995, und für »Sentimentale Reisen« bei Carl Hanser Verlag, München und Wien 1991© 1992 by Joan Didion© der deutschsprachigen Ausgabe2016 by Ullstein Buchverlage GmbH, BerlinCovergestaltung: Sabine Wimmer, BerlinCoverfoto: Nancy Ellison/Polaris/laif
E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin
Alle Rechte vorbehalten
Dieses Buch ist Henry Robbins und Bret Easton Ellis gewidmet, die beide bei ihrem Verleger »einsaßen«.
Inhalt
Über das Buch und die Autorin
Titelseite
Impressum
Widmung
Nach Henry
Washington
Im Reich des Fischerkönigs
Shooters Inc.
Blick auf den Hauptgewinn
Kalifornien
Tage in Los Angeles
Aus dem Rathaus
L. A. noir
Feuersaison
Times Mirror Square
Pazifische Entfernungen
Golden Girl aus dem goldenen Westen
New York
Sentimentale Reisen
Glossar
Feedback an den Verlag
Empfehlungen
Nach Henry
Im Sommer 1966 lebte ich in einem geborgten Haus in Brentwood und hatte gerade ein Baby bekommen. Drei Jahre vorher hatte ich mein bisher einziges Buch veröffentlicht. Mein Mann schrieb gerade sein erstes. In unserem Haushaltsbuch für jene Monate findet sich für den April keinerlei Einkommen, für den Mai 305,06 Dollar, für den Juni wieder keines, für den Juli 5,29 Dollar, Dividende des einzigen Vermögens, das wir hatten, fünfzig Transamerica-Aktien, die mir meine Großmutter hinterlassen hatte. In diesem Haushaltsbuch finden sich Wäschereilisten und Termine bei Kinderärzten. Es finden sich sechzig Geschenke zur Taufe und sechzig Karten zum Dank, der Schlussverkauf bei Saks und ein Versuch, eine Vorauszahlung von fünfzehn Dollar bei Southern Counties Gas wieder einzutreiben, aber es findet sich nicht das Datum im Juni, an dem wir Henry Robbins kennenlernten.
Heute erscheint mir das als ein eigenartiges, quälendes Versäumnis, ein Versäumnis, das auf den speziellen Bewusstseinsriss schließen lässt, den Neugeborene und geborgte Häuser im Gemüt von Menschen erzeugen können, die sich so recht und schlecht durchs Leben schlagen. Bis zu jenem Abend im Juni 1966 war Henry Robbins ein Abstraktum für uns, noch so ein Lektor aus New York, ein Fremder von Farrar, Straus & Giroux, der angerufen oder geschrieben und gesagt hatte, er komme nach Kalifornien, um ein paar Autoren zu treffen. Ich hatte in jenem Sommer eine so schlechte Meinung von mir als Schriftstellerin, dass ich mich irgendwie schämte, mit noch einem Lektor essen zu gehen, mich wieder einmal hinzusetzen und über die »Arbeit« zu diskutieren, die ich nicht tat. Doch am Ende ging ich hin: Am Ende zog ich ein schwarzes Seidenkleid an und ging mit meinem Mann ins Bistro in Beverly Hills, lernte Henry Robbins kennen und begann auf der Stelle zu lachen. Wir lachten bis zwei Uhr morgens, als wir schon längst nicht mehr im Bistro, sondern im Daisy waren und immer wieder »In the Midnight Hour« und »Softly as I Leave You« hörten und dazu unsere lustigen, hinreißenden, bezaubernden Stimmen, Stimmen, die verlorengegangene Wäschestücke, Babysitter und die Aussicht auf 5,29 Dollar vergessen ließen, Stimmen voller Verheißung, Schriftstellerstimmen.
Kurzum, wir betranken uns zusammen, und ehe der Sommer vorüber war, hatte Henry Robbins mit uns beiden Verträge unterzeichnet, und von jenem Sommer 1966 bis zum Sommer 1979 vergingen nur sehr wenige Wochen, ohne dass einer von uns beiden mit Henry Robbins über etwas sprach, was uns amüsierte, interessierte oder beunruhigte, über unsere Hoffnungen und unsere Zweifel, über Arbeit, Liebe, Geld und Klatsch, über gute und schlechte Neuigkeiten. An jenem Morgen im Juli 1979, als wir aus New York die Nachricht erhielten, Henry Robbins sei vor ein paar Stunden auf dem Weg zur Arbeit gestorben, sei mit 51 Jahren im U-Bahnhof 14. Straße tot umgefallen, gab es nur einen einzigen Menschen, mit dem ich darüber reden wollte, und dieser Mensch war Henry.
»Die Kindheit ist das Königreich, in dem niemand stirbt«, lautet eine Zeile in einem Gedicht von Edna St. Vincent Millay, die mir im Gedächtnis haftengeblieben ist, seit ich sie zum ersten Mal las, als ich tatsächlich noch ein Kind war und niemand starb. Natürlich starben Menschen, aber sie waren entweder sehr alt oder starben einen ungewöhnlichen Tod, starben beim Floßfahren auf dem Stanislaus oder beim Laden einer Schrotflinte oder wenn sie betrunken mit 150 über den Freeway fuhren: Der Tod wurde entweder als »Segen« oder als außergewöhnlicher Fall hingestellt, als dramatischer Wendepunkt in der Geschichte eines Menschen (nie der eigenen). Krankheit erledigte sich von selbst in jenem Königreich, in dem ich und die meisten Leute, die ich kannte, noch lange über die Kindheit hinaus verweilten. Ein unerklärliches Fieber verschaffte einem bloß den Genuss einer Woche im Bett. Brustschmerzen offenbarten sich, nachdem sie untersucht worden waren, als Hypochondrie.
Mit der Zeit bemerkten viele von uns, dass unsere guten Erfahrungen bei weitem nicht für alle galten, dass wir bis dahin gesegnet, gefeit oder schlicht begünstigt gewesen waren, Spieler mit einer Glückssträhne, doch da waren wir voll ausgelastet: gefangen in Tagen, die zu erfüllt schienen, zu abwechslungsreich, zu gedrängt voll mit Freunden, Aufgaben und Kindern, Abendgesellschaften und Abgabeterminen, Verpflichtungen und noch mehr Verpflichtungen. »Sie können sich nicht vorstellen, wie es ist, wenn alle, die man kennt, weg sind«, sagte ein alter Mensch, den ich kannte, zu mir, und ich nickte, ohne zu verstehen, doch, kann ich, kann ich mir vorstellen, dachte sogar – Gott verzeih mir –, dass es einen gewissen Frieden geben müsse, wenn man alle Anforderungen und Ansprüche überlebte, wenn man niemanden kannte, sich ungebunden treiben ließ. Ich glaubte, die Tage würden in alle Ewigkeit zu erfüllt sein, zu gedrängt voll mit Freunden, die zu sehen man keine Zeit hatte. Ich glaubte, wenn ich über die Zukunft nachdachte, wir würden alle noch die Beerdigung der anderen mitbekommen. Aber ich irrte mich. Ich hatte es mir nicht vorstellen können, ich hatte es nicht verstanden. So würde es gehen: Ich würde Henrys Beerdigung mitbekommen, aber er nicht meine.
Die Beerdigung war keine richtige Beerdigung, sondern eine Gedenkstunde der üblichen Art, eine Gelegenheit für uns alle, uns an einem tropischen New Yorker Augustmorgen im Vortragssaal der Gesellschaft für Ethische Kultur Ecke 64. Straße und Central Park West zu treffen. Wenn man mit Sprache arbeitet, ist es eine Binsenweisheit, dass von anderen Leuten geprägte Sätze sich ständig über die eigene Erfahrung legen, und dieser Morgen in New York machte da keine Ausnahme. »Bleibe bei mir: Geh nicht fort« war eine Zeile, die ich die ganze Gedenkfeier über unausgesprochen hörte; mein Mann sprach und ein halbes Dutzend anderer Schriftsteller und Verleger, die Henry Robbins nahegestanden hatten – Wilfrid Sheed, Donald Barthelme, John Irving, Doris Grumbach, Robert Giroux von Farrar, Straus & Giroux, John Macrae von Dutton –, doch der Unterton, den ich dabei hörte, war ein Fragment eines Gedichts von Delmore Schwartz, vor dreizehn Jahren gestorben, Opfer eines anderen New Yorker Sommers.
Bleibe bei mir: Geh nicht fort, und dann:
Wir drosseln das Tempo, ehe wir alt werden,
Gehen zusammen auf der entschwindenden Straße,
Wie Chaplin und seine Waisenschwester.
Fünf Jahre vorher hatte Henry den Verlag Farrar, Straus verlassen und war zu Simon & Schuster gegangen, und ich war mitgegangen. Zwei Jahre danach hatte er Simon & Schuster verlassen und war zu Dutton gegangen. Diesmal war ich nicht mitgegangen, war geblieben, wo ich einen Vertrag hatte, und blieb doch Henrys Waisenschwester, Henrys Autorin. Ich erinnere mich, dass er sich von Zeit zu Zeit Sorgen machte, ob wir auch genug Geld hatten, und dass er sich manchmal, mit Mühe, zu der Frage durchrang, ob wir welches brauchten. Ich erinnere mich, dass er den Titel Spiel dein Spiel nicht mochte, und ich erinnere mich, dass ich ihn aus einem Hotelzimmer in Chicago am Telefon beschimpfte, weil True Confessions, der Roman meines Mannes, noch nicht bei Kroch & Brentano im Fenster war, und ich erinnere mich an einen Halloween-Abend 1970 in New York, an dem unsere Kinder in dem Haus in der 86. Straße, wo Henry, seine Frau und ihre beiden Kinder damals wohnten, zusammen singen gingen. Ich erinnere mich, dass seine Wohnung in der 86. Straße weiße Vorhänge hatte und dass wir an einem heißen Sommerabend alle dort saßen, Hühnchen in Estragonaspik aßen und zusahen, wie sich die Vorhänge in der Brise vom Fluss hoben und senkten, und unsere Welt erschien uns ziemlich verheißungsvoll.
Ich erinnere mich, dass ich mich mit Henry über den Gebrauch der zweiten Person im zweiten Satz von Wie die Vögel unter dem Himmel stritt. Ich erinnere mich, dass er tief verletzt und empört war, wenn jemand von uns, jemand von seinen Waisenschwestern oder -brüdern, eine schlechte Kritik oder ein böses Wort oder auch nur einen Brief bekam, von dem er sich vorstellte, er könnte selbst unseren flüchtigsten Augenblick beeinträchtigen. Ich erinnere mich, dass er nach Kalifornien geflogen kam, weil ich wollte, dass er die ersten hundertzehn Seiten von Wie die Vögel unter dem Himmel las, und sie nicht nach New York schicken wollte. Ich erinnere mich, dass er eines Abends 1975, als ich ihn brauchte, in Berkeley auftauchte; ich sollte an dem Abend einen Vortrag halten, und die Veranstaltung war für mich dadurch belastet, dass ich den Vortrag vor Mitgliedern des Englischen Seminars halten sollte, die einst mir Vorträge gehalten hatten. Bis Henry kam, war ich wie von Sinnen vor Angst, der opferbereite Star meines eigenen Entblößungstraums. Ich erinnere mich, dass er zuerst in den Fakultätsklub kam, wo ich übernachtete, und mich dann über den Campus zum Raum 2000LSB begleitete, wo ich sprechen sollte. Ich erinnere mich, dass er mir sagte, alles würde gutgehen. Ich erinnere mich, dass ich ihm glaubte.
Ich glaubte immer, was Henry mir sagte, außer bei zwei Dingen, dem Titel Spiel dein Spiel und dem Gebrauch der zweiten Person im zweiten Satz von Wie die Vögel unter dem Himmel. Ich glaubte ihm sogar noch, als Zeit, Persönlichkeitsentwicklung und die Schwierigkeit, sich den Lebensunterhalt mit dem Verlegen oder Schreiben von Büchern zu verdienen, unsere Beziehung kompliziert hatten. Was Lektoren für Autoren tun, ist rätselhaft und hat entgegen allgemeinem Glauben nicht viel mit Titeln, Satzbau und »Änderungen« zu tun. Es hat auch, ungeachtet meiner Beschwerden, nicht viel mit dem Schaufenster bei Kroch & Brentano in Chicago zu tun. Die Beziehung zwischen Lektor und Autor ist viel subtiler und tiefer, so diffus und radikal zugleich, dass sie beinahe Züge einer Eltern-Kind-Beziehung hat: Der Lektor ist, wenn er wie Henry Robbins ist, der Mensch, der dem Autor jene Vorstellung von sich selbst gibt, jenes Bild von sich selbst, das ihn befähigt, sich alleine hinzusetzen und es zu schaffen.
Das ist ein heikles Unterfangen und verlangt vom Lektor nicht nur, dass er sich einen Glauben bewahrt, den der Autor nur zeitweilig und kurzfristig teilt, sondern auch, dass er den Autor gern mag, was schwer ist. Schriftsteller kann man selten gern mögen. Sie bringen nichts in die Beziehung mit ein, sie lassen alles Gute an der Schreibmaschine zurück. Sie fürchten, dass ihr Beitrag zum allgemeinen Wohlergehen verschwindend gering, wenn nicht gar zweifelhaft ist, und da das Verlagsgewerbe nur ein marginal profitables ist, das zunehmend Menschen anzieht, die sich dieser Marginalität nur allzu deutlich bewusst sind, Menschen, die sich in die Defensive gedrängt oder erniedrigt fühlen, weil sie nicht an den Tischen mit den hohen Einsätzen sitzen (weil sie keine Konzerne führen, keine Filmstudios betreiben, nicht einmal Hauptakteure in dem größeren Unternehmen sind, dem der Verlag gehört), ist es Verlegern oder Lektoren zur zweiten Natur geworden, dass sie sich die Furcht des Autors zunutze machen, sie verstärken und den Autor in ein zwar notwendiges, aber letztlich bedeutungsloses Anhängsel der »wirklichen« Verlagswelt verwandeln. In der wirklichen Welt nehmen Verleger und Lektoren nicht den TWA-Nachtflieger nach Kalifornien, um eine nervöse Autorin zu trösten, die es nur zu einem mittleren Platz auf der Verkaufsliste bringt. Verleger und Lektoren in der wirklichen Welt genießen Firmenprivilegien und ziehen es vor, mit den Abräumern, die sie bislang nicht werden konnten, Kreuzfahrten zu den Galapagosinseln zu machen. Ein Verleger oder Lektor, der seine eigene gesellschaftliche Stellung geringschätzt, findet vielleicht Trost darin, diese Geringschätzung auf den Autor zu übertragen, der gemeinhin keine Firmenprivilegien genießt und wahrscheinlich von der Großzügigkeit des Verlegers abhängig ist.
Das war kein Trost – und übrigens auch keine Geringschätzung – nach Henrys Geschmack. Zum letzten Mal sah ich ihn, zwei Monate ehe er im U-Bahnhof 14. Straße tot umfiel, eines Abends in Los Angeles, kurz vor Schluss des jährlichen Treffens der Amerikanischen Buchhändlervereinigung. Er war auf dem Weg zu einer Party bei uns vorbeigekommen, und wir hatten ihn überredet, die Party sausenzulassen und zum Essen zu bleiben. Was er mir an dem Abend sagte, war indirekt formuliert und voller versteckter Anspielungen auf andere Leute, andere Verpflichtungen und alles, was sich seit jenem Sommerabend 1966 zwischen uns zugetragen hatte, doch es lief auf Folgendes hinaus: Ich sollte wissen, dass ich es auch ohne ihn schaffen könnte. Das war das Dritte, was Henry mir sagte und ich nicht glaubte.
Washington
Im Reich des Fischerkönigs
Präsident Ronald Reagan, so erfuhren wir später von seiner Redenschreiberin Peggy Noonan, verbrachte viele der Dienststunden, in denen keine Kameras surrten, mit dem Beantworten der etwa fünfzig Briefe amerikanischer Bürger, die seine Poststelle allwöchentlich für ihn auswählte. Die Familienfotos, die vielen dieser Briefe beilagen, steckte er in seine Jackentaschen und Schreibtischschubladen. Wenn er bei einem Antwortbrief die Postleitzahl nicht kannte, entschuldigte er sich bei seiner Sekretärin dafür, dass er sie nicht selbst heraussuchte. Seine Bleistifte spitzte er eigenhändig an, wie wir später von Helene von Damm erfuhren, die einst in Sacramento und später in Washington seine persönliche Sekretärin gewesen war, und wenn er Kaffee wollte, dann holte er sich selber welchen.
Als wir uns nach dem Ende der Reagan-Ära beeilten, ein für alle Mal klarzustellen, dass wir schon immer gewusst hatten, wie eigentümlich das Weiße Haus in dieser Besetzung gewesen war, vergaßen wir darüber ganz, wie eigentümlich das Weiße Haus an sich war, was weniger mit der Leere in seinem Inneren zu tun hatte als mit der gewaltigen Fliehkraft, die durch diese innere Leere an den Außenseiten freigesetzt wurde. In Reagans Weißem Haus gab es Raum für große Erwartungen. Die Art von Begeisterung, die in einem vollbesetzten Oval Office eigentlich keine Überlebenschancen hat, konnte sich hier ungehemmt entfalten. »Man war zum Beispiel irgendwo privat eingeladen und sah auf dem Weg zur Toilette im Schlafzimmer ein dickes Exemplar von Paul Johnsons Modern Times aufgeschlagen auf dem Nachttisch liegen«, berichtete Peggy Noonan, die Ronald Reagan die »Jungs von Pointe du Hoc« und die »sanft den irdischen Fesseln entgleitende Challenger-Mannschaft« beschert hat und der George Bush die »tausend funkelnden Lichter« und die »freundlichere, sanftmütigere Nation« verdankt, in ihren Erinnerungen What I Saw at the Revolution: A Political Life in the Reagan Era.
»Wenn man ein Vierteljahr später wieder hinkam, lag das Buch noch genauso da«, schrieb sie weiter. »Und dann all die neuen Worte: Man hatte eine Eingebung statt eines Gedankens, einen Konflikt statt eines Streits, eine positive Einstellung und den direkten Draht zum Zeitgeist. Keiner hatte einen Plan, aber jeder hatte einen Zeitplan, man lag nicht falsch, sondern total daneben, man arbeitete nicht einfach an etwas, man rackerte sich ab, und man einigte sich nicht einfach, sondern machte gleich einen Deal. In der Politik zählt immer das Nächstliegende, aber in der Wirtschaft muss es auch noch das Greifbare sein. Es gab immer neue Sprüche: Alle Personalfragen sind politisch, und Ideen tragen Früchte, und Ideen machen Politik, und es herrscht ein Krieg der Ideen … und Nichtstun heißt Status quo und zurück zur guten alten Breschnew-Doktrin, und Essen gibt es nicht umsonst, vor allem dann nicht, wenn man mit der Presse am Tisch sitzt.«
Als Peggy Noonan 1984 nach Washington kam, lagen dreiunddreißig Jahre Brooklyn, Massapequa, die Höhere-Töchter-Universität Farleigh Dickinson und CBS Radio hinter ihr, wo sie die 5-Minuten-Kommentare für Dan Rather geschrieben hatte. Als Rather ein paar Jahre später vorschlug, ihr kein Weihnachtsgeschenk zu machen, sondern stattdessen einen Wohltätigkeitsverein ihrer Wahl zu bedenken, nannte sie ihm den William Casey Fonds für den Widerstand in Nicaragua. Es sollte eine ganze Weile dauern, genauer gesagt mehrere Monate, bis sie den Mann kennenlernte, für dessen öffentliche Äußerungen sie und ihre Kollegen verantwortlich waren; als Peggy Noonan im Weißen Haus einzog, hatte seit über einem Jahr kein Ghostwriter mehr persönlich mit Mr Reagan gesprochen. »Wir winken ihm zu«, sagte einer.
Und so saß nun diese findige Tochter aus einer großen irisch-katholischen Familie an ihrem Arbeitsplatz im alten Executive Office Building und schrieb sich mangels eines echten Präsidenten einen idealen zurecht: Sie las ihren Vorgänger Vachel Lindsay (insbesondere: »Ich sing ein Lied von Bryan Bryan Bryan und seinem Entwurf eines silbernen Zion«). Sie las Franklin Delano Roosevelt (den sie sich, wiederum idealiter, im Dutchess County vorstellte, wo er »mit all den Mädels an einem großen Tisch saß und ein sommerliches Mittagessen zu sich nahm: dicke Fleischtomaten, Kartoffelsalat mit Mayonnaise und gefüllte Eier auf altem Porzellan, dessen Blumenmuster schon ganz verblasst war«) und dachte dabei: »So sollte Reagan rüberkommen.« Was Miss Noonan von Washington erwartet hatte, schrieb sie in ihren Erinnerungen, war »Aaron Coplands Ballettmusik ›Appalachian Spring‹«. Was sie dagegen vorfand, waren eine im Werden begriffene populistische Revolution, eine aus erhöhten Erwartungen und reduzierten Möglichkeiten entstandene Krise sowie die Kinder einer breiteren Mittelschicht, die fest vorhatten, die etablierte Gesellschaftsordnung und die ihrer Meinung nach repressiven liberalen Dogmen zu zerstören: »Es gab die Freidenker, denen ihre Freundinnen gerade Söhne geboren hatten und die ihr Coors-Bier auch mit Konservativen tranken, wenn die mit der um Freundlichkeit bemühten Gattin am Arm und einem Sohn im Schlepptau, der die neuesten Erzeugnisse aus Papis Garten im Einmachglas mitbrachte, auf ihren Partys erschienen. Es gab die protestantischen Fundamentalisten, die hofften, von den neokonservativen Intellektuellen aus Queens nicht sofort abgebügelt zu werden, und die Neokonservativen, die sich mit den Fundamentalisten unterhielten und dabei dachten: Wenn die mich so anschauen, sehen die dann, was Annie Halls Großmutter sah, als sie vom anderen Ende der Tafel Woody Allen anschaute?«
Sie blieb im Weißen Haus bis zum Frühjahr 1986, das heißt, bis sie mehr oder weniger gezwungen wurde zu gehen, weil der damalige Chief of Staff Donald Regan sich weigerte, ihre Beförderung zur obersten Redenschreiberin zu genehmigen. Laut Larry Speakes, der nie hehre Gefühle für die Romantik der Revolution entwickelt hat, hielt Regan sie für zu »hart«, zu »dogmatisch«, zu »rechts«, zu stark »von Buchanan protegiert«. Zu ihrem Rücktritt bekam sie ein Formschreiben vom Präsidenten, das mit dem Unterschriftsautomaten signiert war. Donald Regan meinte, es sei nicht nötig, ihr einen sogenannten »Abschiedsmoment« zu gewähren: ein letztes Händeschütteln mit dem Präsidenten. Doch just an dem Tag, als Donald Regan selbst das Weiße Haus verließ, fand Miss Noonan auf ihrem Anrufbeantworter folgende Nachricht von einem Freund im Weißen Haus vor: »Hallo, Peggy, Don Regan hat auch keinen Abschiedsmoment bekommen.« Inzwischen klangen ihr die »Stimmen des wahren Washington« nicht mehr nach dem zahmen »Appalachian Spring«, sondern sehr viel rauer, »näher an Jefferson Starship und ›They Built This City on Rock and Roll‹«.
Im Weißen Haus ihrer Schilderung herrschte eine fieberhafte Atmosphäre. Alle, berichtete sie uns, konnten Richard John Neuhaus zum sogenannten Zusammenbruch der Dogmen säkularer Aufklärung zitieren, Michael Novak zur angeblich gescheiterten Annahme, dass Bildung »wertfrei« sei oder sein sollte, George Gilder zur Menschlichkeit des freien Marktes. Alle konnten Jean-Franwis Revel zum Untergang der Demokratien zitieren und Jeane Kirkpatrick zum Thema autoritäre versus totalitäre Regierungen, und alle redeten von der »Bewegung«: »Er ist schon seit Urzeiten in der Bewegung« oder: »Sie ist gut, sie vertritt die harte Linie«.
Sie redeten über die Ausschaltung der Pragmatiker, die glaubten, ohne die Washington Post und die Fernsehanstalten sei keine Auseinandersetzung zu gewinnen – man könne nicht »über die Köpfe der Medien hinweg an die Menschen appellieren«. Sie feuerten sich gegenseitig an, indem sie sich unentwegt Briefe, Vermerke und Zeitungsausschnitte zuschickten. »Vielen Dank für die neue Abhandlung von Macedo; seine Version von höchstrichterlichem Aktivismus ist doch viel anständiger als die von Tribe« war der Tenor. »Wenn die Russen davon Wind bekommen, dann fällt der Vorhang für die Freie Welt!« war der angesagte Ton auf den gelben Haftzetteln, die an den Zeitungsausschnitten klebten, »Weiter so!« der beliebte Abschlusssatz eines Schreibens. Die PROF-Memos von Robert McFarlane an Oberstleutnant Oliver North (»Roger, Ollie. Gute Arbeit – wenn die Welt nur wüsste, wie oft Sie der US-Regierungspolitik mit Aufrichtigkeit und gesundem Menschenverstand zur Seite gestanden haben, würde man Sie zum Außenminister ernennen. Aber man weiß es nicht, und wenn man es wüsste, würde man sich doch nur beschweren – so sieht nämlich die Demokratie am Ende des 20. Jahrhunderts aus … Bravo Zulu«) scheinen in diesem Zusammenhang nicht einmal besonders ungewöhnlich.
»Bürokraten mit weichen Händen legten sich die knappe, lakonische Sprechweise eines John-Ford-Darstellers zu«, schrieb Peggy Noonan. »Ein kleiner Mann vom National Security Council wurde bei einem Gespräch gefragt, ob er jemanden kenne, der eine Pressemitteilung auftexten könne. Ja, im State Department wisse er einen, einen bezahlten Texter, der schon mal was Anständiges zu Papier gebracht habe.« Gemäßigt zu sein hieß, eine »Flasche«, ein »Waschlappen«, ein »Schlappschwanz« zu sein. »Der ist auseinandergenommen worden« sagte man von jemandem, dem etwas schiefgegangen war, oder: »Er hat was eingesteckt, blieb aber unbeleckt.« Im Weißen Haus trug man Krawatten (laut Peggy Noonan »immer leicht fleckige: Das kam von der Mayonnaise, die beim Arbeitsessen zur Rechtsreform aus dem heruntergewürgten Sandwich tropfte«), die mit Symbolen der Bewegung bestickt waren: Adlern, Flaggen, Büsten von Jefferson. Kleine goldene Laffer-Kurven identifizierten ihre Träger als »Verfechter der freien Marktwirtschaft«. Freiheitsglocken symbolisierten die »Selbstbeschränkung des Bundesverfassungsgerichts«.
Hier – wie in der Außenpolitik – war der bevorzugte Stil offenbar weniger militärisch als paramilitärisch: Es ging um den knappen, knallharten Ton. »Von meiner Diskette kommt das nicht«, meinte Oberstleutnant Oliver North kurz und bündig, wenn er ausdrücken wollte, dass etwas nicht seine Idee gewesen war. »Die Jungs«, wie Noonan sie nannte, die Schlagfertigen, die Aalglatten, die aus dem inneren Kreis und die, die gern dazugehört hätten, legten in der Air Force One gar nicht erst die Sicherheitsgurte an. Die weniger weit Gekommenen protzten mit Souvenirs von kleineren Scharmützeln an den äußersten Grenzen der Reagan-Doktrin. »Jack Wheeler kam mit dem Gürtel eines russischen Offiziers über der Schulter aus Afghanistan zurück«, erinnert sich Noonan. »Grover Norquist kam mit Ringen unter den Augen aus Afrika zurück, weil er sich bei Savimbi im Zelt so viele Notizen gemacht hatte.« Peggy Noonan selbst hat einmal in der Kantine des Weißen Hauses mit einem »Mudschahedinkrieger« und seinem PR-Mann zu Mittag gegessen. »Wie steht es mit Ihren Truppen im Felddienst?«, fragte sie. »Wir brauchen Hilfe«, erwiderte er. Der philippinische Kellner näherte sich mit Stift und Block in der Hand. Der Mudschahedinführer schaute hoch und sagte: »Ich nehme Fleisch.«
In diesem Milieu denkt man sich nicht unbedingt eine Nancy Reagan, deren Vorlieben der stärker strukturierten, wenngleich nicht weniger strikten Welt entstammten, aus der sie selbst kam. Das Wesen dieser Welt wurde weitgehend missverstanden. Ich erinnere mich, dass ich bei meinen Washington-Reisen in den ersten zwei Jahren nach Reagans Amtsantritt immer wieder verblüfft davon war, wie hartnäckig sich bestimmte Missverständnisse über die Reagans hielten, und nicht nur über sie, sondern auch über die Männer, die als ihre intimen Freunde galten, also die kleine Gruppe von Industriellen und Unternehmern, die Ronald Reagans Gastspiele sowohl in Sacramento als auch in Washington gefördert und finanziert hatten – sozusagen als Risikokapitalinvestition. Der Präsident, so erzählte man mir immer wieder, war vor allen Dingen ein Kalifornier, ein Mann aus dem Westen, genau wie die Leute, die sein »Küchenkabinett« bestückten. Es war die Mentalität des Westens, die nicht nur die ziemlich kompromisslose Haltung dieser Männer zur amerikanischen Mission in der heutigen Welt erklärte, sondern auch ihr scheinbar mangelndes Interesse an jenen Amerikanern, für die der Trend nicht ständig aufwärts ging und mit denen sie sich nicht identifizieren konnten. Diese »Westernness« erklärte auch die trotzige Missachtung des herrschenden Stils, die während ihrer ersten Jahre in Washington so heftig diskutiert wurde, sie erklärte die auffällige Kleidung und den geliehenen Schmuck, das Haar von Le Cirque und die Teppichböden und das Tafelgeschirr. Aber es ging ja nicht nur um Stilfragen – auch inhaltlich ließen die Reagans und ihre Freunde eine Mentalität erkennen, die zunächst einfach als »kalifornisch« angesehen wurde und später, nachdem die Regierung sich eingearbeitet hatte und die sozialen Verwerfungen dieser exotischen Landschaft sich allmählich abzeichneten, das Etikett »California-Club-Mentalität« verpasst bekam.
Ich erinnere mich noch an ein Essen in Georgetown, wo über diese »California-Club-Mentalität« geredet wurde und ich mit einer Art atavistischer Empörung reagierte (ich selbst stamme aus Kalifornien, mein eigener Bruder wohnte damals unter der Woche im California Club). Im Nachhinein kommt mir diese Etikettierung schon deshalb so absurd vor, weil viele der betreffenden Männer, einschließlich des Präsidenten, keineswegs natürliche Bindungen an Kalifornien oder überhaupt den Westen hatten. Zwar war William Wilson in Los Angeles zur Welt gekommen und Earle Jorgenson in San Francisco, doch der mittlerweile verstorbene Justin Dart stammte aus Illinois, wo er die Northwestern-Universität besuchte, eine Walgreen-Erbin aus Chicago heiratete und die United Rexall – später Dart Industries – erst dann von Boston nach Los Angeles umsiedelte, als er deren Vorstand übernommen hatte. Der – ebenfalls verstorbene – Alfred Bloomingdale wurde in New York geboren, studierte an der Brown-Universität und fütterte den Diners Club mit Geld aus seinem New Yorker Familienbetrieb. Für was diese Männer standen, das war nicht »der Westen«, sondern eine in unserem Jahrhundert relativ neue, vermögende Schicht von Amerikanern, eine Gruppe ohne jede soziale Verantwortung, eben weil sie nirgendwo ein echtes Heimatgefühl herausbilden konnte.
Ronald und Nancy Reagan hatten zwar einen Großteil ihres Erwachsenenlebens in Kalifornien verbracht, aber ihre Branche, die Unterhaltungsindustrie, stellte nun einmal keine Mitglieder im California Club. Als ich 1964 nach Los Angeles zog, war das Leben der Frauen in den oberen Sphären dieser Szene äußerst streng geregelt und sollte es auch noch eine Zeitlang bleiben. Die Damen verließen das Esszimmer gleich nach dem Dessert und nahmen ihren Kaffee eine Etage höher, in der Isolation des Schlaf- oder Ankleidezimmers. Er wurde in Mokkatassen serviert, mit aus London importierten Zuckerwürfeln und Zimtstangen anstelle von Demitasse-Löffeln. Auf der Frisierkommode der Gastgeberin standen immer sehr große Flaschen Fracas, Gardenia und Tuberose. Das dieser Klausur vorausgehende Dessert (Soufflé oder Mousse mit Himbeersauce) wurde stets auf Flora-Danica-Tellern angerichtet, und zuvor hatte stets das Ritual mit den Fingerschalen und Spitzendeckchen stattgefunden. Immer wieder bekam ich die Geschichte von Joan Crawford und der jungen Frau zu hören, die die Fingerschale weggestellt, aber das Spitzendeckchen liegen gelassen hatte. Die Details dieser lehrreichen Geschichte – also was genau Joan Crawford gesagt hatte und zu wem und wer der Gastgeber gewesen war – unterschieden sich zwar je nach Quelle, aber es ging immer um Joan Crawford und um dieses Spitzendeckchen: In Jetzt kann ich reden, ihrer Darstellung vom Leben im Weißen Haus, informierte uns Mrs Reagan, dass sie das neue Geschirr, das für so viel Aufregung sorgen sollte, unter anderem deswegen bestellt hatte, weil es für das von den Johnsons angeschaffte keine Fingerschalen gab.
Diese Abende in subtropischer Atmosphäre waren keinesfalls stimulierend und sollten es auch gar nicht sein. Große Blumensträuße von David Jones verhinderten jeden Versuch, ein allgemeines Tischgespräch in Gang zu bringen, und sorgten so für eine reibungslose Einhaltung des Zeitplans. Die Damen trugen teure »Kurort«-Kleider, pyjamaartige Hosenanzüge und bodenlange Seidenkreationen von Pucci. Wenn sie nach dem Kaffee wieder unten bei den Männern erschienen, wurden Tabletts mit weißer Creme de Menthe herumgereicht. Größere Partys fanden in Zelten statt, mit rosafarbenen Lichtern und Chili con Carne von Chasen’s. Den Lunch nahm man im Bistro ein, später dann im Bistro-Garden oder bei Jimmy’s, das Jimmy Murphy gehörte, den jeder kannte, weil er für Kurt Niklas im Bistro gearbeitet hatte.
All dies gehörte zur Etikette des örtlichen ancien régime und konnte sich nicht über die sechziger Jahre hinaus halten, aber es spiegelt sich detailgenau in den Fotos wider, die Jean Howard zu jener Zeit gemacht und in Jean Howard’s Hollywood: A Foto Memoir veröffentlicht hat. Obwohl keiner der Reagans dort abgebildet ist (Jean Howard verkehrte hauptsächlich mit den Stars, den Mächtigen, den fabelhaft Amüsanten, und die Reagans, die für schlechte Zeiten und das Fernsehen standen, passten in keine dieser Schubladen), vermitteln diese Bilder doch ein Gefühl für die herrschenden Zwänge. Was einem bei dem Foto von Joseph Cottens Lunchparty am Unabhängigkeitstag 1955 auffällt – es war der Tag, an dem Jennifer Jones die Polonaise in den Swimmingpool anführte –, ist nicht der Swimmingpool. Natürlich sind ein paar Leute und sogar Stühle im Wasser, aber die meisten Gäste sitzen brav auf dem Rasen, angetan mit Ripskrawatten, Seidenkleidern und hochhackigen Schuhen. Mrs Henry Hathaway, auf einem eintägigen Abstecher in die Sonne und Anatole Litvaks Strandhaus, trägt ein schulterfreies Kleid aus besticktem Organdy mit Schippenmuster und dazu Perlohrringe. Natalie Wood, die auf Minna Wallis’ Rasen mit Warren Beatty, George Cukor, den Hathaways, den Minnellis und den Axelrods luncht, trägt einen schwarzen Strohhut mit Seidenband, ein weißes Kleid, eine Kette aus schwarzen und weißen Glasperlen; ihr Make-up ist perfekt, ihr Haar nach hinten hochgesteckt.
Aus dieser Welt kam Nancy Reagan, als sie 1966 nach Sacramento und 198o nach Washington ging, und in vielerlei Hinsicht hat sie diese Welt – die in situ bereits im Verschwinden begriffen war, bevor Ronald Reagan Gouverneur von Kalifornien wurde – nie verlassen. Jetzt kann ich reden ist keine Dokumentation eines Lebens, das durch spätere Erfahrungen radikal geändert wurde. Die acht Jahre in Sacramento haben Mrs Reagan so wenig geprägt, dass sie das Haus, in dem sie wohnte – 45. Straße Höhe M-Straße in einer Stadt, die numerisch und alphabetisch, von 1 bis 66 und von A bis Y, im Schachbrettmuster aufgeteilt ist –, als »eine Art englisches Landhaus in einem Vorort« beschrieb.
Sie fand es keineswegs ungewöhnlich, dass dieselben Männer, die dieses Haus für sie und ihren Mann gekauft und an sie vermietet hatten (sie zahlten 1250 Dollar im Monat), dem Bundesstaat Kalifornien viereinhalb Hektar Land schenkten, auf denen dann die »Gouverneursvilla« gebaut wurde, die Mrs Reagan so gern wollte, dass diese Männer später die millionenteure Renovierung und Neueinrichtung des Weißen Hauses unter Reagan finanzierten und schließlich das Haus in der St. Cloud Road in Bel Air kauften, in das die Reagans zogen, als sie Washington verließen. (Eigentlich hatte es die Hausnummer 666, aber die Reagans ließen sie in 668 umändern, um jede Assoziation mit dem Tier in der Offenbarung zu vermeiden.) Anscheinend betrachtete sie Häuser genauso als Teil ihrer Geschäftsgrundlage wie die Quartiere, die Schauspielern am Drehort zur Verfügung gestellt werden. Bevor das Küchenkabinett Ronald Reagans Vertrag übernahm, bewohnten die Reagans ein Haus in Pacific Palisades, das Reagans vormaliger Sponsor General Electric renoviert hatte.
Dass sich immer jemand finden würde, der sich um ihre Bedürfnisse kümmerte, war eine Erwartungshaltung, die ganz allgemein und sehr schnell auffiel – und die normalerweise als eine Angewohnheit der Reichen gilt. Aber natürlich ist dies nicht allein eine Angewohnheit der Reichen, und im Übrigen waren die Reagans keineswegs reich. Sie selbst – und ihre Erwartungen – waren Produkte eines Studios namens Hollywood, eines Systems, in dem Künstler künstlerische Leistungen erbrachten und im Gegenzug versorgt wurden. »Mir war das Studiosystem lieber als die Angst, in New York Arbeit suchen zu müssen«, erzählte uns Mrs Reagan in Jetzt kann ich reden. Im Laufe der acht Jahre, die sie in Washington verbrachte, habe sie »nie einen Fuß in einen Supermarkt oder ein anderes Geschäft gesetzt, mit Ausnahme der Schreibwarenhandlung Ecke 17. und K-Straße, wo ich meine Geburtstagskarten kaufte«, und Bargeld habe sie nur dabeigehabt, wenn sie zur Maniküre ging.
Sie war überrascht, als sie erfuhr (»Davon hatte uns keiner etwas gesagt«), dass man von ihr und ihrem Mann erwartete, für Essen, Zahnpasta und die Wäschereikosten selbst aufzukommen, solange sie im Weißen Haus residierten. Offenbar hat sie nie begriffen, warum es unklug war, Kleider von deren Designern anzunehmen, wo die sie ihr doch förmlich aufgedrängt hatten. Nur Geoffrey Beene, von dem ein Teil der Garderobe für Patricia Nixon und das Hochzeitskleid für Lynda Bird Johnson stammte – wobei alle Stücke im Einzelhandel und zu Einzelhandelspreisen gekauft worden waren –, schien dieser Versuchung widerstanden zu haben. »Ich begreife nicht ganz, wie die Garderobe einer Frau ›ausgeliehen‹ sein kann«, sagte er gegenüber der Los Angeles Times im Januar 1982, als die Frage nach Nancy Reagans neuen Kleidern zum ersten Mal aufkam. »Und ich denke, es dürfte schwierig werden zu entscheiden, welche dieser vielen Kleider Museumsqualität haben. Zudem wird behauptet, damit leiste sie einen Beitrag zur ›Rettung‹ der amerikanischen Modeindustrie. Dass diese Industrie so notleidend ist, war mir allerdings bisher nicht bekannt.«
Diese Kleider stellten aus Mrs Reagans Sicht ihre »Kostüme« dar – eine Produktionsausgabe genau wie die Wohnung, das Catering, die Möbel, die Gemälde und die Wagen, die nach Abschluss der Dreharbeiten mit nach Hause genommen werden – und gehörten deshalb in den Studioetat. Dass die Produzenten dieser speziellen Produktion – die Männer, die Mrs Reagan ihre »vermögenderen Freunde« oder ihre »sehr großzügigen« Freunde nannte – ihre eigene Rolle zeitweise missverstanden, war schon verständlich: Wie Helene von Damm berichtete, habe man William Wilson eindringlich klarmachen müssen, dass das FBI jeden unter die Lupe nehmen werde, der offizielle Beziehungen zum Weißen Haus unterhielt (Fred Fielding, der Rechtsberater des Weißen Hauses, übernahm diese Aufklärung), bevor er Suite 180 des Executive Office Building räumte, die er am Tag nach der Amtseinsetzung requiriert hatte, um die Berufung der Mitglieder des nominellen (im Gegensatz zum Küchen-) Kabinetts zu überwachen.
»Damit übernahm ich die Verwalterrolle«, schrieb Edith Bolling Wilson später über den Schlaganfall, der Woodrow Wilson im Oktober 1919 gelähmt hatte – achtzehn Monate bevor er das Weiße Haus verließ. Diese Rolle, die Nancy Reagan sich zunächst mit James Baker, Ed Meese und Michael Deaver teilte und dann auch unter erschwerten Bedingungen mit Donald Regan, war vielleicht deshalb so byzantinisch, weil jeder der Hauptakteure ein anderes Szenario zugrunde legte und nur einer davon, James Baker, ein annähernd fertiges Drehbuch vorzuweisen hatte. Baker, dessen Rolle in diesem Weißen Haus letztlich darin bestand, es für die tradierte Ordnung zu bewahren, scheint sich ganz darauf verlassen zu haben, dass sich gegensätzliche Kräfte irgendwann einmal neutralisieren. »Normalerweise gibt es in jedem großen Unternehmen eine Person oder eine Gruppe, vor der man Angst haben muss«, berichtete Peggy Noonan. »Aber im Weißen Haus unter Reagan gab es zwei – den Chief of Staff mit seinen Leuten und die First Lady mit ihren: Man befand sich in einer Zwickmühle, die jeden verletzlich machte.« Sie beschreibt, wie Mrs Reagan durch die Flure des Ostflügels wanderte, gefolgt von ihrer Entourage, deren Mitglieder man im Westflügel für »unseriös« hielt, für W- und Vogue-Leserinnen und -Leser. Mrs Reagan selbst wurde verschiedentlich »Evita«, »Mommy«, »The Missus« und »die nervöse Frisur« genannt. Miss Noonan beschrieb sie als »weder liberal noch links noch moderat noch détente-orientiert«, sondern als »Galanoanhängerin, eine wohlhabende, gutgekleidete Frau, die die Weisheiten ihrer Klasse befolgte«.
Doch Nancy Reagan war weitaus interessanter, als es in dieser Beschreibung zum Ausdruck kommt. Es war gerade »ihre Klasse«, an die sie nicht so recht glauben konnte. Sie verfügte über keine großen Erfahrungen. Ihre sozialen Fähigkeiten waren wie die vieler Frauen, deren Sozialisation auf der Insel der Filmwelt stattfindet, deutlich unterentwickelt. Sie und Raissa Gorbatschow hatten »wenig gemeinsam« und »gänzlich verschiedene Ansichten«. Sie und Betty Ford »waren unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Welten«. Wohl fühlte sie sich anscheinend nur in Gesellschaft von Michael Deaver, Ted Graber (ihrem Innenarchitekten) und ein paar wenigen anderen. Offensichtlich hatte sie wenig Gespür dafür, wer mit wem zusammenpasste. Bei einem Staatsempfang für José Napoleón Duarte aus El Salvador nahm sie den Platz zwischen Duarte und Ralph Lauren ein. Ihre soziale Erfahrung war beschränkt, ihre soziale Angst anscheinend grenzenlos. Helene von Damm beschwert sich darüber, dass Mrs Reagan während des ersten Präsidentschaftswahlkampfs den Spendensammlern nicht erlaubte, sich an »ihre New Yorker Freunde« zu wenden. Als von Damm im November 1979 die Gästeliste für das Essen in New York zusammenzustellen versuchte, bei dem Ronald Reagan seine Kandidatur bekanntgeben sollte, musste sie schließlich einen Vertreter zu Jerry Zipkin schicken, dem Macher mit den Hollywood-Verbindungen. Zipkin trennte sich nur sehr widerwillig von den gewünschten Informationen und fügte hinzu: »Denken Sie daran, mein Name darf nicht auftauchen.«
Vielleicht der liebenswerteste Zug an Mrs Reagan war ihre kleinmädchenhafte Angst, übergangen zu werden: keine besten Freunde zu haben und nicht zu den Partys in den großen Häusern eingeladen zu werden. Sie sammelte Kränkungen. Sie rettete sich ins Feine-Pinkel-Getue, in die vornehme Art (das »englische Landhaus in einem Vorort«); sie benutzte Wörter wie »unpassend«: Dass Geraldine Ferraro und ihr Mann auf einem Empfang der Italian-American Federation 1984, bei dem die Kandidaten beider Parteien eine Ansprache hielten, das Podium verließen, um »sich im Saal unters Volk zu mischen«, empfand sie als »gelinde gesagt unpassend«. Als John Koehler für die Nachfolge von Patrick Buchanan im Amt des Kommunikationsdirektors bestellt wurde und dann herauskam, dass Koehler in der Hitlerjugend gewesen war, empfand sie Donald Regans Kommentar »Schuld hat da der Ostflügel« als »unangebracht – und gemein«.
Frau Gorbatschow, so Mrs Reagan, behandele sie »von oben herab« und erwarte, dass »man sich ihr beugt«. Frau Gorbatschow hatte eine Einladung von Pamela Harriman angenommen, bevor sie auf eine von Mrs Reagan reagierte. Die Bemerkung des Washington Post-Chefredakteurs Ben Bradlee, die Iran-Contra-Affäre sei »das Amüsanteste, was ich seit Watergate erlebt habe«, lasse sich möglicherweise darauf zurückführen, erklärte sie in Jetzt kann ich reden, dass er sie um ihre Beziehung zu Katharine Graham beneidet habe. Betty Ford hatte beim Parteitag der Republikaner 1976 eine Loge im Saal bekommen und Mrs Reagan lediglich eine in den obersten Rängen. Doch Mrs Reagan war unparteiisch: Maureen Reagan »hatte möglicherweise recht«, wenn sie darin einen beabsichtigten Affront sah. Als am zweiten Abend des Parteitags das Orchester während einer Ovation für Mrs Reagan mit »Tie a Yellow Ribbon Round the Ole Oak Tree« einsetzte, fing Mrs Ford an, mit Tony Orlando zu tanzen. Aber Nancy Reagan blieb großherzig: »Einige unserer Leute sahen darin den vorsätzlichen Versuch, mir die Schau zu stehlen, aber ich habe nie geglaubt, dass das ihre Absicht war.«
In seiner Version der Ereignisse dieser Zeit – Behind the Scenes – erzählt uns Michael Deaver eine faszinierende Geschichte aus dem Wahlkampf 1980. Er schildert, wie er die Reagans zu einer episkopalischen Kirche bei Middleburg in Virginia begleitete, ganz in der Nähe der Farm, wo sie untergebracht waren. Nachdem er sich bei der Kirche angekündigt und mit dem Pfarrer über das Thema der Predigt verhandelt hatte (Hesekiel und die Knochen statt dem, was Deaver »wiedergeborene Christen« nannte, womit er vermutlich die christliche Wiedergeburt meinte), wurde schließlich vereinbart, dass die Reagans den 11-Uhr-Gottesdienst besuchen würden. »Man hatte uns aber nicht gesagt«, berichtet Deaver, »und ich hatte nicht erwartet, dass beim 11-Uhr-Gottesdienst auch die Kommunion gefeiert würde« – ein Ritual, das »den Reagans äußerst fremd« sei. Er beschreibt »nervöse Blicke« und »leicht panisches« Geflüster über das richtige Verhalten, da die Erfahrung der Reagans sich auf die presbyterianische Gemeinde in Bel Air beschränkte, »eine ordentliche protestantische Kirche, in der Tabletts mit kleinen Gläsern Traubensaft und Brotwürfelchen herumgereicht wurden«. Dann war es so weit: »Auf halbem Weg zum Altar spürte ich, wie Nancy nach meinem Arm griff … ›Mike!‹, zischte sie. ›Trinken die Leute etwa alle aus einem Glas?‹«
An dieser Stelle bekommt die Geschichte eine gewisse Ähnlichkeit mit der Seifenoper I Love Lucy. Deaver versichert Mrs Reagan, dass es durchaus reiche, wenn sie die Hostie nur kurz in den Kelch tauche. Mrs Reagan versucht es, aber dann fällt ihr die Hostie doch in den Wein. Ronald Reagan, hier in der Rolle von Lucys Ehemann Ricky Ricardo, ist zu taub, um Deavers geflüsterte Instruktionen zu hören, und seine Frau hat ihm aufgetragen: »Tu genau das, was ich tue.« Also lässt auch er die Hostie in den Wein fallen, wo sie neben der seiner Frau schwimmt. »Nancy war erleichtert, endlich die Kirche verlassen zu können«, erzählt Deaver. »Der Präsident war bester Laune, als er ins Sonnenlicht hinaustrat, weil der Gottesdienst so zufriedenstellend gelaufen war.«
Ich hatte diese Geschichte bereits mehrfach gelesen, als mir klar wurde, was mich daran so faszinierte: Dies war ein perfektes Modell für das Weiße Haus unter Reagan. Es gibt den Berater, der den richtigen Schauplatz findet (»Ich habe ein paar Erkundigungen eingezogen und eine schöne episkopalische Kirche gefunden«), der jedes erdenkliche Problem vorherzusehen und geschickt zu lösen weiß (er führte eine »diskrete Unterhaltung mit dem Pfarrer«, er »stellte vorsichtige Fragen«) und dem trotzdem, wie beim Bitburg-Besuch, etwas Wesentliches entgeht. Es gibt die Frau, deren Aufgabe es ist, das Gesicht ihres Mannes vor der Welt zu wahren, eine Aufgabe übrigens, die – wie sie in Jetzt kann ich reden hat durchblicken lassen – große Wachsamkeit erforderte. Ronald Reagan war ein Mann, der anderen Menschen gegenüber »naiv« sein konnte. So hatte er »zu großes Vertrauen« in David Stockman. So hatte er Helmut Kohl »sein Ehrenwort gegeben« und fühlte sich daher »verpflichtet, sein Wort zu halten« und nach Bitburg zu fahren. Er war, wie Mrs Reagan bei einem Interview in der Good Morning America-Talkshow anlässlich des Erscheinens von Jetzt kann ich reden enthüllte, »einfach zu gutmütig«, wenn es um »die Armen« ging (auch in dieser Formulierung fehlt wieder etwas Wesentliches). Mrs Reagan verstand das alles. Sie wurde mit alldem fertig. Doch hier, in der Nähe von Middleburg, Virginia, war sie wieder einmal Opfer der schlechten Organisation geworden, konfrontiert mit einem »fremden« Abendmahlstisch und der Angst, dass eine Fingerschale ohne das dazugehörige Spitzendeckchen weggeräumt werden könnte.
Und dort, im Zentrum des Ganzen, stand Ronald Reagan: unzureichend gebrieft (oder, wie es im Weißen Haus heißt: »schlecht bedient«), was die Hostienfrage betraf, der aber dann »ins Sonnenlicht« hinaustrat, zufrieden mit seiner Leistung und mit der aller anderen und offenbar ohne zu ahnen (oder sich – noch – dafür zu interessieren), welche Krisen wieder einmal in seiner Anwesenheit und zu seinem Besten gemanagt wurden. Er hatte etwas, das sein Berater oder seine Frau nicht hatten, nämlich den Sinn für die Geschichte, das übergeordnete Konzept, das, was Ed Meese »das große Bild« nannte: »Er ist ein Mann des großen Bildes.« Und das große Bild hier war das eines Kandidaten, der sonntagmorgens in die Kirche geht; die Details, die seine Frau und den Berater verrückt machen – welche Kirche, was man mit der Hostie anstellt – hätten den Rahmen gesprengt.
Seit der Zeit in Kalifornien arbeitete der Hauptdarsteller dieser Regierung mit Erkenntnissen, die zumindest als sehr speziell angesehen werden konnten. Er hatte bestimmte »Gefühle«, beispielsweise gegenüber dem Vietnamkrieg. »Ich habe das Gefühl, dass wir in diesem Krieg besser abschneiden, als man es der Nation erzählt«, so zitierte ihn die Los Angeles Times vom 16. Oktober 1967. Die dem Präsidentenamt innewohnende Transformationskraft verlieh diesen speziellen Erkenntnissen, die sonst keiner verstand – diesen großen Bildern, diesen übergeordneten Konzepten –, eine magische Dimension, und so einige im Weißen Haus kamen zu der Überzeugung, dass der Mann in ihrer Mitte, der seine Bleistifte im Oval Office selbst anspitzte, der Fischerkönig persönlich war, der Hüter des heiligen Grals, jener Quelle des sagenhaften Kontakts mit den Wählern, der wiederum die Quelle der Macht darstellte.
Heute wissen wir, dass es Zeiten gab, in denen sich das Weiße Haus mit einigem Erfolg von der Kunst des Möglichen verabschiedete. Dass McFarlane mit Kuchen, Bibel und zehn gefälschten irischen Pässen nach Teheran flog, wich keinesfalls von den Traditionen unserer Exekutive ab. Doch hier funktionierte ein ganzer Betrieb kraft Aberglaubens, Vogelschau und der Überzeugung, dass der Präsident nur einen Funken Aufmerksamkeit zu zeigen brauchte, wenn ihm ein Plan vorgelegt wurde (ideal waren laut Peggy Noonan solche Vorlagen, bei denen »der Präsident sich ein Bild ansehen, ein kurzes Schreiben lesen oder auf eine Frage antworten musste«), um zu gewährleisten, dass sich dieser Zauber auf das Thema der Woche übertrug, das die Kinder, die die Revolution machen wollten, gerade mit Leidenschaft verhandelten – ob nun SDI, die Mudschaheddin, Jonas Savimbi oder die Contras.
Da gab es die von Miss Noonan »Contra-Treffen« genannten und von dem magischen Denken inspirierten Sitzungen, die Präsentation des Präsidenten in der richtigen Umgebung (»über die Köpfe der Medien hinweg direkt an die Menschen«) sei genau das Richtige, um ein »Engagement auf Seiten des amerikanischen Volkes zu wecken«. Bei diesen Treffen besprach man mögliche Einsätze des Präsidenten: eine Rede in der Orange Bowl von Miami am Jahrestag von John F. Kennedys Rede in der Orange Bowl nach der Schweinebucht-Invasion; wen kümmerte es da, dass die Kennedy-Rede in Miami mit den Jahren zum Symbol des amerikanischen Verrats geworden war? Bei diesen Treffen besprach man, wie sich der Präsident über die Köpfe seiner Gegner im Kongress hinweg direkt ans Volk wenden könnte, nämlich mit einer Rede im Wahlbezirk von Jim Wright nahe dem Alamo: »Ungefähr so etwas wie: ›Punkt Punkt Punkt Meilen nordwärts liegt das Alamo‹« schrieb Miss Noonan in ihrem Notizbuch und skizzierte damit das Ritual, nach dem der Zauber übertragen werden würde. »›… Wo mutige Helden Punkt Punkt Punkt und wo während jener letzten furchtbaren Tage der Kommandant der Garnison schrieb: Punkt Punkt Punkt.‹«
Aber der Fischerkönig war dabei, ein ganz anderes großes Bild zu skizzieren, eines, das er schon seit Kalifornien im Sinn hatte. Immer wieder bekamen wir zu hören, Mrs Reagan habe den Präsidenten vom Reich des Bösen abgebracht und zu den Treffen mit Gorbatschow bewegt. (Später, in der NBC-Nachrichtensendung Nightly News, beanspruchte die kalifornische Astrologin Joan Quigley für sich, auf beide Reagans Einfluss ausgeübt zu haben; die Reagans seien von ihrer »Reich-des-Bösen-Haltung« abgekommen, nachdem sie »sie zu Gorbatschows Horoskop gebrieft« habe.) Mrs Reagan selbst erklärte, sie habe es »lächerlich gefunden, wie diese zwei schwerbewaffneten Supermächte einfach dasaßen und nicht miteinander redeten«, und dass sie »Ronnie schon ein bisschen Druck gemacht« habe.
Wie viel Druck tatsächlich erforderlich war, bleibt unklar. Ronald Reagan begriff die Sowjetunion als Abstraktion, als ein Land, dessen Menschen hilflos dem »Kommunismus« ausgeliefert waren: dem seelenlosen Bösen, das – wie er es 1951 bei einer Tagung der Kiwanis und in den folgenden dreieinhalb Jahrzehnten immer wieder formulierte – »versucht hat, in unsere Industrie einzudringen«, jedoch »bekämpft« und schließlich »fertiggemacht« worden sei. In dieser Konstruktion erschienen die Bürger der Sowjetunion – genau wie die Filmindustrie – als Opfer einer Invasion, die nur noch auf ihre Befreiung warteten. Und diese Befreiung konnte ihnen vielleicht der Auftritt einer Shane-artigen Figur bringen, eines edlen Cowboys, der das Böse »fertigmachen« würde – oder aber einfach das süße Licht der Vernunft. »Ein Volk, das die freie Wahl hat, wird immer den Frieden wählen«, erklärte Präsident Reagan im Mai 1988 vor Studenten der Universität Moskau.
Möchten Sie gerne weiterlesen? Dann laden Sie jetzt das E-Book.